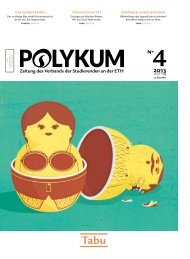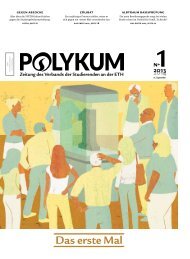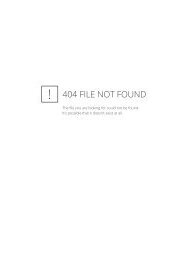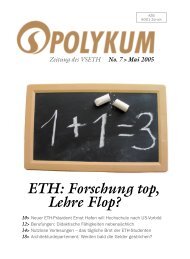Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
grÜn<br />
12<br />
die Würde<br />
der Pflanze<br />
Dass man sich bei der Gentechnologie in Bezug auf<br />
Mensch und Tier streitet, ist verständlich. Warum aber<br />
sollen Pflanzen geschützt werden? Genetische Veränderungen an Pflanzen sind, solange sie deren Eigenst<br />
Von Lucas Müller<br />
Frühling – überall beginnt das Grün zu<br />
spriessen und verkündet das Ende der kalten<br />
Jahreszeit. Mit dem Grün sind natürlich<br />
Pflanzen gemeint. Deren Blätter enthalten den<br />
Farbstoff Chlorophyll, der grünes Licht streut<br />
und den Pflanzen ermöglicht, Photosynthese<br />
zu betreiben, also Energie zu gewinnen und zu<br />
leben. Doch was für Lebewesen sind Pflanzen<br />
eigentlich? Gerade im Zuge der neuen Möglichkeiten<br />
der Gentechnologie, die eine Manipulation<br />
des Genoms erlauben, stellt sich die<br />
Frage, ob Eingriffe in den existenziellen Teil<br />
jedes Lebewesens moralisch gerechtfertigt<br />
sind.<br />
Im Artikel 120 der Schweizerischen Bundesverfassung<br />
über Gentechnologie im Ausserhumanbereich<br />
steht geschrieben: «Er [der Gesetzgeber]<br />
trägt dabei der Würde der Kreatur<br />
sowie der Sicherheit von Mensch, Tier und<br />
Umwelt Rechnung und schützt die genetische<br />
Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten.» Ist die<br />
Würde der Pflanzen nur eine juristische Spielerei<br />
oder steckt wirklich etwas dahinter? Mit<br />
dieser Frage hat sich die Eidgenössische Ethikkommission<br />
für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich<br />
(EKAH) befasst. Sie hat der<br />
Pflanze letztlich eine Würde zuerkannt, wofür<br />
sie 2008 den Ig-Nobelpreis erhalten hat.<br />
Was ist überhaupt eine Pflanze? Dieser<br />
Frage ist Jürg Stöcklin von der Universität<br />
Basel für die Ethikkommission nachgegangen.<br />
Er hat herausgefunden, dass es sehr auf die Position<br />
ankommt: Auf der einen Seite steht der<br />
Anthropozentrismus, der den Menschen zum<br />
Massstab nimmt, und auf der anderen Seite<br />
der Biozentrismus, der jedes Lebenswesen um<br />
seiner selbst Willen berücksichtigt. Aus anthropozentrischer<br />
Sicht, die also die Selbstähnlichkeit<br />
des Menschen zum Kritierium macht, lässt<br />
sich eine Überlegenheit der Tiere herleiten,<br />
denn diese haben wie der Mensch ein Nervensystem<br />
und eine körperliche Integrität.<br />
Überlegenheit der Pflanzen<br />
Der Biozentrismus, der die Erkenntnisse<br />
der modernen Biologie berücksichtigt, kann<br />
dagegen keine Inferiorität der Pflanzen gegenüber<br />
der Tierwelt feststellen. Evolutionsbiologisch<br />
haben sich Pflanzen und Tiere im<br />
Vergleich zur langen gemeinsamen Entwicklung<br />
erst in jüngerer Zeit in zwei verschiedene<br />
Reiche aufgespalten. Sie beide haben eigene<br />
Entwicklungs- und Anpassungsprozesse an<br />
die Umwelt durchlaufen, wobei die Pflanzen<br />
ebenso komplexe Wechselwirkungen mit der<br />
Umwelt eingegangen sind wie Mensch und<br />
Tier. Viele Mechanismen der pflanzlichen Reaktion<br />
auf Reize der Umgebung und der inneren<br />
Kommunikation sind ähnlich differenziert,<br />
aber eben an die festsitzende und autotrophe<br />
Lebensweise der Pflanzen angepasst.<br />
Laut Stöckli liesse sich sogar am ehesten noch<br />
eine Überlegenheit der Pflanzen postulieren,<br />
da tierisches Leben selten eine Vorraussetzung<br />
für pflanzliches ist, wogegen tierisches Leben<br />
ohne Pflanzen nicht möglich wäre.<br />
Die eidgenössische Kommission schliesst sich<br />
der modernen biozentristischen Sichtweise an.<br />
Ausserdem geht sie davon aus, dass einem Lebewesen<br />
auch geschadet werden kann, wenn<br />
es die Schädigung selbst nicht als solche erlebt.<br />
Schliesslich erhebt die Kommission die Einzelpflanze<br />
und nicht die Population beziehungsweise<br />
die Art zum Objekt der moralischen Berücksichtigung.<br />
Allerdings scheint die Kommission<br />
dem Biozentrismus nicht konsequent<br />
Rechnung zu tragen, wenn sie eine stärkere<br />
Rechtfertigung für die Nutzung von Tieren als<br />
für die Nutzung von Pflanzen verlangt. Jedoch<br />
ist für sie die Bedeutung einer Pflanzenart<br />
ebenso hoch wie die einer Tierart.<br />
Aus all diesen Überlegungen ergeben sich<br />
sieben Schlussfolgerungen für den Umgang<br />
mit Pflanzen – unter anderem, dass es moralisch<br />
verwerflich ist, Pflanzen am Wegesrand<br />
ohne vernünftigen Grund zu köpfen, oder dass<br />
niemand völlig frei und beliebig mit Pflanzen<br />
umgehen darf. Genetische Veränderungen an<br />
Pflanzen sind, solange sie ihre Eigenständigkeit<br />
nicht gefährden, allerdings zulässig.<br />
eine neue ethik<br />
Natürlich fragt man sich, ob solche Überlegungen<br />
nicht als akademisches Geschwätz<br />
abzutun sind und die Mitglieder der EKAH<br />
nichts Sinnvolleres zu tun haben, als über eine<br />
mögliche Würde der Pflanze zu diskutieren.<br />
In den letzten gut 100 Jahren hat die Wissenschaft<br />
enorme Fortschritte gemacht und viele<br />
neue Möglichkeiten eröffnet. Dagegen ist die<br />
Ethik in der Beantwortung moralischer Fragen<br />
Polykum Nr. 7/08–09 Bild: Hannes Hübner