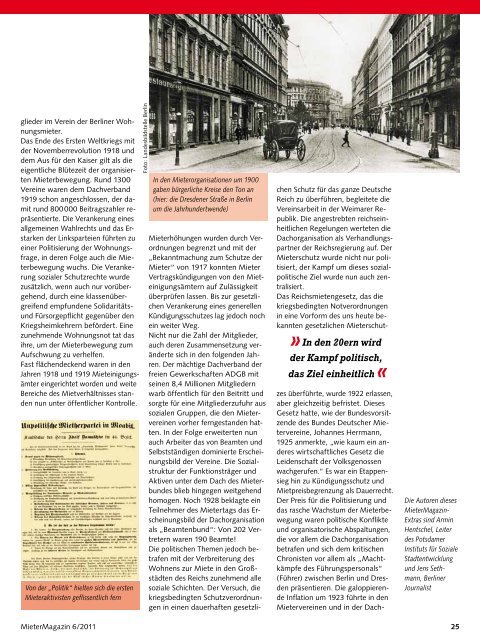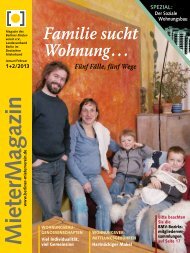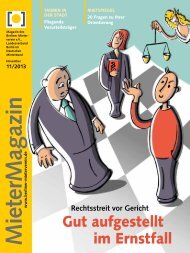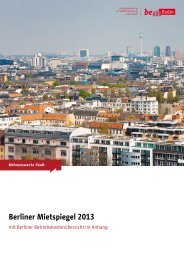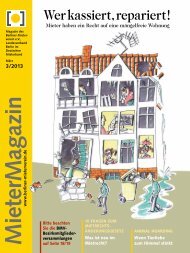PDF-Version - Berliner Mieterverein e.V.
PDF-Version - Berliner Mieterverein e.V.
PDF-Version - Berliner Mieterverein e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
glieder im Verein der <strong>Berliner</strong> Wohnungsmieter.<br />
Das Ende des Ersten Weltkriegs mit<br />
der Novemberrevolution 1918 und<br />
dem Aus für den Kaiser gilt als die<br />
eigentliche Blütezeit der organisierten<br />
Mieterbewegung. Rund 1300<br />
Vereine waren dem Dachverband<br />
1919 schon angeschlossen, der damit<br />
rund 800 000 Beitragszahler repräsentierte.<br />
Die Verankerung eines<br />
allgemeinen Wahlrechts und das Er <br />
starken der Linksparteien führten zu<br />
einer Politisierung der Wohnungsfrage,<br />
in deren Folge auch die Mieterbewegung<br />
wuchs. Die Verankerung<br />
sozialer Schutzrechte wurde<br />
zusätzlich, wenn auch nur vorübergehend,<br />
durch eine klassenübergreifend<br />
empfundene Solidaritäts<br />
und Fürsorgepflicht gegenüber den<br />
Kriegsheimkehrern befördert. Eine<br />
zunehmende Wohnungsnot tat das<br />
ihre, um der Mieterbewegung zum<br />
Aufschwung zu verhelfen.<br />
Fast flächendeckend waren in den<br />
Jahren 1918 und 1919 Mieteinigungs <br />
ämter eingerichtet worden und weit e<br />
Bereiche des Mietverhältnisses standen<br />
nun unter öffentlicher Kontrol le.<br />
Von der „Politik“ hielten sich die ersten<br />
Mieteraktivisten geflissentlich fern<br />
Foto: Landesbildstelle Berlin<br />
In den Mieterorganisationen um 1900<br />
gaben bürgerliche Kreise den Ton an<br />
(hier: die Dresdener Straße in Berlin<br />
um die Jahrhundertwende)<br />
Mieterhöhungen wurden durch Verordnungen<br />
begrenzt und mit der<br />
„Bekanntmachung zum Schutze der<br />
Mieter“ von 1917 konnten Mieter<br />
Vertragskündigungen von den Mieteinigungsämtern<br />
auf Zulässigkeit<br />
überprüfen lassen. Bis zur gesetzlichen<br />
Verankerung eines generellen<br />
Kündigungsschutzes lag jedoch noch<br />
ein weiter Weg.<br />
Nicht nur die Zahl der Mitglieder,<br />
auch deren Zusammensetzung veränderte<br />
sich in den folgenden Jahren.<br />
Der mächtige Dachverband der<br />
freien Gewerkschaften ADGB mit<br />
seinen 8,4 Millionen Mitgliedern<br />
warb öffentlich für den Beitritt und<br />
sorgte für eine Mitgliederzufuhr aus<br />
sozialen Gruppen, die den <strong>Mieterverein</strong>en<br />
vorher ferngestanden hatten.<br />
In der Folge erweiterten nun<br />
auch Arbeiter das von Beamten und<br />
Selbstständigen dominierte Erscheinungsbild<br />
der Vereine. Die Sozialstruktur<br />
der Funktionsträger und<br />
Aktiven unter dem Dach des Mieterbundes<br />
blieb hinge gen weitgehend<br />
homogen. Noch 1928 beklagte ein<br />
Teilnehmer des Mietertags das Erscheinungsbild<br />
der Dachorganisation<br />
als „Beamtenbund“: Von 202 Vertretern<br />
waren 190 Beamte!<br />
Die politischen Themen jedoch betrafen<br />
mit der Verbreiterung des<br />
Wohnens zur Miete in den Großstädten<br />
des Reichs zunehmend alle<br />
soziale Schichten. Der Versuch, die<br />
kriegsbedingten Schutzverordnungen<br />
in einen dauerhaften gesetzli<br />
chen Schutz für das ganze Deutsche<br />
Reich zu überführen, begleitete die<br />
Vereinsarbeit in der Weimarer Republik.<br />
Die angestrebten reichseinheitlichen<br />
Regelungen werteten die<br />
Dachorganisation als Verhandlungspartner<br />
der Reichsregierung auf. Der<br />
Mieterschutz wurde nicht nur politisiert,<br />
der Kampf um dieses sozialpolitische<br />
Ziel wurde nun auch zentralisiert.<br />
Das Reichsmietengesetz, das die<br />
kriegsbedingten Notverordnungen<br />
in eine Vorform des uns heute bekannten<br />
gesetzlichen Mieterschut <br />
» In den 20ern wird<br />
der Kampf politisch,<br />
das Ziel einheitlich «<br />
zes überführte, wurde 1922 erlassen,<br />
aber gleichzeitig befristet. Dieses<br />
Gesetz hatte, wie der Bundesvorsitzende<br />
des Bundes Deutscher <strong>Mieterverein</strong>e,<br />
Johannes Herrmann,<br />
1925 anmerkte, „wie kaum ein anderes<br />
wirtschaftliches Gesetz die<br />
Leidenschaft der Volksgenossen<br />
wachgerufen.“ Es war ein Etappensieg<br />
hin zu Kündigungsschutz und<br />
Mietpreisbegrenzung als Dauerrecht.<br />
Der Preis für die Politisierung und<br />
das rasche Wachstum der Mieterbewegung<br />
waren politische Konflikte<br />
und organisatorische Abspaltungen,<br />
die vor allem die Dachorganisation<br />
betrafen und sich dem kritischen<br />
Chronisten vor allem als „Machtkämpfe<br />
des Führungspersonals“<br />
(Führer) zwischen Berlin und Dresden<br />
präsentieren. Die galoppierende<br />
Inflation um 1923 führte in den<br />
<strong>Mieterverein</strong>en und in der Dach<br />
Die Autoren dieses<br />
Mieter Magazin-<br />
Extras sind Armin<br />
Hentschel, Leiter<br />
des Potsdamer<br />
Instituts für Soziale<br />
Stadtentwicklung<br />
und Jens Sethmann,<br />
<strong>Berliner</strong><br />
Journalist<br />
MieterMagazin 6/2011 25