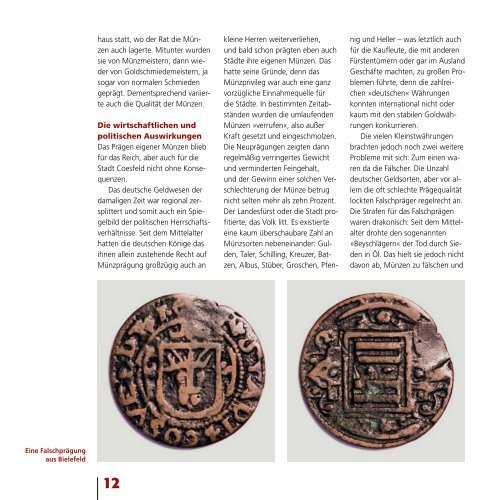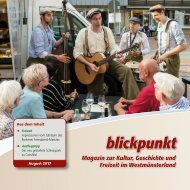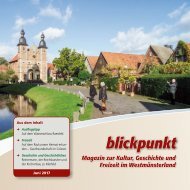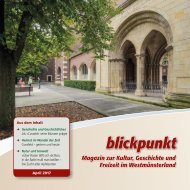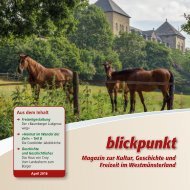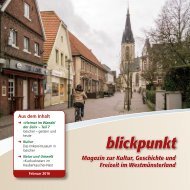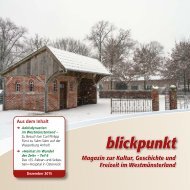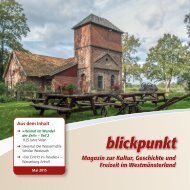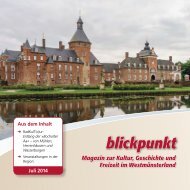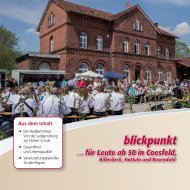bpdigital_2_2017
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Eine Falschprägung<br />
aus Bielefeld<br />
haus statt, wo der Rat die Münzen<br />
auch lagerte. Mitunter wurden<br />
sie von Münzmeistern, dann wieder<br />
von Goldschmiedemeistern, ja<br />
sogar von normalen Schmieden<br />
geprägt. Dementsprechend variierte<br />
auch die Qualität der Münzen.<br />
Die wirtschaftlichen und<br />
politischen Auswirkungen<br />
Das Prägen eigener Münzen blieb<br />
für das Reich, aber auch für die<br />
Stadt Coesfeld nicht ohne Konsequenzen.<br />
Das deutsche Geldwesen der<br />
damaligen Zeit war regional zersplittert<br />
und somit auch ein Spiegelbild<br />
der politischen Herrschaftsverhältnisse.<br />
Seit dem Mittelalter<br />
hatten die deutschen Könige das<br />
ihnen allein zustehende Recht auf<br />
Münzprägung großzügig auch an<br />
kleine Herren weiterverliehen,<br />
und bald schon prägten eben auch<br />
Städte ihre eigenen Münzen. Das<br />
hatte seine Gründe, denn das<br />
Münzprivileg war auch eine ganz<br />
vorzügliche Einnahmequelle für<br />
die Städte. In bestimmten Zeitabständen<br />
wurden die umlaufenden<br />
Münzen »verrufen«, also außer<br />
Kraft gesetzt und eingeschmolzen.<br />
Die Neuprägungen zeigten dann<br />
regelmäßig verringertes Gewicht<br />
und verminderten Feingehalt,<br />
und der Gewinn einer solchen Verschlechterung<br />
der Münze betrug<br />
nicht selten mehr als zehn Prozent.<br />
Der Landesfürst oder die Stadt profitierte,<br />
das Volk litt. Es existierte<br />
eine kaum überschaubare Zahl an<br />
Münzsorten nebeneinander: Gulden,<br />
Taler, Schilling, Kreuzer, Batzen,<br />
Albus, Stüber, Groschen, Pfennig<br />
und Heller – was letztlich auch<br />
für die Kaufleute, die mit anderen<br />
Fürstentümern oder gar im Ausland<br />
Geschäfte machten, zu großen Problemen<br />
führte, denn die zahlreichen<br />
»deutschen« Währungen<br />
konnten international nicht oder<br />
kaum mit den stabilen Goldwährungen<br />
konkurrieren.<br />
Die vielen Kleinstwährungen<br />
brachten jedoch noch zwei weitere<br />
Probleme mit sich: Zum einen waren<br />
da die Fälscher. Die Unzahl<br />
deutscher Geldsorten, aber vor allem<br />
die oft schlechte Prägequalität<br />
lockten Falschpräger regelrecht an.<br />
Die Strafen für das Falschprägen<br />
waren drakonisch: Seit dem Mittelalter<br />
drohte den sogenannten<br />
»Beyschlägern« der Tod durch Sieden<br />
in Öl. Das hielt sie jedoch nicht<br />
davon ab, Münzen zu fälschen und<br />
diese in Umlauf zu bringen. Ein<br />
weiteres Problem bestand darin,<br />
dass der Markt zunehmend mit<br />
kleinen Münzen überschwemmt<br />
wurde. Immer mal wieder sammelten<br />
sich die Kupfermünzen in den<br />
Nachbarstädten und -orten Coesfelds<br />
in großer Zahl. Ahaus hatte<br />
zum Beispiel für 900 Taler Coesfelder<br />
Kupfermünzen angesammelt,<br />
da Coesfeld sich weigerte, diese<br />
Münzen gegen anderes Geld einzulösen.<br />
Dies und die zunehmende<br />
Zahl an Fälschungen untergruben<br />
das Vertrauen in das Coesfelder<br />
Geld. Die Weigerung der Stadt, ihr<br />
Geld zurückzunehmen, führte zu<br />
zahlreichen Protesten anderer Städte,<br />
wie z.B. Dülmen, Ahaus, Ottenstein,<br />
Vreden oder auch Rheine.<br />
Dies ging so weit, dass am 4. Juni<br />
1720 der Münsteraner Fürstbischof<br />
Clemens August von Bayern eine<br />
Verordnung »wegen der Stadt<br />
Coesfeldischen Münzen«, ihrem<br />
Überangebot und ihren Fälschungen<br />
erließ. Schließlich wurden die<br />
vor 1712 geprägten Coesfelder<br />
Münzen gesammelt, nach Coesfeld<br />
gebracht und die als echt anerkannten<br />
Münzen mit einem Stempel,<br />
dem sogenannten Kontrestempel,<br />
versehen. Die letzten Coesfelder<br />
Kupfermünzen wurden 1763, also<br />
am Ende des Siebenjährigen Krieges,<br />
geprägt.<br />
Am 12. Juli 1764 wurden per<br />
Edikt alle Kupfermünzen abgewertet,<br />
die Coesfelder und Bocholter<br />
Prägungen auf ein Viertel ihres<br />
Nennwertes. Das war das Ende der<br />
städtischen Münzprägungen.<br />
4-Pfennig-Münze von<br />
1763, der sogenannte<br />
»Silberabschlag«. Von<br />
dieser Münze sind nur<br />
drei Exemplare bekannt.<br />
Eine davon befindet<br />
sich im Westfälischen<br />
Landesmuseum,<br />
eine im Stadtarchiv<br />
Coesfeld und eine im<br />
Privatbesitz.<br />
12 13