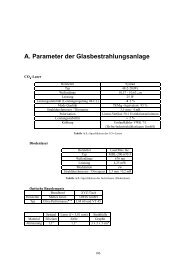Vierter Teil: Sozialismus und Formalismuskampagne
Vierter Teil: Sozialismus und Formalismuskampagne
Vierter Teil: Sozialismus und Formalismuskampagne
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
226<br />
Auffassung, dass der Künstler die Arbeiterklasse nicht „nur als leidende, unterdrückte,<br />
dem Schicksal hilflos ausgelieferte Masse“ zeigen sollte. So hieß es in dem Beitrag<br />
weiter: „Gerade von Karl Völker muss festgestellt werden, dass von ihm keine Beispiele<br />
jetzt vorhanden sind, die eine Fortführung seines früheren Weges zu einer sozialistischen<br />
Kunst bedeuten könnten. Vielleicht kann er uns selbst sagen woran das liegt? Ich bin<br />
jedenfalls der Meinung, dass es heute noch viel bessere Möglichkeiten gibt für den<br />
aktuellen Einsatz von Kunst ... Noch herrlicher, als zu Kampf zu rufen, müsste es doch<br />
sein, das sieghafte in unserem neuen Leben zu zeigen.“ 1395 Den Abschluss des 24-<br />
seitigen Referates bildeten eine Reihe von Forderungen an die anwesenden Künstler, so<br />
u.a.: „Jeder Genosse muss in der Kunst den sozialistischen Realismus zu seiner<br />
Schaffensmethode machen“ <strong>und</strong> „Jeder Genosse muss die sowjetische bildende Kunst<br />
als Vorbild nicht nur anerkennen, sondern auch von ihr lernen“. 1396 Die Künstler wurden<br />
„in ihrer künstlerischen Arbeit vor eine Entscheidung“ gestellt: „die gesellschaftlich-<br />
künstlerischen Verpflichtungen“ anzuerkennen, „sich des Auftrages der Arbeiterklasse<br />
bewußt“ zu sein <strong>und</strong> dies in ihrer Arbeit zu zeigen oder aber auf eine Förderung durch<br />
Partei <strong>und</strong> Staat zu verzichten. 1397 Zugleich unterstellte man, dass sich die Künstler „auf<br />
dem von ihnen eingeschlagenen Weg außerhalb unserer gesellschaftlichen Entwicklung<br />
zum <strong>Sozialismus</strong> (zu) befinden. 1398 Eines der Argumente, die nur sprachlos machen<br />
konnten. Was folgte, war entweder ein Rückzug ins Private, der Weggang aus der DDR<br />
oder die Anpassung. Völker zog sich zunehmend in seine Privatsphäre <strong>und</strong> damit nach<br />
Weimar zurück. In der Diskussion um die Ausstellung versuchte er noch gegenzuhalten<br />
bzw. den vermeintlichen Konflikt zu entschärfen, wie eine Mitschrift im Protokoll der<br />
Beratung verdeutlicht. Man unterstellte den Künstlern „daß man den Staat zwingen wollte,<br />
der Ausstellung zuzustimmen oder die Ausstellung nicht durchzuführen.“ Karl Völker<br />
antwortete darauf: „Das ist eine Hypothese. Es ging darum, es kann doch nicht jeder<br />
kommen <strong>und</strong> sagen, Ihr könnt das so nicht machen. Man muß das dann doch auch richtig<br />
begründen können. Sind wir nicht ein Verband der bildenden Künstler in der DDR <strong>und</strong><br />
können wir nicht selbst entscheiden, was wir ausstellen. Die Sache trug keinen<br />
provokatorischen Charakter.“ 1399 Noch vor der Eröffnung der Ausstellung erschien in der<br />
Zeitung „Freiheit“ eine sicherlich verordnete „Stellungnahme der Genossen bildenden<br />
Künstler des Bezirkes Halle“ voller Selbstkritik. Man forderte darin die Arbeiter <strong>und</strong> alle<br />
1395<br />
SAPMO BArch. DY 30 / IV 2 / 906 / 52, Bl. 63. In HÜTT 1998, S. 140 f. <strong>und</strong> HÜTT 1999, S. 178<br />
f. wird eine ähnliche Fragestellung als Disput zwischen Horst Weiß <strong>und</strong> dem Künstler dargestellt. In<br />
den recherchierten Archivalien im B<strong>und</strong>esarchiv Berlin, u.a. ein Protokoll der Beratung, fand die<br />
Autorin allerdings darauf keine Hinweise.<br />
1396<br />
Ebd., Bl. 78.<br />
1397<br />
Ebd., Bl. 79.<br />
1398<br />
Ebd.<br />
1399<br />
SAPMO BArch. DY 30 / IV2 / 906 / 53, Bl. 176.