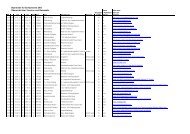impulse08Tagungsbericht - Lebenshilfe Berlin
impulse08Tagungsbericht - Lebenshilfe Berlin
impulse08Tagungsbericht - Lebenshilfe Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Lebenshilfe</strong> für Menschen mit geistiger Behinderung · Fachtag der <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong> am 16. April 2008<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong><br />
Wohnen mit Au(f)sicht
Häuser sind ...<br />
„Ich bau mIr eIn haus, In dem Ich leben wIll“ - wunschhäuser vom bew Karow<br />
Vorwort<br />
Vorwort<br />
Im Jahr 2007 wurde von den Keramikgruppen ein Kunstprojekt zum Thema Wohnen im BEW Karow in Angriff genommen und gemeinsam<br />
umgesetzt. Nach einer intensiven individuellen Beratung konnte jeder Künstler sich unter Anleitung sein eigenes Heim herstellen. Die Ergebnisse<br />
waren insgesamt sehr eindrucksvoll und reichten vom Tadsch Mahal bis zu einem Bauernhaus.<br />
Die Wunschhäuser konnten von Januar bis Oktober 2007 im Rahmen einer Ausstellung im Freizeithaus Weißensee betrachtet werden. Zusätzlich<br />
zum Freizeithaus wurde auch die Möglichkeit genutzt, sich als Kunstgruppe auf dem Sommerfest und dem Weihnachtsmarkt der <strong>Lebenshilfe</strong><br />
<strong>Berlin</strong> zu präsentieren und an der jährlichen Ausstellung „Ermutigung“ in Fürstenwalde zu beteiligen.<br />
In den Keramikgruppen werden Dinge des täglichen und persönlichen Bedarfs, Plastiken und Produkte für Ausstellungen hergestellt, teilweise<br />
auch für den Verkauf.<br />
wohnturm – nach Gaudi<br />
Potala Palast – tibet<br />
westerburg – im Harzvorland<br />
thailändisches Haus<br />
Leuchtturm – am Atlantik<br />
Einsam stehendes Haus – irgendwo in Deutschland<br />
Mecklenburgisches Haus<br />
tadsch Mahal – Indien<br />
Zum vierten Mal fand der jährliche Fachtag der <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong> zu<br />
einem aktuellen Praxisthema statt. „Wohnen mit Au(f)sicht“, das (f) in<br />
der Klammer verweist auf das Spannungsfeld, in dem sich unterschiedliche<br />
Wohn und Lebensformen behinderter Menschen befinden.<br />
Den Ablauf haben wir in diesem Jahr etwas verändert und auf Workshops<br />
und Arbeitsgemeinschaften verzichtet, um mit acht Expertenbeiträgen<br />
unterschiedliche Aspekte des Themas zu beleuchten. Wir<br />
hoffen, Ihnen eine gute Mischung aus Theorieansätzen, interessanten<br />
Praxisbeispielen und provokanten Aussagen geboten zu haben. In der<br />
vorliegenden Dokumentation finden Sie eine Wiedergabe aller Tagungsbeiträge.<br />
Gegliedert in der Chronologie des Fachtages. Vom Inhaltsverzeichnis<br />
aus können Sie alle Referate je nach Interesse auch direkt<br />
ansteuern.<br />
Zwischen den Beiträgen bitten wir Sie um Ihre Aufmerksamkeit für<br />
eine kleine Fotoausstellung von Objekten, die behinderte Menschen<br />
als Antwort auf die Frage „Wie willst Du wohnen?“ gestaltet haben.<br />
Gedacht als spielerische Ergänzung und um die Wahrnehmung zu<br />
öffnen, für die Menschen, um die es uns geht. Ihre Bedürfnisse, ihre<br />
Wünsche nach Selbstbestimmung und die optimale Organisation<br />
ihres Unterstützungsbedarfes sind schließlich die Ausgangspunkte<br />
für unsere Arbeit.<br />
Wir wünschen Ihnen eine fruchtbare vertiefende Beschäftigung mit<br />
dem Thema, dass Sie Spaß beim Lesen haben und dass diese Dokumentation<br />
Ihnen hilft, Erkenntnisse und Anregungen des Fachtages<br />
in Ihre Praxis umzusetzen. Wir freuen uns über das wachsende Interesse<br />
und werden auch im nächsten Jahr wieder einen Fachtag veranstalten.<br />
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und hoffen, Sie auch<br />
im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.<br />
Für die <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong> grüßt Sie ganz herzlich<br />
Ihre<br />
Christiane MüllerZurek<br />
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing,<br />
christiane.mueller-zurek@lebenshilfe-berlin.de<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 2
Begrüßung<br />
Referat 1<br />
Referat 2<br />
Referat 3<br />
Referat 4<br />
Die Gorillas<br />
Referat 5<br />
Referat 6<br />
Referat 7<br />
Referat 8<br />
Resümee<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
GEORG SCHNITZLER, <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong><br />
Daheim statt Heim – Bundesinitiative für ein Leben behinderter<br />
und älterer Menschen in der Gemeinde<br />
SILVIA SCHMIDT, SPDBundestagsabgeordnete, Bundesinitiative „Daheim statt Heim“<br />
Wohnen wie andere – Unterstütztes Wohnen in der Hausgemeinschaft<br />
MARTIN RÖSNER, Leben mit Behinderung Hamburg<br />
ContecUntersuchung zur Wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung der Behindertenhilfe<br />
in Bayern – Fachlichinhaltliche Bewertung und Schlussfolgerungen<br />
RENATE BAIKER, <strong>Lebenshilfe</strong> Bayern<br />
THEA – Telematische Hilfen zur Eingliederung und Autonomieförderung<br />
THOMAS RINKLAGE, Xit GmbH forschung.planung.beratung, Nürnberg<br />
IMPROVISATIONSTHEATER BERLIN<br />
Elternwünsche<br />
JUDY GUMMICH und HEIDE BESUCH, Eltern beraten Eltern e.V.<br />
Mittendrin statt außen vor – Dezentrales Wohnen für Menschen mit hohen<br />
Assistenzbedarfen<br />
DR. HEIDE VÖLTZ, alsterdorf assistenz nord, Verbund der Evangelischen Stiftung Alsterdorf<br />
Persönliches Budget in einer stationären Einrichtung für Menschen mit Behinderung<br />
SUSANNE SELLIN, Behindertenhilfe der v. Bodelschwingschen Anstalten Bethel,<br />
Region Bielefeld/Ostwestfalen<br />
Einsatz des Persönlichen Budgets<br />
Überwindung der Trennung von Eingliederungshilfe und Pflege<br />
JOACHIM SPEICHER, <strong>Lebenshilfe</strong> Einrichtungen GmbH Worms<br />
früher: „Paritätisches Kompetenzzentrum Persönliches Budget“ Mainz<br />
UTE SCHÜNEMANN, MARTIN SCHÜTZHOFF, <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong><br />
InHALt<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 3<br />
4<br />
8<br />
12<br />
20<br />
26<br />
33<br />
35<br />
38<br />
40<br />
43<br />
48
Guten Morgen meine Damen und Herren,<br />
liebe Besucherinnen und Besucher dieses 4. Fachtags<br />
Impulse 2008 der <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong>,<br />
mein Name ist Georg Schnitzler, Geschäftsführer der <strong>Lebenshilfe</strong><br />
gGmbH, der Betriebsgesellschaft, d.h. des Trägers der vielen Einrichtungen<br />
und Dienste für Menschen mit geistiger Behinderung im Verbund<br />
der <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong>.<br />
Die Kundgebung der Gewerkschafter, die Sie hier heute Morgen<br />
empfangen hat, galt uns, der Betriebsgesellschaft mit unseren ca.<br />
800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.<br />
Sie – und übrigens wir auch – sind unzufrieden mit dem, was wir an<br />
Gehältern zahlen können. Und weil im öffentlichen Dienst hier in<br />
<strong>Berlin</strong> gerade viele Streikaktionen laufen, rumort es auch bei uns.<br />
<strong>Berlin</strong> ist – unser Regierender Bürgermeister hat es auf den Punkt<br />
gebracht – arm aber sexy. <strong>Berlin</strong> ist – auch ein Zitat von Wowereit –<br />
Ostdeutschland, das sich aber, so meine Erfahrung, mit Westberliner<br />
Erwartungen und Ansprüchen konfrontiert sieht. Wir werden in den<br />
nächsten Wochen ausloten, wie wir unseren Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeitern eine Gehaltsaufbesserung bieten können. Verrückterweise<br />
fällt uns das für unsere Mitarbeiter in den ambulanten Diensten,<br />
also vor allem im Betreuten Einzelwohnen, besonders schwer,<br />
obwohl doch eigentlich hier die Zukunft liegt. Wir leiden darunter,<br />
dass wir im Betreuten Einzelwohnen mit 30,08 Euro für die Fachleistungsstunde<br />
exakt 27 Cent weniger in Rechnung stellen können als<br />
vor 13 Jahren, während z.B. die Hessen 50,66 Euro zahlen. Soweit zu<br />
den ökonomischen Rahmenbedingungen unseres heutigen Themas.<br />
„Wohnen mit Aufsicht“ oder „Wohnen mit Aussicht“ – „Individuelle<br />
Assistenz für Menschen mit Behinderung“ unter diesem Titel haben<br />
wir Sie heute eingeladen.<br />
Wir freuen uns über knapp 150 Gäste, sogar ein paar mehr Anmeldungen<br />
als im vergangenen Jahr. Die meisten von Ihnen kommen<br />
aus <strong>Berlin</strong>, einige aus Brandenburg, nach unserer Liste hatten Sie,<br />
Jutta Renner aus Kiel den weitesten Weg. Die meisten von Ihnen sind<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behindertenhilfe, aber auch<br />
Menschen mit Behinderung, Angehörige, Freunde, Politiker und unsere<br />
Gegenüber aus den Bezirksämtern und der für uns zuständigen<br />
<strong>Berlin</strong>er Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Einige<br />
wenige möchte ich namentlich begrüßen: Die SPDBundestagsab<br />
bEGrüSSunG<br />
geordneten Silvia Schmidt und Mechthild Rawert, Angela Budäus,<br />
Elisabeth Schuckenböhmer, Wolfgang PapeWunnenberg und Uwe<br />
Lehmann aus der Senatsverwaltung, unsere frühere Vorsitzende, Prof.<br />
Dr. Monika Seifert und Ulrich Arndt, heute Vorsitzender der <strong>Lebenshilfe</strong><br />
<strong>Berlin</strong>. Herzlich willkommen.<br />
Der Untertitel: „Ambulant vor / statt / und / oder stationär“ beschreibt<br />
den Rahmen der Vorträge, die Sie heute hören. Diese beiden Begriffe<br />
beschreiben zunächst einmal Rechtsformen. Wenn ich mit Menschen<br />
zu tun habe, die nicht in der Behindertenhilfe zuhause sind, merke<br />
ich immer wieder – und es nervt mich jedes Mal mehr – wie antiquiert<br />
und von vorgestern diese Begriffe sind. Immer muss ich sie erklären<br />
und es gelingt mir meist nur unvollständig. Vor allem ist die Realität<br />
der Lebenssituation und der Betreuung nicht deutlich unterscheidbar.<br />
Ein zentraler Begriff bleibt „die eigene Wohnung“. Nun haben<br />
wir aber z.B. ambulant betreute Wohngemeinschaften, in denen vier<br />
bis sechs Menschen mit Behinderung als unsere Untermieter leben<br />
und zugleich von uns betreut werden – nicht einzeln, sondern als<br />
Gruppe. Eigene Wohnung?<br />
Andererseits: In den nächsten Wochen werden wir eine neue – stationäre<br />
– Wohnstätte in Betrieb nehmen, die aus 10 Zweizimmerwohnungen,<br />
jeweils mit geräumiger Wohnküche und Bad besteht. Die<br />
Wohnungen gehören zu einem neugebauten Mietshaus des geförderten<br />
Wohnungsbaus, die Wohnungen sind jeweils erreichbar über<br />
ein ganz normales öffentliches Treppenhaus, im Haus leben weitere<br />
ebenfalls ganz normale Mieter. Keine eigene Wohnung? Es gibt viele<br />
Beispiele, die deutlich machen, dass die klassische Zweiteilung in der<br />
Welt des Wohnens von Menschen mit Behinderung verschwimmt.<br />
In allen Formen der Assistenz für Menschen mit Behinderung steht<br />
die Individualisierung auf der Tagesordnung. In Wohnheimen werden<br />
dafür Zeitbudgets ausprobiert oder der Kühlschrank im eigenen<br />
Zimmer. Andererseits: Die Altenhilfe macht es uns vor, wie in Wohngemeinschaften<br />
persönlich zugemessene Leistungen der Pflegeversicherung<br />
und der Sozialhilfe gemeinschaftlich genutzt, verpoolt<br />
werden. Ich vermute, dass Nutzer des Persönlichen Budgets noch<br />
ganz andere Formen der – auch gemeinsam genutzten – Assistenz<br />
finden und ausprobieren werden. Und wenn dann auch noch die<br />
Pflegeversicherung mitmacht beim Persönlichen Budget, z.B. mit den<br />
Leistungen für die Pflegestufe Null, dann wird die Unterscheidung in<br />
den Rechtsformen ambulant und stationär bald endgültig auf dem<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 4
Misthaufen der Geschichte landen. Zumindest der Geschichte der<br />
Behindertenhilfe.<br />
Einen richtungweisenden Anlauf hat im vergangenen Jahr der Deutsche<br />
Verein genommen. Unter der Federführung von Klaus Lachwitz,<br />
dem Justitiar und Leiter des <strong>Berlin</strong>Büros der <strong>Lebenshilfe</strong>Bundesvereinigung<br />
hat der Ausschuss „Teilhabe“ eine Empfehlungen des<br />
Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung zentraler Strukturen in der<br />
Eingliederungshilfe unter dem Titel Verwirklichung selbstbestimmter<br />
Teilhabe behinderter Menschen! vorgelegt. Sehr zur Lektüre zu empfehlen.<br />
Die <strong>Lebenshilfe</strong> Bundesvereinigung hat in diesen Tagen nachgelegt<br />
und ein Orientierungs und Diskussionspapier zum Thema „ambulant/stationär“<br />
veröffentlicht unter dem Titel „Auf das Wunsch und<br />
Wahlrecht kommt es an: Teilhabe sichern – Trennung ambulant/stationär<br />
überwinden“. Sie finden dieses Papier draußen auf den Infotischen.<br />
Unsere Beiträge heute sind praktischer, polititscher, konkreter. Ich<br />
hoffe, die Referenten berichten auch von Beispielen, Vorbildern und<br />
anderen anschaulichen Geschichten zu ihrem Thema.<br />
Zu einigen der folgenden Vorträge einige Anmerkungen vorweg:<br />
Für die Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ spricht die SPDBundestagsabgeordnete<br />
Silvia Schmidt. Gleich zu Anfang – und prompt sind<br />
wir, die Veranstalter dieses Fachtags, missverstanden worden. Als<br />
wollten wir, die <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong>, sagen, dies sei nun auch unser<br />
Impuls, unsere Botschaft dieses Tages. Nein, soweit sind wir – noch ? –<br />
nicht. Wir betreiben 12 Wohnstätten und werden, ich hatte es Ihnen<br />
dargestellt, bald eine neue aufmachen.<br />
Aber wir haben uns bei der Programmgestaltung für diesen Tag gedacht,<br />
dass eine kleine aufmunternde Provokation am frühen Morgen<br />
nicht schaden kann.<br />
Wie es gehen kann und wie eine Hausgemeinschaft aus ambulant und<br />
stationär zusammenwachsen kann, zeigt dann ein Beispiel aus Hamburg.<br />
Die anschließende Pause nutzen wir, um den Film zu zeigen,<br />
den die Hamburger mitgebracht haben.<br />
Am Beispiel Bayern wird vorgerechnet, welche wirtschaftlichen Vorund<br />
Nachteile eine Ambulantisierung der Behindertenhilfe mit sich<br />
bringt. Bei THEA werden Sie sich vielleicht fragen, was telematische<br />
Hilfen in der Behindertenhilfe mit ambulant und stationär zu tun haben.<br />
Die Antwort: Sie erleichtern die Kommunikation und damit die<br />
Aufsicht und eine bedarfsorientierte Steuerung der Assistenz.<br />
bEGrüSSunG<br />
Gegen die Mittagsmüdigkeit setzen wir die Gorillas ein, ein Improtheater<br />
allererster Güte, lassen Sie sich überraschen.<br />
Danach kommen Eltern zu Wort, sie gehören bei der <strong>Lebenshilfe</strong> zu<br />
denen, nach deren Wünschen wir uns richten ebenso wie wir natürlich<br />
und in erster Linie nach den Wohnvorstellungen junger Menschen<br />
fragen.<br />
Auf die Frage, die uns immer begleitet: Und was ist mit den Menschen<br />
mit schweren und mehrfachen Behinderungen antwortet heute eine<br />
weitere Hamburger Einrichtung, die Ev. Stiftung Alsterdorf. Und zum<br />
Schluss fällt zweimal das Stichwort „Persönliches Budget“, bevor wir<br />
ein Resümee ziehen und Sie einladen, vor dem Nachhauseweg noch<br />
ins Gespräch zu kommen.<br />
Wir haben dem Tag einen Rhythmus gegeben, der heißt: Halbstündige<br />
Beiträge, eine viertel Stunde Nachfrage und Diskussion, neun Referenten,<br />
ein Resümee und die Gorillas. Die Impulse stehen im Vordergrund,<br />
wir verzichten in diesem Jahr auf Gruppenarbeit und Podiumsdiskussion.<br />
Wir freuen uns wenn Sie sich zu Wort melden und<br />
hinterher noch einen Moment bleiben zum Gespräch, zu Nachfragen<br />
und zum Kontakteknüpfen. Zwischendurch sollten Sie einen Blick in<br />
die Ausstellung von Hausmodellen werfen, die als Kunstprojekt unter<br />
dem Titel „Ich baue mir ein Haus“ in unserem Treffpunkt des Betreuten<br />
Einzelwohnens in Karow entstanden ist.<br />
Durch den Tag führt sie Christiane MüllerZurek, die neue Leiterin<br />
unserer Öffentlichkeitsarbeit und frühere Vorsitzende der <strong>Lebenshilfe</strong><br />
<strong>Berlin</strong>. Ich wünsche Ihnen und uns einen anregenden Tag mit viel<br />
Stoff zum Nachdenken und viel Spaß. Vielen Dank.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 5
Referenten<br />
Silvia SchmidT<br />
marTin röSner<br />
renaTe Baiker<br />
ThomaS rinklake<br />
heide BeSuch und Judy Gummich (v.l.n.r)<br />
dr. heide völTz<br />
SuSanne Sellin<br />
Joachim Speicher<br />
REFERENTEN<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 6
Häuser … Wohnturm nach Gaudi<br />
Inge liesegang, 61 Jahre<br />
Frau Liesegang ließ sich von der verspielten Form<br />
des Hauses inspirieren.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 7
undesinitiative „Daheim statt Heim“<br />
SILVIA ScHMIDt Mdb ist behindertenbeauftragte der SPD-bundestagsfraktion und Initia-<br />
torin der bundesinitiative „Daheim statt Heim“<br />
Die Initiative setzt sich ein für die konsequente umsetzung des Grundsatzes „ambulant<br />
vor stationär“. Denn teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist ein Grundrecht für alle<br />
bürger.<br />
rEFErAtE<br />
Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ von Silvia Schmidt<br />
WAS WILL DIe InITIATIVe?<br />
1. Die Verwirklichung der Rechte älterer Menschen und der Menschen<br />
mit Behinderung auf ein Leben in der eigenen Häuslichkeit<br />
und in der Gemeinde.<br />
Heime sind eine Sonderwelt, in denen die Menschen von der Teilhabe<br />
am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind. In der Sonderwelt<br />
„Heim“ wird die Menschenwürde auf freie Entfaltung eingeschränkt.<br />
Der Staatsrechtler Prof. Dr. Höfling hat einmal aufgelistet, welche<br />
Grundrechte verletzt werden:<br />
> das Grundrecht auf Leben<br />
> auf körperliche Unversehrtheit<br />
> das allgemeine Persönlichkeitsrecht<br />
> der Anspruch auf Achtung der Menschenwürde<br />
> das Grundrecht der körperlichen Bewegungsfreiheit<br />
und Freizügigkeit<br />
Die Charta der Rechte hilfe und pflegebedürftiger Menschen, die aus<br />
dem Runden Tisch Pflege hervorgegangen ist, und die vom BMG und<br />
BMFSFJ herausgegeben worden ist, spricht eine deutliche Sprache!<br />
Alle nur erdenklichen Selbstverständlichkeiten bei einem selbstbestimmten<br />
Leben zu Hause wie Nahrungszufuhr beispielsweise, werden<br />
darin geregelt. Ich zitiere: „Ihre Mahlzeiten sollen Sie möglichst<br />
auch außerhalb der regulären Essenszeiten – Ihrem Lebensrhythmus<br />
und Appetit entsprechend – zu sich nehmen können. Zwischenmahlzeiten<br />
und Getränke sollen jederzeit zur Verfügung stehen.“<br />
Die Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ wurde von Wissenschaftlern,<br />
Politikern, Pflegekräften, Behindertenbeauftragten, Trägern großer<br />
sozialer Einrichtungen und Betroffenen am 1. Dezember 2006 gegründet.<br />
2. Wir fordern ambulant statt stationär, d.h. einen Baustopp für<br />
neue Heime und den Abbau bestehender Heimplätze.<br />
Tatsächlich aber werden immer neue Heime aus dem Boden gestampft.<br />
Jüngstes Beispiel ist der Ort Igersheim in BadenWürttemberg:<br />
In der Presse wird der erste Spatenstich für den Bau eines<br />
1<br />
Seniorenzentrums gefeiert, es wird der „Pioniergeist“ der Verantwortlichen<br />
hochgejubelt und der Bürgermeister stellt sich als Wohltäter<br />
für seine Bürger dar. Igersheim ist kein Einzelfall, sondern ist Alltag<br />
in unserem Land. Beispielsweise baut die <strong>Lebenshilfe</strong> Ostallgäu eine<br />
Wohlanlage für 33 Menschen mit Behinderung.<br />
Den Baustopp für Heimneubauten und Abbau von bestehenden Heimplätzen<br />
fordern inzwischen 1.658 Unterstützer, darunter mitgliederstarke<br />
Sozialverbände wie der Sozialverband Deutschland, die Bundesarbeitsgemeinschaft<br />
Gemeinsam leben – gemeinsam lernen e. V., Mensch<br />
zuerst Netzwerk People First Deutschland e.V. und die Evangelische<br />
Stiftung Alsterdorf in Hamburg. Alle Verbände und Einzelunterzeichner<br />
zusammengerechnet, vertritt die Bundesinitiative „Daheim statt<br />
Heim“ bereits mehrere Millionen Bundesbürger.<br />
Die Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ kritisiert nicht das Pflegepersonal<br />
in den Heimen. Im Gegenteil, die Menschen dort leisten<br />
schwere und aufopferungsvolle Arbeit, die von unserer Gesellschaft<br />
viel zu wenig honoriert wird.<br />
Wie ist die gegenwärtige Situation? Derzeit leben über 900.000<br />
Menschen in Heimen. Der freie Journalist Christoph Lixenfeld hat in<br />
seinem soeben erschienen Buch „Niemand muss ins Heim“ neueste<br />
Zahlen vorgelegt:<br />
> Über 300.000 alte Menschen müssen sich im Heim ein<br />
Zimmer mit einem wildfremden Menschen teilen.<br />
> Mindestens 100.000 Menschen könnten zu Hause<br />
versorgt werden, wenn Geld in den Ausbau der ambulanten<br />
Infrastruktur gesteckt würde.<br />
> Jeder vierte könnte noch zu hause oder in wohngemeinschaf<br />
ten betreut werden!<br />
Warum ist es nicht wie im Hamburger Alsterdorf möglich, Menschen<br />
mit geistiger Behinderung in kleinen Wohnungen ein selbstbestimmtes<br />
Leben zu ermöglichen? Wir brauchen auch keine neuen<br />
Pflegeheime für ältere Menschen mit Behinderung. Hier haben wir<br />
die Schnittstelle mit der Pflegeversicherung. Anstatt Pflege in Fachpflegeheimen<br />
zuzulassen, kann sich auch die <strong>Lebenshilfe</strong> dafür einsetzen,<br />
dass kleine Wohngruppen mit ambulanter Pflege eingerichtet<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 8
undesinitiative „Daheim statt Heim“<br />
werden. Das ist in Alsterdorf und auch in Hephata Mönchengladbach<br />
geschehen – warum sollte das andernorts nicht gehen?<br />
Die älteren Menschen stimmen längst mit den Füßen ab und zögern<br />
den Einzug in ein Heim so lange wie möglich hinaus. Mit durchschnittlich<br />
87 Jahren ziehen die Menschen schweren Herzens in ein<br />
Heim und leben dort im Durchschnitt noch ein Jahr und drei Monate.<br />
Sie ziehen ins Heim, weil sie Hilfe brauchen und sich dorthin begeben,<br />
wo sie Hilfe erhalten. Es ist doch widersinnig!<br />
Viel klüger, aber vor allem auch menschenfreundlicher wäre es, die<br />
Hilfe zu den Menschen zu bringen. Dies gelingt längst in Dänemark,<br />
das von oben herab einen Baustopp für neue Heime beschlossen<br />
hat. Das gelingt in Schweden seit 30 Jahren, in dem über 250.000<br />
Menschen mit Alltagskompetenz als Assistenten arbeiten. Das gelingt<br />
in Bielefeld, in dem die Menschen in kleinen Wohnquartieren<br />
leben und ambulant betreut werden.<br />
Deutschland ist Schlusslicht in Europa, was die Gemeinde nahen Unterstützungssysteme<br />
angeht. Die Ratifizierung der UNKonvention<br />
über die Rechte von Menschen mit Behinderung ist deshalb besonders<br />
dringlich. Teilhabe fängt nicht beim Wohnen an. Von Anfang<br />
an müssen Kinder mit Behinderung Teil der Gesellschaft sein. Ihre<br />
Anwesenheit in Schulen und Kindergärten muss Normalität sein.<br />
Förderung und Zugehörigkeit von Anfang an – das ist Inklusion. Das<br />
fordert die Konvention – anstatt Eingliederung im Nachhinein, Zugehörigkeit<br />
von Anfang an fördern!<br />
Das Umbenennen von Heimen in Wohnstätten hilft dann eben auch<br />
nichts. Es muss von Anfang an ein selbstbestimmtes Leben gefördert<br />
werden. Voraussetzung dafür ist die Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen.<br />
Ohne Zugang z.B. zu Informationen, Gebäuden oder auch<br />
Bildungschancen gibt es keine Gleichberechtigung und keine selbstbestimmte<br />
Teilhabe.<br />
rEFErAtE<br />
3. Wir fordern daher den flächendeckenden Aus- und Aufbau individuell-<br />
bedarfsdeckender vernetzter Unterstützungsangebote für<br />
ältere und behinderte Menschen.<br />
Unsere Gegner sind die Kartelle der Heimträger und Leistungsanbieter.<br />
Längst haben sich Investoren auf den Bau von Billigheimen eingestellt.<br />
Sie bauen „Pflegefabriken“ für diejenigen, die sich keinen<br />
Platz in einer „Residenz“ leisten können. Die Heime werfen Renditen<br />
von bis zu zehn Prozent ab.<br />
Ein Artikel in einer der letzten Ausgaben des „Stern“ macht dies<br />
deutlich: Seit Ende vorigen Jahres hält der Investor Guy WyserPratte<br />
fünf Prozent an der börsennotierten Curanum AG in München, die<br />
mit 7.638 Pflegeplätzen einen Jahresgewinn von rund acht Millionen<br />
Euro erwirtschaftet. Wer noch etwas Gerechtigkeitssinn hat, wer<br />
noch ein Gefühl hat für Menschenwürde und Sozialstaatlichkeit, der<br />
kann nicht hinnehmen, dass mit der Pflegebedürftigkeit der Menschen<br />
ein Geschäft gemacht wird.<br />
Auf das Kostenargument trifft man aber allerorts: Kostenintensiv ist<br />
ein Begriff, der mir, wenn er benutzt wird, immer etwas wehtut.<br />
Wenn ich miterleben muss, dass eine Gesellschaft es nicht fertig<br />
bringt, Menschen zu unterstützen, die ihre Unterstützung brauchen,<br />
und ständig nur von Kosten redet, wird mir teilweise schwindlig.<br />
Ich verweise auf den Fall Leonhard in Hamburg. Man hat billigend<br />
in Kauf genommen das Gutachten hat es aufgezeigt –, dass das<br />
Leben dieses Mannes automatisch verkürzt wird, wenn er in eine<br />
Einrichtung kommt. Das ist skandalös. Es geht um SGB XII § 13. Dort<br />
steht: Ambulanten Leistungen der Sozialhilfe ist nur so lange Vorrang<br />
zu gewähren, solange sie nicht mit unzumutbaren Mehrkosten<br />
verbunden sind. In diesem Paragrafen ist aber auch geregelt, dass<br />
die Versorgung zumutbar sein muss. Das war im Fall Leonhard überhaupt<br />
nicht so. Man hat sich über das Kriterium der Zumutbarkeit<br />
hinweggesetzt.<br />
Der berechtigte Bedarf eines Einzelnen, das Wunsch und Wahlrecht,<br />
muss nicht nur im Persönlichen Budget Ausdruck finden; vielmehr<br />
muss dieser Bedarf, egal wie klein er ist, uns dazu veranlassen, der<br />
Menschenwürde eines jeden Einzelnen auch gerecht zu werden. In<br />
Kommunen und Ländern muss man endlich erkennen, dass die ambulante<br />
Versorgung insgesamt auch kostengünstiger ist. Pflegehochburgen<br />
und Wohnheime können sich die überschuldeten Kommunen<br />
nicht mehr leisten.<br />
Der Kostenvergleich von ambulant und stationär der überörtlichen<br />
Sozialhilfeträger zeigt: 23.172,00 Euro je Leistungsberechtigtem im<br />
Jahresdurchschnitt 2006 für stationäres Wohnen stehen 11.890,00<br />
Euro im ambulanten Wohnen entgegen. Das sind klare Zahlen!<br />
Umsteuern heißt hier aber nicht kaputt sparen: Mit der Förderung<br />
ambulanten Wohnens werden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.<br />
Neben dem Teilhabeaspekt, den ich schon beschrieben habe, eröffnen<br />
sich durch die Belegung von bisher freiem Wohnraum neue<br />
Möglichkeiten zur Gestaltung des gemeindenahen Raums. Menschen<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 9
undesinitiative „Daheim statt Heim“<br />
mit Behinderung mitten in der Gesellschaft sind Mieter, Käufer und<br />
somit auch ein wirtschaftlicher Faktor. Gleichermaßen sind dies auch<br />
ältere Menschen. Das kann und darf nicht länger ignoriert werden.<br />
4. Die Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ fordert die Garantie der<br />
Wahlmöglichkeiten der Betroffenen.<br />
Denn, wenn wir das Wunsch und Wahlrecht nicht im Gesetz aufnehmen,<br />
sondern immer wieder beiseite schieben – im SGB IX steht,<br />
dass es bei der Budgetverteilung keine Mehrkosten geben dürfe –,<br />
dann brauchen wir uns mit Selbstbestimmung und dem Gedanken<br />
der Teilhabe überhaupt nicht mehr auseinanderzusetzen. Wir müssen<br />
die Bereiche SGB IX – das Budget darf die vorhergehenden Kosten<br />
nicht übersteigen –, SGB XII § 13 aufgreifen und ändern.<br />
Schwerstmehrfach behinderte Menschen müssen genauso wie jeder<br />
andere Mensch die Möglichkeit haben, da zu leben, wo sie leben<br />
möchten, egal wie hoch das Budget ist. Ich kann Ihnen versichern<br />
– das zeigen die Evangelische Stiftung Alsterdorf, der große Träger<br />
Hephata und das Johanneswerk –: Man ambu lantisiert; man nimmt<br />
schwerstmehrfachbehinderte Menschen aus den Einrichtungen heraus,<br />
ohne dass das höhere Kosten nach sich zieht.<br />
5. Wir fordern die Gewährleistung des Grundsatzes „Daheim<br />
statt Heim“ in allen gesetzes- und verwaltungstechnischen<br />
Regelungen und auf allen ebenen und in der Praxis.<br />
Es gibt positive Beispiele aus der Praxis, wie das nordrheinwestfälische<br />
Unna zeigt. Mit einfachsten Instrumenten wie einer Wohnberatung<br />
können in hervorragender Weise Kosten bei der Pflegeversicherung,<br />
der Krankenversicherung, der Eingliederungshilfe und der<br />
Altenhilfe gespart werden.<br />
Bei unseren Wohnungsbaugesellschaften stehen viele Wohnungen<br />
leer. Wir müssen keine neuen Einrichtungen bauen, sondern im Rahmen<br />
unserer gesetzgeberischen Möglichkeiten dafür sorgen, dass<br />
verstärkt barrierefreier Wohnraum geschaffen wird. Für KfWKredite<br />
sind im Bundeshaushalt 2008 100 Mio. Euro eingestellt. Ähnlich dem<br />
Co2Gebäudesanierungsprogramm werden zinsgünstige Kredite vergeben.<br />
Nocheinmal: Ambulante Pflege ist kostengünstiger.<br />
Während die Kosten der stationären Pflege von 1997 bis 2004 um<br />
31 Prozent stiegen, betrug die Ausgabensteigerung im selben Zeitraum<br />
im ambulanten Bereich gerade einmal 5 Prozent. Vor diesem<br />
Hintergrund frage ich mich ernsthaft, warum wir immer noch so den<br />
Schwerpunkt auf den stationären Bereich legen.<br />
6. Wir fordern die Beteiligung der Betroffenen an dem Reformprozess<br />
nach der Devise „nichts über uns ohne uns“.<br />
Die Leistungs und die Kostenträger haben kein Interesse daran, den<br />
Menschen mit Behinderungen das Wunsch und Wahlrecht zu gewähren.<br />
Die Menschen mit Behinderungen könnten ja den Wunsch<br />
äußern, woanders zu leben als dort, wo sie jetzt leben. Deshalb müssen<br />
wir die älteren und die Menschen mit Behinderung darin bestärken<br />
rEFErAtE<br />
und sie dabei unterstützen, ihre eigenen Zukunftsperspektiven zu<br />
entwickeln und nicht klein beizugeben, wenn ihnen ein freier Heimplatz<br />
angeboten wird.<br />
Die Stadt Bielefeld – an vorderster Front der Dezernent Tim Kähler –<br />
betont: Wir schaffen konsequent die Nachfrage nach Heimplätzen<br />
ab, wir lassen diese Nachfrage gar nicht mehr aufkommen, weil wir<br />
so viele andere Alternativen für ein selbst bestimmtes Leben im Alter<br />
schaffen.<br />
Im Mittelpunkt unserer Initiative stehen der Mensch und seine Wahlfreiheit<br />
für „Daheim“ statt Heim. Unterstützen Sie uns mit Ihrem<br />
Eintrag in unsere Unterstützerliste! Unterstützen Sie uns, in dem Sie<br />
vor Ort aktiv werden!<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 10
Häuser ... Potala Palast, Tibet<br />
Peter schütze, 45 Jahre<br />
Herr Schütze bevorzugt übersichtliche, klare Formen.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 11
Wohnen wie andere –Unterstütztes Wohnen in der Hausgemeinschaft<br />
LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG 1 hat das Konzept des Unter-<br />
stützten Wohnens in der Hausgemeinschaft entwickelt, um auf der<br />
Grundlage dieses Konzeptes seine Wohnangebote zu modernisieren<br />
und inhaltlich weiterzuentwickeln. Das Konzept wird als Beitrag zur<br />
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe verstanden.<br />
Das Konzept hat unterschiedliche historische, fachliche und sozialrechtliche<br />
Ausgangspunkte, die bei der Entwicklung des Konzepts der Hausgemeinschaft<br />
einbezogen wurden.<br />
1. AusgAngspunkte<br />
säulen der eingliederungshilfe: stationär und ambulant<br />
LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG ist ein Elternverein mit ca. 1.500<br />
Mitgliedern. Nach den Erfahrungen der Aussonderung und Ermordung<br />
von behinderten Menschen im deutschen Faschismus wurde<br />
der Elternverein 1956 von einem Hamburger Juden gegründet. Zunächst<br />
setzte sich der Verein für die Beschulung von behinderten Kindern<br />
ein.<br />
In den siebziger Jahren wurde das Konzept der stadtteilintegrierten<br />
Wohngruppe als Alternative zum Heim entwickelte und in Hamburg<br />
als die Wohnform für Menschen mit Behinderung durchgesetzt. Jeweils<br />
acht Menschen mit unterschiedlichen Unterstützungsbedarf<br />
(alle Bedarfsgrupppen) leben selbstbestimmt und mit einer hohen<br />
Lebensqualität in einer Wohnung im normalen Wohnumfeld zusammen.<br />
Rechtlich handelt es sich bei der Wohngruppe allerdings um<br />
ein (Kleinst-)Heim.<br />
In Hamburg werden seit 20 Jahren auch ambulante pädagogische<br />
Leistungen für Menschen mit Behinderung angeboten, die in der<br />
eigenen Wohnung leben. Die Pädagogische Betreuung im eigenen<br />
Wohnraum (PBW), wie in Hamburg die Fachleistungsstunde heißt,<br />
ist ein Erfolgsmodell: Die PBW ermöglichte vielen Wohngruppenbewohnern<br />
in die eigene Wohnung zu ziehen. Trotz stetiger Reduzierung<br />
des Umfangs der Unterstützung ziehen nur wenige Menschen<br />
in eine Wohngruppe zurück. LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG<br />
unterstützte 2007 erstmals mehr Menschen ambulant als stationär.<br />
Trotz Pflegeversicherung und Hilfe zur Pflege werden Menschen<br />
1 Leben mit Behinderung Hamburg, Sozialeinrichtungen, gemeinnützige GmbH: Rahmen-<br />
konzeption für betreute Wohngruppen. Hamburg 1995<br />
martin rösner ist Bereichsleiter Unterstütztes Wohnen West LeBen mit BeHinDerUnG<br />
HamBUrG.<br />
mit der Hausgemeinschaft „max-B“ wurde ein Konzept entwickelt, das stadtteilintegriertes<br />
Wohnen in der eigenen Wohnung unabhängig vom Unterstützungsbedarf und unabhängig<br />
von der Leistungsform realisiert.<br />
referate<br />
Wohnen wie andere – unterstütztes Wohnen in der Hausgemeinschaft von Martin Rösner<br />
2<br />
mit hohem Unterstützungsbedarf von einem Leben in der eigenen<br />
Wohnung mit ambulanten Hilfen eher ausgeschlossen. Wirtschaftliche<br />
Rahmenbedingungen führen bei vielen Klienten nur zu ein bis zwei<br />
persönlichen Kontakten pro Woche. Im Durchschnitt erhalten die Klienten<br />
3–3,5 Stunden face-to-face-Leistung.<br />
Ende der 90er Jahre hatten sich zwei Säulen in der Hamburger Eingliederungshilfe<br />
herausgebildet: die (stationäre) Wohngruppe und die<br />
pädagogische Betreuung in der eigenen Wohnung. Die Rahmenbedingungen<br />
ambulanter Hilfen verhinderten jedoch, dass viele Menschen<br />
mit Behinderung eine wirkliche Entscheidung zwischen Wohngruppe<br />
und eigener Wohnung treffen konnten.<br />
Unzufrieden mit dieser Situation und aufgrund der Erfahrung, dass viele<br />
Menschen mit Behinderung sich mehr soziale Kontakte wünschten,<br />
baute bzw. ließ LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG zwei Häuser<br />
mit je 9 bzw.14 Wohnungen für ein bzw. zwei Personen bauen. Die<br />
Mieter erhalten die eben genannten Leistungen durch Dienstleister<br />
ihrer Wahl. Soziale Kontakte im Haus werden durch Mitarbeiter von<br />
LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG erfolgreich unterstützt.<br />
Wohnen wie andere: Wohnwünsche von jungen Menschen<br />
mit Behinderung<br />
Von großer Bedeutung für die konzeptionellen Überlegungen zur<br />
Weiterentwicklung der Wohn- und Unterstützungsangebote war die<br />
Untersuchung von Frau Dr. Metzler zu den Wohnwünschen von jungen<br />
Menschen mit Behinderung2 .<br />
Frau Dr. Metzler kam in der Untersuchung zu dem nicht wirklich<br />
überraschenden Ergebnis: „Menschen mit Behinderung wollen ihr eigenes<br />
Leben gestalten und eingebunden sein in das soziale Netzwerk<br />
mit Menschen ohne Behinderung.“ Nur 13% der Befragten wollten in<br />
einem Heim wohnen.<br />
Bei der Planung neuer Wohn- und Unterstützungsstrukturen, die Bedürfnisse<br />
von Menschen befriedigen wollen, muss dieses Ergebnis<br />
berücksichtigt werden. Die eigene Wohnung – ob sie nun allein oder<br />
gemeinsam mit anderen bewohnt wird, ist für Menschen mit Behinderung<br />
genauso wichtig wie für alle anderen Menschen.<br />
2 Metzler, H.; Rauscher; C.: Wohnen inklusiv. Wohn- und Unterstützungsangebote für<br />
Menschen mit Behinderungen in Zukunft. Projektbericht. Hrsg. vom Diakonischen<br />
Werk Württemberg. Stuttgart 2004<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 12
wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />
Bei der Planung von Wohn und Unterstützungsangeboten müssen<br />
deshalb Wohnungsgrößen realisiert werden, die es den Menschen<br />
möglich macht, Einfluss auf ihre realen Lebensbedingungen zu nehmen.<br />
Die Personenzahl im gemeinschaftlichen Leben innerhalb einer<br />
Wohnung sollte deshalb nicht vier bis fünf Personen übersteigen.<br />
Ambulant vor stationär: bessere Rahmenbedingungen<br />
für ambulante Unterstützung<br />
Will man mit dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ ernst machen<br />
und die Rahmenbedingungen für ein Wohnen in der eigenen Wohnung<br />
verbessern, braucht es mehr als die bloße Veränderung von Wohnungsgrößen.<br />
Die Rahmenbedingungen können auf zwei Wegen verbessert<br />
werden:<br />
1. der umfang der ambulanten hilfen wird vergrößert.<br />
Durchschnittliche pädagogische Unterstützungsumfänge von 3,5 Stunden<br />
pro Woche verhindern, dass viele Menschen mit Behinderung ihren<br />
Wunsch nach einem Wohnen in der eigenen Wohnung realisieren<br />
können.<br />
Von ambulanten Wohngemeinschaften in <strong>Berlin</strong> wurde die Grundidee<br />
einer ambulanten Tagespauschale zur Idee einer ambulanten<br />
Leistung für ein Wohnen in Gemeinschaft (Wohn und Hausgemeinschaft)<br />
weiterentwickelt.<br />
In der Zielvereinbarung zwischen LEBEN MIT BEHINDERUNG HAM<br />
BURG SOZIALEINRICHTUNGEN gGmbH und der Behörde für Soziales,<br />
Familie, Gesundheit u. Verbraucherschutz zur Weiterentwicklung<br />
des stationären und ambulanten Hamburger Hilfesystems für behinderte<br />
Menschen konnte eine neue ambulante Leistung, die ambulant<br />
betreute Wohngemeinschaft3 vereinbart werden. Ambulante<br />
Tagespauschalen für alle Hilfebedarfsgruppen (Metzler, HMBWVerfahren)<br />
betragen durchschnittlich ca. 75% der stationären Maßnahmenpauschale.<br />
Der Umfang ambulanter Leistungen konnte damit<br />
deutlich angehoben werden. Ein Zugang zur ambulanten Unterstützung,<br />
auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, wurde<br />
formell geschaffen. Die Zukunft wird zeigen, ob mit der Inanspruchnahme<br />
dieser Leistung für Menschen mit großem Unterstützungsbedarf<br />
auch bedarfsdeckende Unterstützung organisiert und erbracht<br />
werden kann. Auf diesem Weg sind von allen Beteiligten noch hohe<br />
Anforderungen zu bewältigen.<br />
2. die organisation der ambulanten und stationären leistungserbringung<br />
rückt näher zusammen und erfolgt aus einer<br />
hand und aus einem Team.<br />
Zur den Rahmenbedingungen ambulanter Leistungsorganisation gehört,<br />
dass Fahrzeiten pauschal einberechnet sind und nicht entsprechend<br />
des realen Umfangs abgerechnet werden können. Dies führt<br />
dazu, dass kurze Unterstützungszeiten oder spontane bzw. ungeplante<br />
Unterstützung nicht wirtschaftlich erbracht werden können.<br />
Will man erreichen, dass mehr Menschen mit Behinderung in der<br />
3 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/sozialesfamilie/infoline/allgemeine<br />
informationen/sgb12/ambulantbetreutewohngemeinschaft.html<br />
eigenen Wohnung leben können, müsste sich dies ändern. Erreichbar<br />
wäre dies durch eine reale Abrechnungsmöglichkeit der Fahrzeit<br />
oder durch eine Verbindung ambulanter und stationärer Leistungserbringung.<br />
Da eine reale Abrechnung der Fahrzeiten mit dem Kostenträger äußerst<br />
unwahrscheinlich zu erreichen ist, müssen Wohn und Unterstützungskonzepte<br />
unabhängig vom Kostenträger vorangetrieben werden.<br />
Das Zusammenrücken von stationärer und ambulanter Leistung<br />
ist deshalb eine unverzichtbare Option.<br />
Ambulantisierung: ein Sparprogramm?<br />
Die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit u. Verbraucherschutz<br />
(BSG) ist 2005 an die Leistungserbringer mit der Idee herangetreten,<br />
künftig 30% der stationär betreuten Menschen d.h. ca. 800 Menschen<br />
in Hamburg mit ambulanten Hilfen zu unterstützen zu erreichen.<br />
4 Insbesondere Menschen der Bedarfsgruppen 1 und 2 sollten<br />
aus Wohngruppen ausziehen. Nachdem erkennbar wurde, dass dies<br />
nicht ausreichen würde, um das Ziel zu erreichen, sollten auch Menschen<br />
mit Bedarfgruppe 3 einbezogen werden.<br />
Das Ziel der der BSG wurde deutlich formuliert: nachhaltige Kostensenkungen<br />
sollten erreicht werden. Im gleichen Zeitraum wurden der<br />
Haushalt der Hamburger Eingliederungshilfe 12 Millionen Euro5 gekürzt.<br />
Die wirtschaftliche Logik dieses Vorhabens liegt auf der Hand:<br />
die Fallkosten für Menschen mit geringerem Unterstützungsbedarf<br />
sind trotz Einführung der Bedarfgruppen, die mit unterschiedlich hohen<br />
Maßnahmepauschalen auf den unterschiedlich hohe Bedarfe reagieren,<br />
bei ambulanten Hilfen insbesondere bei den niedrigen Bedarfsgruppen<br />
deutlich geringer als die stationären. Der Einspareffekt gegenüber<br />
den stationären Hilfen ist dort am größten. 6<br />
4 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/bsg/soziales/behinderung/ambulant<br />
betreuteswohnendatei,property=source.pdf, S. 3<br />
5 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/pressemeldungen/2004/juni/23/20040623<br />
bsfhaushalt.html<br />
6 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/pressemeldungen/2008/februar/13/20080213<br />
bsgambulantisierung.html<br />
rEFErAtE<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 13
wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />
Die Folgen eines solchen Programms sind allerdings fatal. Menschen<br />
mit großem Unterstützungsbedarf würden in stationären Einrichtungen<br />
konzentriert. Die Teilhabe am Leben der Gesellschaft und Gemeinschaft<br />
würde sich, nach mehreren Nullrunden bei den Erlösen in den letzten<br />
Jahren und aufgrund der geringen Steigerungsraten der Maßnahmenpauschalen<br />
in den Bedarfgruppen 4 und 5, auf ein beaufsichtigtes<br />
Zusammensein in einer Wohnung reduzieren.<br />
Dieses Programm fügte der Idee eines selbstbestimmten Lebens in<br />
einer eigenen Wohnung einen unermesslichen Schaden zu:<br />
> Es würde einen nicht unwesentlichen Teil der Menschen mit Behinderung<br />
von einem selbstbestimmten Leben in der eigenen Wohnung<br />
ausschließen.<br />
> Die ökonomisch bedingte Verkürzung von Ambulantisierungsbemühungen<br />
enthält einen unauflösbaren Widerspruch: die mit dem<br />
unterstützten Wohnen in der eigenen Wohnung verbundene Idee<br />
eines selbstbestimmten Lebens mit Teilhabe am Leben der Gesellschaft<br />
wird gerade denen verwehrt, die davon am meisten profitieren<br />
würden. Vollends unerträglich wird es, wenn in biologistischer<br />
Manier und in Ignoranz gegenüber der fachlichen Weiterentwicklung<br />
der Rehabilitationstheorie unterstütztes Wohnen in der eigenen<br />
Wohnung an individuelle Kompetenzen gekoppelt wird.<br />
> Ambulantisierung würde zu einer Zwangsbeglückung: Wer verließe<br />
eine zufrieden stellende und selbstbestimmte Lebenssituation in<br />
einer Wohngruppe freiwillig, wenn er oder sie als Motiv der Ambulantisierung<br />
Einsparungen und die Reduzierung von Unterstützungsleistungen<br />
vermutet?<br />
> Eine fiskalisch gesteuerte Engführung von Ambulantisierung entzöge<br />
einer von Kostenträgern und Leistungserbringern gemeinsamen<br />
vorangetriebenen und verantworteten Arbeit an der Weiter<br />
entwicklung der Leistungsstrukturen der Eingliederungshilfe jegliche<br />
vertrauensvolle Grundlage.<br />
Obwohl in Hamburg wesentliche Rahmenbedingungen dieses Programms<br />
verändern werden konnten, gilt es weiterhin wachsam zu<br />
sein. Die Gefahr der Aussonderung von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf<br />
ist vorläufig abgewendet, aber noch nicht gebannt.<br />
Im einem Konsenspapier zur Weiterentwicklung der Hamburger<br />
Ein gliederungshilfe für Menschen mit Behinderung7 erklärten am<br />
07.03.2005 der Sozialhilfeträger (BSF), die Spitzenverbände der Freien<br />
Wohlfahrtspflege, Verbände der Träger privater Einrichtungen<br />
und die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen,<br />
dass der Übergang zu ambulanten Hilfen freiwillig erfolgen<br />
solle und reversibel sein kann. Damit wurde für die betroffenen Men<br />
7 http://www.laghhamburg.de/homepage032002/Konsens.htm<br />
schen und ihre Angehörigen und rechtlichen Betreuer die notwendige<br />
Sicherheit bezüglich der Freiwilligkeit des Prozesses geschaffen<br />
Grundsätzlich muss die Erkenntnis, die schon Prof. Dörner vor vielen<br />
Jahren zum Ausgangspunkt seiner Ambulantisierung in Gütersloh8 machte, zur Grundlage von Strukturveränderungen gemacht werden:<br />
Bei der Veränderung von Systemen und Strukturen der Eingliederungshilfe<br />
muss man mit dem Schwierigen beginnen. Menschen<br />
mit hohem Unterstützungsbedarf müssen am Ausgangspunkt und<br />
nicht am Ende dieser Überlegungen stehen. Nur so kann verhindert<br />
werden, dass Menschen mit großem Unterstützungsbedarf auf der<br />
Strecke bleiben. Erforderliche Veränderungen für die Menschen mit<br />
geringem Unterstützungsbedarf zu erreichen, ist auf diesem Weg<br />
nicht mehr schwierig.<br />
„Ambulant vor stationär“ kann deshalb nur für alle gelten: Jeder<br />
Mensch, egal wie behindert, muss ein Recht auf das Wohnen in der<br />
eigenen Wohnung mit der dafür erforderlichen Unterstützung haben.<br />
Dieses Recht darf nicht abhängig gemacht werden vom Vorhandensein<br />
bestimmter Fähigkeiten. Jeder Mensch kann in der eigenen<br />
Wohnung leben, wenn die für die Organisation der Unterstützung<br />
notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.<br />
Noch muss um das Recht auf ein Wohnen in der eigenen Wohnung<br />
gekämpft werden. Das Persönliche Budget gibt auch Menschen mit<br />
hohem Unterstützungsbedarf und ihren Unterstützern ein Mittel in<br />
die Hand, den Wunsch nach dem Leben in der eigenen Wohnung in<br />
die eigene Hand zu nehmen und die dafür notwendigen finanziellen<br />
Mittel einzufordern. Vielleicht könnten diese Budgetanträge sogar<br />
dazu beitragen, ausreichende Unterstützung für ein Leben in der<br />
8 Dörner, K.: Auf dem Weg zur Heimlosen Gesellschaft,<br />
http://bidok.uibk.ac.at/library/imp2703doernergesellschaft.html<br />
rEFErAtE<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 14
wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />
eigenen Wohnung für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf<br />
durchzusetzen. Damit wäre es möglich, dass Menschen mit Behinderung<br />
endlich ihr Wunsch und Wahlrecht wahrnehmen und sich für<br />
eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn und Unterstützungssituation<br />
entscheiden könnten.<br />
2. DAS konZePT DeR HAUSGeMeInScHAFT<br />
Die Hausgemeinschaft – das Wohnhaus<br />
Leitidee des Konzepts der Hausgemeinschaft war ein Haus, in dem<br />
Menschen mit Behinderung unabhängig vom Umfang ihres Unterstützungsbedarfs<br />
und der Art der Hilfe in der eigenen Wohnung leben<br />
können. Die Konkretisierung der Grundidee soll am Beispiel der<br />
ersten Hausgemeinschaft am Rande des Hamburger Schanzenviertels<br />
vorgestellt werden.<br />
Im September 2006 hat LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG zwei<br />
stationäre Wohngruppen für 14 Menschen geschlossen. Sie zogen<br />
zusammen mit fünf weiteren Personen in die erste Hausgemeinschaft<br />
und erhalten dort stationäre oder ambulante Leistungen.<br />
In der Hausgemeinschaft MAXB leben 19 Menschen in elf Wohnungen.<br />
Im Haus sind acht Wohnungen für Menschen vorhanden<br />
sein, die alleine in einer Wohnung leben wollen. Gemeinschaftlich<br />
bewohnte Wohnungen werden von max. vier Personen bewohnt.<br />
Die Bewohner einer Wohngemeinschaft werden ambulant unterstützt,<br />
die anderen beiden Wohngemeinschaften sind stationäre<br />
Wohngruppen.<br />
In der Hausgemeinschaft werden bei zwölf Personen ambulante und<br />
bei sieben Personen stationäre Leistungen erbracht. Im Haus wohnen<br />
derzeit Menschen mit den Bedarfgruppen zwei bis vier. Mehrere<br />
Bewohner haben eine Pflegestufe. Bewohner mit ambulanter Unterstützung<br />
und einer Pflegestufe werden von einem Pflegedienst<br />
unterstützt.<br />
Die Funktionsräume für Mitarbeiter (Büro) sind nicht Teil der Wohnungen.<br />
Alle Bäder sind barrierefreie Duschbäder, ein Pflegebad wird<br />
gemeinschaftlich genutzt. Im Haus gibt es weitere gemeinschaftlich<br />
genutzte Räume, die Begegnung und Kontakte innerhalb des Hauses<br />
ermöglichen und für Feste außerhalb der Wohnung genutzt werden<br />
können.<br />
Die Hausgemeinschaft – Teil eines Wohnprojekts<br />
Die Hausgemeinschaft ist aktiver Teil eines Wohnens in lebendiger<br />
Nachbarschaft. Das Haus ist gut mit barrierefreien öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
erreichbar und liegt in einem Umfeld von leicht Einkaufsmöglichkeiten<br />
und attraktiven Freizeitangeboten.<br />
Das Haus ist eines von neun Häusern des Wohnprojekts MAXB<br />
Arbeiten Wohnen Kultur. Das ganze Wohnprojekt wurde von einer<br />
Wohnungseigentümergemeinschaft bestehend aus Baugemeinschaften<br />
und einer Baugenossenschaft gemeinsam mit der Architektin<br />
Iris Neitmann errichtet. Leitidee des Projektes war die Reali<br />
sierung einer „dörflichen Nachbarschaft in der Stadt mit Platz für<br />
alle Lebensphasen“. 9 Es sollt über die einzelnen Hausgemeinschaften<br />
hinaus ein städtisches Quartier gestaltet werden, in dem alle Generationen<br />
ihren Raum finden.<br />
Auf über 8000 qm entstanden in neun Häusern 105 Miet und Eigentumswohnungen<br />
für 150 Erwachsene und 72 Kinder. Jedes Haus<br />
verfügt über Gemeinschaftsräumen. In einem Haus befinden sich 4<br />
Praxen, 2 Büros und ein Cafe. Gemeinsam werden drei ineinander<br />
übergehende Innenhöfe, eine Tiefgarage und ein Blockheizkraftwerk<br />
genutzt. 10 Einzelne Häuser haben sich ein Motto wie z.B. „Jung und<br />
Alt“ gegeben. Im Wohnprojekt leben in zwei Häusern Menschen mit<br />
geistiger und psychischer Behinderung.<br />
Ein Teil der Häuser sind als Eigentümerprojekte, der andere Teil wurde<br />
von einer Baugenossenschaft realisiert. Das Wohnprojekt wurde<br />
von der Architektin gemeinsam mit den künftigen Bewohnern unter<br />
großem kommunikativem Aufwand geplant. Auf den regelmäßigen<br />
Wohnprojekttreffen wurde das gesamte Bauvorhaben in den einzelnen<br />
Phasen diskutiert, geplant und entschieden.<br />
Das Wohnprojekt wurde 2007 vom Hamburger Senat als ein vorbildliches,<br />
famlienfreundliches Wohnquartier ausgezeichnet. Besonders<br />
der gemeinschaftliche Ansatz gegenseitiger Hilfe und Unterstützung,<br />
das Zusammenleben verschiedener Generationen und Kulturen, die<br />
Freizeitmöglichkeiten und die familien, behinderten und kindgerechte<br />
Gestaltung überzeugten die Jury. 11<br />
Das Wohnprojekttreffen tagt auch heute noch regelmäßig. Der gemeinsame<br />
Nenner des Wohnprojekts – die „Lust an gemeinschaftlichen<br />
Aktivitäten“ 12 – wird gepflegt. Unter Beteiligung aller Bewohner<br />
wurde ein erstes Projektfest organisiert und durchgeführt. Das<br />
Wohnprojekttreffen beschäftigt sich nach dem Ende der Bauphase<br />
jetzt stärker mit sozialen Fragen des Zusammenlebens. Am Trägertreffen<br />
nehmen Bewohner der Hausgemeinschaft regelmäßig teil.<br />
Die Hausgemeinschaft – eigentum und Vermietung<br />
Die Hausgemeinschaft wurde im Eigentum einer Baugenossenschaft<br />
im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus realisiert. Das Haus wurde<br />
so geplant, dass später durch einfache Umbauten die Gesamtfläche<br />
eines Geschosses in drei Wohnungen aufgeteilt werden kann und einer<br />
anderen Nutzung zugeführt werden könnte. Der behinderungsbedingte<br />
Mehraufwand für die vollständige Barrierefreiheit und das<br />
Pflegebad wurde durch Mittel der Aktion Mensch unterstützt.<br />
LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG hat sich bewusst gegen Eigentum<br />
und die damit verbundene Rolle als Vermieter entschieden. Wir<br />
9 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/stadtentwicklungumwelt/bauen<br />
wohnen/familienfreundlicheswohnquartier/wettbewerbaltonamaxbarbeiten<br />
wohnenkultur,property=source.pdf, S. 1<br />
10 http://www.wkhamburg.de/fileadmin/pdf/ueberuns/JB_06_SG.pdf, S.18<br />
11 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/stadtentwicklungumwelt/bauen<br />
wohnen/familienfreundlicheswohnquartier/2007preisverleihung.html<br />
12 ebenda, S.17<br />
rEFErAtE<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 15
wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />
wollen Menschen mit Behinderung möglichst nur als Dienstleister<br />
gegenübertreten. Die Baugenossenschaft vermietet erfreulicherweise –<br />
dies ist leider nicht selbstverständlich – direkt an die Menschen mit<br />
Behinderung, auch an die Bewohner der Wohngemeinschaft.<br />
Die Flächen der beiden Wohnungen, in denen stationäre Dienstleistungen<br />
erbracht werden, sind an LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG<br />
vermietet. Die Kosten der Gemeinschaftsräume sind anteilmäßig auf<br />
alle Mieter umgelegt.<br />
Die Hausgemeinschaft – das Heimgesetz<br />
Die stationäre Leistungserbringung für sieben Menschen in zwei<br />
Wohnungen unterliegt den üblichen Anforderungen des Heimgesetzes.<br />
Die Bedeutung einer künftigen Weiterentwicklung des Heimgesetzes<br />
zu einem Verbraucherschutzgesetz, das auch ambulante<br />
Leistungserbringer einbezieht, bleibt zunächst abzuwarten.<br />
Die ambulante Leistungserbringung bei 12 Bewohnern unterliegt<br />
nicht dem Heimgesetz. Mietvertrag und Dienstleistungsvertrag sind<br />
nicht gekoppelt. Die Mieter wählen den Dienstleister, sofern erforderlich,<br />
selbständig oder mit Unterstützung ihrer rechtlichen Betreuer<br />
aus.<br />
Die Hausgemeinschaft – die organisation der Leistungserbringung<br />
Unter dem Dach der Hausgemeinschaft werden von einem Hausteam<br />
stationäre Leistungen erbracht. Die Mitarbeiter des Hausteams<br />
erbringen auch ambulante Leistungen für Mieter, wenn diese sich<br />
entscheiden, ambulante Leistungen vom stationären Leistungserbringer<br />
einzukaufen. Der Vorteil einer Beauftragung des Hausteams<br />
mit der ambulanten Leistung ist die Möglichkeit, erforderliche Unterstützungsleistungen<br />
kleinteilig oder kurzfristig zu erbringen.<br />
rEFErAtE<br />
Zu den verschiedenen ambulanten Leistungen gehören Pädagogische<br />
Betreuung im eigenen Wohnraum (PBW), Wohnassistenz und ambulante<br />
betreute Wohngemeinschaft. Ambulante pflegerische Leistungen<br />
der Pflegeversicherung und der Hilfe zur Pflege, die eine Zulassung<br />
als Pflegedienst zur Voraussetzung haben, werden von einem Pflegedienst<br />
in Zusammenarbeit mit dem Hausteam erbracht.<br />
Im Hausteam arbeiten Sozialpädagogen, pädagogische und pflegerische<br />
Fachkräfte, Assistenzkräfte, Reinigungskräfte und junge Menschen<br />
im Freiwilligen Sozialen Jahr/ZDL. Derzeit umfasst das gesamte<br />
Team 10,35 Stellen. Der Pflegedienst ist momentan mit ca. einer halben<br />
zusätzlichen Stelle tätig. Nachtbereitschaft wird vom Hausteam<br />
geleistet. Menschen, die einen höheren nächtlichen Unterstützungsbedarf<br />
haben, der nur durch eine Nachtwache gedeckt werden kann,<br />
können nicht einziehen, da eine Nachtwache mit den Kostensätzen<br />
nicht finanzierbar.<br />
Der persönliche Hilfeplan ist der Ausgangspunkt einer Planung und<br />
Organisation der unterschiedlichen Unterstützungsleistungen in der<br />
Hausgemeinschaft. In der Planung und Organisation wird kein qualitativer<br />
Unterschied zwischen stationärer und ambulanter Leistung<br />
gemacht. Die Planung pflegerischer Hilfen ist Bestandteil der Hilfeplanung<br />
und erfolgt ggfs. in enger Abstimmung mit den Mitarbeitern<br />
des Pflegedienstes. In der Hilfeplanung werden Ressourcen des<br />
familiären und sonstigen Netzwerkes erfasst und eingeplant.<br />
Bei der Umsetzung der Hilfeplanung in die Organisation des Alltags<br />
und in den Dienstplan wird zwischen folgenden Unterstützungsstrukturen<br />
unterschieden:<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 16
wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />
> ansprechbarkeit/notruf<br />
Jede Wohnung im Haus ist mit einem Notruf ausgestattet. Mitarbeiter<br />
können darüber hinaus jederzeit von Bewohnern für kleine<br />
ungeplante Hilfen angesprochen werden.<br />
> Planungsgespräche / besondere unterstützung<br />
In regelmäßigen Planungsgesprächen planen Bewohner und Bezugsmitarbeiter<br />
die Aktivitäten der nächsten Zeit. Besondere Unterstützungssituationen<br />
wie z.B. Facharztbesuche werden ebenfalls<br />
vom Bezugsmitarbeiter oder einem anderen festgelegten<br />
Mitarbeiter unterstützt.<br />
> tägliche unterstützung<br />
Alltägliche (Lern)Unterstützung wird durch im Dienstplan geplante<br />
Mitarbeiter erbracht. Die konkrete Planung der Unterstützung<br />
wird vom Bezugsmitarbeiter vorgenommen.<br />
> gemeinschaftliche angebote<br />
In der Hausgemeinschaft organisieren Bewohner ihr soziales Leben<br />
innerhalb des Hauses häufig selbst. Sie laden sich gegenseitig<br />
ein und treffen Verabredungen zu gemeinsamen Aktivitäten.<br />
Mitarbeiter organisieren zusammen mit Bewohnern gelegentliche<br />
Kaffeerunden, gemeinsame Mahlzeiten am Wochenende, oder<br />
Filmabende.<br />
Anders als in der klassischen ambulanten Arbeit wird ein Teil der<br />
Unterstützungsleistung durch Mitarbeiter erbracht, die nach Dienstplan<br />
eingeteilt sind. Der Anteil geplanter oder terminierter Unterstützungsprozesse<br />
hat im Vergleich zur Wohngruppe zugenommen.<br />
Zu den, mit dem Wechsel verbundenen Schwierigkeiten gehörten,<br />
dass ein Arbeiten in einem Haus mit mehreren Bewohnern auf mehreren<br />
Stockwerken eine neue Form der persönlichen und kollektiven<br />
Arbeitsorganisation erfordert. Die Bewohner der Hausgemeinschaft<br />
hatten allerdings damit weniger Probleme als Mitarbeiter: Sie nutzten<br />
die, sich aus den Umstellungsschwierigkeiten ergebenden Unterstützungslücken<br />
und Freiräume, aktiv für Selbsthilfeprozesse.<br />
Im Hausteam der Hausgemeinschaft wird heute eine Mischung aus<br />
ambulanten und stationären Arbeitsstrukturen praktiziert. Die Zusammenarbeit<br />
mit dem Pflegedienst ist eng und hat große Bedeutung<br />
für eine erfolgreiche Arbeit bei einzelnen Bewohnern.<br />
Die Hausgemeinschaft – Hausversammlung<br />
und Interessenvertretung<br />
Der Veränderungsprozess wird durch eine regelmäßige Versammlung<br />
aller Bewohner des Hauses unterstützt. Ein Bewohner wurde<br />
von der Hausversammlung zum Interessenvertreter gewählt.<br />
3. eRGeBnISSe UnD ZUkUnFTSTHeMen<br />
rEFErAtE<br />
ergebnisse ambulant unterstützten Wohnens in der Hausgemeinschaft<br />
und in ambulanten Wohngemeinschaften<br />
Hausgemeinschaft<br />
Alle Bewohner der Hausgemeinschaft, d.h. auch diejenigen, die<br />
stationär leben, schätzen die Bedeutung der „eigenen“ Wohnung<br />
sehr hoch ein. Das Selbstbewusstsein in Bezug auf die Kompetenzen<br />
einer eigenständigen Lebensgestaltung ist gewachsen, die eigenen<br />
Unterstützungsbedarfe sind klarer konturiert.<br />
Soziale Kontakte zwischen den Bewohnern der Hausgemeinschaft<br />
sind vielfältig und werden eigenständig und unabhängig von Mitarbeitern<br />
gepflegt. Konflikte im Zusammenleben, die es in der Wohngruppe<br />
mit sieben Personen gab, haben sich deutlich verringert.<br />
Die Bewohner der Hausgemeinschaft sind bekannte und akzeptierte<br />
Mitglieder des Wohnprojekts. Nachbarschaftliche Kontakte sind alltäglich<br />
und werden in unterschiedlichen Intensitäten gepflegt.<br />
Die Möglichkeiten des Stadtteils werden alltäglich für Einkauf und<br />
Freizeit genutzt.<br />
Die Hausbewohner haben sich mit der Hausversammlung ein eigenes<br />
Forum gegeben, in dem sie Fragen des Zusammenlebens besprechen<br />
und regeln, sowie gemeinsame Interessen formulieren und<br />
verfolgen.<br />
Ambulante Wohngemeinschaften<br />
In 2006 und 2007 wurden bei LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG<br />
sieben Wohngruppen mit insgesamt 52 Plätzen in 12 ambulante<br />
Wohngemeinschaften umgewandelt.<br />
Das bisherige Ergebnis des Ambulantisierungsprozesses, d.h. das Ergebnis<br />
der Umwandlung einer stationären in ambulante Unterstützung,<br />
wird von 2007 bis 2010 von der Hochschule für angewandte<br />
Wissenschaft, Fakultät Wirtschaft und Soziales, Department Pflege<br />
und Management evaluiert. 50 Nutzer von Wohngruppen, Angehörige<br />
und Mitarbeiterinnen werden von zu den Ergebnissen befragt.<br />
Die Zwischenergebnisse werden am 29.04. in Hamburg am Fachtag<br />
„Wohnen wie andere – Von der Wohngruppe zum Wohnen mit<br />
ambulanter Unterstützung“ vorgestellt. Der Zwischenbericht kann<br />
demnächst beim LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG angefordert<br />
werden.<br />
Trotz großer, mit dem Umwandlungsprozess verbundener Unsicherheiten<br />
kann konstatiert werden:<br />
> Die Mieter erleben, wie schon zuvor, einen hohen Grad der Selbstbestimmung<br />
und sind überwiegend mit ihrer Lebenssituation sehr<br />
zufrieden. Im Bereich der Alltagsunterstützung besteht ebenfalls<br />
eine hohe Zufriedenheit.<br />
> Die Freizeit wird aktiver gestaltet und als weniger langweilig empfunden.<br />
Der Kontakt zu Freunden und Mitbewohnern hat zuge<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 17
wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />
nommen. Familieangehörige haben eine große Bedeutung. Menschen<br />
mit Behinderung werden allerdings mehr besucht, als dass<br />
sie andere Menschen aktiv besuchen.<br />
> Mitarbeiter sind in dieser Phase des Prozesses für Nutzer wichtiger<br />
geworden. Individuelle Unterstützungsbedarfe haben sich aber<br />
gleichzeitig reduziert.<br />
Die positiven Ergebnisse des bisherigen Prozesses beruhen auf intensiver<br />
Kommunikation: Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter mussten<br />
und müssen von den Chancen dieses Weges überzeugt werden.<br />
Voraussetzung für eine gute Entwicklung war und ist, dass alle Beteiligten,<br />
insbesondere aber Mitarbeiter und Angehörige bereit sind,<br />
die bisherige, stationär geprägte Arbeits und Erwartungshaltung infrage<br />
zustellen, sich auf den eingeschlagenen Weg einzulassen und<br />
aktiv an seiner Ausgestaltung mitzuwirken.<br />
Ganz wichtig hierbei ist Vertrauen: Gegenseitiges Vertrauen im Prozess<br />
und die Bereitschaft Fehler für Veränderung zu nutzen. Vor allem<br />
aber: gemeinsames Vertrauen in die Kompetenzen von Menschen<br />
mit Behinderung, die meistens besser in der Lage sind, ihr Leben in<br />
die eigene Hand zu nehmen, als dies Angehörige und Mitarbeiter<br />
meinen.<br />
Die Zukunft: umfassende soziale und gesellschaftliche Beteiligung<br />
30 Jahre stadtteilintegrierte Wohngruppe, 30 Jahre Leben im Stadtteil<br />
haben gezeigt, dass mit Wohnen im Stadtteil gesellschaftliche<br />
Teilhabe erreicht wird. Der Abbau von Barrieren, die Teilhabe be oder<br />
verhindern, wird noch eine lange Zeit unsere Aufmerksamkeit und<br />
Energie erfordern. Dieses Ziel verfolgen wir mit der Gewissheit, dass<br />
die barrierefreie Gestaltung unserer Umwelt nicht nur Menschen mit<br />
Behinderung, sondern allen Menschen, alten Menschen und Familien<br />
ebenso nützt.<br />
30 Jahre Leben im Stadtteil haben aber auch gezeigt, dass Wohnen<br />
im Stadtteil nicht automatisch dazu führt, dass Menschen mit Behinderung<br />
umfassend am sozialen und gesellschaftlichen Leben beteiligt<br />
sind. Zu einem Leben in der eigenen Wohnung gehört neben<br />
einem Mehr an Selbstbestimmung auch eine stärkere gesellschaftliche<br />
Teilhabe. Menschen mit Behinderung wollen anerkannte und<br />
wertgeschätzte Mitbürger sein. Mit der Ambulantisierung von Unterstützungsleistungen<br />
rückt die Frage der Teilhabe am gesellschaftlichen<br />
Leben in den Mittelpunkt.<br />
Mehr Selbstbestimmung ist durch gute Wohn und Unterstützungskonzepte,<br />
sowie durch veränderte rechtliche und organisatorische<br />
Strukturen zu erreichen. Teilhabe am Leben der Gesellschaft wird<br />
jedoch nicht allein durch die Beseitigung von Teilhabebarrieren, nicht<br />
allein durch gute rechtliche und strukturelle Voraussetzungen erreicht.<br />
Umfassende Beteiligung von Menschen mit Behinderung am<br />
sozialen und gesellschaftlichen Leben13 will im alltäglichen Leben erarbeitet<br />
und erkämpft werden.<br />
13 Aktion Mensch, Zukunft gestalten mit dem lokalen Teilhabeplan, Bonn 2005, S. 4<br />
Das Konzept der Hausgemeinschaft setzt noch stärker als das Wohngruppenkonzept<br />
auf ein vernetztes und sich veränderndes Wohnen<br />
in Nachbarschaft. Im Rahmen eines Projektes werden wir daran<br />
arbeiten, Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben des<br />
Stadtteils praktisch zu verbessern. Die wichtigsten Themenfelder und<br />
Ziele dieses Projektes werden sein:<br />
Themenfeld Ziele<br />
Soziale Kontakte mit Freunden, Angehörigen,<br />
Nachbarn und Unterstützern<br />
Angebote im Stadtteil<br />
> Konsum<br />
> Freizeit<br />
> Bildung<br />
rEFErAtE<br />
> Kontakte eigenständig pflegen<br />
> Besuche bei Freunden machen<br />
> Nachbarschaftliche Kontakte ausbauen<br />
> Barrieren abbauen<br />
> Angebote öffnen und nutzen<br />
> Angebotsspektrum durch Zusammenarbeit<br />
erweitern<br />
> Treffpunkte im Stadtteil kultivieren<br />
Kulturelle Aktivität im Stadtteil > kulturell im Stadtteil präsent sein<br />
z.B. durch Schreibwerkstatt, Musik,<br />
Theater, Fotografie<br />
politische Beteiligung > Interessenvertretung stärken<br />
> Mitarbeit an der Weiterentwicklung<br />
des Wohnprojekts<br />
> Mitarbeit in Gremien im Stadtteil<br />
> Runder Tisch Barrierefreiheit<br />
Von ganz besonderer Bedeutung für die Erreichung der Ziele wird<br />
es dabei sein, im Stadtteil Unterstützer und Kooperationspartner für<br />
diesen Prozess zu gewinnen. In den nächsten Jahren gilt es eine eigen<br />
erfolgreiche Praxis zu entwickelt und von erfolgreichen Aktivitäten<br />
anderer zu lernen.<br />
Ich denke es ist deutlich geworden: Der Grundsatz „ambulant vor<br />
stationär“ erfordert mehr als den Abbau stationärer Plätze und die<br />
Unterstützung des Wohnens in der eigenen Wohnung. „Ambulant<br />
vor stationär“ ist ein Programm, für das Gleichstellung, Selbstbestimmung<br />
und Teilhabe für alle Menschen mit Behinderung sowohl<br />
Ausgangspunkt wie auch Ziel ist. Die Weiterentwicklung von ambulanten<br />
Wohn und Unterstützungsangeboten für Menschen mit<br />
großem Unterstützungsbedarf ist dafür ebenso erforderlich wie die<br />
Arbeit an einer umfassenden sozialen und gesellschaftlichen Beteiligung<br />
von Menschen mit Behinderung.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 18
Häuser ... Westerburg –<br />
im Harzvorland<br />
eberhard Gaetke, 44 Jahre<br />
Wohnen in einer Burg, wie ein Ritter –<br />
dies gefällt Herrn Gaetke. Und man kann<br />
die Burg zum Spielen benutzen.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 19
contec-Studie zur wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung der behindertenhilfe in bayern<br />
FAcHLIcH-InHALTLIcHe BeWeRTUnG UnD<br />
ScHLUSSFoLGeRUnGen<br />
Die Contec Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH, Bochum<br />
hat 2006/2007 auf gemeinschaftliche Initiative der <strong>Lebenshilfe</strong> Landesverband<br />
Bayern e.V. und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes<br />
Landesverband Bayern e.V. und mit Unterstützung des Bayerischen<br />
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Gesundheit<br />
eine Untersuchung zur „Wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung<br />
der Behindertenhilfe“ durchgeführt.<br />
Die Studie war ein Ergebnis zur 2006 vorhandenen Ausgangssituation<br />
in Bayern im Hinblick auf die Rahmenbedingungen und den Tenor<br />
der Diskussionen um die Ausgestaltung ambulanter Versorgung von<br />
Menschen mit Behinderung.<br />
1. AUSGAnGSSITUATIon In BAyeRn<br />
Um den Hintergrund der 2006 durchgeführten Studie zur „Wirtschaftlichkeit<br />
der Ambulantisierung der Behindertenhilfe in Bayern“ und<br />
das darin enthaltene Studiendesign verstehen zu können, muss man<br />
die konkrete Ausgangssituation zum Thema Ambulantisierung im<br />
Freistaat Bayern zu dieser Zeit berücksichtigen.<br />
Grundsätzlich kann man sagen, dass zu diesem Zeitpunkt das Ambulant<br />
Unterstützte Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung<br />
in Bayern im bundesweiten Vergleich nur sehr gering ausgebaut war.<br />
Diese Situation war Konsequenz der schwierigen Rahmenbedingungen<br />
für diesen Bereich. Die wesentlichen Rahmenbedingungen<br />
sollen im Folgenden kurz dargestellt werden:<br />
> Im Jahr 2006 bestand in Bayern eine getrennte Kostenträgerschaft<br />
für ambulante und stationäre Leistungen. Für ambulante Leistungen<br />
waren die örtlichen Träger der Sozialhilfe (in Bayern sind dies 96<br />
Kommunen und kreisfreie Städte) zuständig, für den stationären Bereich<br />
die überörtlichen Träger der Sozialhilfe (7 Regierungsbezirke).<br />
> Die strukturelle und finanzielle Situation in den bayerischen Kommunen<br />
und Bezirken ist extrem unterschiedlich. Vor diesem Hintergrund<br />
sind auch die Rahmenbedingungen der Angebote zum<br />
rEnAtE bAIKEr ist referentin für wohnen und offene Hilfen im <strong>Lebenshilfe</strong> Landes-<br />
verband bayern e.V.<br />
Eine konsequente Ambulantisierungsstrategie erfordert eine umfängliche wirtschaftliche<br />
betrachtung und muss die Interessen von Menschen mit sehr hohen Hilfebedarfen<br />
im blick haben, um die Ausgrenzung von restgruppen zu vermeiden.<br />
rEFErAtE<br />
contec-Studie zur Wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung<br />
der Behindertenhilfe in Bayern von Renate Baiker<br />
3<br />
Ambulant Unterstützten Wohnen vor Ort sehr unterschiedlich. In<br />
zahlreichen Kommunen war keine Bereitschaft zu spüren, Vereinbarungen<br />
zum Ambulant Unterstützten Wohnen zu schließen, da<br />
dieses Angebot im Gegensatz zum stationären Wohnen die angespannten<br />
kommunalen Haushalte zusätzlich belastet hätte.<br />
> Seitens der überörtlichen Sozialhilfeträger entstand ein zunehmender<br />
Druck auf Anbieter stationärer Wohnformen, Personen<br />
der Hilfebedarfsgruppe 1 und 2 (nach dem H.M.B.W.Verfahren)<br />
in die ambulante Versorgung zu überführen, wobei aber häufig<br />
eine ambulante bzw. kommunale Versorgungsstruktur fehlte. Die<br />
stationären Kostenübernahmen wurden teilweise nur noch halbjährlich<br />
erteilt, auf der ambulanten Seite konnte aufgrund der o.g.<br />
Situation das Angebot nicht entsprechend auf und ausgebaut<br />
werden.<br />
> Aus Sicht der Kostenträger sollten alle Personen der Hilfebedarfsgruppen<br />
1 und 2 ambulantisiert werden, also die Personen mit vermeintlich<br />
geringem Hilfebedarf. Die Frage, ob die Zuordnung zu<br />
den stationär vorgesehenen Hilfebedarfsgruppen Rückschlüsse<br />
auf den tatsächlichen Hilfebedarf in einer ambulanten Versorgung<br />
und Aussagen über den individuellen Wunsch und die Fähigkeit<br />
zum Leben in einer ambulanten Versorgung unter den vorhandenen<br />
Rahmenbedingungen zulassen, wurde in diesem Zusammenhang<br />
nicht thematisiert. Personen mit hohem Hilfebedarf spielten bei<br />
den Überlegungen der Kostenträger keine Rolle bei der Frage der<br />
Ambulantisierung von Hilfen.<br />
> Und schließlich wurde das Thema Ambulantisierung, wie sicher in<br />
vielen anderen Bundesländern auch, seitens der Kostenträger vor<br />
allem unter den Blickwinkel finanzieller Fragestellungen betrachtet.<br />
Hierbei wurden, wie meist in dieser Diskussion, die Kosten vollstationären<br />
Wohnens mit den reinen Unterstützungskosten im ambulanten<br />
Wohnen (in Bayern zu diesem Zeitpunkt meist zwischen 3 und 5 Stunden<br />
pro Woche bei einem Stundensatz von häufig weit unter 30)<br />
verglichen.<br />
> Die Frage der Ambulantisierung wurde ausschließlich als Frage der<br />
Wohnambulantisierung diskutiert.<br />
> Die Gespräche um eine ambulante Versorgung von Menschen mit<br />
Behinderung wurden seitens der Kostenträger mit Blick auf ein pau<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 20
contec-Studie zur wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung der behindertenhilfe in bayern<br />
schaliertes, vom Umfang der individuellen Unterstützungsstunden<br />
her sehr begrenztes Angebot der Leistungen im Ambulant Unterstützten<br />
Wohnen geführt. Weitergehende Unterstützungsbedarfe<br />
im ambulanten Bereich und damit andere für den langfristigen Erfolg<br />
von Ambulantisierungsmaßnahmen erforderliche Hilfen wie<br />
z.B. Integrationshilfen, Freizeitangebote u.ä. wurden in der Regel<br />
nicht berücksichtigt.<br />
Das bedeutet, dass Rahmenbedingungen gesetzt waren, die im Prinzip<br />
eine Ambulantisierung von Leistungen erschwerten, wenn nicht<br />
gar aktiv verhinderten. Zu diesem Zeitpunkt war es kaum möglich,<br />
inhaltliche Diskussionen um Ausgestaltung und die notwendigen<br />
strukturellen, finanziellen Hilfen zu führen. Diese Auseinandersetzung<br />
wurde mit dem Finanzargument verhindert und in den Systemproblemen<br />
zerrieben.<br />
Diese schwierige Ausgangslage hat die beteiligten Verbände und das<br />
Sozialministerium dazu veranlasst, eine Studie zu initiieren, die neue<br />
Impulse in der Ambulantisierungsdiskussion setzten sollte.<br />
2. ZIeL DeR UnTeRSUcHUnG<br />
Da der Versuch, rein fiskalische Argumentationslinien mit inhaltlichen<br />
Argumenten zu kontern, nicht zum gewünschten Erfolg führte, wurde<br />
im Rahmen der Studie nun versucht, den fiskalischen Argumenten<br />
mit einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise zu begegnen, um hierüber<br />
eine erneute inhaltliche Diskussion anzustoßen.<br />
Bislang wurden in der fiskalischen Betrachtungsweise von Ambulantisierungsprozessen<br />
die Kosten einer stationären Versorgung mit den<br />
reinen Betreuungskosten im ambulanten Bereich – aus unserer Sicht<br />
unzulässig verkürzt – verglichen mit dem naheliegenden Ergebnis,<br />
dass eine ambulante Wohnversorgung wesentlich kostengünstiger<br />
ist als eine stationäre Versorgung.<br />
Die vorgelegte Studie ging hier bewusst einen anderen Weg. Ziel<br />
der Untersuchung war ein umfassender Kostenvergleich ambulanter<br />
und stationärer Behindertenhilfe. Es ging somit um eine genauere<br />
Betrachtung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Ambulantisierungsmaßnahmen.<br />
Der Blick war nicht auf die einzelne Person<br />
gerichtet, sondern auf das „System Behindertenhilfe“. Dieser umfassende<br />
Ansatz führte auch dazu, dass alle für eine ambulante<br />
Versorgung notwendigen ambulanten Hilfen und Sozialleistungen<br />
mit in den Blick genommen wurden, nicht nur die reinen Betreuungsleistungen<br />
im Rahmen Ambulant Unterstützten Wohnens.<br />
Soll Ambulantisierung ein „Erfolgsmodell“ werden, müssen neben<br />
wohnbezogenen Hilfen auch die Rahmenbedingungen für Vernetzung,<br />
Integration und Verankerung der Menschen mit Behinderung<br />
in ihrem Wohnumfeld geschaffen werden, wie dies die Erfahrungen<br />
zum Beispiel aus Norwegen eindrücklich zeigen. Ambulantisierung<br />
ist mehr als wohnbezogene Hilfen.<br />
Ziel der Studie war es also zusammenfassend, eine volkswirtschaftliche<br />
Datenbasis für die weitere inhaltliche Diskussion um die Ausgestaltung<br />
von Ambulantisierungsmaßnahmen zu gewinnen.<br />
3. GRUnDAnnAHMen DeR UnTeRSUcHUnG<br />
rEFErAtE<br />
Diese grundsätzlichen Überlegungen haben zu Grundannahmen geführt,<br />
vor deren Hintergrund die nachfolgenden Ergebnisse zu bewerten<br />
sind. Im Rahmen der Studien wurden von folgenden Thesen<br />
ausgegangen:<br />
a) Grundsätzlich ist eine ambulante versorgung für alle menschen<br />
mit behinderung unabhängig von der art und schwere<br />
ihrer behinderung möglich.<br />
Die Entscheidung darüber, ob eine Person ambulant versorgt<br />
werden kann, liegt nicht grundsätzlich im Hilfebedarf der Person<br />
selbst begründet, sondern ist abhängig von den von außen gesetzten<br />
Rahmenbedingungen, unter denen eine ambulante Versorgung<br />
erbracht werden kann.<br />
b) die derzeit in der stationären versorgung erbrachten leistungen<br />
bilden den tatsächlichen hilfebedarf einer Person ab.<br />
Zu diesem Hilfebedarf gehören neben dem direkten Betreuungsaufwand<br />
und dem Pflegeanteil auch die Gestaltung der Freizeit,<br />
die notwendigen Fahr und Begleitdienste, die hauswirtschaftliche<br />
Versorgung etc., also alle relevanten Leistungen, die auch im<br />
Rahmen einer Überführung stationärer in ambulante Leistungen<br />
Berücksichtigung finden müssten.<br />
Hierbei wurde die Frage, ob nach jahrelangen Deckelungsphasen,<br />
einer kostenneutralen Systemumstellung auf Hilfebedarfsgruppen<br />
und prospektive Entgelte sowie einer damit einher gehenden jahrelangen<br />
NettoAbsenkung der Entgelte die erbrachten Leistungen<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 21
contec-Studie zur wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung der behindertenhilfe in bayern<br />
tatsächlich bedarfsdeckend sind, nicht berücksichtigt. Im Gegenzug<br />
dazu blieb auch die Fragestellung, ob es im Einzelfall im<br />
Rahmen stationärer Versorgung zu einer Überversorgung kommen<br />
kann, unberücksichtigt. Im Rahmen der Studie wurde also<br />
die tatsächlich erbrachte Leistung als sachgerecht und notwendig<br />
unterstellt.<br />
c) es wird in der ambulanten versorgung von einzelwohnen<br />
ausgegangen.<br />
Hierbei wurde unterstellt, dass von den betroffenen Personen<br />
Einzelwohnen erwünscht ist. Dabei sollte nicht in Abrede gestellt<br />
werden, dass auch ambulante Wohngemeinschaftsmodelle inhaltlich<br />
sinnvoll sind, wenn diese von den Betroffenen gewünscht<br />
werden und diese sowohl organisatorisch als auch finanziell attraktiver<br />
sein können. Allerdings wurde bewusst eine Extremposition<br />
in die Studie eingebracht, um hierüber wieder den Blick auf<br />
inhaltliche Positionen und Diskussionen lenken zu können.<br />
d) eine ambulante leistungserbringung umfasst alle notwendigen<br />
Teilhabe- und Pflegeleistungen, nicht nur wohnbezogene<br />
leistungen.<br />
Will man das System Behindertenhilfe ambulantisieren, so ist es<br />
erforderlich, dass gesamte Leistungsspektrum zu überführen.<br />
Aussagen darüber, welche Leistungen im konkreten Einzelfall<br />
erforderlich sind, sind werden hierbei nicht getroffen. Ambulantisierung<br />
hat aus diesem Blickwinkel Auswirkungen auf verschiedenste<br />
Leistungsbausteine die bei einer Veränderung des Systems<br />
bzw. einer Simulation einer Überführung berücksichtigt werden<br />
müssen.<br />
e) schlussendlich legt eine volkswirtschaftliche betrachtungsweise<br />
nahe, dass ambulantisierungsmaßnahmen auswirkungen<br />
auf alle sozialleistungsträger haben.<br />
Auf Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung, aber auch auf<br />
die Bereich Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt, auf<br />
Wohngeldausgaben etc. Vor diesem gedanklichen Hintergrund<br />
erfolgte die Datenerhebung der Studie. Für die Erhebung relevant<br />
waren<br />
> nutzerbezogene Daten wie Hilfebedarfsgruppe, Pflegestufe,<br />
stationärer Kostensatz, Barbeträge und Zusatzbarbeträge,<br />
Bekleidungsbeihilfe, Einkommen etc.<br />
> der derzeitige quantitative Betreuungsaufwand (erbrachte Leistungen<br />
und zeitlicher Aufwand) im stationären Bereich<br />
> die konzeptionellen Rahmenbedingungen der stationären Einrichtungen,<br />
z.B. Zentralküche, zentrale Wäscheversorgung, hauswirtschaftliche<br />
Tätigkeiten in der Wohngruppe o.ä. (qualitativ)<br />
> die Infrastruktur im Bereich der regionalen ambulanten Versorgung<br />
(qualitativ)<br />
rEFErAtE<br />
Der derzeitige Betreuungsaufwand wurde im stationären Bereich erhoben<br />
und in der Folge in eine ambulante Versorgung simuliert. Die<br />
konzeptionellen Rahmenbedingungen der stationären Einrichtungen<br />
wurden berücksichtigt, da sich diese Leistungen entweder in der Erfassung<br />
des individuellen Betreuungsbedarfs oder in den Entgelten<br />
für zentrale Versorgung niederschlagen. Die ambulanten Infrastrukturvoraussetzungen<br />
wurden zum einen mit Bezug auf die örtliche<br />
Preisgestaltung erhoben, zum anderen mit Blick auf die grundsätzlich<br />
vorhandene Infrastruktur für eine ambulante Versorgung. Die<br />
örtlichen Voraussetzungen hierfür sind in einem Flächenstaat mit<br />
einerseits großstädtischer Infrastruktur und sehr stark ländliche geprägten<br />
Gebieten andererseits sehr unterschiedlich. Die Erhebung<br />
wurde daher im großstädtischen Bereich, in einer Kleinstadt sowie in<br />
einem ländlich geprägten Gebiet durchgeführt.<br />
Für die weitere Auswertung der Studie wurde versucht, die stationären<br />
Kostenanteile entsprechenden ambulanten Kostenkomplexen<br />
gegenüberzustellen:<br />
a) Teilhabeleistungen:<br />
> stationär: Maßnahmepauschale<br />
> ambulant: Leistungen der ambulanten Eingliederungshilfe<br />
b) bereich „leben“:<br />
> stationär: Grundpauschale, Barbetrag, Bekleidungsbeihilfe<br />
> ambulant: Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherungsleistun gen<br />
c) bereich „wohnen“:<br />
> stationär: Investitionspauschale<br />
> ambulant: Kosten für Unterkunft/Heizung, evtl. Wohngeldleistun gen<br />
d) bereich Pflege:<br />
> stationär: Pauschale Kostenerstattung (nachrichtlich)<br />
> ambulant: Pflegesachleistungen<br />
Die Simulation der derzeit stationär erbrachten Leistungen in eine<br />
ambulante Versorgungsstruktur ergab, dass – über alle Sozialleistungsträger<br />
und alle erforderlichen Sozialleistungen hinweg – unter<br />
vorgenannten Grundannahmen eine Ambulantisierung der Behindertenhilfe<br />
über alle Hilfebedarfsgruppen hinweg nicht kostengünstiger<br />
wird. Dies heißt nicht, dass sich die Bilanz für einen einzelnen<br />
Sozialleistungsträger oder für bestimmte Teilbereiche oder in Bezug<br />
auf den Einzelfall kostenmäßig nicht positiv auswirken kann. aus einer<br />
volkswirtschaftlichen warte und in bezug auf alle sozialleistungsträger<br />
zeigt sich jedoch, dass die Grundsatzannahme<br />
der Kostenträger – ambulant ist billiger als stationär – so nicht<br />
ohne weiteres zutrifft. 1<br />
Selbstverständlich müssen diese rechnerischen Ergebnisse auf der<br />
Basis der in die Studie eingeflossenen Grundannahmen interpretiert<br />
und bewertet werden.<br />
1 Die konkreten Ergebnisse können in der Veröffentlichung der Contec Gesellschaft für<br />
Organisationsentwicklung mbH (Hrsg): „Wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung der<br />
Behindertenhilfe“, Bochum, 2007 nachgelesen werden.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 22
contec-Studie zur wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung der behindertenhilfe in bayern<br />
4. ZenTRALe eRGeBnISSe UnD BeWeRTUnG<br />
Die rechnerischen Ergebnisse sind an dieser Stelle eher von untergeordneter<br />
Bedeutung. Von weit größerem Interesse ist die inhaltliche Bewertung<br />
der Ergebnisse und deren Gehalt für die weitere Diskussion.<br />
Die in der Studie dargestellten Ergebnisse sind, wie bereits oben erwähnt,<br />
in hohem Maße den ihr zugrunde liegenden Grundannahmen<br />
und Thesen, hier vor allem der Ambulantisierungsstrategie – eine<br />
vollständige Überführung des bisherigen stationären Systems in ambulante<br />
Versorgungsstrukturen sowie Einzelwohnen – geschuldet.<br />
Diese beiden Aspekte haben selbstverständlich in den finanziellen<br />
Auswirkungen massive Konsequenzen. Aber bereits an dieser Stelle<br />
wird deutlich, dass maßgeblich für qualifizierte Aussagen über eine<br />
mögliche Kostenbilanz von Ambulantisierungsmaßnahmen eine inhaltliche<br />
Auseinandersetzung über eine Ambulantisierungsstrategie und<br />
die damit verbundenen mittel und langfristigen Konsequenzen ist.<br />
Erst wenn inhaltliche und strukturelle Grundentscheidungen getroffen<br />
sind, ist eine belastbare volkswirtschaftliche Berechnung der Konsequenzen<br />
möglich.<br />
Folglich ist es erforderlich, die in der Studie zugrunde gelegten Grundannahmen<br />
des Einzelwohnens (z.B. mit Blick auf Themen wie nächtliche<br />
Versorgung, Personaleinsatz, u.ä.), der Frage des tatsächlichen<br />
ambulanten Hilfebedarfs (bezogen auf alle im Einzelfall erforderlichen<br />
Lebensbereiche), eine eventuell von der Zielsetzung der Leistung abhängige<br />
notwendige hilfeleistungsbezogenen Differenzierung des<br />
Personaleinsatzes im ambulanten Bereich, die Nutzung von Synergieeffekten<br />
im ambulanten Bereich, etc. inhaltlich zu diskutieren.<br />
Jede Veränderung einer der in Frage stehenden Grundannahmen führt<br />
in der Folge zu einer Veränderung der Kostenbilanz der Ambulantisierungsmaßnahmen<br />
in der Behindertenhilfe. Hierbei sind nicht nur die<br />
jeweiligen Auswirkungen auf alle Sozialleistungsträger zu berücksichtigen,<br />
sondern auch die inhaltlichen, strukturellen und finanziellen<br />
Konsequenzen für das verbleibende stationäre System. Nur<br />
über einen solchen Weg können Aussagen für das System Behin<br />
dertenhilfe getroffen werden. Sind die wesentlichen inhaltlichen und<br />
strategischen Fragestellungen nicht beantwortet, greift eine auf Einzelaspekte<br />
reduzierte Kostenbetrachtung zu kurz.<br />
Zahlreiche Aspekte, die im Rahmen einer grundlegenden Studie zu<br />
den Auswirkungen einer Ambulantisierung des Systems Behindertenhilfe<br />
berücksichtigt werden müssten, konnten in dieser Studie<br />
nicht berücksichtigt werden. Exemplarisch sind dies u.a. folgende<br />
Aspekte:<br />
> Nicht berücksichtigt werden konnten die Rückwirkungen einer<br />
Ambulantisierung nur bestimmter Personengruppen auf das weiterhin<br />
bestehende stationäre System.<br />
> Daneben wurden im Rahmen der Kostenbilanz noch nicht alle<br />
notwendigen finanziellen Aspekte in ausreichender Weise berücksichtigt,<br />
um eine vollständige Kostenbilanz erstellen zu können.<br />
> Es wurden keine Erhebungen des tatsächlichen ambulanten Bedarfs<br />
vorgenommen.<br />
> Gleichzeitig wurde die Frage einer möglichen Veränderung des<br />
Hilfebedarfs ambulant versorgter Menschen nicht berücksichtigt,<br />
was nur im Rahmen einer Langschnittstudie möglich gewesen<br />
wäre.<br />
> Keine Aussagen waren darüber möglich, ob die derzeitige stationäre<br />
Ausstattung inhaltlich und finanziell hinreichend ist.<br />
> Des weiteren muss berücksichtigt werden, dass die Studie nicht repräsentativ<br />
ist, sondern nur eine Möglichkeit der Annäherung an<br />
die Frage der finanziellen Auswirkungen von Ambulantisierungsmaßnahmen<br />
darstellt. Die Stichprobe der Studie bildet zwar die<br />
prozentuale Verteilung der Hilfebedarfsgruppen in stationären<br />
Einrichtungen in Bayern ab, ist allerdings für repräsentative Aussagen<br />
zu klein.<br />
Aus der Studie ergeben sich zahlreiche Bereiche, die mit Blick auf das<br />
Thema Ambulantisierung von Hilfen in der Behindertenhilfe inhaltlich<br />
diskutiert werden müssten.<br />
5. konSeqUenZen FüR DIe WeITeRe DISkUSSIon<br />
rEFErAtE<br />
Welche Schlüsse können nun aus der vorgelegten Studie gezogen<br />
werden? Grundsätzlich kann das Resümee gezogen werden, dass die<br />
Frage der Kostenbilanz der Ambulantisierung von Leistungen der Behindertenhilfe<br />
nicht ausschließlich aus einem fiskalischen Blickwinkel<br />
beantwortet werden kann. Die Kostenvergleichsberechnungen sind<br />
immer abhängig von inhaltlichen Entscheidungen, die zwischen den<br />
beteiligten Akteuren ausgehandelt werden müssen.<br />
> Im Rahmen der Studie wurde deutlich, dass der verkürzte Kostenvergleich<br />
zwischen stationären und ambulanten Versorgungsformen,<br />
der bislang häufig die Kostendiskussion prägt, zu kurz<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 23
contec-Studie zur wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung der behindertenhilfe in bayern<br />
greift. Qualifizierte Aussagen zu einer Kostenbilanz können nur<br />
aus einem volkswirtschaftlichen Blickwinkel vorgenommen<br />
werden.<br />
> Das Kostenargument muss an dieser Stelle hinter eine zwingend<br />
erforderliche Diskussion über die ambulantisierungsstrategie<br />
(z.B. Welche Personengruppen sollen ambulantisiert werden?)<br />
und die damit verbundenen inhaltlichen und strukturellen<br />
rahmenbedingungen (Bis zu welchem zeitlichen Umfang wird<br />
eine ambulante Versorgung genehmigt? Welche ambulanten<br />
Wohnformen sollen angeboten werden? etc.) zurücktreten.<br />
> Gleichzeitig muss in der Diskussion berücksichtigt werden, dass<br />
die Frage der Ambulantisierung von Hilfen nicht nur auf die Frage<br />
des Wohnens reduziert werden kann, sondern dass i.d.R. weitere<br />
Teilhabe und Integrationsleistungen hinzu kommen müssen,<br />
wenn Ambulantisierung ernst genommen wird und gelingen soll.<br />
> Diskutiert und bewertet werden müssen in diesem Zusammenhang<br />
aber auch die inhaltlichen, strukturellen und finanziellen<br />
der gewählten Ambulantisierungsstrategie auf den stationären<br />
Bereich und die in ihm verbleibenden Personen.<br />
> Für eine gelingende Ambulantisierung der Leistungen der Behindertenhilfe<br />
müssen die infrastrukturellen voraussetzungen<br />
geschaffen werden. Dies erfordert neben den grundsätzlichen<br />
inhaltlichen Entscheidungen auch die Bereitschaft, in den Aufbau<br />
dieser Infrastrukturen zu investieren.<br />
Wie bereits zu Anfang erwähnt, ist der Ausgangspunkt der Studie<br />
die in gewisser Weise festgefahrene Situation in Bayern im Jahr<br />
2006. Die Ergebnisse der Studie sind hiermit vor diesem Hintergrund<br />
zu sehen. Heute im Jahr 2008 stellt sich die Situation in Bayern an<br />
einigen Stellen durchaus deutlich verändert dar. Seit 01.01.2008<br />
wurde durch die Änderung des Bayerischen Ausführungsgesetzes<br />
zum Sozial gesetzbuch XII die Kostenträgerschaft für die Eingliede<br />
rungshilfe vereinheitlicht und auf der Ebene der überörtlichen Sozialhilfeträger<br />
zusammengeführt. Hierdurch konnte ein hemmender<br />
Aspekt beim Ausbau Ambulant Unterstützen Wohnens, nämlich die<br />
widerstreben den Interessen der verschiedenen Sozialhilfeträger in<br />
Bezug auf den Ausbau dieses Leistungsangebots, beseitigt werden.<br />
Landesweite Verhandlungen um die Rahmenbedingungen ambulanter<br />
Versorgung wurden aufgenommen. Der Hauptausschuss des<br />
Verbands der bayerischen Bezirke als Zusammenschluss der überörtlichen<br />
Träger der Sozialhilfe in Bayern hat im vergangenen Herbst eine<br />
vielbeachtete Resolution verabschiedet, die konstatiert, dass Menschen<br />
mit Behinderung eigenständig, alleine oder in Wohngemeinschaften<br />
leben können, wenn sie geeignete ambulante Leistungen<br />
der Eingliederungshilfe erhalten und notwendige Rahmenbedingungen<br />
für Krisenbewältigung, Angebot für Freizeitgestaltung und Tagesstrukturierung<br />
und Integration in das soziale Umfeld vorhanden sind.<br />
Damit anerkennen die Sozialhilfeträger zwischenzeitlich auch öffentlich,<br />
dass beim Ausbau der Angebote des Ambulant Unterstützten<br />
rEFErAtE<br />
Wohnens auch weitergehende Hilfen über die eigentliche Unterstützung<br />
in der Wohnung hinaus erforderlich sind, wenn Ambulantisierungsmaßnahmen<br />
langfristig gelingen sollen.<br />
Hintergrund der Studie war es, für Bayern neue Impulse in der Ambulantisierungsdiskussion<br />
zu setzen. Ziel der Auftraggeber war es, über<br />
diesen Weg die einseitige Kostendiskussion zu verlassen und wieder<br />
zu einer inhaltlichen Diskussion um die Rahmenbedingungen und<br />
Ausgestaltung der Ambulantisierung von Hilfen in der Behindertenhilfe<br />
zurückzukommen. Seit der Veröffentlichung der Studienergebnisse<br />
wurde an verschiedenen Stellen kontrovers über die Anlage<br />
der Studie, ihre Grundannahmen und natürlich ihre Ergebnisse diskutiert.<br />
Somit kann man zu de Schluss kommen, dass die Studie bei<br />
allen Unzu länglichkeiten und der zum Teil berechtigten Kritik an der<br />
Anlage und Ausgestaltung eines der zentralen Ziele erreicht hat: eine<br />
(erneute) vermehrt inhaltliche Diskussion über die Inhalte und Strukturen<br />
ambulanter Leistungen der Behindertenhilfe.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 24
Häuser … Thailändisches Haus<br />
Gabi hentschel, 47 Jahre<br />
Für Frau Hentschel war wichtig, dass sie es möglichst immer warm hat,<br />
an dem Ort, an dem sie leben möchte. Sie hält sich gern im Freien auf.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 25
telematische Hilfen zur Eingliederung und Autonomieförderung (tHEA)<br />
1. TecHnIScHe HILFen UnD SoZIALe ARBeIT<br />
In der sozialen Arbeit hält die Telematik bisher vergleichsweise langsam<br />
Einzug. Dabei kann sie auch dort einen hohen Nutzen stiften.<br />
Der Begriff „Telematik“ ist zusammengesetzt aus „Telekommunikation“<br />
und „Informatik“. Erstmalig aufgeworfen wurde er im Jahr 1978 von<br />
Nora und Minc1 . Die beiden Franzosen sprechen seinerzeit in ihrem<br />
Bericht an den französischen Präsidenten von einer „wachsenden Verflechtung<br />
von Rechnern und Telekommunikationsmitteln, [...] die einen<br />
völlig neuen Horizont eröffnet“.<br />
Bereiche, in denen telematische Lösungen vorrangig eingesetzt werden<br />
sind folgende:<br />
> Verkehrstelematik (Fahrzeuginformations und Navigatonssysteme,<br />
Verkehrsmanagementysteme und zentralen, Verkehrslenkung,<br />
Mautsysteme)<br />
> Gebäudeautomatisierung (Facility Management), ECommerce<br />
> Gesundheitstelematik/Telemedizin (EHealth), Bildungstelematik<br />
(Elearning), Sicherheitstelematik<br />
Von Anbietern sozialer Dienstleistungen wird vielfach die Quadratur<br />
des Kreises erwartet: Die Anforderungen an die Leistungsqualität werden<br />
von den Kostenträgern und zuständigen Kontrollorganen immer<br />
strikter formuliert. Die Zahlungsbereitschaft der Kostenträger für<br />
qua litativ hochwertige Dienstleistungen nimmt hingegen tendenziell<br />
ab. Neben den Ansprüchen der Finanzierungsträger, Medizinischen<br />
Dienste, Heimaufsichten und Gesetzgeber ist das Sozialwesen durch<br />
einen verschärften Wettbewerb zwischen den Einrichtungen begleitet,<br />
der durch persönliche Budgets, HBGbezogene pauschalierte Entgelte,<br />
einen potenziellen Angebotsüberhang sowie durch verschärften<br />
Kostendruck bei sinkenden Einnahmen in Schwung gehalten wird.<br />
Eine Chance, die Zielkonflikte etwas zu minimieren, bieten telematische,<br />
sensortechnische und weitere ITLösungen. Der verstärkte<br />
Einsatz von (Informations)Technologien kann helfen, solche soziale<br />
Dienstleistungen zu rationalisieren und ggf. kostengünstiger herzustellen,<br />
die durch einen hohen Anteil an Warte und Wegezeiten,<br />
zeitlichen Friktionen und unwahrscheinlichen Leistungseintrittsrisiko<br />
1 Nora, Simon/Minc, Alain (1978): L‘informatisation de la société. Avec. Paris, Seuil<br />
tHoMAS rInKLAKE ist Diplom Soziologe und Mitarbeiter der unternehmensberatung<br />
xit GmbH forschung.planung.beratung, nürnberg.<br />
Das Modellprojekt „tHEA“ zeigt, wie für Menschen mit behinderungen neue Autonomie-<br />
und Sicherheitsgrade im Alltag stabilisiert werden können, wenn telematische Hilfen<br />
eine Möglichkeit zur Kommunikation mit professionellen und nicht professionellen Helfern<br />
anbieten.<br />
charakte ri siert sind. Entsprechende Technologien bieten hier nicht nur<br />
die Mög lichkeit, mit geringerem Personalaufwand eine gewünschte<br />
Versorgung zu garantieren, sondern können vor allem – bei kluger<br />
Konstruktion – auch die Qualitätsstruktur des Dienstleistungsangebotes<br />
aus Sicht des Klienten sogar verbessern.<br />
Bereits bekannt sind die Bilder von Pflegerobotern, die verschiedentlich<br />
als die Lösungen eines zu erwartenden „Pflegenotstands“ bezeichnet<br />
werden. Was Pflegerobotern jedoch fehlt, ist die emotionale Intelligenz<br />
und die Qualität menschlicher Beziehungen. Die künstliche Robbe<br />
„Paro“, die auf Zuwendung reagiert und diese auch einfordert, ist<br />
ein Versuch, Emotionalität technisch zu vermitteln. Eine ernsthafte<br />
Konkurrenz für den Menschen ist „Paro“ jedoch nicht. Allerdings soll<br />
„Paro“ das auch gar nicht sein. Vielmehr soll das Haustier ersetzt<br />
werden, um das sich im Alter ggf. nicht mehr gekümmert werden<br />
kann oder das aus hygienischen Gründen im Krankenhaus nicht sein<br />
darf. Hier kommt Technik sinnvoll zum Einsatz, ohne dass die Rolle<br />
des Menschen geschmälert oder gar ersetzt werden soll.<br />
Das Modellprojekt THEA ist beispielhaft für die Erprobung des sinnvollen<br />
Einsatzes telematischer Lösungen in der Behindertenhilfe, die<br />
Sicherheit bieten und den zwischenmenschlichen Kontakt durch Technik<br />
unterstützen.<br />
2. PRojekTHInTeRGRUnD UnD PRojekTIon<br />
rEFErAtE<br />
Telematische Hilfen zur eingliederung und Autonomieförderung (THeA) von Thomas Rinklake<br />
4<br />
2.1. Der nutzen telematischer Angebote in der Behindertenhilfe<br />
Die deutsche Landschaft der Behindertenhilfe ist in Bewegung. Es<br />
gibt Grund zu der Annahme, dass die Behindertenhilfe in 20 Jahren<br />
vom heutigen Standpunkt aus praktisch nicht wiedererkennbar ist.<br />
Kennzeichen und Stichworte dieser Umwälzungen sind folgende Aspekte<br />
der aktuellen sozialpolitischen Diskussion:<br />
> Zukunft der Eingliederungshilfe<br />
> Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe<br />
> Menschen mit Behinderung als Experten in eigener Sache<br />
> mehr Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung<br />
> Maximierung der Planungsfreiheit<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 26
telematische Hilfen zur Eingliederung und Autonomieförderung (tHEA)<br />
> Autonomie bei Vereinbarung und Verwendung benötigter<br />
Hilfeleistungen<br />
> Individualisierung der Leistungserbringung und Bedarfsdeckung<br />
durch persönliche Budgets<br />
> zukünftig möglicher Fachkräftemangel in der Behindertenhilfe<br />
> „ambulant vor stationär“<br />
> „Daheim statt Heim“<br />
> private Anbieter<br />
> neue Mixes auf Anbieterseite<br />
Auf der Leistungserbringerseite stellen die krassen Unterschiede der<br />
Finanzierungssicherheit stationärer und ambulanter Angebote ein<br />
Hindernis dar. Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen<br />
hatten bisher angesichts dieser Bedingungen häufig keine echte<br />
Wahlmöglichkeit zwischen ambulanten und stationären Leistungen.<br />
Der gesetzliche Vorrang ambulanter Leistungen geht daher wegen<br />
fehlender, ungesicherter oder unzureichender Angebote weitgehend<br />
ins Leere. Telematische Hilfen könnten in diesem Zusammenhang einen<br />
Beitrag leisten, ambulante Formen der Leistungserbringung voranzutreiben.<br />
Besonderen Schwung erhält die sozialpolitische Reise der Behindertenhilfe<br />
durch die demographische Entwicklung der Menschen mit<br />
Behinderungen. 2 Die demographische Datenbasis in der Behindertenhilfe<br />
ist deutlich dünner als für die Gesamtbevölkerung, da die amtliche<br />
Statistik z. T. nicht die Grundlagen für Vorausberechnungen liefert.<br />
Anhaltspunkte liefern Zahlen aus dem Schulwesen, den Werkstätten<br />
für Menschen mit Behinderungen (WfbM), den Integrationsämtern<br />
oder Angaben von den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe.<br />
Konsens besteht in der Frage, dass die Fallzahlen der Eingliederungshilfe<br />
zumindest mittelfristig zunehmen werden. 3<br />
Als Gründe für den zu erwartenden Anstieg des Bedarfs und der<br />
Zunahme der Fallzahlen sind vor allem der medizinische Fortschritt<br />
sowie eine verbesserte Pflege, Betreuung und Förderung zu nennen.<br />
Die Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung ist deutlich<br />
gestiegen und erstmals erreicht eine ganze Generation mit angeborener<br />
bzw. erworbener Behinderung das Rentenalter. Neben einer<br />
zahlenmäßigen Zunahme der Menschen mit Behinderung ist es somit<br />
auch und vor allem die sich verändernde Altersstruktur, die die Behindertenhilfe<br />
vor neue Herausforderungen stellt.<br />
Die skizzierten Eckpunkte der sozialpolitischen Diskussion und die<br />
demographischen Entwicklungen in der Behindertenhilfe münden<br />
nicht zuletzt in einem zunehmenden Kostendruck. Während die Zahlungsbereitschaft<br />
der Kostenträger tendenziell abnimmt, nimmt die<br />
2 Komp, Elisabeth (2006): Sinnerfüllte Lebensphase Alter für Menschen mit Behinderung.<br />
Neuwied; Landesverband für Körper und Mehrfachbehinderte BadenWürttemberg<br />
e.V. (2006) „50plus – Menschen mit Behinderung im Alter“ – Verantwortung und<br />
Perspektive für die Behindertenhilfe und selbsthilfe. Stuttgart<br />
3 Vgl.: Deutscher Verein (2007): Entwicklung der Fallzahlen in der Eingliederungshilfe.<br />
In: NDV Februar 2007, S. 33–44<br />
Zielgruppe gleichzeitig zu, ebenso wie der Wettbewerb um Klienten,<br />
die ihrerseits vermehrt über Wahlmöglichkeiten verfügen werden.<br />
Telematische Hilfe leisten in anderen Bereichen sozialer Dienstleistungen<br />
bereits einen Beitrag zur Gestaltung der gegenwärtigen und<br />
künftigen Herausforderungen (vgl. Abschnitt 2.2.). Es stellt sich die<br />
Frage, ob und wie auch die Behindertenhilfe von technischen Neuerungen<br />
und innovativen Betreuungskonzepten profitieren kann. Tele ma<br />
tische Hilfen verbreitern die Möglichkeiten der Kommunikation zwischen<br />
Kunden und Mitarbeitern4 und können, abhängig von den Bedürfnissen<br />
und Fähigkeiten der Kunden, aufgrund ihrer visuellen Komponente<br />
schriftlichen oder telefonischen Kontakten überlegen sein.<br />
2.2. Ausgangspunkt SoPHIA<br />
rEFErAtE<br />
SOPHIA steht für „Soziale Personenbetreuung – Hilfen im Alltag“<br />
und war in der Zeit von 2002 bis 2004 ein Modellprojekt zum Erhalt<br />
und zur Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen in und<br />
um Bamberg. Nach dem erfolgreichen Verlauf des Modellprojekts ist<br />
SOPHIA nun ein Verbund von mehreren Firmen, deren Gesellschaften<br />
hauptsächlich aus der Wohnungswirtschaft kommen.<br />
Ausgangspunkt des Projekts war die Frage, wie das Leben im Alter<br />
durch technische Lösungen sinnvoll unterstützt werden kann, um<br />
den Verbleib in der eigenen Wohnung möglichst lange zu gewährleisten.<br />
Jeder Mensch hat das wohlbegründete Bedürfnis, sein Leben selbstbestimmt<br />
und sicher in den vertrauten vier Wänden zu gestalten.<br />
Oftmals genügt jedoch bereits eine kleine Veränderung und plötzlich<br />
sind verschiedene Dinge des Alltags nicht mehr zu bewältigen.<br />
Eine Stufe wird zum Hindernis, der Einkauf zur Strapaze oder die<br />
Wohnung zum Gefängnis. SOPHIA soll in diesem Zusammenhang<br />
Sicherheit bieten, und vor allem auch Teilhabe am sozialen Leben<br />
ermöglichen.<br />
Eine zentrale Säule von SOPHIA ist die Möglichkeit zur Bildkommunikation<br />
mit einer rund um die Uhr erreichbaren Servicezentrale über<br />
das eigene Fernsehgerät.<br />
4 Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche<br />
Form verwendet. Es sind jedoch stets beide Geschlechter gemeint.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 27
telematische Hilfen zur Eingliederung und Autonomieförderung (tHEA)<br />
Die technischen Voraussetzungen belaufen sich dabei auf eine hochwertige<br />
Webcam, einen Fernseher, externe Lautsprecher, ein USB<br />
Richtmikrofon und ein StandardBooksize PC mit Modem. Die intuitive<br />
Bedienbarkeit des Systems erfolgt über eine seniorengerechte<br />
InfrarotFernbedienung, die ohne Bedienungsanleitung und Vorkenntnis<br />
bedient werden kann.<br />
SOPHIA bedeutet jedoch nicht einfach „nur“ BildKommunikation.<br />
Die Bildkommunikation ist vielmehr in ein Gesamtbetreuungskonzept<br />
eingebettet. SOPHIA geht den Teilnehmern bei alltäglichen Aufgaben<br />
zur Hand, die schwer fallen oder lästig sind. Ein Anruf bei der<br />
Servicezentrale genügt und ein starkes Netzwerk aus professionellen<br />
und ehrenamtlichen Dienstleistern kümmert sich um Einkaufsservice,<br />
Putzhilfe, Handwerker etc. SOPHIA ist dabei immer nur so nah, wie<br />
es gewünscht wird. Es werden nur die Arbeiten abgenommen, die<br />
selbst ausgewählt wurden. Die Teilnehmer können sich ihre Unabhängigkeit<br />
bewahren. Die Servicezentrale wird in der Zeit von 9 bis<br />
18 Uhr von Ehrenamtlichen betrieben, die in Form von Paten für die<br />
SOPHIAKunden zur Verfügung stehen. Nach 18 Uhr übernimmt der<br />
ArbeiterSamariter Bund in Köln die Servicezentrale und steht für<br />
Notfälle zur Verfügung.<br />
Die Paten führen mit den Teilnehmern Gespräche, nehmen Erinnerungsanrufe<br />
vor, vermitteln die genannten Dienstleistungen oder<br />
einmalige Hilfen, geben verschiedenste Informationen und machen<br />
auch schon mal am Bildschirm bei Gymnastikübungen mit. Darüber<br />
hinaus helfen die Paten auch bei den jährlich stattfindenden Teilnehmertreffen<br />
mit.<br />
Über SOPHIA können die Nutzer jedoch nicht nur mit der Servicezentrale<br />
kommunizieren, sondern auch jederzeit mit anderen SOPHIA<br />
Kunden oder Freunden und Angehörigen, die vom heimischen PC<br />
aus an SOPHIA teilnehmen. Sie erhalten die dazu erforderliche Software<br />
zur Selbstinstallation.<br />
Neben der Bildkommunikation mit der Servicezentrale und weiteren<br />
SOPHIATeilnehmern, bildet ein Sicherheitspaket eine weitere Säule<br />
des SOPHIAKonzepts. Das Sicherheitspaket besteht aus einem Armband<br />
und einer Basisstation sowie einem optionalen Adapter zur Anbindung<br />
von haus und sicherheitstechnischen Systemen.<br />
Der Erfolg und der Nutzen des SOPHIAKonzepts wurden nicht zuletzt<br />
durch die Teilnehmerzahlen widergespiegelt. Deutschlandweit<br />
nehmen inzwischen über 800 Personen teil. SOPHIA stellt sowohl<br />
die technische als auch die konzeptionelle Grundlage für das Modellprojekt<br />
THEA dar.<br />
3. DAS MoDeLLPRojekT THeA<br />
3.1. Projektkonzeption<br />
Auftraggeber des Projekts THEA war die Fachabteilung Behindertenhilfe<br />
der Diakonie Neuendettelsau, die April bis September 2007<br />
gemeinsam mit verschiedenen Partnern den Einsatz telematischer<br />
Hilfen bei Menschen mit Behinderung in fünf stationären Wohnbereichen<br />
der Region Obernzenn/Rothenburg erprobt hat. Externe Partner<br />
waren die SOPHIA GmbH & Co. KG, die das technische Wissen<br />
und einen wertvollen Erfahrungsschatz aus der Praxis der Altenhilfe<br />
liefern konnten. Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation von<br />
THEA erfolgte durch die xit GmbH forschen.planen.beraten und die<br />
Katholische Universität EichstättIngolstadt.<br />
Kernstück von des Projekts war in einem ersten Schritt die Möglichkeit<br />
zur Bildschirmkommunikation der teilnehmenden Kunden bzw.<br />
der Wohnbereiche mit einer von Ehrenamtlichen betriebenen Servicezentrale<br />
zu Zeiten, die von den Kunden vorrangig selbständig,<br />
ohne unmittelbaren Kontakt zu einer begleitenden Person, gestaltet<br />
wurden. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, dass die Bewohner<br />
verschiedener teilnehmender Wohngruppen untereinander kommunizieren.<br />
Der angenommene praktische Nutzen von THEA wird in den in Tabelle 1<br />
skizzierten Dimensionen deutlich.<br />
Tabelle 1: nutzen von Thea<br />
1 alltagsmanagement<br />
Unterstützung diverser Handlungen und Hilfe beim<br />
Treffen von Entscheidungen. Kunden können an<br />
wichtige Handlungen erinnert werden (Einnahme von<br />
Medikamenten, Termine, Ernährung usw.) bzw.<br />
zum selbständigen Handeln motiviert und in ihrer<br />
Selbstkontrolle unterstützt werden.<br />
2 soziale Kontakte Sicherung sozialer Kontakte auch außerhalb regulärer<br />
Betreuungszeiten. Kunden werden regelmäßig und<br />
zuverlässig angerufen. Ebenso besteht die Möglichkeit,<br />
situativ und spontan den Kontakt zu suchen, insbesondere<br />
auch zu befreundeten Bewohnern anderer<br />
Wohngruppen, die an THEA teilnehmen. Dies hilft<br />
Isolation und Ausgrenzung zu vermeiden. Ebenso kann<br />
die Kontaktaufnahme zu anderen Bezugspersonen<br />
oder Leistungserbringern angeregt oder auch gelenkt<br />
werden. Bei entsprechender Qualifikation der Bezugsperson<br />
sind auf dem Weg telematischer Hilfe auch<br />
psychosoziale Begleitung möglich.<br />
3 Konfliktmanagement<br />
Möglichkeit, in Konfliktsituationen einzugreifen. Die<br />
Situation kann durch visuellen Kontakt besser eingeschätzt<br />
werden. Die Bezugsperson kann helfen die<br />
Situation zu klären, zu beruhigen, zu schlichten,<br />
verbale Hilfestellung zur Konfliktlösung geben oder<br />
weiterführende Maßnahmen einleiten.<br />
4 sicherheit Telematische Hilfen helfen Sicherheit herzustellen. Durch<br />
den visuellen Kontakt können die aktuelle Befindlichkeit<br />
und Situation des Kunden besser eingeschätzt und<br />
Risikopotentiale erfasst werden.<br />
5 Informationen Der Kunde hat die Möglichkeit Informationen abzufragen<br />
und solche, die für ihn regelmäßig von Bedeutung sind,<br />
zuverlässig zu erhalten.<br />
6 entwicklungsbegleitende<br />
maßnahmen<br />
rEFErAtE<br />
Telematische Hilfen unterstützen die Durchführung<br />
entwicklungsbegleitender Maßnahmen, die keinen<br />
direkten persönlichen Kontakt erfordern.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 28
telematische Hilfen zur Eingliederung und Autonomieförderung (tHEA)<br />
Folgende mögliche Angebotspakete wurden formuliert:<br />
Tabelle 2: angebotspakete<br />
a > Anruf der Servicemitarbeiter beim Kunden (Kontakt, Information, Beratung,<br />
psychosoziale Begleitung, Lernprozesse)<br />
> Entwicklung von Patenschaften<br />
> Möglichkeit für den Kunden im Notfall Kontakt aufzunehmen<br />
b > Aktiver Anruf durch den Kunden (Kontakt, Information, Beratung,<br />
psychosoziale Begleitung, Lernprozesse)<br />
> Kontakt zwischen Kunden<br />
c > A und B<br />
> Zusatzfunktion 1: Menü mit „links“ zu diversen Informationen<br />
d > A und B / optional C<br />
> Zusatzfunktion 2: Armband (Vitalfunktionen, Alarm)<br />
Insbesondere die Angebotsvarianten A und B sollten im Rahmen des<br />
Modellprojekts erprobt werden. Den Schwerpunkt bildete der planmäßige<br />
Anruf der Bezugsperson in der Servicezentrale beim Kunden<br />
(Variante A). Die bevorzugte Anwendung dieser Variante versprach,<br />
insbesondere bei eingeschränkten Projektressourcen in der<br />
Modellphase, ein Höchstmaß an Kontinuität und Verbindlichkeit. Die<br />
Anwendung telematischer Hilfen kann somit für die Anwender am<br />
ehesten zur Normalität werden und die Leistungserbringung durch<br />
THEA kann auf diesem Wege am besten gesteuert werden.<br />
3.2. Technik<br />
Aufgrund des Kostendrucks wurde vom Auftraggeber entschieden,<br />
die teilnehmenden Wohngruppen an das bestehende SOPHIA System<br />
in Bamberg anzuschließen. Eine Betreuung durch SOPHIA, die<br />
über technische Aspekte hinausgeht, war nicht vorgesehen. So bildete<br />
man mit dem THEANutzerkreis ein eigenes SOPHIASubsystem,<br />
das neben dem System der SOPHIANutzer bestand.<br />
Das System selbst wurde gegenüber dem SOPHIASystem für Senioren<br />
nicht geändert. Ziel war es, zu testen, ob Menschen mit Behinderung<br />
genauso gut mit dem System zurechtkommen wie dies<br />
Senioren in einem Alter von mehr als 80 Jahren tun.<br />
Das Videokommunikationssystem wurde ursprünglich so eingerichtet,<br />
dass alle Nutzer untereinander kommunizieren konnten. Im<br />
Nachhinein wurden die Telefonbücher der einzelnen Nutzer(gruppen)<br />
an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst.<br />
Das Konzept, keine eigene technische Zentrale zu installieren, war<br />
auf Grund der sonst entstehenden Investitionskosten vernünftig. Ein<br />
daraus resultierendes Problem war, dass mehrere gleichzeitig eingehende<br />
Anrufe in der THEAZentrale nicht auf mehrere Plätze verteilt<br />
werden konnten, wie es in der vollständigen SOPHIAZentrale der<br />
Fall ist.<br />
rEFErAtE<br />
3.3. Teilnehmer<br />
Der Einsatz telematischer Hilfen sollte einem differenzierten Personenkreis<br />
(Fähigkeiten im Bereich der Kommunikation, Wohnsituation,<br />
Technikinteresse) zur Erprobung angeboten werden. Bei der Auswahl<br />
der teilnehmenden Wohnbereiche erschien es zweckmäßig, solche Bereiche<br />
zu nehmen, in denen während der Betriebszeiten der THEA<br />
Servicezentrale direkte Begleitung durch Mitarbeiter nicht bzw. eingeschränkt<br />
zur Verfügung steht und die Kunden die Zeit selbständig,<br />
ohne unmittelbaren Kontakt zu einer begleitenden Person, gestalten.<br />
Insgesamt haben 31 Kunden aktiv an THEA teilgenommen. Hinzu<br />
kamen insgesamt 11 passive Teilnehmer. „Aktiv“ bedeutet, dass die<br />
Teilnehmer gezielt von der Servicezentrale angerufen wurden und<br />
auch selbst Anrufe vornehmen können. „Passiv“ bezieht sich dagegen<br />
auf die Kunden, die nicht unmittelbar an THEA teilnehmen, da<br />
sie dazu aus verschiedenen Gründen (Technikverständnis, Artikulationsfähigkeit<br />
etc.) nicht in der Lage sind. Diese „passiven“ Kunden<br />
wurden jedoch nicht von THEA ausgeschlossen, sondern bekamen<br />
im Projektverlauf auch die Gelegenheit, in die Nutzung von THEA<br />
einzublicken. Die Evaluation des Projektverlaufs bezieht sich auf die<br />
im Mittelpunkt stehenden aktiven Nutzer, die auch Projekt begleitend<br />
zu ihren Erfahrungen mit THEA befragt wurden.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 29
telematische Hilfen zur eingliederung und autonomieförderung (tHea)<br />
3.4. Servicezentrale<br />
Die THEA-Servicezentrale bestand aus acht ehrenamtlichen Mitarbeitern<br />
und einer hauptamtlichen Kraft. Die Zentrale wurde an drei und<br />
zum Projektende hin an fünf Wochentagen in der Zeit von ca. 18 bis<br />
22 Uhr betrieben. Ein darüber hinaus gehender Betrieb war vor dem<br />
Hintergrund der personellen Ressourcen nicht möglich.<br />
4. Evaluation<br />
Im Rahmen der Projektevaluation wurden sowohl die Teilnehmer, die<br />
Mitarbeiter in den Wohnbereichen und die Mitarbeiter der Servicezentrale<br />
befragt. Nachstehend finden Sie einige Ergebnisse der Evaluation.<br />
Die Mehrheit der Teilnehmer (60%) befand THEA nach eigener Aussage<br />
für gut. Die Teilnehmer, die THEA nur bedingt gut oder gar<br />
schlecht fanden waren Teilnehmer, die tendenziell einen größeren<br />
Unterstützungsbedarf haben und möglicherweise nicht die ideale<br />
Zielgruppe von THEA darstellten.<br />
Die Mitarbeiter der Servicezentrale haben am Projektende in gemeinsamer<br />
Runde erörtert, inwiefern THEA für die einzelnen Nutzer<br />
geeignet ist. Die Ergebnisse sind Abbildung 2 zu entnehmen.<br />
19,4<br />
19,4<br />
19,4<br />
6,5<br />
35,5<br />
voll und ganz geeignet<br />
eher gut geeignet<br />
teils, teils<br />
eher ungeeignet<br />
völlig ungeeignet<br />
Abbildung 2: Wie gut ist THEA für die einzelnen Teilnehmer<br />
geeignet? Einschätzung der Mitarbeiter der Servicezentrale (Angaben:<br />
Anteil der Teilnehmer in %)<br />
Die Mitarbeiter der Wohnbereiche würden anderen Wohnbereichen<br />
den Einsatz von THEA zu einem Drittel „eher“ oder “voll und ganz“<br />
weiterempfehlen. Ein weiteres Drittel spricht eine eingeschränkte<br />
Weiterempfehlung aus. Als Gründe für die Einschränkung wurden<br />
die Betriebszeiten und die begrenzte Integration in den Arbeitsalltag<br />
aus Mitarbeitersicht genannt. Der wichtigste genannte Grund war jedoch<br />
der, dass die Zielgruppe eher im ambulanten als im stationären<br />
Wohnbereich zu suchen sei.<br />
Neben den verschiedenen Einschätzungen der Projektbeteiligten gibt<br />
die Dokumentation der THEA-Kontakte weitere interessante Hinweise<br />
auf die Nutzung (vgl. Abbildung 3).<br />
Neben dem Top-Thema „Geplauder“ zeigen sich viele weitere Themen.<br />
Besonders interessant ist die Beratung in 18 Fällen und in<br />
weiteren vier Fällen die Unterstützung bei besonderen kritischen<br />
Ereignissen. THEA wurde nach einer Eingewöhnungsphase somit<br />
durchaus auch inhaltlich genutzt.<br />
Geplauder<br />
Abendveranstaltung<br />
Ausflüge/Reisen<br />
Allgemeines Tagesgeschehen<br />
Feiern/Festtage<br />
Arbeit<br />
THEA<br />
Andere Bewohner<br />
Beratung/Information<br />
Besondere Ereignisse<br />
Vorstellung<br />
Rückruf<br />
Begrüßung/Verabschiedung<br />
94<br />
86<br />
82<br />
63<br />
59<br />
58<br />
40<br />
18<br />
4<br />
32<br />
Abbildung 3: Gesprächsthemen der Kontakte zwischen Teilneh-<br />
mern und Servicezentrale<br />
Alle Teilnehmer standen in Kontakt mit der Servicezentrale. Zwei<br />
Drittel der Kontakte ging von der Servicezentrale aus. In einem Drittel<br />
der Gespräche haben die Teilnehmer die Initiative ergriffen.<br />
Von der zusätzlichen Möglichkeit, mit Teilnehmern anderer Wohnbereich<br />
Kontakt aufzunehmen, machten insgesamt 13 Teilnehmer<br />
Gebrauch. Die Frequenz ging dabei von täglichen bis hin zu seltenen<br />
punktuellen Kontakten.<br />
5. ZEntralE ErkEnntniSSE Zur WEitErEntWicklung<br />
referate<br />
0 50 100 150 200 250 300 350<br />
Die Modellphase hat gezeigt, dass THEA von der Mehrheit der Teilnehmer<br />
gut genutzt wurde. Technische Entwicklungen sind nicht<br />
oder nur in geringem Umfang erforderlich. Die Bedienbarkeit des<br />
vorhandenen technischen Systems hat sich prinzipiell als unproblematisch<br />
heraus gestellt. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass die Ergänzung<br />
der Betreuung durch telematische Angebote für die Behindertenhilfe<br />
durchaus möglich und sinnvoll sein kann.<br />
Bei einer Projektfortführung müssten jedoch verschiedene konzeptionelle<br />
Anpassungen und Weiterentwicklungen vorgenommen werden.<br />
Diese Entwicklungsarbeiten beziehen sich auf die Bereiche Nutzerkreis,<br />
Nutzungssituation, Leistungsspektrum, Ehren- vs Hauptamt,<br />
Organisation/Ausstattung und Betrieb der Servicezentrale sowie die<br />
Einbeziehung von Interessensgruppen (Mitarbeiter, Angehörige, gesetzliche<br />
Betreuer usw.).<br />
89<br />
110<br />
294<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 30
telematische Hilfen zur Eingliederung und Autonomieförderung (tHEA)<br />
Das Thema der „hybriden Dienstleistungen“, in denen personale<br />
Dienstleistungen und technische Lösungen zu einer neuen, individualisierten<br />
Wertschöpfungskonfiguration verschmelzen, ist in der Sozialwirtschaft<br />
noch nicht angekommen. Hier bieten sich erhebliche<br />
Innovationspotenziale, und auch entsprechende „Pioniergewinne“.<br />
THEA „light“, wie es ausprobiert wurde, zeigt, dass es geht, zeigt<br />
aber auch, dass es so, wie es geht, nicht weit genug geht.<br />
Die Attraktivität eines THEA Produktes, und damit auch die Wertschöpfung<br />
aus Sicht des Klienten und des Unternehmens, verlangt<br />
die konzeptionelle Erweiterung von THEA.<br />
a. THEA müsste aus der SpielzeugEcke herausgeholt werden und in<br />
die Wertschöpfungsketten des Unternehmens integriert werden.<br />
An welcher Stelle in welchem Dienstleistungsprozess wird die<br />
Leistungsqualität verbessert? Wo lassen sich in den Leistungsprozessen<br />
durch THEA möglicherweise Kosten abbauen? Für welche<br />
THEATeilleistungen besteht Zahlungsbereitschaft?<br />
b. THEA stiftet offensichtlich für einzelne Klientengruppen unterschiedliche<br />
Nutzengewinne. Man müsste die THEAWirkungen<br />
sehr viel klientenspezifischer nachweisen und den Fokus eher auf<br />
Teilnehmer aus dem ambulanten Bereich richten.<br />
c. Eine Weiterführung von THEA müsste durch Workshops mit Mitarbeitern<br />
angetrieben werden, in denen die Technik so formatiert<br />
werden sollte, dass sie auch aus Mitarbeitersicht zu einem<br />
unterstützendem Tool werden kann, zu einer entlastenden und/<br />
oder qualitätsfördernden und/oder kostensparenden Variante im<br />
alltäglichen Arbeitsprozess.<br />
d. Der Zugriff auf THEA war zwar überraschend hoch, verlangt aber<br />
auf Dauer die Integration in ein „ContentSystem“, das für den<br />
einzelnen Klienten auch andere Informationsnutzen – wie z.B. ein<br />
Intranet – bietet. Die technische Basis dafür liegt bereits vor. Im<br />
Rahmen von SOPHIA wird es bereits entsprechend umgesetzt.<br />
e. THEA hat kritische Größen. Die Ehrenamtlichen in der Servicezentrale<br />
wollen etwas zu tun haben, wollen „traffic“, zu wenig Teilnehmer<br />
führen zu Enttäuschungen; (zu) viele Teilnehmer führen<br />
aber in der Konsequenz zu Stress und hohen Vorhaltekosten, die<br />
nicht unbedingt realisiert werden können. Insofern wird THEA als<br />
kleines Modell, auch angesichts der Investitionskosten, für einzige<br />
Wohngruppen nicht überlebensfähig sein, sondern verlangt eine<br />
andere Größenordnung. Hier allerdings bieten sich wahrscheinlich<br />
auch interessante Geschäftsmodelle an.<br />
f. Dieses Geschäftsmodell ist noch nicht ausgereift, weil die unterschiedlichen<br />
Nutzenwirkungen für verschiedene Klientengruppen<br />
angesichts der geringen Teilnehmerzahl nicht ausreichend valide<br />
beurteilt werden können. Außerdem, das zeigt THEA deutlich,<br />
muss THEA in die „normalen Geschäftsprozesse“ des Unternehmens<br />
integriert werden, um überhaupt seine Nutzenpotenziale<br />
entfalten zu können.<br />
6. AUSBLIck<br />
rEFErAtE<br />
Wir regen eine Überlegung für ein größeres Modellprojekt an, in<br />
dem die skizzierten THEAErweiterungen vorgenommen werden<br />
können und in dem die THEAEffekte, als integraler Bestandteil von<br />
Leistungsprozessen, klientenspezifischer gemessen werden können.<br />
Dazu möchten wir vor dem Hintergrund der gesammelten Erfahrungen<br />
mit interessierten Trägern und Anbietern eine gemeinsame<br />
Lösung für ein größeres Folgeprojekt suchen.<br />
Für Träger und Anbieter, die zwar prinzipiell interessiert sind, den<br />
unmittelbaren Sprung in den Praxistest jedoch scheuen, möchten<br />
wir einen „THEACheck“ entwickeln. Der „THEACheck“ soll als<br />
Entscheidungshilfe einen Beitrag dazu leisten, zu bestimmen, ob und<br />
in welchen Bereichen THEA in der Praxis einsetzbar wäre und welche<br />
Effekte zu erwarten sind.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 31
Häuser … Leuchtturm –<br />
am Atlantik<br />
leuchtturm – am atlantik,<br />
hans-Georg Klimmeck, 68 Jahre<br />
Herr Klimmeck wollte die weite See bei sich haben<br />
und gestaltete dann noch liebevoll<br />
verschiedenes praktisches Zubehör.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 32
Improvisationstheater berlin<br />
Die Gorillas Improvisationstheater <strong>Berlin</strong><br />
„Deine Phantasie ist nicht impotent, solange du nicht tot bist; du bist nur eingefroren.<br />
Schalte den verneinenden Intellekt aus und heiße das Unbewusste willkommen...“<br />
Keith Johnstone<br />
Erfinder des modernen<br />
Improvisationstheaters<br />
DIE GorILLAS<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 33
Improvisationstheater berlin<br />
„Hier ist der Zuschauer der wahre Regisseur“ schrieb die Welt am<br />
Sonntag ganz richtig über die Gorillas. Beim Improvisationstheater<br />
werden sämtliche Darstellungsformen wie Sprech, Bewegungs,<br />
oder Musiktheater in die Spielszenen einbezogen. Die Interaktion zwischen<br />
Publikum und Akteuren ist gewollt; die Zuschauer sind live dabei,<br />
wenn aus ihren Themenvorschlägen, Worten und Orten Geschichten<br />
auf der Bühne entstehen. Alle Szenen sind im wahrsten Sinne des<br />
Wortes einmalig, jeder Song ist ein Unikat und jede Show eine Premiere.<br />
Doch kann man zu Themen wie dem persönliche Budget überhaupt<br />
improvisieren und es unterhaltsam darstellen? Ja, man kann!<br />
„Impulse 2008 Wohnen mit Au(f)sicht“ setzten die Gorillas spontan<br />
mitreißend in Szene. Sie spielten und sangen, was das Publikum<br />
wollte. Improvisierten Wohnsituationen im Flur und in der Küche.<br />
Bildeten lustige und kluge Dialoge aus den Wortfetzen, die aus dem<br />
Publikum gerufen wurden.<br />
DIE GorILLAS<br />
Irrwitzig, lustig, erhellend – einmal ganz anders und immer ganz spontan,<br />
aus dem Stand heraus. Der Auftritt der Gorillas war ein kleiner<br />
Höhepunkt. Zeitlich gut gelegen, gleich nach der Pause, gut um wieder<br />
beim Thema und in der Tagung anzukommen. Als idealer Einstieg<br />
in die zweite Hälfte der Fachtagung. Entdecken Sie nun weiter, gemeinsam<br />
mit den Referenten, die Chancen, Risiken und Herausforderungen<br />
vielfältiger Wohn, Lebens und Betreuungsformen.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 34
Wünsche von Familienmitgliedern mit Behinderungserfahrung<br />
Heide BesucH (links), eltern beraten eltern e.V. und Judy GummicH (rechts), Projektleiterin<br />
„Lebensübergänge“ ebenfalls bei eltern beraten eltern e.V.<br />
NormalisieruNgspriNzip, iNtegrative WohNformeN,<br />
heterogeNität uNd vielfältige, soziale verNetzuNgeN<br />
Sohn: Ja klar möchte ich „ganz normal“ mit anderen jungen Leuten<br />
zusammen in der WG. wohnen. Alle arbeiten, studieren oder gehen<br />
zur Schule. Vielleicht fährt einer auch Moped oder Auto? – Mit den<br />
Leuten möchte ich etwas unternehmen, zum Billard gehen oder Partys<br />
feiern. Ich möchte in meinem Kiez bleiben, in dem ich groß geworden<br />
bin. Hier kennen mich viele Leute, die mich brauchen.<br />
Mal schnell rüber zu meinen Eltern, gucken, ob meine Mutter nicht<br />
traurig ist. Klasse wäre es, mit dem Bruder im Sommer zum Schwimmen<br />
zu gehen. – Unsere Leute aus der Kirchengemeinde sind auch<br />
so nett, da war ich in der Kita.<br />
Ich möchte ausprobieren, wie es mit dieser WG klappt oder ob es in<br />
einer gemischten WG besser geht? Meine Freundin bleibt dann über<br />
Nacht, das ist doch klar. Mein alter Klassenkamerad, mit dem Rolli muss<br />
dabei sein! Wenn wir etwas zusammen machen, lacht er immer.<br />
Wenn ich in der WG oder bei der Arbeit Stress habe, rufe ich meine<br />
Oma an und erzähle ihr alles oder sause mal eben zu meiner Familie.<br />
Einen Garten fände mein Vater schön, wichtiger fände ich aber die<br />
U-Bahn und viele Läden, in denen man rumstöbern kann.<br />
transparenz, zusammenarbeit, fließende Übergänge, zukunftswerkstatt<br />
Mutter: Immer dieses nicht Loslassen können, was uns da untergeschoben<br />
wird. Damit haben wir die Schuld, wenn es schwierig ist.<br />
– Dabei darf ich gar nicht loslassen. – Meine Elternpflicht ist, unsere<br />
Söhne und Töchter lebenslang zu begleiten. Wir sind das hoch motivierte<br />
und nachhaltigste Netzwerk unserer Kinder!<br />
Diese Ressource wollen wir einsetzen und nicht außen vor lassen. –<br />
Transparenz in den Lebenszusammenhängen des WG-Alltags gibt<br />
uns Sicherheit und Vertrauen. Wir wollen nicht nur ab und zu Besucher<br />
sein, sondern uns einbringen und ein Gefühl für das Leben unserer<br />
Kinder bekommen. Die Übergänge von zu Hause zur WG sollen<br />
fließen. Selbstbestimmung soll an erster Stelle stehen! Mal sind die<br />
jungen Leute in der WG, mal bei den Eltern. Kein Reglement durch<br />
Dienstpläne, sondern freie Wahlmöglichkeit.<br />
menschen mit Behinderung und ihre Familien wünschen sich inklusive Angebote in ihrem<br />
sozialen umfeld und erwarten von mitarbeitern eine Begegnung auf Augenhöhe.<br />
reFerAte<br />
Wünsche von familienmitgliedern mit Behinderungserfahrung von Heide Besuch<br />
5<br />
Wir Eltern, die jungen Leute und die Assistenten sind ein Team, das<br />
zusammen arbeitet, um für die individuellen Bedürfnisse der Bewohner<br />
Sorge zu tragen. Unser soziales Netzwerk kann bei jungen<br />
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, z.B. im Rahmen der<br />
Zukunftskonferenz, Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung begleiten.<br />
Durch alle Möglichkeiten des normalen Miteinanders nutzen wir<br />
die soziale Spiegelung, damit entsteht Solidarität und Sicherheit für<br />
unsere jungen Menschen.<br />
veränderung des Beziehungsfeldes: du bist oK!<br />
Tochter: Total komisch ist mir, wenn ich bei den WG-Besprechungen<br />
dabei bin. – Hier sitzt mein Bruder, da die Betreuer und Eltern. Furchtbar,<br />
wie er sich fühlen muss, wenn dann Dinge besprochen werden,<br />
die nicht klappen. Wir hier – Du da!<br />
Da wird sortiert, das macht ihn klein und ist sehr peinlich. – Ich würde<br />
mir das nicht gefallen lassen, er muss es aushalten? In einer normalen<br />
WG gäbe es solche Situationen gar nicht! Ich wünsche mir für Ihn,<br />
dass wir sehen, wo er richtig Klasse ist und das ihm auch uneingeschränkt<br />
zeigen. Du bist OK Bruder, und wir erziehen und therapieren<br />
nicht ewig an dir herum. Du darfst an den Herausforderungen<br />
auch mal scheitern. Wir trauen dir zu, dass du weißt, wie du es dann<br />
anders machen kannst.<br />
Kulturelle Werte<br />
Tante: Schwierig ist es, Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund<br />
achtsam zu erfassen. Da ist es möglicherweise undenkbar, Menschen<br />
mit Assistenzbedarf an einem anderen Ort als in der Familie zu<br />
pflegen. Wir brauchen für Familien mit Migrationshintergrund Entlastung,<br />
altersentsprechende Angebote und Weiterentwicklungsmöglichkeiten!<br />
sorge, machtmissbrauch, isolation<br />
Vater: Große Sorge macht uns die Isolation in Wohnstätten und WGs,<br />
in die unsere Söhne und Töchter mit Assistenzbedarf geraten können.<br />
Durch fehlende Außenperspektiven und Korrektive besteht die Möglichkeit,<br />
in einem Umfeld von ausschließlich professionell helfenden<br />
Menschen leben zu müssen, die das Zusammenleben bestimmen.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 35
Wünsche von familienmitgliedern mit Behinderungserfahrung<br />
Totale Abhängigkeiten von den Unterstützern können entstehen, die<br />
zu Verhaltensoriginalitäten, Ohnmachtsgefühlen und Überanpassung<br />
führen können. Geringe Entwicklungsmöglichkeiten verhindern die<br />
Persönlichkeitsreife. Es ist gefährlich, solche geschlossenen Systeme<br />
nicht zu hinterfragen! Wir brauchen die gemeinsame Verantwortung<br />
des sozialen Umfeldes und die Entwicklung des Community-Care-<br />
Gedankens, für eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung des<br />
unterstützten Wohnens mit einer permanenten Überprüfung der<br />
ethischen Ansprüche<br />
Gute Ideen werden gesucht, engagierte Menschen gebraucht, für<br />
den Paradigmenwechsel zum Normalisierungsprinzip der Inklusion!<br />
referate<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 36
Häuser... Einsam stehendes Haus<br />
– irgendwo in Deutschland<br />
Joachim hentschel, 63 Jahre<br />
Für Herrn Hentschel war es wichtig, Ruhe und Abgeschiedenheit zu haben;<br />
nur seine Frau – auf der Couch liegend – und er sollten dort wohnen.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 37
Mittendrin statt außen vor oder Mittendrin ist näher dran<br />
ALSTeRDoRF ASSISTenZ noRD GGMBH IM VeRBUnD DeR eV.<br />
STIFTUnG ALSTeRDoRF, HAMBURG<br />
Dezentrale Wohnangebote für Menschen mit hohem Assistenzbedarf<br />
wie z.B. bei nahezu allen stellvertretenden Tätigkeiten im Alltag,<br />
stark eingeschränkten Möglichkeiten zur verbalen Kommunikation,<br />
bei Pflege Tag und Nacht, bei der Umsetzung eines Unterbringungsbeschlusses,<br />
bei langjährigen Erfahrungen in stationären Einrichtungen<br />
Sechs Thesen vor dem Hintergrund des Einsatzes von (knapper werdenden)<br />
Ressourcen, der Nachfragen von Klienten, der Ablauforganisation<br />
und der Anforderungen an Mitarbeitende.<br />
These 1: Mittendrin ist näher dran<br />
> an den Assistenzbedarfen der Klienten<br />
> am Auftrag der sozialen Rehabilitation<br />
> an zukunftsfähigen Wohn und Arbeitsmöglichkeiten für Klienten<br />
und Mitarbeitende<br />
> an dezentralen und leitungsfähigen Strukturen von Organisationen<br />
These 2: Der Institution auf´s Dach zu steigen ermöglicht<br />
neue Perspektiven<br />
> Durchlässigkeit der Systeme schaffen<br />
> „Auswildern“ als integraler Bestandteil von Assistenzplanungen<br />
> attraktive Übergänge gestalten: stationäre – ambulantisierte <br />
ambulante Angebote, Wohnen im Appartement, SatellitenWohnungen,<br />
die ambulant betreute WG, die SeniorenWG, …<br />
These 3: Die Umsetzung hoher Assistenzbedarfe braucht<br />
organisatorisch schlanke Lösungen<br />
> gezielter Ressourceneinsatz: Assistenz setzt dort (und nur dort an),<br />
wo das Handicap des Menschen beginnt<br />
> Differenzierung der Leistungen in Grundassistenz und persönliche<br />
Assistenz<br />
> Übergreifende Einsätze von Mitarbeitenden in unterschiedlichen<br />
Assistenzangeboten – Tag und Nacht<br />
> Einsatz von Technik zum Schaffen von Freiräumen<br />
Dr. HEIDE VöLtz ist bereichsleiterin der alsterdorf assistenz nord gGmbH im Verbund<br />
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf.<br />
Dezentrale wohnangebote für Menschen mit hohen Assistenzbedarfen lassen sich auch<br />
vor dem Hintergrund knapper werdender ressourcen umsetzen. Dazu bedarf es maßgeschneiderter<br />
netzwerke im Stadtteil.<br />
These 4: Der Mensch wohnt nicht nur – Bildung und Beschäftigung<br />
für Menschen mit hohen Assistenzbedarfen<br />
> Wohnen und Arbeiten im Quartier<br />
> als Mensch mit Assistenzbedarf und in der Verantwortung für<br />
das Gemeinwohl sichtbar werden: Baumscheibenpflege, Objektpflege,<br />
Hausmeister, kleine Serviceangebote in der Nachbarschaft<br />
> Unterstützung zum Gelingen des Alltags aus der Nachbarschaft<br />
gewinnen<br />
These 5: Mittendrin ist gleich nebenan<br />
> Fachlichkeit und Professionalität bringen die Mitarbeitenden –<br />
Inte grationsfähigkeit bringen allein die Menschen in den Nach<br />
barschaften und im Stadtteil<br />
rEFErAtE<br />
Mittendrin statt außen vor oder Mittendrin ist näher dran von Dr. Heide Völtz<br />
6<br />
> Give and take: Freiwilligenarbeit gezielt andocken und selber<br />
anbieten<br />
> professionelle Sozialarbeit vernetzt sich mit den Akteuren im<br />
Stadtteil<br />
These 6: Damit es gelingt, brauchen wir Mitarbeitende, die ambulant<br />
denken und handeln<br />
> nicht der Ort, an dem Mitarbeitende tätig sind, oder die<br />
Assistenz bedarfe der Klienten zählen, sondern allein die Haltung<br />
und die Angebote, die daraus erwachsen<br />
> die Ambivalenz von Institutionsinteressen erkennen und konstruktiv<br />
gestalten<br />
> Mut zum Risiko, Übernahme von Verantwortung, ein hohes Maß<br />
an Selbstkenntis und „Selbstführung“ durch Fortbildung, kollegiale<br />
Beratung, Coaching und konkretem Tun<br />
> Führungskräfte, die dies ausdrücklich unterstützen, fordern und<br />
fördern<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 38
Häuser … Mecklenburgisches<br />
Haus<br />
hartmut hellge, 62 Jahre<br />
Herr Hellge wollte unbedingt in seinem Land bleiben<br />
und suchte nach einer möglichst schlichten Form.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 39
Das Persönliche budget im wohnheim am Stadtring<br />
Das Wohnheim am Stadtring ist eine stationäre Einrichtung des<br />
Stiftungsbereiches Behindertenhilfe der von Bodelschwingschen Anstalten<br />
Bethel mit 25 Plätzen, die sich aufteilen in drei Gruppen mit je<br />
vier Plätzen, 11 Apartments und einem Doppelapartment für Menschen<br />
mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen.<br />
In den Jahren 2003 bis 2007 erprobte unsere Einrichtung das persönliche<br />
Budget. Die erste Phase des Modellprojekts PerLe dauerte von<br />
August 2003 bis September 2005. Im Vordergrund des Interesses<br />
stand die Frage der Anwendung des Budgets durch die Bewohnerinnen<br />
und Bewohner. Die bis dahin gemachten Erfahrungen erforderten<br />
2005 einen Neustart unter klareren, für alle Beteiligten verbindlicheren<br />
Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen bezogen sich<br />
nicht nur auf die Menschen, die das Budget in Anspruch nehmen<br />
wollen, sondern auch auf die institutionelle Seite und damit auf die<br />
Organisationsstruktur des Wohnheims.<br />
Das Budget ist ein Teil der Maßnahmepauschale, die für die Komplexleistung<br />
der Einrichtung („alles inklusive“) seitens des Landschaftsverbandes<br />
gezahlt wird. Insofern mindert der Anteil des Budgets die<br />
Summe, die zum Einsatz von Personal im Wohnheim am Stadtring<br />
zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass in der Höhe des Budgets<br />
Personal reduziert werden muss, damit das Budget frei zur Verfügung<br />
steht.<br />
Die Organisationsstruktur eines stationären Betriebs ist demgegenüber<br />
an zeitlicher Präsenz und einer ganzheitlichen Leistungserbringung<br />
orientiert (Anwesenheit von morgens bis abends an sieben Tagen<br />
in der Woche). Dieses Modell unterstellt, dass durch die präsenten<br />
Mitarbeitenden in der gesetzten Zeit alle anfallenden Arbeiten (die<br />
als Aufgaben definiert sind, in der Regel aber nicht als Einzelleistung)<br />
erledigt werden. Begleitung in der Einrichtung ist der Normalfall,<br />
Begleitungen außerhalb der Einrichtung können nur erfolgen, wenn<br />
gleichzeitig die Präsenz im Haus gewährleistet ist, sie müssen also<br />
gesondert geplant werden.<br />
Da das persönliche Budget prinzipiell freizügig sein muss (sonst hat<br />
es den Namen nicht verdient), muss ein Teil der bisherigen Präsenzzeit<br />
in Geld zur Verfügung stehen. Das bedeutet auch eine Reduzierung<br />
der bisher in der Präsenzzeit erbrachten Leistungen zur Teilhabe am<br />
Leben in der Gemeinschaft (nicht der sonstigen Bestandteile der<br />
Komplexleistungen).<br />
SuSAnnE SELLIn ist teamleiterin im wohnheim am Stadtring in bielefeld, Stiftungsbereich<br />
behindertenhilfe der von bodelschwinghschen Anstalten bethel.<br />
Im rahmen des Modellprojekts PerLe wurde der Einsatz des Persönlichen budgets in einer<br />
stationären Einrichtung erprobt und von teilnehmern und Mitarbeitenden insgesamt positiv<br />
bewertet.<br />
rEFErAtE<br />
Das Persönliche Budget im Wohnheim am Stadtring von Susanne Sellin<br />
7<br />
Die bisherige Berechnungsgrundlage war eine „gegriffene Größe“.<br />
Sie war zwar plausibel, aber rein rechnerisch ermittelt. Die tatsächliche<br />
Inanspruchnahme im Jahr 2004 lag unter 10% des ermittelten<br />
Betrages. 2004 wurden knapp 16.000 Euro als Budgets verwendet,<br />
die entsprechenden Leistungen wurden zu 44% durch Mitarbeitende<br />
des Wohnheims am Stadtring erbracht und zu 56% durch externe<br />
Anbieter.<br />
Geht man von 25 am Modell teilnehmenden Personen und einer (im<br />
Vergleich zur vorherigen Berechnung) halbierten Summe aus, wären<br />
für die Laufzeit von 12 Monaten ca. 82.000 Euro zur Verfügung zu<br />
stellen, was etwa zwei Vollkräften entspricht. Legt man nur die Personen<br />
zu Grunde, die aktiv mit dem persönlichen Budget umgehen,<br />
so ergibt sich ein Betrag von ca. 46.000 Euro für den gleichen Zeitraum.<br />
Das entspricht etwa der dreifachen Höhe des Betrages, der<br />
2004 tatsächlich verwendet wurde.<br />
Das persönliche Budget ist prinzipiell freizügig, aber nicht beliebig.<br />
Es geht um Leistungen für Menschen mit Behinderungen, die ihnen<br />
die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen sollen. Der<br />
Gesetzestext ist orientierend: … alltägliche und regelmäßig wiederkehrende<br />
Bedarfe … An die Entscheidung ist der Antragsteller für<br />
die Dauer von sechs Monaten gebunden (§17, 2 SGB IX). Notwendig<br />
folgen daraus Maßnahmen, die der Logik der Hilfeplanung und der<br />
Sozial und Verlaufsberichte entsprechend aus der Hilfeplanung erkennbar<br />
und in ihr festgelegt sein müssen. (Im Zeitraum X will ich Y<br />
machen. Dazu möchte ich Mittel aus meinem Budget in Höhe von<br />
X Euro einsetzen.) Insofern rückt die Hilfeplanung einmal mehr ins<br />
Zentrum. An ihr sind auch Angehörige und/oder gesetzliche Betreuer<br />
einvernehmlich zu beteiligen. An der Veränderung der Haltung, es<br />
handele sich im Prinzip um einen erweiterten Barbetrag, ist im Zuge<br />
der neuen Festlegungen zu arbeiten.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 40
Das Persönliche budget im wohnheim am Stadtring<br />
Das Budget wird eingesetzt für:<br />
> Freizeitplanung<br />
> Begleitung zur Freizeitgestaltung<br />
(Kino und Konzertbesuche, Schwimmen, Fußballspiel live ansehen<br />
auch Auswärtsspiele und WMSpiele, am Treffen von Fanclub<br />
teilnehmen Begleitung der Sitzung, Wanderungen, Stadtbummel,<br />
Spaziergänge, Ausflüge, Eislaufen, Erkundung der weiteren Umgebung<br />
mit der Straßenbahn)<br />
> Bildung<br />
(Kursangebote von VHS,BBB, Sportvereine)<br />
> Zukunftsplanung<br />
(Begleitung bei der Haushaltsführung, Kochen, Waschen)<br />
> Budgetberatung<br />
Der Heimvertrag wird durch ein Änderungsprotokoll ergänzt. Die<br />
Einigung auf Inhalt und Absicht zur Verwendung des persönlichen<br />
Budgets wird im Änderungsprotokoll dokumentiert und verbindlich<br />
(Budgetnehmerin, ggf. gesetzliche Betreuerin) unterschrieben. Für den<br />
Neubeginn wurden für die Personen, die teilnehmen wollten, Ordner<br />
angelegt, in denen die relevanten Dokumente ihren Platz haben.<br />
Ein personenbezogenes Kontoblatt ermöglicht jederzeit einen Überblick<br />
über geplante, bereits durchgeführte und noch (oder nicht mehr)<br />
planbare Aktivitäten. Ansparungen für umfangreichere Aktivitäten<br />
waren in diesem Rahmen (s.o. Hilfeplanung) möglich.<br />
rEFErAtE<br />
Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
und die Teamleitung beurteilen das Persönliche Budget in ihrer Einrichtung<br />
folgendermaßen:> Mehr Möglichkeiten und Selbstbestimmung<br />
durch den Einkauf von externen Begleitung/Angeboten;<br />
> Mehr Auswahl an Angeboten, die wahrgenommen werden können;<br />
> Wahlmöglichkeit: mit wem möchten die Bewohnerinnen und Bewohner<br />
was machen;<br />
> Fühlen sich durch den Vertrag, der mit ihnen geschlossen worden<br />
ist, ernst genommen;<br />
> Insgesamt wurde das Projekt von allen Mitarbeitenden als positive,<br />
ergänzende Möglichkeit sowohl für die Teilnehmer als auch<br />
Nichtteilnehmer gesehen (können vom Miterleben der Zusatzmöglichkeiten<br />
anderer durchaus profitieren, Mut zum Neuen entwickeln).<br />
> Das Projekt hat bei den Mitarbeitenden viel in Bewegung gesetzt,<br />
Betreuungszeiten für jede einzelne Bewohnerin und für jeden einzelnen<br />
Bewohner wurden überprüft und korrigiert, mehr Transparenz<br />
und Grenzsetzung.<br />
> Mehr Verbindlichkeiten – Transparenz, aber auch die Möglichkeit<br />
auf externe Anbieter verweisen zu können, schafft für alle Beteiligten<br />
mehr Sicherheit, Gelassenheit, Entlastung (Wir können und müssen<br />
nicht alles selber leisten!).<br />
> Die Budgetassistenz erfordert einen hohen Zeitaufwand, ist sehr<br />
wichtig und notwendig und sollte zusätzlich finanziert werden.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 41
Häuser … Tadsch Mahal – Indien<br />
andrea Poerschke, 39 Jahre<br />
Ein halbes Jahr arbeitete Frau Poerschke an ihrem Palast,<br />
der ihr für ihre Wohnzwecke angemessen erschien.<br />
(Dieses Bauwerk wurde in der Ausstellung „Ermutigung“<br />
in Fürstenwalde gezeigt.)<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 42
Die „Geldleistung“ in der Hilfe und unterstützung für Menschen mit behinderung<br />
Was die Mehrzahl der Leser 1991 in Jochen Schweitzers Aufsatz<br />
„Wenn der Kunde König wäre?“ 1 noch als soziale Utopie aufnahm,<br />
wurde bereits 1997 von Florian Gerster, dem damaligen Sozialminister<br />
in RheinlandPfalz, ohne die sonst übliche Abstimmung mit den<br />
Wohlfahrtsverbänden unter dem Begriff „Persönliches Budget“ eingeführt.<br />
Die „Geldleistung“ als Alternative zur „Sachleistung“ in der rheinlandpfälzischen<br />
Behindertenhilfe wurde etabliert, trotz aller empörten<br />
Proteste über diesen Akt der „Vollstreckung“. 2 Die seinerzeit<br />
durch das Ministerium einseitig festgesetzten Rahmenbedingungen<br />
und Teilnahmevoraussetzungen werden heute noch in Rheinland<br />
Pfalz angewendet, obwohl seit dem 01.07.2004 bundesweit das<br />
„Trägerübergreifende Persönliche Budget“ nach § 17 SGB IX eingeführt<br />
wurde.<br />
Ermöglicht wird diese Situation durch den neuen § 17 Absatz 5 SGB IX,<br />
wonach alle Modellerprobungen zum Persönlichen Budget, die vor<br />
dem 01.07.2004 in den Bundesländern begonnen wurden, noch in<br />
der am 30.06.2004 geltenden alten Fassung des § 17 (3) SGB IX bis<br />
zum 31.12.2007 fortgeführt werden dürfen. 3<br />
In nahezu allen 36 rheinlandpfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften<br />
ist das Verfahren etabliert. Wohl hat sich aber eine Umsetzungspraxis<br />
entwickelt, die höchst heterogen von jenen Vorgaben<br />
aus dem Jahr 1997 abweicht – im Positiven wie im Negativen.<br />
1 In: Zeitschrift für Systemische Therapie, Jahrgang 1991, Heft 4<br />
2 Seinerzeit konnten sich die wenigsten Akteure der Behindertenhilfe vorstellen, dass<br />
der Leistungsträger den behinderten Menschen selbst das Geld ausgezahlt. Man hielt<br />
das für eine unzulässige Überforderung der Behinderten, die aus pekuniären Motiven<br />
billigend in Kauf genommen würde. Die Empörung wurde dann auch noch stärker,<br />
dass die Geldbeträge, die den Menschen direkt zur Verfügung gestellt wurden, die<br />
Vergütungen, die die Leistungserbringer erhielten, weit unterschritten.<br />
3 § 17 Absatz 3 SGB IX (alte Fassung bis zum 30.06.2004): „Die Rehabilitationsträger<br />
erproben die Einführung persönlicher Budgets durch Modellvorhaben.“<br />
JoAcHIM SPEIcHEr ist Geschäftsführer der <strong>Lebenshilfe</strong> Einrichtungen GmbH in worms.<br />
Von 2004 bis 2007 war er Leiter des bundesweit tätigen „Paritätischen Kompetenzzentrums<br />
Persönliches budget“ in Mainz.<br />
Das Persönliche budget, seit 2008 als regelleistung eingeführt, eröffnet Menschen mit<br />
behinderungen ganz neue Möglichkeiten. Mit einem Geldbetrag kaufen sie sich als Kunden<br />
die für sie notwendigen unterstützungsleistungen selbst ein.<br />
Die Heterogenität (manchmal geht auch das Wort der „Beliebigkeit“<br />
um) betrifft die Fragen des Zugangsrechts zum Persönlichen Budget<br />
genauso wie die Regelungen zum Antragsverfahren und der Bedarfsfeststellung<br />
sowie das geänderte Rechtsverhältnis zwischen<br />
Leistungsträger, Leistungserbringer und Hilfeberechtigtem.<br />
Ende 2003 hatte der Bundesgesetzgeber im „Gesetz zur Einordnung<br />
des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch“ eine neue Ausgangslage<br />
geschaffen, die eine deutliche Verbesserung der bisherigen rheinlandpfälzischen<br />
Lösungen sowie darüber hinaus eine bundesweite<br />
Installierung des „Persönlichen Budgets“ zur Folge hatte.<br />
Wenn wir über das Thema „Persönliches Budget“ sprechen, so zeigt<br />
sich durchaus eine gewisse begriffliche Konfusion. Konkret gibt es<br />
in Deutschland vier, sich wesentlich von einander unterscheidende<br />
Budgettypen:<br />
1. Das Persönliche Budget in RheinlandPfalz (BSHG/ SGB XII) seit 1998 4<br />
2. Das Trägerübergreifende Persönliche Budget (SGB IX) seit 2004 5<br />
3. Das Pflegebudget (SGB XI) seit 2004 6<br />
4. Das Integrierte Budget in RheinlandPfalz<br />
(eine Kombination aus 2. und 3.) seit 20057 4 Persönliche Budgets werden im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe nach SGB XII<br />
(„Eingliederungshilfe“) an leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung alternativ<br />
zu einer Sachleistung („Geld oder Liebe“? – „Wohnheim oder Geld?“) als pauschalierte<br />
Geldbeträge in drei Stufen ausgezahlt. Aktuelle Stufungen und Monatsbeträge<br />
sind Stufe 1 (€ 200,), Stufe 2 (€ 400,) und Stufe 3 (€ 770,). Im Mai 2007 hat das<br />
zuständige Ministerium in Mainz die Obergrenze persönlicher Budgets an die Sachleistungsgrenze<br />
stationärer Hilfen nach oben erweitert.<br />
5 Vgl. § 17 SGB IX und die Budgetverordnung nach § 21 a SGB IX; s. auch: www.bud<br />
get.paritaet.org<br />
6 umfangreiche Information und Darstellung: www.pflegebudget.de<br />
8<br />
7 umfangreiche Information und Darstellung: www.integriertesbudget.de<br />
rEFErAtE<br />
Die „Geldleistung“ in der Hilfe und Unterstützung<br />
für Menschen mit Behinderung von Joachim Speicher<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 43
Die „Geldleistung“ in der Hilfe und unterstützung für Menschen mit behinderung<br />
Eine umfassende Zahl an Praxisbeispielen einer alltäglichen Anwendungspraxis<br />
Persönlicher Budgets gibt es allerdings bisher nur in RheinlandPfalz<br />
zum Budgettyp 1.). Seit der Ankündigung und Einführung<br />
im Jahr 1997 ist die Zahl der Budgetnehmer/innen auf aktuell 3.000<br />
gestiegen und sie nimmt stetig zu.<br />
Den größten Anteil mit knapp 50% stellen Menschen mit seelischer<br />
Behinderung; gefolgt von Menschen mit geistiger Behinderung/Lernschwierigkeiten<br />
sowie Menschen mit Körper und Sinnesbehinderungen.<br />
Die Besonderheit rheinlandpfälzischer Budgets besteht bekanntlich<br />
darin, dass sich die Verfahren und die sonstigen Rahmenbedingungen<br />
mit den jetzt gültigen, in der Budgetverordnung (nach § 21a SGB IX)<br />
festgeschriebenen Regeln kaum vereinbaren lassen.<br />
Auf den Punkt gebracht: rheinlandpfälzische Persönliche Budgets<br />
sind absolut vergleichbar und in der Höhe sogar identisch mit der als<br />
„Pflegegeld“ ausgezahlten Geldleistung in der Pflegeversicherung.<br />
Daher sind sie im Unterschied zu den in der Erprobung befindlichen<br />
„Trägerübergreifenden Persönlichen Budgets“ (Typ 2.) weder bedarfsorientiert,<br />
noch bedarfsdeckend und auch nicht zielorientiert.<br />
(Erst im Mai 2007 wurde die Obergrenze an die Sachleistungsgrenze<br />
stationärer Hilfen (Wohnheime) angepasst!)<br />
Bislang handelt es sich um pauschalierte Geldbeträge, die dem Menschen<br />
mit Behinderung monatlich bar auf sein Girokonto überwiesen<br />
werden und die er zur Sicherung seiner Teilhabe am Leben in der Gesellschaft<br />
frei und ohne Nachweispflicht verwenden kann. Sie werden<br />
zusätzlich zu einer laufenden Grundsicherung oder Hilfe zum<br />
Lebensunterhalt gezahlt.<br />
Diese Besonderheit hat ein rheinlandpfälzischer PsychiatrieErfahrener<br />
kürzlich sehr treffend auf den Punkt gebracht, als er beiläufig<br />
erwähnte, dass er selbst schon mehr als zwei Jahre lang „SchizophrenieGeld“<br />
(in einer herrlichen Analogie zum „BlindenGeld“)<br />
beziehe. 8<br />
Nun liegt die Frage nahe, auf welche Weise die Budgetinhaber ihre<br />
Teilhabe herstellen und sichern, wenn die Geldbeträge doch pauschaliert<br />
und knapp (im Unterschied zu den Sachleistungskosten einer<br />
Wohnheimunterbringung) bemessen sind. 9<br />
8 Die Budgetverordnung schreibt als Bewilligungsvoraussetzung eine schriftliche Zielvereinbarung<br />
zwischen Antragsteller und Leistungsträger vor, die insbesondere Zielformulierungen,<br />
Regelungen zu Verwendungsnachweisen sowie zur Qualitätssicherung<br />
enthalten muss. Die bisherige rheinlandpfälzische Regelung verzichtet völlig auf diese<br />
Bedingungen.<br />
9 s. Fußnote 4<br />
HIeRZU IM FoLGenDen VIeR PRAxISBeISPIeLe<br />
UnD FALLVIGneTTen<br />
rEFErAtE<br />
Beispiel 1:<br />
Ein junger Mann (24) mit geistiger Behinderung lebt zu Hause bei seinen<br />
Eltern und besuchte bislang mehr oder regelmäßig eine Tagesförderstätte.<br />
Es gab wiederkehrende Konflikte mit dem Betreuungspersonal,<br />
da er häufig zu spät kam oder die Einrichtung vorzeitig verließ<br />
und zu Fuß nach Hause lief oder sich in der Stadt umhertrieb.<br />
Die Eltern (Vater = gesetzlicher Betreuer) entschieden sich gemeinsam<br />
mit ihrem Sohn nach eingehender Beratung durch den Sozialen<br />
Dienst des Örtlichen Trägers der Sozialhilfe ein Persönliches Budget<br />
in Anspruch zu nehmen. Es wurde ein monatlicher Geldbetrag in<br />
Höhe von 400,– Euro bewilligt und regelmäßig gezahlt. Ein Verwendungsnachweis<br />
ist nicht erforderlich.<br />
Auf einer öffentlichen Informationsveranstaltung berichtete der junge<br />
Mann selbstbewusst und sichtlich entspannt, was er nun im Unterschied<br />
zu früher tagsüber so tue.<br />
Mit seinem Vater hat er sich eine Dauerkarte im FitnessStudio gekauft,<br />
das er fast täglich aufsucht. Er berichtet, dass die Mitarbeiter<br />
dort viel freundlicher seien. Es gäbe nie Ärger und das Schöne sei, er<br />
könne kommen, wann er wolle. Darüber hinaus erfährt man, werde<br />
der Restbetrag stetig neu verwendet. Mal zur Anschaffung verschiedener<br />
materieller Dinge, mal zur Finanzierung begleitender Hilfen<br />
und Urlaubsreisen oder sonstiger alltäglicher Aktivitäten.<br />
Im Ergebnis hat man nicht den Eindruck, dass hier ein junger Mann<br />
berichtet, dem das Fehlen einer psychosozialen Förderung durch<br />
eine Tagesstätte anzumerken wäre. Im Gegenteil, sein Bericht wirkt<br />
für seine Verhältnisse entspannt und souverän.<br />
Beispiel 2:<br />
Während derselben Informationsveranstaltung berichtet ein Mann<br />
mit seelischer Behinderung (29) in Anwesenheit seines gesetzlichen<br />
Betreuers über seine bisherigen zahlreichen Aufenthalte in psychiatrischen<br />
Kliniken und den sich daran anschließenden Wohnheimunterbringungen.<br />
Alle Versuche, in den Wohnheimen zurechtzukommen,<br />
seien gescheitert. Zumeist habe es Auseinandersetzungen wegen<br />
der Hausordnungen, der Übernahme von Haus und Putzdiensten<br />
und wegen der regelmäßigen Überschreitung von Alkoholverboten<br />
gegeben.<br />
Auch hier, nach einschlägiger Beratung durch den Sozialhilfeträger<br />
habe er sich entschieden, ein Persönliches Budget in Anspruch zu<br />
nehmen. Er erhalte nun den monatlichen Maximalbetrag von rund<br />
770,– Euro.<br />
Im Publikum will man wissen, wozu er das Geld verwende und zur<br />
Überraschung der Zuhörer berichtet der Budgetnehmer, dass er das<br />
Geld drei Monate gespart habe. Zwischenzeitlich habe er mithilfe<br />
und Unterstützung seines gesetzlichen Betreuers in einem Wochenblättchen,<br />
das in der örtlichen Haushalten umsonst verteilt werde,<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 44
Die „Geldleistung“ in der Hilfe und unterstützung für Menschen mit behinderung<br />
ein Inserat aufgegeben: „ ’Bin 29, männlich, seelisch behindert, suche<br />
für 8WocheAufenthalt auf den Balearen eine Begleitperson.<br />
Zuschriften unter Chiffre erbeten an ….“.<br />
Er habe vier Bewerbungen erhalten und sich gemeinsam mit seinem<br />
gesetzlichen Betreuer für einen jungen Studenten der Sozialpädagogik<br />
entschieden. Mit diesem habe er die Regeln und die Bedingungen<br />
für eine gemeinsame Reise nach Mallorca ausgehandelt und<br />
schriftlich vereinbart. Der Betreuer habe in Palma de Mallorca einen<br />
deutschsprachigen Psychiater ausfindig gemacht, mit dem er alle<br />
Eventualitäten und Kriseninterventionen im Fall einer psychischen<br />
akuten Krise vorbesprochen habe. Dann habe er aus seinem angesparten<br />
Budget eine Reise für zwei Personen bei einem Billiganbieter<br />
im Reisebüro gebucht und die beiden haben eine gute Zeit auf<br />
Mallorca im November und Dezember verbracht. Auf die erstaunten<br />
und teilweise gar empörten Rückfrage der professionellen Leistungsanbieter<br />
im Publikum, wo denn hierbei die notwendigen psychosozialen<br />
Betreu ungsleistungen geblieben wären, antwortet der Budgetneh<br />
mer knapp und denkwürdig: „ Wissen Sie das Frühstücksbuffet im<br />
Hotel in Palma de Mallorca ist etwas anderes als die Frühstücksgruppe<br />
im Wohnheim!“<br />
Beispiel 3<br />
Eine chronisch seelisch behinderte Frau (44) lebte nahezu 16 Jahre<br />
in psychiatrischen Wohnheimen. Ihr Aussehen und ihre mangelhafte<br />
Körperhygiene war stets Anlass zu Auseinadersetzungen und sogenannten<br />
„Grenzen setzenden Sanktionen“ durch das Betreuungspersonal.<br />
Eine dauerhafte depressive Grundstimmung äußerte sich<br />
auch in konsequentem Rückzugsverhalten und steter Ablehnung<br />
einer jeden Kooperation.<br />
rEFErAtE<br />
Der Intervention eines aufgeschlossenen, über das Persönliche Budget<br />
gut informierten Mitarbeiters ist es zu verdanken, dass diese Frau<br />
heute seit mehr als zwei Jahren selbständig in einer eigenen Wohnung<br />
lebt und in eigener Verantwortung ein Budget von 700,– Euro<br />
verwaltet, mit dem sie Reinigungspersonal eines hauswirtschaftlichen<br />
Dienstes (180,– Euro pro Monat), Begleitpersonen für ihre wöchentlichen<br />
Einkäufe (60,– Euro pro Monat) sowie die 14tägige psychosoziale<br />
Beratung (90,– Euro pro Monat) bezahlt. Darüber hinaus hat<br />
sie sich in die „Arbeits und Ergotherapiegruppe“ eines Wohnheims<br />
eingekauft. Dort hat sie die Möglichkeit, zweimal in der Woche jeweils<br />
zwei Stunden an der Gruppe teilzunehmen und bezahlt dafür<br />
monatlich einen Pauschbetrag von 250,– Euro an den Wohnheimträger.<br />
Darin ist auch zweimal pro das Mittagessen enthalten. Der Restbetrag<br />
wird von ihr, wie in den vorangegangenen Beispielen, ganz frei<br />
und nach Bedarf verwendet. Häufig dient er zu Finanzierung von<br />
Freizeitaktivitäten, zusätzlichen Friseurbesuchen (!) oder einfach nur<br />
zur Verbesserung der ökonomischen Situation.<br />
Beispiel 4<br />
Ein geistig behinderter Mann mit schweren Verhaltensauffälligkeiten<br />
(40) lebt zuhause bei seinen Eltern, die beide älter als 70 Jahre sind.<br />
Er sollte in ein Wohnheim umziehen, jedoch war die Suche lange erfolglos.<br />
Entweder waren die in Frage kommenden Heime nicht bereit,<br />
ihn aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeiten aufzunehmen oder die<br />
zur Verfügung stehenden Plätze waren auf lange Sicht ausgebucht.<br />
So steht er heute auf der Warteliste eines Heimes auf Platz 14. Was<br />
geschieht aber in der Zwischenzeit? Üblicherweise interessiert das<br />
die Wohnheimträger weniger, ebenso den Leistungsträger.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 45
Die „Geldleistung“ in der Hilfe und unterstützung für Menschen mit behinderung<br />
Der Rechtsanspruch auf Leistungen zur Teilhabe besteht aber im Einzelfall<br />
und zwar genau dann, sobald der Bedarf festgestellt worden<br />
ist. Dabei bleibt festzuhalten, der Bedarf auf Leistungen zur Teilhabe<br />
artikuliert sich immer in Formulierungen wie bspw. „Hilfe zur Selbstversorgung“,<br />
„Hilfe zur Tagesgestaltung“, „Hilfe zur Arbeit“ u.ä..<br />
Der Rechtsanspruch bezieht sich entsprechend auch nur auf solche<br />
Formulierungen. Es gibt keinen Bedarf, der lauten würde: „ Ich brauche<br />
ein Wohnheim!“ Oder: „Ich brauche eines Tagesförderstätte!“<br />
Unter diesen Umständen ist das Konzept der „Betreuten Warteliste“,<br />
das von uns unter ausdrücklicher Umsetzung des Persönlichen Budgets<br />
erfunden worden ist, eine realistische Perspektive, auch in solchen<br />
Bedarfssituationen zeitnah tätig werden zu können, in denen<br />
Menschen im üblichen Sachleistungssystem nicht sofort auf Hilfe<br />
rechnen dürfen.<br />
Der Mensch mit geistiger Behinderung konnte in unserem Beispiel<br />
weiter zuhause wohnen bleiben. Er und seine Eltern nutzten die umfassende<br />
Budgetberatung, die sie durch einen Wohnheimträger und<br />
dessen CaseManagementBeauftragten (nicht identisch mit dem<br />
Wohnheimträger, auf dessen Warteliste er sich befand) erhalten haben.<br />
Sie erhielten den maximalen Budgetbetrag zur Sicherung der<br />
Teilhabe in Höhe von 770,– Euro monatlich durch den Sozialhilfeträger.<br />
Zudem wurde die psychiatrische Institutsambulanz (Leistungen<br />
nach § 118 SGB V) des Trägers mit der regelmäßigen, aufsuchenden<br />
fachärztlichen Behandlung und Betreuung beauftragt. Mit dem Geld<br />
aus dem Budget wurden psychosoziale Fachleistungsstunden in Form<br />
von Kriseninterventionen bei Bedarf und in der eigenen Familie eingekauft<br />
sowie „Babysitterdienste“. So bezeichnete die Mutter die<br />
Dienste, die durch ambulantaufsuchendes Betreuungspersonal des<br />
beratenden Trägers immer dann erforderlich wurden, wenn die Eltern<br />
beide gleichzeitig außer waren und der behinderte Sohn beaufsichtigt<br />
werden musste. Verbleibende Restbeträge wurden aufgespart<br />
und zur Finanzierung einer begleiteten Einzelreise des Sohnes<br />
genutzt. Als nach 8 Monaten der Platz im Wohnheim frei wurde,<br />
entschieden sich der behinderte Sohn und seine Eltern gemeinsam,<br />
die über das persönliche Budget gefundene Lösung weiter fortzuführen.<br />
Aktuell plant die Familie erstaunlich offen und gemeinsam<br />
mit „ihrem“ Betreuungspersonal die Zeit nach dem Tod der Eltern.<br />
Insbesondere weiß man nun, dass durch das Budget die unschätzbare<br />
Möglichkeit besteht, das Personal weiter zu beschäftigen, zu<br />
dem man inzwischen großes Vertrauen gefunden hat. Dabei werden<br />
offen die Varianten einer Vorbereitung und Unterbringung in einer<br />
Gastfamilie genauso in den Blick genommen wie der Wechsel in eine<br />
betreute Wohngemeinschaft, in der allerdings das Personal nicht wie<br />
üblich einmal in der Woche im Schlüssel 1:12 vorbeischaut, sondern<br />
in der dieselben individuell zugeschnittenen komplexen Leistungen<br />
erbracht werden, wie jetzt zuhause bei den Eltern.<br />
rEFErAtE<br />
FAZIT<br />
Das rheinlandpfälzische Persönliche Budget zeigt trotz seiner<br />
strukturellen Schwächen (= keine Bedarfsorientierung, keine Zielformulierung,<br />
kein Verwendungsnachweis, pauschalierte Beträge)<br />
erstaunliche Ergebnisse in der Sicherung der Teilhabe behinderter<br />
Menschen. Die Geldleistung befördert offensichtlich auch unter diesen<br />
Bedingungen günstige Lösungsentwicklungen, die im herkömmlichen<br />
Sachleistungsprinzip eher schwierig oder unmöglich sind.<br />
Die Leistungserbringer, die sich an diesen Lösungen beteiligen, verändern<br />
ihren Einrichtungsbegriff, ohne allerdings die Einrichtung<br />
selbst aufzulösen. Sie bieten eben zusätzlich zum „Kerngeschäft“<br />
ambulantaufsuchende Leistungen an, für die eine eigenständige<br />
Kalkulation und Personalbewirtschaft sowie häufig eine andere Leistungsbeschreibung<br />
erforderlich ist. Weitaus stärker als bisher sind<br />
Leistungen zur Teilhabe im Blick (Stichwort: Lebensqualität und –zufriedenheit).<br />
Nicht so sehr gefragt sind die eher „mitarbeiterorientierten“ Leistungen<br />
des Therapierens, Betreuens, Pflegens, Beratens, Begleitens usw.,<br />
die von den allermeisten Budgetnehmern als Mittel zum Zweck verstanden<br />
werden und für die man sich aufgrund des Wunsch und<br />
Wahlrechts entscheiden kann oder auch nicht. Die Entscheidung<br />
trifft der, der das Geld hat. Wer hier als Leistungserbringer weiter<br />
„strukturkonservativ“ denkt und handelt, der erreicht die Budgetinhaber<br />
nicht.<br />
Aufgrund dieser Praxiserfahrungen darf man nun sehr gespannt die<br />
Ergebnisse der Modellerprobungen (Typen 2, 3 und 4) auf der Bundesebene<br />
erwarten und es bleibt zu wünschen, dass die verbesserten –<br />
gesetzlich im SGB IX und der Budgetverordnung sowie im SGB XI<br />
verankerten – Strukturbedingungen spätestens dann ab 2008 zu einer<br />
bundesweiten Alltagsumsetzung Persönlicher Budgets führen werden.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 46
Resümee<br />
Herr Schützhoff begann das Resümee mit einer Frage<br />
ins Publikum zu Herrn Speicher.<br />
Ein ungewöhnlicher, aber sehr passender Einstieg.<br />
Bitte lesen Sie selbst ...<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 47
Viele Fragen und neue Antworten – zusammenfassung und abschließende Gedanken zur heutigen tagung<br />
martin schützhoff: Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Speicher,<br />
die mich angesichts seiner Ausführungen ganz persönlich als Resümee<br />
interessiert. Warum sind Sie eigentlich in die Geschäftsführung der<br />
<strong>Lebenshilfe</strong> Worms gewechselt? Die Zeiten sind für Unternehmen der<br />
Behindertenhilfe angesichts der von Ihnen aufgezeigten Perspektiven<br />
ja nicht einfach.<br />
Joachim speicher: Ich habe ja mit allem gerechnet, nur nicht damit,<br />
dass Sie mich so etwas fragen. Aber eigentlich ist es eine ganz einfache<br />
Sache. Eine Variante hat uns Frau Sellin aus Bethel heute gezeigt.<br />
Es muss einen interessieren, wie ich meine Firma am Leben erhalte.<br />
Das meine ich nicht nur wirtschaftlich, sondern besonders auch Aspekte,<br />
wie kann ich das, wovon ich überzeugt bin – und damit meine ich die<br />
Qualität unserer Erfahrung – für Weiterentwicklungen nutzen.<br />
Ich habe gesehen und gelernt, dass wir mit dem persönlichen Budget<br />
auch kein schlechtes Geld zur Umsetzung unseres Auftrags verdienen.<br />
Das ist ein wichtiger Punkt. Es gab mal eine Aussage eines<br />
Kollegen von mir, der etwas bösartig aus der klassischen Trägerperspektive<br />
formuliert hatte, dass er das Geld, das die Leute im Persönlichen<br />
Budget jetzt selbst haben, wiederhaben möchte. Es ist die<br />
Frage, wie man das macht, aber es ist ein neues Geschäftsfeld und<br />
es muss einen Geschäftsführer interessieren.<br />
martin schützhoff: Für mich hat sich der Kreis heute geschlossen.<br />
Frau Schmidt hat gesagt, wer trotzdem in ein Heim ziehen wolle,<br />
solle es doch bitte auch weiterhin tun. Sozusagen das Heim als etwas,<br />
wozu es viele Alternativen gibt. Und ich finde, Sie haben heute<br />
die Alternativen auf der anderen Seite des Spektrums sehr plakativ in<br />
ihrer Wirkung aufgezeigt.<br />
Bezogen auf <strong>Berlin</strong> muss man jedoch wissen, dass es andere Strukturen<br />
als in Hamburg oder Bayern gibt. Im Land <strong>Berlin</strong> leben bereits<br />
50% der Menschen mit Behinderung, die Leistungen im Rahmen<br />
unterstützten Wohnens erhalten, in ambulanten Strukturen. Der Anteil<br />
innerhalb der Angebote der <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong> beträgt hier sogar<br />
zwei Drittel. Wir haben in <strong>Berlin</strong> eine durchschnittliche Stundenzahl<br />
im ambulant unterstützen Einzelwohnen von neun Stunden und<br />
in den ambulant betreuten Wohngemeinschaften ergeben sich im<br />
Martin Schützhoff (am Mikro) ist verantwortlich für Produkt und Konzeptentwicklung<br />
und Ute Schünemann (rechts daneben) ist Regionalleiterin West bei der <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong><br />
rESüMEE<br />
Viele Fragen und neue Antworten – Zusammenfassung<br />
und abschließende Gedanken zur heutigen Tagung von Martin Schützhoff und Ute Schünemann<br />
Durchschnitt anteilig ca. 12 Stunden pro Woche und Assistenznehmer.<br />
Alle diese Möglichkeiten haben wir hier bereits. Insofern ist der<br />
Handlungsdruck, den es manchmal auch ein wenig für weitere Entwicklung<br />
braucht, bei uns in <strong>Berlin</strong> programmatisch vielleicht nicht<br />
ganz so hoch, wie woanders, wo er sehr viel offensiver formuliert<br />
wird.<br />
Trotzdem tun wir gut daran auch unsere stationären Angebote weiter<br />
zu entwickeln, wir werden sie auf absehbare Zeit, in geeigneter,<br />
individualisierter Form, – wie auch immer sie dann heißen mögen, – mit<br />
ihrer umfänglichen Verlässlichkeit auch teilweise weiter brauchen.<br />
Das hat heute auch Frau Baikers Beitrag gezeigt. Wir sollten die stationären<br />
Angebote umsichtig modernisieren und uns die Frage stellen,<br />
wen wir daran wie beteiligen.<br />
Damit möchte ich zu Frau Schünemann überleiten, die mir gesagt hat,<br />
sie habe sich gerade kurzfristig vorgenommen zu versuchen, die Perspektive<br />
von Assistenznehmern einzunehmen und soweit möglich aus<br />
dieser Perspektive heraus zu berichten.<br />
ute schünemann: In die Erfahrungswelt eines anderen zu schlüpfen,<br />
ist immer wieder ein Wagnis. Im heutigen Tagungsverlauf stellte<br />
ich mir zuweilen vor, ein Mensch mit Behinderung, der alle Zeiten<br />
durchlebt hätte, hätte uns zugehört. Ein Mensch mit dem Wissen<br />
um die historischen und aktuellen Lebensumstände von Menschen<br />
mit geistiger Behinderung in unserer Gesellschaft, ein Mensch, der<br />
aufmerksam zugehört hat.<br />
Wäre dieser Mensch heute dabei gewesen, der in früheren Zeiten<br />
als Dorftrottel herhalten musste, von der Medizin als Idiot, als nicht<br />
lernfähig abgestempelt wurde, der in Anstalten als Insasse, Pflegling,<br />
Zögling behandelt, verwaltet und verwahrt sowie häufig medikamentös<br />
ruhig gestellt wurde. Ein Mensch, der Zeiten erlebt hat,<br />
die nahezu unvorstellbar sind, der als unwertes Leben deklariert vergast<br />
oder medizinischen Versuchen zugeführt wurde. Ein Mensch,<br />
der nach diesem Wahnsinn über den Normalisierungsgedanken,<br />
die Integrationsbestrebungen einen Teil seiner gesellschaftlichen<br />
Rehabilitation erfuhr, der heute als gleichberechtigter Bürger in der<br />
Gesellschaft verstanden sein will. Wäre dieser Mensch heute dabei<br />
gewesen, hätte er sich wahrscheinlich gewundert, von uns modern<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 48
Viele Fragen und neue Antworten – zusammenfassung und abschließende Gedanken zur heutigen tagung<br />
beseelten Vorkämpfern in Richtung Verselbstständigung, Beteiligung,<br />
Empowerment , Inklusion immer noch als ‚Bewohner’ tituliert<br />
zu werden; gar ‚mein’ oder ‚unser Bewohner’.<br />
Ich möchte kein Bewohner sein, und ich möchte auch nicht Euer<br />
Bewohner sein.<br />
Ich bin froh, dass sich z.B. mit dem Persönlichen Budget neue Wege<br />
eröffnen, die mich dabei unterstützen, mich selbst zu vertreten. Ich<br />
will nicht mehr von einzelnen Institutionen, Organisationen abhängig<br />
sein. Ich will nicht mehr zu einer vorgesetzten Zeit essen, was<br />
aufgewärmt aus der Großküche auf den Tisch kommt. Ich will nicht<br />
mehr mit acht oder neun Leuten wohnen, die ich zum Teil nicht leiden<br />
kann. Ich will nachts schlafen und nicht dauernd daran gehindert<br />
werden, weil mein Nachbar schreit! Ich will nicht mehr, dass jemand<br />
in mein Zimmer kommt und mir Sachen wegnimmt! Ich will mir<br />
meine Assistenten selbst aussuchen! Ich will meine Wohnsituation ,<br />
mein Leben, selbst bestimmen!<br />
Das wollt Ihr auch?<br />
Wenn es aber darum geht „Wer bezahlt das? Wer macht das? Wie<br />
soll’s gehen?“ bin ich auf einmal von Einzelinteressen, sogar von Euren<br />
Eigeninteressen umgeben. Und ich stehe nicht mehr mittendrin sondern<br />
außen vor! Ich bin unter anderem auch ein gesellschaftlicher<br />
Kostenfaktor. Das wissen wir alle. Für jede Gesellschaftsform – quer<br />
durch alle Zeiten – bin ich Indikator des herrschenden Menschenbilds.<br />
Am Umgang mit mir ist zu ermessen, wie viel ich gesellschaftlich<br />
wert bin, wie Ressourcen verteilt werden. Ich bin jedoch heute<br />
auf dem Weg, zugleich Auftraggeber für die von mir gewünschten<br />
Dienstleistungen zu werden, ein Kunde, der sich Leistungen einkauft,<br />
diese bewertet, beibehält oder kündigt.<br />
Wenn sich in historischen Phasen sinnvolle Chancen am Horizont eröffnen,<br />
ein Quantensprung möglich wird, ein Paradigmenwechsel,<br />
dann scheint ein solcher gerade in der Behindertenhilfe (was für ein<br />
Wortungetüm) statt zu finden. Wir alle hier erleben einen Quantensprung<br />
in Richtung Selbstbestimmung der Menschen mit einer geistigen<br />
Behinderung. Überall kracht’s im Gebälk. Strukturen lösen sich<br />
auf. Berufsrollen ändern sich. Manches bleibt beharrlich konterkarierend,<br />
anderes ist in Bewegung. Der Prozess stolpert und rollt gleichzeitig.<br />
Das Gefühl von Krise und Verunsicherung bei den Beteiligten<br />
blockiert und gibt so manchem zum Jammern Anlass. Wir brauchen<br />
jedoch nicht zu jammern. Lassen Sie uns den Blick nach vorn richten!<br />
Das Ziel ist es wert, auch wenn der Weg noch beschwerlich ist.<br />
Wir sind gefordert, mit dem Klienten in seinem Umfeld, mit seinem<br />
Umfeld die gesellschaftlichen Bedingungen zielorientiert mit zu bahnen.<br />
Dafür sind heute positive und ermutigende Beispiele referiert<br />
worden.<br />
Der Mensch mit geistiger Behinderung braucht in Zukunft, wenn wir<br />
wirklich erfolgreich sind, keine besondere Bezeichnung mehr: nicht<br />
Pflegling, nicht Schützling, nicht Bewohner, irgendwann auch nicht<br />
mehr Klient oder Klientin. Er/ sie trägt einen Namen, der – wie bei<br />
Ihnen oder mir – ausreicht: Er ist Herr oder Frau X.<br />
rESüMEE<br />
Das ist eine Aufgabe, die nicht nur Menschen mit einer geistigen<br />
Behinderung, Professionelle, Familien und Angehörige, rechtliche<br />
Betreuer, Träger etc. zu erledigen haben. Das muss politisch gewollt<br />
und unterstützt werden. Hier liegt gesellschaftliche Arbeit, Bewusstseinsarbeit,<br />
die wir wesentlich mit bewegen müssen.<br />
Ich wünsche mir bei allen Appellen und gesellschaftlichen Diskursen<br />
um die Selbstbestimmung der Menschen mit einer geistigen Behinderung,<br />
dass die Gesellschaft, die sich im Moment rapide verändert,<br />
auf humanem Kurs bleibt. Auch wenn ich weiß, dass ich immer auch<br />
Kostenfaktor bin, hoffe ich, dass, wenn vorhandene Ressourcen<br />
primär in andere Kanäle fließen, nicht wieder ein neues Paradigma<br />
mit wehenden Fahnen auf dem Markt der Möglichkeiten im Wind<br />
knattert und die Fremdbestimmung im neuen Gewand preist.; mir<br />
plötzlich erklärt wird, dass dies für mich deutlich angenehmer wäre:<br />
„Da musst Du Dich nicht mehr so mühen! Du sollst Dich nicht mehr<br />
so mühen!“<br />
Herr X und ich freuen uns, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung<br />
heute zugemutet wird, ihr eigenes Leben zu führen. Wir alle<br />
sollten sie dabei angemessen unterstützen!<br />
Große Gefühle für große Veränderungen – das Persönliche Budget<br />
als Opernarie vorgetragen.<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 49
Impulse 2008 Impressum<br />
Veranstalter und Herausgeber:<br />
<strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong><br />
Heinrich-Heine-Straße 15 (Annenhöfe)<br />
10179 <strong>Berlin</strong><br />
www.lebenshilfe-berlin.de<br />
Verantwortlich:<br />
Christiane Müller-Zurek,<br />
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing<br />
christiane.mueller-zurek@lebenshilfe-berlin.de<br />
Konzept:<br />
Susanne Birk, www.kommunikationsbuero.net<br />
Design, Grafik:<br />
Tom Senft, onfire Design<br />
Fotos:<br />
Florian von Ploetz, www.florianvonploetz.de<br />
Stand: Juli 2008<br />
impressum<br />
<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 50