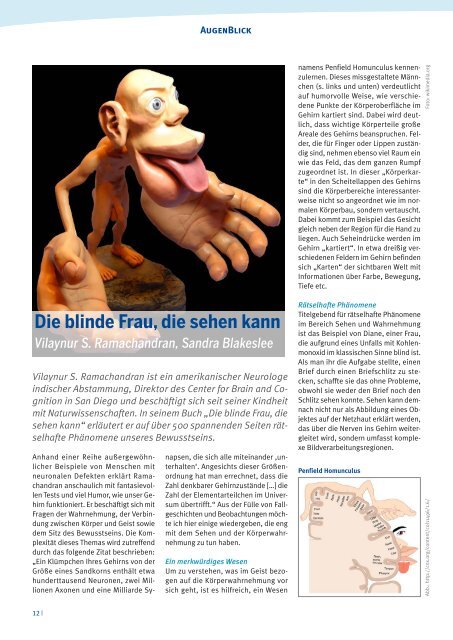Augenblick_22_v3
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die blinde Frau, die sehen kann<br />
Vilaynur S. Ramachandran, Sandra Blakeslee<br />
Vilaynur S. Ramachandran ist ein amerikanischer Neurologe<br />
indischer Abstammung, Direktor des Center for Brain and Cognition<br />
in San Diego und beschäftigt sich seit seiner Kindheit<br />
mit Naturwissenschaften. In seinem Buch „Die blinde Frau, die<br />
sehen kann“ erläutert er auf über 500 spannenden Seiten rätselhafte<br />
Phänomene unseres Bewusstseins.<br />
Anhand einer Reihe außergewöhnlicher<br />
Beispiele von Menschen mit<br />
neuro nalen Defekten erklärt Ramachandran<br />
anschaulich mit fantasievollen<br />
Tests und viel Humor, wie unser Gehirn<br />
funktioniert. Er beschäftigt sich mit<br />
Fragen der Wahrnehmung, der Verbindung<br />
zwischen Körper und Geist sowie<br />
dem Sitz des Bewusstseins. Die Komplexität<br />
dieses Themas wird zutreffend<br />
durch das folgende Zitat beschrieben:<br />
„Ein Klümpchen Ihres Gehirns von der<br />
Größe eines Sandkorns enthält etwa<br />
hunderttausend Neuronen, zwei Millionen<br />
Axonen und eine Milliarde Synapsen,<br />
die sich alle miteinander ‚unterhalten‘.<br />
Angesichts dieser Größenordnung<br />
hat man errechnet, dass die<br />
Zahl denkbarer Gehirnzustände […] die<br />
Zahl der Elementarteilchen im Universum<br />
übertrifft.“ Aus der Fülle von Fallgeschichten<br />
und Beobachtungen möchte<br />
ich hier einige wiedergeben, die eng<br />
mit dem Sehen und der Körperwahrnehmung<br />
zu tun haben.<br />
Ein merkwürdiges Wesen<br />
Um zu verstehen, was im Geist bezogen<br />
auf die Körperwahrnehmung vor<br />
sich geht, ist es hilfreich, ein Wesen<br />
namens Penfield Homunculus kennenzulernen.<br />
Dieses missgestaltete Männchen<br />
(s. links und unten) verdeutlicht<br />
auf humorvolle Weise, wie verschiedene<br />
Punkte der Körperoberfläche im<br />
Gehirn kartiert sind. Dabei wird deutlich,<br />
dass wichtige Körperteile große<br />
Areale des Gehirns beanspruchen. Felder,<br />
die für Finger oder Lippen zuständig<br />
sind, nehmen ebenso viel Raum ein<br />
wie das Feld, das dem ganzen Rumpf<br />
zugeordnet ist. In dieser „Körperkarte“<br />
in den Scheitellappen des Gehirns<br />
sind die Körperbereiche interessanterweise<br />
nicht so angeordnet wie im normalen<br />
Körperbau, sondern vertauscht.<br />
Dabei kommt zum Beispiel das Gesicht<br />
gleich neben der Region für die Hand zu<br />
liegen. Auch Seheindrücke werden im<br />
Gehirn „kartiert“. In etwa dreißig verschiedenen<br />
Feldern im Gehirn befinden<br />
sich „Karten“ der sichtbaren Welt mit<br />
Informationen über Farbe, Bewegung,<br />
Tiefe etc.<br />
Rätselhafte Phänomene<br />
Titelgebend für rätselhafte Phänomene<br />
im Bereich Sehen und Wahrnehmung<br />
ist das Beispiel von Diane, einer Frau,<br />
die aufgrund eines Unfalls mit Kohlenmonoxid<br />
im klassischen Sinne blind ist.<br />
Als man ihr die Aufgabe stellte, einen<br />
Brief durch einen Briefschlitz zu stecken,<br />
schaffte sie das ohne Probleme,<br />
obwohl sie weder den Brief noch den<br />
Schlitz sehen konnte. Sehen kann demnach<br />
nicht nur als Abbildung eines Objektes<br />
auf der Netzhaut erklärt werden,<br />
das über die Nerven ins Gehirn weitergleitet<br />
wird, sondern umfasst komplexe<br />
Bildverarbeitungsregionen.<br />
Penfield Homunculus<br />
Foto: wikimedia.org<br />
Abb.: http://cnx.org/content/col11496/1.6/<br />
Grafiken: bennemanndesign<br />
Wie oder Was? – Zwei Datenbahnen<br />
im Gehirn<br />
Offensichtlich werden die Seheindrücke<br />
über zwei entwicklungsgeschichtlich<br />
verschieden alte Neuronenbahnen<br />
durchs Gehirn geleitet: Die genetisch<br />
ältere „Wie-Bahn“ ist für die Orientierung,<br />
das Greifen und andere räumliche<br />
Funktionen zuständig. Nähert zum<br />
Beispiel etwas möglicherweise Bedrohliches,<br />
zeigt diese Sehbahn blitzschnell<br />
die Lage des Objektes an. Körper und<br />
Kopf können sich dann reflexartig so<br />
ausrichten, dass das Objekt direkt angeblickt<br />
werden kann. Für das detaillierte<br />
Erkennen, um was für ein Objekt<br />
es sich handelt, ist die zweite Sehbahn<br />
zuständig. Diese genetisch gesehen<br />
neuere Bahn wird als „Was-Bahn“ bezeichnet,<br />
die für Objekterkennung,<br />
Farbe und feine Unterscheidungen zuständig<br />
ist. Man vermutet, dass nur die<br />
neuere Bahn zu bewusster Wahrnehmung<br />
fähig ist.<br />
Kommt es wie bei Diane durch den Unfall<br />
zur Schädigung der Was-Bahn, ist<br />
sie im herkömmlichen Sinn blind, da<br />
Brief oder Briefschlitz nicht mehr zu<br />
erkennen sind. Die Wie-Bahn funktioniert<br />
aber noch und ermöglicht ein sog.<br />
„Blindsehen“. Diana kann den Brief so<br />
halten, dass sie ihn exakt in den Schlitz<br />
wirft. Die jüngere Objekt- oder Was-<br />
Bahn macht das bewusste Wahrnehmen<br />
möglich, während die ältere Bahn<br />
die Seheindrücke für alle möglichen<br />
Arten von Verhalten nutzen kann, ohne<br />
dass sich die betroffene Person dessen<br />
bewusst ist.<br />
Optische Täuschung: Die „Blumen” nach<br />
S. Aglioti<br />
Optische Täuschungen<br />
Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen<br />
Wie- und Was-Bahn nicht reibungslos,<br />
kommt es zu optischen Täuschungen,<br />
die auch Menschen mit völlig<br />
intakten Sehbahnen wahrnehmen.<br />
Die mittleren Kreise in den Blumen<br />
von Salvatore Aglioti sind gleich groß!<br />
Trotzdem sieht derjenige, der von großen<br />
Kreisen umgeben ist, kleiner aus<br />
als jener, der von kleinen Kreisen umgeben<br />
ist. Unsere Wahrnehmung ist<br />
also nicht absolut, sondern vom Kontext<br />
abhängig. Wurden Versuchspersonen<br />
gebeten, nach den mittleren Kreisen<br />
zu greifen, öffneten sich die Finger<br />
allerdings in beiden Fällen gleich weit!<br />
Die Wie-Bahn lässt sich also nicht durch<br />
den Größenkontrast täuschen.<br />
An Erhöhungen und Vertiefungen, die<br />
aus Kreisen mit Schattierungen bestehen,<br />
kann man physikalische Deutungen<br />
der Augen gut sichtbar machen.<br />
Der einzige Unterschied zwischen den<br />
Kreisen ist, dass der eine oben dunkel,<br />
der andere oben hell ist. Unser Gehirn<br />
Optische Täuschung: Scheinbare<br />
Erhöhung und Vertiefung<br />
deutet denjenigen, der oben hell ist, als<br />
Erhöhung, den anderen als Vertiefung.<br />
Grund ist die Annahme der visuellen<br />
Regionen im Gehirn, dass Sonnenlicht<br />
immer von oben scheint, also Erhöhungen<br />
oben hell sein müssen und umgekehrt.<br />
Dreht man die Abbildung um,<br />
wandelt sich die Erhöhung in eine Vertiefung.<br />
Der blinde Fleck<br />
Rein anatomisch gesehen ist jeder<br />
Mensch zumindest in einem kleinen<br />
Bereich des Auges blind. Es handelt<br />
sich um den blinden Fleck, an dem der<br />
Sehnerv den Augapfel verlässt. Dieser<br />
wird im normalen Sehen nicht bemerkt,<br />
da er sich im einäugigen Sehen<br />
an unterschiedlichen Punkten befindet.<br />
Ein laut Ramachandran amüsanter<br />
Test, diesen blinden Fleck herauszufinden,<br />
ist das „Köpfen“, das er zur<br />
Erheiterung in langweiligen Sitzungen<br />
übte: Eine ca. drei Meter weit entfernte<br />
Person wird mit dem linken Auge angeschaut.<br />
Danach wird der Kopf waagrecht<br />
so weit nach rechts gedreht, bis<br />
der Kopf der angeschauten Person verschwunden<br />
ist. Interessanterweise entsteht<br />
dann kein Loch, sondern der Hintergrund<br />
wird ausgefüllt und zwar mit<br />
dem Muster, das die Wand hinter dem<br />
Kopf hat! Hier ergänzt also das Gehirn<br />
die unerklärliche Lücke im Bild.<br />
Die klinische Form des blinden Flecks<br />
heißt Skotom und kann größere Flächen<br />
des Blickfeldes betreffen. Auch<br />
hier ist das Gehirn in einem gewissen<br />
Rahmen in der Lage, das eigentlich<br />
lückenhafte Blickfeld mit Wahrnehmungsergänzungen<br />
auszufüllen,<br />
um ein erstaunlich komplettes Bild der<br />
Welt abzubilden. Dies ist eine nicht willentlich<br />
beeinflussbare Leistung des<br />
Sehsystems aufgrund von erfahrenen<br />
Wahrscheinlichkeiten. Es folgen viele<br />
weitere Testobjekte im Buch, die zeigen,<br />
inwieweit Muster oder Linien vom<br />
Gehirn automatisch aufgefüllt werden.<br />
Ramachandran betrachtet in humorvoller<br />
und einfühlsamer Weise Seh- oder<br />
Persönlichkeitsstörungen, Menschen<br />
mit Phantomschmerzen oder multiple<br />
Persönlichkeiten und spannt den<br />
Bogen bis hin zu der Frage, ob es einen<br />
Lachschaltkreis gibt. Eine Fülle von Erklärungen<br />
und ideenreichen Versuchen<br />
ohne große medizinische Apparaturen<br />
stellt die Gehirnforschung in ein<br />
ganz anderes Licht. Es stellt sich nach<br />
der Lektüre des Buches die Frage, ob<br />
die klassischen Methoden in Bezug auf<br />
Augenuntersuchungen und Sehschärfemessungen<br />
nicht viel zu kurz greifen<br />
und wesentliche Teile der Sehwahrnehmung<br />
unberücksichtigt lassen. Die blinde<br />
Frau, die sehen kann ist im Rowohlt<br />
Taschenbuch Verlag (5. Auflage 2002,<br />
512 Seiten, ISBN 978-3499613814) erschienen.<br />
Alexandra Wiegels<br />
12 | | 13