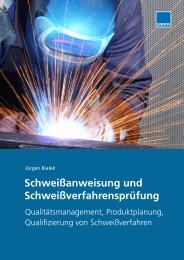SB_15.535NLP
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abschlussbericht AiF-Vorhaben Nr. 15.535N Seite - 5 -<br />
1.4 Aufgabenstellung<br />
Aufgabe ist die Bereitstellung aufgearbeiteter Daten zum abgesicherten Prozessfenster<br />
für manuelle Reparatur und Nacharbeit an elektronischen Baugruppen für den industriellen<br />
Anwender; die Absicherung mittels Zuverlässigkeitsuntersuchungen; die Aufarbeitung<br />
in Form von Bereitstellung von Informationen zum Schädigungspotential in Form von Gutund<br />
Schlechtmustern, die für Schulungszwecke geeignet sind und als Arbeitsanweisungen<br />
in Form von Bild- und Text-Katalogen als Workmanship Standards erstellt werden.<br />
2. Forschungsziel und Lösungsweg<br />
2.1 Angestrebte wissenschaftlich-technische Ergebnisse<br />
Das Ziel des Projektes ist die Erfassung von Zeit- und Temperaturverläufen beim Handlöten.<br />
Der Einfluss der Handhabungs- und Werkzeugparameter sowie des Leiterplattenaufbaus<br />
auf den Wärmeeintrag, die Wärmeableitung und das Schädigungspotential werden<br />
erfasst und simulationstechnisch beschrieben. Auf Basis der Balance von Lötwärmebedarf<br />
und Lötwärmebeständigkeit sollen die Grenzen der Prozessfenster in Zeit und Temperatur<br />
unter Einbeziehung des Wärmeübergangs vom Lötwerkzeug bzw. Wärmeträger-Medium<br />
in die Fügestelle und -teile hinein ermittelt werden; die Grenzkriterien sind dabei zum einen<br />
direkte visuelle Schädigungen, zum anderen Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit<br />
unter Temperaturzykelbeanspruchung. Zu unterscheiden ist hierbei noch die unterschiedliche<br />
Empfindlichkeit der Kupferhülsen (schnelle Temperaturzyklen sind ebenso kritisch<br />
wie langsame, entscheidend ist die Amplitude) und der Lötstellen (langsame Temperaturzyklen<br />
sind kritischer als schnelle). Im Ergebnis ist festzuhalten, welche Schwachstellen<br />
im Gesamtsystem elektronische Baugruppe unter welcher Vorbehandlung das stärkste<br />
Schädigungspotential haben, und wie Reparaturverfahren und Methodik zur größtmöglichen<br />
Schonung auszulegen sind.<br />
2.2 Angestrebte wirtschaftliche Ergebnisse<br />
Ein verfahrenstechnisch besser beschriebener Reparaturprozess ergibt eine höhere Lötsicherheit<br />
bei verringertem Schädigungspotential. Dem Fertigungspersonal werden Ursache-Wirkprinzipien<br />
vermittelt, so dass die Auswahl der geeigneten Verfahren und Werkzeuge<br />
zu verringerten Reparatur-Folgeschäden führt. Dies ist vor allem deshalb förderlich,<br />
weil üblicherweise keine Informationen zur Betriebszuverlässigkeit vorliegen, die in diesem<br />
Projekt jedoch in die Beurteilung eingeschlossen wird. Dadurch werden das Image und<br />
der wirtschaftliche Erfolg der Reparatur als prozessintegrierter beherrschter Schritt angehoben.<br />
2.3 Innovativer Beitrag<br />
Die Innovation liegt in der exakten Dokumentation des Reparaturprozesses sowohl messtechnisch<br />
als auch mittels Rechenmodellen. Für den Serienprozess geeignete Temperaturfühler<br />
und Datalogger dienen der Abstützung und Verifikation des Rechenmodells. Diese<br />
Grundlagen werden durch die Aufnahme der flächenhaften Temperaturverteilung, der<br />
Wärme-Einbringung und -Ableitung durch thermographische Aufnahmen unterstützt. In