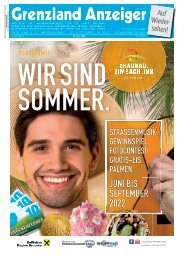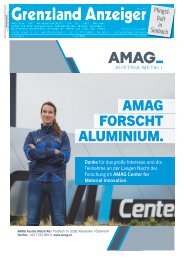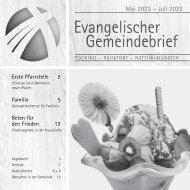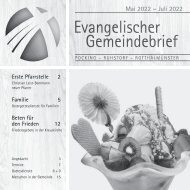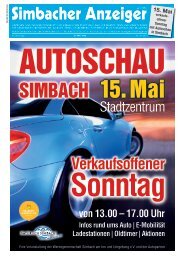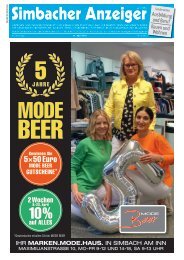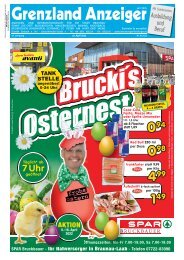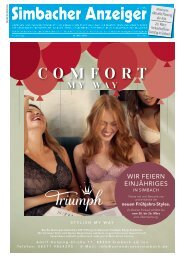Ehrenbürger Ferdinand Aufschläger sen.
Simbach a. Inn: Ehrenbürger Ferdinand Aufschläger sen.
Simbach a. Inn: Ehrenbürger Ferdinand Aufschläger sen.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Simbacher<br />
EHRENBÜRGER<br />
Ein genialer Erfinder und seiner Zeit weit voraus<br />
<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />
Teil I<br />
von Walter Geiring<br />
Unter dem Titel „Simbachs <strong>Ehrenbürger</strong>“<br />
befasst sich die aktuelle Ausgabe des Simbacher<br />
Anzeigers mit dem genialen Erfinder<br />
und Tüftler <strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />
Es war ein Sonntag, als der kleine <strong>Ferdinand</strong><br />
in Simbach gegenüber der österreichischen<br />
Stadt Braunau am 21. Januar 1855<br />
das Licht der Welt erblickte.<br />
Sein Vater war der Sohn eines Schmiedemeisters<br />
aus Hengersberg im bayerischen<br />
Wald, der Uhren und die damals<br />
noch primitiven landwirtschaftlichen Maschinen<br />
reparierte und auch neu anfertigte.<br />
An der Passauer Straße in unmittelbarer<br />
Nähe zum Simbach baute er zusammen mit<br />
seiner Frau ein Haus und errichtete eine<br />
Schmiedestätte.<br />
Zudem befasste sich sein Vater damals<br />
schon mit Wasserleitungen. Wohl aus diesem<br />
Grund bastelte der kleine <strong>Ferdinand</strong><br />
schon als Knabe sehr viele kleine Wasserräder,<br />
die mit Stampf- und Hammerwerk<br />
ausgestattet waren, lag doch das Elternhaus<br />
direkt am Simbach. Der Junge besaß<br />
auch hervorragende Schnitzfertigkeiten<br />
und konnte aus vielen hölzernen Gegenständen<br />
etwas schnitzen. Besonders gefragt<br />
waren in der Schule von seinen Klas<strong>sen</strong>kameraden<br />
seine Pfeile, da sie höher als<br />
alle anderen flogen.<br />
„Und wenn ich für meine kleinen Wassermühlen<br />
zu wenig Wasser hatte, nahm ich einen<br />
langen Schürhaken aus der Schmiede<br />
und minierte bei der Quelle mit diesem so<br />
lange, bis die nötige Wassermenge erreicht<br />
war. Dadurch habe ich schon als Knabe erfahren,<br />
dass die meisten Quellen mehr oder<br />
weniger verschüttet sind.“<br />
Mit fünf Jahren wurde der Knabe in Simbach<br />
eingeschult, leider musste er bereits<br />
ein Jahr später den schmerzlichen Verlust<br />
seines Vaters hinnehmen, der am 7. Februar<br />
1861 mit 40 Jahren starb. Unbegreiflich<br />
schlug das Schicksal zwei Jahre später erneut<br />
zu, als er seiner geliebten Mutter Elisabeth<br />
ins Grab nachschauen musste. Sie<br />
wurde nur 41 Jahre alt. Zum Glück gab es<br />
noch die jüngere Schwester seiner Mutter,<br />
welche nun die Erziehung von <strong>Ferdinand</strong><br />
übernahm und ebenso dem ein Jahr jüngeren<br />
Bruder Franz und der zwei Jahre älteren<br />
Schwester Elise eine Ersatzmutter<br />
war. Sie übernahm nicht nur die weitere Erziehung<br />
der Kinder, sondern zusammen mit<br />
einem Werkführer auch die Leitung des Geschäftes<br />
in Simbach.<br />
Mit 12 Jahren zur Schmiede-Lehre<br />
Bereits mit zwölf Jahren kam <strong>Ferdinand</strong><br />
aus der Schule und sollte in der heimischen<br />
Schmiedewerkstätte eine Lehre beginnen.<br />
Allerdings befürchtete seine Tante, dass<br />
<strong>Ferdinand</strong> zu Hause unter Anleitung des<br />
Werkführers nicht viel lernen würde, weshalb<br />
er für zwei Jahre zu seinem Onkel nach<br />
Hengersberg in die Schmiede geschickt<br />
wurde. Danach gab es durch den Bahn- und<br />
Brückenbau in Simbach sehr viel Arbeit,<br />
hauptsächlich zum Gerüstbau für die Ei<strong>sen</strong>bahnbrücke.<br />
Durch die verschiedenen Baustellen am<br />
Brückenbau konnte der wissbegierige Junge<br />
sehr viel Neues lernen. Er sah etwas vom<br />
Tiefbau, das Aufbauen der Brückenwiderlager<br />
und der fahrbaren Kräne. Besonders interessierte<br />
er sich für den Vorgang, als die<br />
Caissons zur Fundamentierung abge<strong>sen</strong>kt<br />
wurden, denn hier sah er zum ersten Mal die<br />
damalige mühselige und zeitraubende Art,<br />
die Sondierung für die Widerlager durchzu-<br />
<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger<br />
führen. Zum Verständnis: Die Gründung der<br />
Flusspfeiler erfolgte mittels Ab<strong>sen</strong>kung von<br />
Caissons/Senkkästen, des<strong>sen</strong> Oberfläche<br />
zwei Meter über den Innwasserspiegel hinausragten.<br />
Wenn der Caisson auf dem Inngrund<br />
stand, war er voll Wasser, das mittels<br />
Drucklufttechnik hinausgetrieben wurde.<br />
Nun konnte man auf dem Innschotter stehen,<br />
ohne dass einem die Schuhe nass wurden<br />
und aufgrund der Größe des Caissons<br />
bequem arbeiten. Einige Flusspfeiler mussten<br />
so über 20 Meter tief unter dem Wasserspiegel<br />
ver<strong>sen</strong>kt werden, bis sie tragfähigen<br />
Boden erreichten. In dem Senkkasten war<br />
auch eine luftdichte Einstiegskammer angebracht,<br />
damit der Schotter entleert werden<br />
und die Arbeiter aus- und einsteigen konnten.<br />
Hunderte Schmiede und Schlosser<br />
am Brückenbau beteiligt<br />
Repro: Geiring<br />
Am Bau der Ei<strong>sen</strong>bahnbrücke war <strong>Ferdinand</strong> Aufschläger beteiligt. Mit sieben Lokomotiven<br />
wurde am 22. Mai 1871 die Last geprobt<br />
Foto: Stadtchronik<br />
Es war 1869 und es gab sogar schon eine<br />
elektrische Lichtanlage mit einer zehn PS-<br />
Lokomobile. Zwei große Bogenlampen und<br />
zwei große Scheinwerfer beleuchteten<br />
nachts die Baustellen, da ununterbrochen<br />
Tag und Nacht gearbeitet wurde. Zur Stromerzeugung<br />
diente eine große Induktionsmaschine,<br />
da die Dynamomaschine damals<br />
noch nicht erfunden war. Der junge Aufschläger<br />
beobachtete auch genau, wie die<br />
Sondierungsvorarbeiten beim Bau der neuen<br />
Ei<strong>sen</strong>bahnbrücke abliefen.<br />
Bei der mit Händen vorgenommenen<br />
Sondierung waren etwa 30 Mann acht Tage<br />
lang beschäftigt. Die Granitbausteine wurden<br />
von Neuhaus und Schärding im rohen<br />
Zustand mit Fahrzeugen an die Baustelle<br />
gefahren. Aufgrund des Gewichts
Simbacher<br />
EHRENBÜRGER<br />
<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />
Fortsetzung Teil I<br />
konnte immer nur ein Stein transportiert<br />
werden. Die Steine wurden an der Baustelle<br />
weit auseinander gelagert, weil sie erst noch<br />
gebrauchsfähig bearbeitet werden mussten.<br />
Sie hatten eine Höhe von 50 Zentimeter,<br />
waren zwei Meter lang und einen Meter<br />
breit. Hunderte von Steinmetzen waren mit<br />
der Bearbeitung beschäftigt. Nachdem die<br />
Joche und Widerlager fertig gemauert wa-<br />
ren, kam die Ei<strong>sen</strong>konstruktion für die Bahnbrücke<br />
von der Firma Kramer & Klett aus<br />
Nürnberg an. Die Ei<strong>sen</strong>teile für die Brücke<br />
waren nur gelocht, da die Konstruktion zuerst<br />
auf einem Holzgerüst zusammengestellt und<br />
an Ort und Stelle mit weißglühend gemachten<br />
Ei<strong>sen</strong>nieten zusammengenietet werden<br />
musste. Für diese Arbeit waren Hunderte von<br />
Kesselschmieden und Schlosser zusätzlich<br />
anwe<strong>sen</strong>d. Laut Aufschläger war alles Handarbeit,<br />
da es Nietmaschinen noch nicht gab.<br />
Verwendet wurden nur fahrbare Kräne mit<br />
Handbetrieb.<br />
Am 22. Mai 1871 war es dann so weit. Sieben<br />
mit Eichenlaub bekränzte schwerste Lokomotiven<br />
wurden auf die Mittelfelder der<br />
Brücke gefahren und dort einen Zeit lang stehen<br />
gelas<strong>sen</strong>. Anschließend wurde mit einem<br />
Nivellierinstrument die Senkung der Brücke<br />
festgestellt, die zehn Millimeter betrug, was<br />
als vorzüglich befunden wurde. Nach der<br />
Belastungsprobe stieg die Ei<strong>sen</strong>bahnbrücke<br />
wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück.<br />
Alle Informationen über den Bau, Maße<br />
und Arbeiten wurden handschriftlich von<br />
dem technikinteressierten Knaben festgehalten.<br />
Mitte der 1890er Jahre war Aufschläger<br />
selbst mit seiner Firma im Auftrag des Bauamtes<br />
Simbach für die Straßenbrücke zwischen<br />
Simbach und Braunau mit den Sondierungsarbeiten<br />
beschäftigt. Allerdings<br />
hatte sich der geniale Erfinder dazu eine eigene<br />
Konstruktion aus Ei<strong>sen</strong>stangen zusammengestellt.<br />
Mit seiner Erfindung benötigte<br />
er viel weniger Zeit. So schafften vier<br />
Mann zehn Sondierungen in sechs Arbeitstagen.<br />
Teil II folgt
Simbacher<br />
EHRENBÜRGER<br />
Ein genialer Erfinder und seiner Zeit weit voraus<br />
<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />
Teil II<br />
von Walter Geiring<br />
Dampfmaschine machte<br />
den 14jährigen neugierig<br />
Kopfzerbrechen machte sich in jenen Tagen<br />
Aufschläger auch über die Funktionsweise<br />
der Dampfmaschine. Eine zerlegte<br />
Maschine hatte der Junge zuvor noch nicht<br />
gesehen und die damaligen Maschinisten<br />
konnten nicht befragt werden, da sie selbst<br />
nichts über die Funktion wussten. Sie waren<br />
nur für das Heizen, Schmieren und Bedienen<br />
zuständig. Im Falle einer Reparatur<br />
musste ein Monteur einer Lokomotivfabrik<br />
oder ein Mechaniker aus England zum Richten<br />
kommen.<br />
„Ich studierte das Geheimnis der Funktion<br />
Tag und Nacht bis ich es endlich herausgebracht<br />
hatte“, schreibt Aufschläger in seinen<br />
Lebenserinnerungen, der zu diesem Zeitpunkt<br />
gerade 14 Jahre alt war. Nachdem alles<br />
klar war, fertigte er ein Modell aus Holz,<br />
das in Lehm geformt wurde. Der Dampfzylinder<br />
war aus Messing. Die Konstruktion<br />
befestigte er auf einer Ei<strong>sen</strong>platte.<br />
Bei der ersten Inbetriebnahme kam die<br />
Maschine voll auf Touren und brummte so<br />
laut, dass er sich hinter eine Mauer stellte<br />
und sie austoben ließ. Es war dies die<br />
Kriegszeit 1870/71, in der in Simbach ununterbrochen<br />
an Bahnbrücken und Gebäudebau<br />
gearbeitet wurde und die Leute durchwegs<br />
gut verdienten und gut zu es<strong>sen</strong> hatten,<br />
schrieb Aufschläger weiter.<br />
Kurz nach den kriegerischen Auseinandersetzungen<br />
wurde vor dem Anwe<strong>sen</strong> in<br />
der Passauer Straße ein Brunnen mit dem<br />
Namen „Sedansbrunnen“ aufgestellt, der<br />
an die entscheidende Schlacht gegen<br />
Frank reich erinnern sollte. Es gab eine öffentliche<br />
Feier mit vielen Reden, allerdings<br />
gab der Brunnen kein Wasser. Die Quelle<br />
entsprang bei den Pichlmeier`schen Anwe<strong>sen</strong><br />
und lief am alten Krankenhaus an der<br />
Pfarrkirchner Straße vorbei die ganze Innstraße<br />
entlang bis zur Innbrücke. Angeschlos<strong>sen</strong><br />
waren alle Anwe<strong>sen</strong> entlang dieser<br />
Quelle. Laut den Aufzeichnungen von<br />
Aufschläger bestanden die Leitungen aus<br />
Holzröhren, welche bereits zum Teil verfault<br />
waren. So kam es, dass ausgerechnet am<br />
Tag der Feierlichkeiten kein Wasser zur Verfügung<br />
stand und auch die Anwe<strong>sen</strong> entlang<br />
der Innstraße über kein Wasser verfügten.<br />
Der junge Aufschläger nahm dies zum<br />
Anlass, im Keller seines Hauses einen Brunnen<br />
zu graben, um für den Notfall Wasser zu<br />
haben. Die Bohrungen gestalteten sich nicht<br />
einfach, da lediglich zweieinhalb Meter<br />
Raumhöhe bis zum Gewölbe zur Verfügung<br />
standen. Aus diesem Grund mussten vom<br />
Keller bis zum Dach Löcher durch die Decken<br />
geschlagen werden, damit man das<br />
Gestänge ausziehen und in das Bohrloch hineinlas<strong>sen</strong><br />
konnte.<br />
Bei den Bohrungen kam er auf eine schief<br />
gelagerte Mergelschicht. Doch der unternehmungslustige<br />
Bursch gab nicht auf. Er<br />
bohrte in den Mergel hinein und traf in 40<br />
Metern Tiefe auf eine unter Druck stehende<br />
wasserführende Schicht, sodass ein artesischer<br />
Brunnen entstand. Das erbohrte<br />
Wasser stieg so hoch über den Keller hinaus,<br />
dass es in der Waschküche, wo sich<br />
auch der Gemeindewasserauslauf befand,<br />
zwei Meter über dem Boden stand. Nun<br />
wusste der mittlerweile 17-Jährige, dass<br />
man in der Inn- und Bachstraße erfolgreich<br />
nach artesisch gespanntem Wasser bohren<br />
kann.<br />
Erste Wasserbohrungen<br />
machten Bevölkerung aufmerksam<br />
Erst richtig anerkannt wurde Aufschläger,<br />
als er 1873 für den Metzger Brodschelm<br />
nach Wasser bohrte, da die Gemeinde einen<br />
Anschluss an die Gemeindewasserleitung<br />
nicht erlaubte. Der junge Tüftler machte ihm<br />
den Vorschlag, nach einem artesischen<br />
Brunnen zu bohren. „Da ich ihm laufendes<br />
Wasser garantierte, war er sogleich einverstanden.<br />
Ich hatte eine Maschine mit Seilzug<br />
und konnte einige Tage später anfangen“,<br />
erinnerte sich Aufschläger. Die Bohrarbeiten<br />
an einem öffentlichen Platz erregten<br />
großes Aufsehen, da niemand dem<br />
jungen Mann mit seinem neuen Unternehmen<br />
einen Erfolg zutraute. Nach sechs Tagen<br />
kam die große Überraschung. In 40 Metern<br />
Tiefe stieß man auf Wasser, das mit<br />
einem so hohen Druck aus dem Boden<br />
schoss, dass es die Höhe des Wohnhauses<br />
von sieben bis acht Metern erreichte. Aufschlägers<br />
erster artesischer Brunnen in<br />
Die Werkstätte mit Schmiede und Dreherei<br />
Ein Aufschläger-Windmotor<br />
fremden Auftrag brachte 40 Liter in der Minute.<br />
Nun war der Durchbruch geschafft.<br />
Durch die<strong>sen</strong> Erfolg stieg der 18-jährige<br />
Simbacher zum anerkannten Wasserfachmann<br />
auf und wurde von nun an von technischen<br />
Beamten und Bauingenieuren eingeladen,<br />
um die studierten Herren über geologische<br />
und physikalische Verhältnisse der<br />
Region zu unterrichten. Die Brunnenbohrung<br />
im Anwe<strong>sen</strong> des Metzgers Brod-<br />
Fotos: Geiring
schelm im Jahre 1873 war also der erste<br />
Brunnenbohrauftrag des <strong>Ferdinand</strong>-Aufschläger-Betriebes.<br />
Mit unablässigem Selbststudium und Arbeit<br />
im Tiefbohr- und Wasserversorgungsfach,<br />
fügte von da ab der Gründer Stein auf<br />
Stein, um dem Betrieb ein Fundament zu<br />
geben, das ihn gute und schlechte Zeiten<br />
überdauern ließ.<br />
Auf Erdgas gestoßen<br />
Simbacher<br />
EHRENBÜRGER<br />
<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />
Fortsetzung Teil II<br />
Bei den Bohrungen nach Wasser stieß<br />
Aufschläger aber auch auf Erdgas. So wie<br />
Jahre später am neuen Firmensitz in unmittelbarer<br />
Nähe des Hotels „Alte Post“, dem<br />
späteren Kaufhaus Stock & Steubl. Am<br />
Standort des jetzigen Café Dali befand sich<br />
die spätere Werkstatt.<br />
Durch die Bohrung vom 19. Juni 1897<br />
stieß man in 300 Metern Tiefe auf so viel<br />
Erdgas, dass damit nicht nur die Wohnung,<br />
sondern auch ein mehrpferdekräftiger Motor<br />
angetrieben werden konnte, hieß es in den<br />
Tagesmeldungen. Bereits sechs Jahre zuvor<br />
war der Hydrotechniker in Wels/Österreich<br />
fündig geworden. Bei den Bohrungen<br />
stieß man neben Wasser auch auf Erdgas.<br />
Simbachs erste Hochräder<br />
mit Spezialbereifung<br />
Anfang der 1870er Jahre baute er zusammen<br />
mit seinem Bruder Franz ein Hochrad.<br />
Sie hatten die Möglichkeit zwei moderne<br />
Hochräder zu sehen, als zwei Franzo<strong>sen</strong> zu<br />
einer Wettfahrt von Paris nach Wien innerhalb<br />
von acht Tagen in Simbach einen Zwischenstopp<br />
im Hotel „Alte Post“ einlegten<br />
und die Räder an der Außenwand des Hotels<br />
stehen ließen. Nur eineinhalb Stunden hatten<br />
die zwei Brüder Zeit die Räder genau zu besichtigen<br />
und Skizzen anzufertigen.<br />
Bereits am nächsten Tag ging die Arbeit los<br />
und nach vier Wochen war das erste Fahrrad<br />
fertig, allerdings mit Ei<strong>sen</strong>reifen. Die beiden<br />
französischen Räder besaßen Vollgummibereifung.<br />
Über einen Rei<strong>sen</strong>den wurden zwei<br />
Gummireifen aus Paris bestellt, nachdem die<br />
kürzlich gegründete Firma Metzeler die Reifen<br />
nicht liefern konnte. Die bestellte Reifengarnitur<br />
kostete 100 Mark. Leider war die gelieferte<br />
Bereifung viel kleiner, sodass die Brüder<br />
sie mit Gewalt dehnen mussten, um sie<br />
auf die Räder aufziehen zu können.<br />
Anfangs hielten sie gut, aber beim Fahren<br />
stellte sich heraus, dass dies doch nicht der<br />
Fall war, da sie beim Brem<strong>sen</strong> absprangen. Irgendwie<br />
musste man die Reifen befestigen.<br />
Leider half hier auch kein Harz und Schellack.<br />
Schließlich kam <strong>Ferdinand</strong> die Idee, die eisernen<br />
Hohlreifen mit einem glühenden Ei<strong>sen</strong><br />
in kurzen Teilen so stark anzuwärmen, dass<br />
der Gummi an dem Hohlreifen angeschmolzen<br />
wurde und dadurch rundherum einen<br />
festen Halt bekam. Ein auf diese Weise angeschmolzener<br />
Reifen konnte man nur noch mit<br />
Gewalt wieder herunterreißen. Von da an<br />
funktionierte es. Es kamen Räder aus England<br />
und Frankreich, die auf diese Weise mit<br />
den Gummireifen bestückt wurden. „Dieses<br />
‚ankitten‘ war längere Zeit unser Geheimnis“,<br />
schreibt <strong>Ferdinand</strong> in seinen Aufzeichnungen<br />
aus dem Jahr 1927.<br />
Nach diesem Erfolg wurden Dutzende<br />
Fahrräder für die Kundschaft gemeinschaftlich<br />
hergestellt. Bruder Franz gründete ein<br />
Geschäft zur Fabrikation von Fahrrädern sowie<br />
einen Nähmaschinenhandel und Reparaturservice.<br />
Das Tiefbohr- und Wasserleitungsgeschäft<br />
sowie die Reparaturwerkstätte<br />
für große Maschinen samt der Fabrikation<br />
für Windmotoren fiel in den Bereich<br />
von <strong>Ferdinand</strong>.<br />
Diese Änderungen fielen in das Jahr<br />
1882, in dem <strong>Ferdinand</strong> Anna Groß aus<br />
Simbach heiratete, die ihm am 14. März<br />
1883 einen Sohn schenkte, der auch auf den<br />
Namen <strong>Ferdinand</strong> getauft wurde. Ergänzt<br />
wurde die Familie durch Schwester Anna,<br />
die am 19. März 1886 auf die Welt kam. Sie<br />
heiratete später Postinspektor Schröder,<br />
starb allerdings nach kurzer Ehe und hinterließ<br />
Sohn Georg, der im Hause seiner Großeltern<br />
aufwuchs und als Oberlehrer in Simbach<br />
am 29. Oktober 1961 starb. Aus der<br />
Ehe mit Hedwig Schröder entsprang Sohn<br />
Reinhold Schröder, den viele Simbacher<br />
Schülergenerationen als Lehrer der Hauptschule<br />
noch gut in Erinnerung haben. Schröder<br />
verstarb am 12. Juni 2019 und fand seine<br />
letzte Ruhestätte auf dem Friedhof in<br />
Triftern.<br />
Teil III folgt
Simbacher<br />
EHRENBÜRGER<br />
Ein genialer Erfinder und seiner Zeit weit voraus<br />
<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />
Teil III<br />
von Walter Geiring<br />
Sauberes Wasser für Simbach<br />
Anfang der 1890er Jahren arbeiteten die<br />
Brüder, obwohl sie getrennte Geschäfte hatten,<br />
an der Erfindung von Motorrädern. Hierüber<br />
berichtete der Simbacher Anzeiger bereits<br />
in der Ausgabe vom 1. März 2020. Die<br />
Firma entwickelte sich zusehends und der<br />
Fachmann für Tiefbohr-, Brunnenbau und<br />
Wasserversorgung war nicht nur zwischen<br />
Mühldorf und Passau gefragt, sondern auch<br />
im ganzen Innviertel.<br />
„Ich kam auch viel in Ober- und Niederösterreich<br />
sowie in Tirol und der Steiermark<br />
herum und leistete dort immer erfolgreiche<br />
Arbeit“, so der Simbacher Pionier. Anfragen<br />
gab es sogar aus den Balkanländern wie<br />
Rumänien, Bosnien und Siebenbürgen.<br />
Nachdem aber zu dieser Zeit Rei<strong>sen</strong> mit die<strong>sen</strong><br />
Entfernungen mindestens acht Wochen<br />
dauerten, verzichtete Aufschläger auf die<br />
Aufträge, um die heimische Arbeit nicht zu<br />
unterbrechen. Er befürchtete, dass es dann<br />
zu Hause mehr Schaden und Verdruss gegeben<br />
hätte.<br />
Als den größten Erfolg seines Lebens bezeichnete<br />
er die Versorgung seiner Heimatgemeinde<br />
mit einwandfrei sauberem Wasser.<br />
Es hatte viel Mühe gekostet die politisch<br />
Verantwortlichen von dem Vorhaben zu<br />
überzeugen. Es war eine verborgene Quelle<br />
mit einem rie<strong>sen</strong>großen Einzugsgebiet im<br />
Wald, die 70 Meter höher als die Innstraße<br />
lag. Durch seine langjährige Erfahrung<br />
konnte er die Quelle lokalisieren, wenngleich<br />
die Herren der Gemeinde Simbach<br />
damals von der Ergiebigkeit und an den Erfolg<br />
der Bohrung nicht geglaubt hatten. Erst<br />
nach langem hin und her übernahm der Geschäftsmann<br />
die Garantie und so konnte<br />
man mit den Bohrarbeiten beginnen.<br />
Rund 350 Meter lange Schlitze mussten<br />
die Arbeiter auf der Heinzelspitze graben,<br />
bis die Quelle erschlos<strong>sen</strong> war. Am Ende lieferte<br />
sie 1100 Liter in der Minute. „Das Wasser<br />
war von Anfang an tadellos rein, hatte<br />
nur sieben Grad Celsius Wärme und ganz<br />
wenig Mineralien, also für den menschlichen<br />
Genuss ganz vorzüglich“, so die erste<br />
Analyse. Für dieses Bravourstück erhielt<br />
Aufschläger am 14. März 1928 das <strong>Ehrenbürger</strong>recht<br />
der Gemeinde Simbach verliehen.<br />
Zudem wurde die Straße zu dem Wasserreservoir<br />
in „<strong>Ferdinand</strong>-Aufschläger-<br />
Straße“ benannt.<br />
Nicht unerwähnt soll in der Biografie von<br />
<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger bleiben, dass er<br />
durch höchst amtliche Verleihungsurkunde<br />
des Oberbergamt München die Erlaubnis<br />
besaß, auf seinen Grundstücken nach Öl,<br />
Bitumen und anderen Bodenschätzen zu<br />
graben. Die Bergwerkgerechtsame, also die<br />
Berechtigung für den Abbau von Bodenschätzen,<br />
stammt aus dem Jahr 1919. Die<br />
Grube erhielt den Namen Anna Johanna,<br />
wie der Name seiner Mutter.<br />
Firmenerweiterung<br />
mit Autohandel und Tankstelle<br />
Sohn <strong>Ferdinand</strong> wurde Diplomingenieur<br />
und arbeitete ab 1902 zusammen mit seinem<br />
Vater. Im Jahr 1908 wurde die Firma in<br />
„<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger und Sohn“ umbenannt.<br />
Mit Sohn <strong>Ferdinand</strong> sollte das Geschäft<br />
in die Zukunft geführt werden. Seiner<br />
Umsicht und Tatkraft war es zu verdanken,<br />
als er nach vierjähriger Kriegsdienstzeit im<br />
<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger mit Pfeife um 1940<br />
Ersten Weltkrieg (1914-1918) als Unteroffizier<br />
der königlich bayerischen Armee des<br />
Etappen-Kraftwagen Park 6 die Geschäftsführung<br />
übernahm, dass die gefährlichen<br />
Klippen der Nachkriegszeit mit ihrer Inflation<br />
und Deflation sowie die folgenden Jahre<br />
der Arbeitslosigkeit glücklich umschifft<br />
werden konnten.<br />
Um über die schweren Zeiten hinwegzukommen,<br />
gliederte <strong>Ferdinand</strong> jun. das Autoreparatur-<br />
und Auto-Handelsgeschäft für<br />
BMW und Adler samt Tankstelle an den Betrieb<br />
an. Auch wenn er in der Öffentlichkeit<br />
nicht so sehr in Erscheinung trat und im<br />
Schatten seines Vaters stand, so war er es,<br />
der den Betrieb durch die schwersten und<br />
schwierigsten Jahre hindurch geführt hatte.<br />
Mit 51 Jahren auf dem Höhepunkt seines<br />
Lebens und am Beginn der für ihn leichteren<br />
Jahre wurde er durch einen Schlaganfall<br />
leider am 16. Januar 1935 hinweggerafft.<br />
Durch den tragischen Tod war der<br />
Aufschläger‘sche Betrieb nun über Nacht<br />
verwaist. Wie sollte es mit den Betrieb nun<br />
weitergehen? Der Firmengründer war bereits<br />
80 Jahre alt und konnte und wollte keine<br />
Verantwortung mehr übernehmen.<br />
Otto Zottmaier<br />
übernimmt das Familienunternehmen<br />
Werkstatt 1946 am Simbach gegenüber der heutigen Bäckerei Braumiller<br />
Fotos: Geiring<br />
Aus der Ehe mit Jeanette Aufschläger im<br />
Jahr 1908, einer geborenen Stolz-Tochter,<br />
gingen die beiden Töchter Anni und Jeanette<br />
hervor. Während die Ehe von Tochter Anni<br />
mit Bankdirektor Franz Lagger kinderlos<br />
blieb, entsprang aus der Verbindung
Simbacher<br />
EHRENBÜRGER<br />
<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />
Fortsetzung Teil III<br />
war Geschäftsführer einer Brauerei, eines Kinos<br />
und einer Versicherung.<br />
Dennoch nahm der Kaufmann die große<br />
Herausforderung an und erledigte die Arbeiten<br />
nebenberuflich zu seiner eigentlichen Arbeit<br />
von München aus. Nach kurzer technischer<br />
Einweisung durch den Seniorchef und<br />
seiner Mitarbeiter sowie der weiteren Unterstützung<br />
durch seine Schwägerin Anni, welche<br />
einige Jahre bereits den Büroteil des Betriebes<br />
führte und sehr gute Kontakte zur<br />
treuen Belegschaft hatte, wurde der Betrieb<br />
durch Zottmaier im kleinsten Rahmen ohne<br />
Autowerkstätte weitergeführt. Bereits nach<br />
kurzer Zeit war Anni die führende Kraft im Innendienst<br />
und Senior-Bohrmeister Josef<br />
Schreiner im Außendienst tätig.<br />
Abermals traf 1937 eine Krise im Betrieb<br />
ein, als Aufschläger-Tochter Anni plötzlich<br />
verstarb. Von da an übernahm Zottmaier<br />
komplett die Zügel des Betriebes gemeinsam<br />
mit dem alten Stamm der Bohrmeister und<br />
dem neu eingestellten technischen Leiter Ingenieur<br />
Lordt. Mithilfe seiner Frau Jeanette<br />
ging es nun hauptsächlich wieder an den Aufund<br />
Ausbau des Betriebes als ausschließliches<br />
Tiefbohr-, Brunnen- und Wasserverder<br />
zweiten Tochter Jeanette mit Otto Zottmaier<br />
die vier Kinder Otto-<strong>Ferdinand</strong>, Siegfried,<br />
Helma und Susanne. Nach dem plötzlichen<br />
Tod des Sohnes von Franz Aufschläger<br />
stand nun die Frage im Raum, was mit<br />
dem Familienunternehmen geschehen<br />
sollte. Auflö<strong>sen</strong>, verpachten oder verkaufen?<br />
Als einziges männliches Mitglied der Familie<br />
Aufschläger war nun die Reihe an Otto<br />
Zottmaier, dem Schwiegersohn seines verstorbenen<br />
Sohnes <strong>Ferdinand</strong>. Allerdings<br />
hatte sich Otto Zottmaier nie groß mit dem<br />
Aufschläger`schen Betrieb und Besitz auseinandergesetzt,<br />
da er als Kaufmann in leitender<br />
Position ganz andere Pläne und zudem<br />
mit Technik nicht viel zu tun hatte. Er<br />
sorgungs-Betrieb. Im Zuge des Ausbaus<br />
wurde Sitz und Leitung nach München verlegt,<br />
das Stammhaus in Simbach jedoch<br />
beibehalten und eine Zweigniederlassung in<br />
Braunau errichtet.<br />
1941 wurde die Firma in eine Familien-<br />
Kommandit-Gesellschaft umgewandelt, deren<br />
persönlich haftender und geschäftsführender<br />
Gesellschafter Otto Zottmaier war.<br />
Am 25. Mai 1942 durcheilte die Trauerkunde<br />
den Ort, dass <strong>Ferdinand</strong> Aufschläger,<br />
schnell und unerwartet im Alter von 87 Jahren<br />
verschied.<br />
„Ein schönes Stück Ortsgeschichte hat<br />
der Verstorbene miterlebt und er sah Simbach<br />
entstehen aus noch kleinen Anfängen<br />
heraus bis zu seiner jetzigen Gestalt“, hieß<br />
es damals in der Simbacher Zeitung. Aufschläger<br />
wurde nach dem Trauergottesdienst<br />
in der Pfarrkirche St. Marien in der Familiengruft<br />
im Simbacher Friedhof beerdigt.<br />
Über die weitere Entwicklung des Betriebes<br />
unter Otto Zottmaier befasst sich eine<br />
der nächsten Ausgaben des Simbacher<br />
Anzeigers. Er erhielt 1974 den Ehrenring der<br />
Stadt und wurde 1979 mit der <strong>Ehrenbürger</strong>schaft<br />
der Stadt am Inn ausgezeichnet.