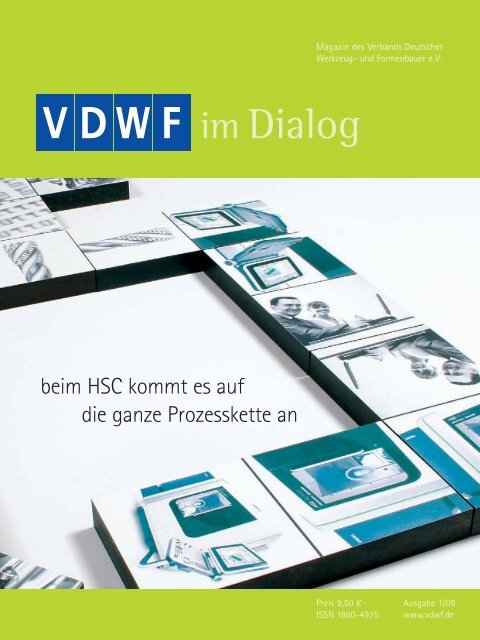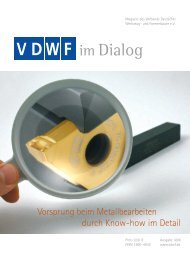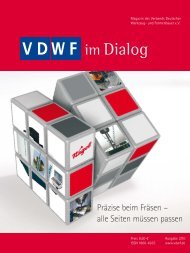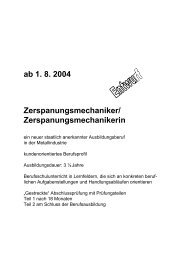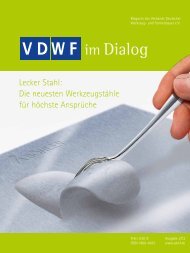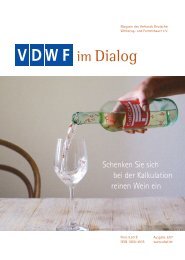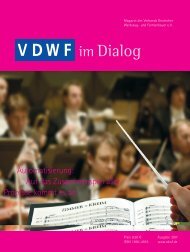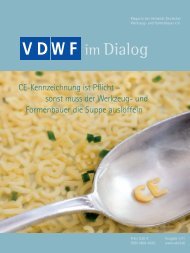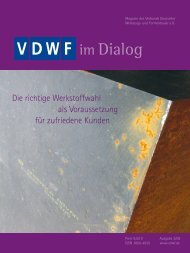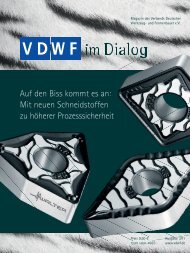VDWF im Dialog 1/2008
VDWF im Dialog 1/2008
VDWF im Dialog 1/2008
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
e<strong>im</strong> HSC kommt es auf<br />
die ganze Prozesskette an<br />
Magazin des Verbands Deutscher<br />
Werkzeug- und Formenbauer e.V.<br />
Preis 9,50 € Ausgabe 1/08<br />
ISSN 1860-4935 www.vdwf.de
e<strong>im</strong> HSC kommt es auf<br />
die ganze Prozesskette an<br />
Magazin des Verbands Deutscher<br />
Werkzeug- und Formenbauer e.V.<br />
Preis 9,50 € Ausgabe 1/08<br />
ISSN 1860-4935 www.vdwf.de
Liebe Leser, liebe Verbandsmitglieder,<br />
das vergangene Jahr war für den deutschen Werkzeugbau ein Jahr der Hochkonjunktur.<br />
Dabei waren die Auftragsbücher der Werkzeugbaubetriebe voll und die Kapazitäten<br />
ausgelastet, um nur zwei Beispiele für die positiven Entwicklungen zu nennen. Bei aller<br />
Freude darf zum Beginn des Jahres <strong>2008</strong> jedoch nicht übersehen werden, dass sich die<br />
Unternehmen des deutschen Werkzeugbaus in einer Phase des fundamentalen Wandels<br />
befinden. Gerade jetzt ist es für den deutschen Werkzeugbau unabdingbar, aus der<br />
Vielzahl von Aufträgen langfristige Kundenbeziehungen zu entwickeln. Um eine hohe<br />
Kundenbindung zu erreichen, muss neben einer Reaktion auf die veränderten Marktbedingungen<br />
vor allem die Konkurrenz dieses globalen Marktes langfristig “abgewehrt”<br />
werden. Bildlich gesprochen kann die Abwehr dieser stetig lauernden “Vampire” nur<br />
mit dem Einsatz eines geeigneten “Knoblauchs” erfolgen.<br />
“Vampirabwehr” <strong>im</strong> Werkzeugbau: Strategische und operative Exzellenz sind zu unabdingbaren<br />
Basisfaktoren geworden, um <strong>im</strong> heutigen globalen Wettbewerb bestehen zu<br />
können. Deutsche Werkzeugbauunternehmen müssen sich industrialisieren, eine Marke<br />
aufbauen und sich mit innovativen Kombinationen aus Produkten und Dienstleistungen<br />
von der Konkurrenz abheben, um Premiumpreise zu rechtfertigen. Bereits heute bieten<br />
deutsche Werkzeugbaubetriebe eine Fülle an Zusatzleistungen an, um die Wünsche des<br />
Kunden zu erfüllen. Das angebotene Spektrum an Zusatzleistungen beschränkt sich dabei<br />
auf die frühen Phasen <strong>im</strong> Produktlebenszyklus des mit dem Werkzeug herzustellenden<br />
Artikels. Viele Werkzeugbauer begleiten den Kunden darüber hinaus bis zum Serienanlauf<br />
des Artikels und übernehmen in diesem Zusammenhang oft die Abst<strong>im</strong>mung des<br />
Gesamt systems aus Produktionsmaschine, Werkzeug und Peripheriegeräten. Durch das<br />
eigene <strong>im</strong>plizite Knowhow kann dem Kunden bereits in der Entstehungsphase des<br />
Artikels ein deutlicher, allerdings schwer quantifizierbarer Mehrwert geschaffen werden.<br />
Wie muss der “Knoblauch” eingesetzt werden? Die vom Werkzeugbau angebotenen<br />
SupportProzesse sind mit einer Vielzahl an Zusatzleistungen verbunden, welche bisher<br />
nur selten separat in Rechnung gestellt werden. Damit diese Zusatzleistungen dem<br />
Kunden als eigenständige Dienstleistungen angeboten und verkauft werden können,<br />
muss der Werkzeugbau zum einen sein Leistungsangebot auf die Nutzungs und Ausmusterungsphasen<br />
des Werkzeugs ausdehnen und zum anderen die angebotenen<br />
Dienstleistungen systematisch und kundenorientiert entwickeln. Neben der Konzentration<br />
auf den technologischen Vorsprung sind die Erweiterung des Leistungsspektrums durch<br />
geeignete Dienstleistungsangebote sowie die aktive Vermarktung der hoch wertigen<br />
Eigenschaften eigener Leistungen unabdingbar.<br />
Der Einsatz des “Knoblauchs” erfordert somit einen Paradigmenwechsel <strong>im</strong> Werkzeugbau:<br />
Das technologisch hervorragende deutsche Werkzeug muss zur Gewinnung und Bindung<br />
von Kunden dienen, die begleitenden Dienstleistungen stellen den Erfolgsfaktor dar, der<br />
in Kombination mit den Werkzeugen Einzigartigkeit schafft und dem Werkzeugbau den<br />
unternehmerischen Erfolg sichert. Um sich mit Dienstleistungen erfolgreich vom Wettbewerb<br />
differenzieren zu können und gleichzeitig das Ertragspotenzial über den gesamten<br />
Lebenszyklus des Werkzeugs nutzen zu können, müssen Werkzeugbaubetriebe ihr Angebot<br />
systematisch strukturieren und kommunizieren. Durch technische Lösungen kann<br />
dann auch die Kundenbindung zusätzlich gesteigert werden, zum Beispiel indem Bauteile<br />
mit hohem Verschleiß als fertige Austauschmodule angeboten werden.<br />
Ich wünsche Ihnen allen für das Jahr <strong>2008</strong> viel Erfolg bei der Anwendung des “Knoblauchs”,<br />
vor allem bei den Herausforderungen der Industrialisierung, der Servicekonzeption<br />
und des aktiven Marketings.<br />
Mit herzlichen Grüßen aus Aachen<br />
Ihr Günther Schuh<br />
Prof. Dr.Ing. Dipl.Wirt. Ing. Günther Schuh,<br />
Direktor des Werkzeugmaschinenlabors (WZL)<br />
der RWTH Aachen und des FraunhoferInstituts<br />
für Produktionstechnologie IPT
Mit sieben Produktlinien <strong>im</strong> Fräsen unterstreicht<br />
der GildemeisterKonzern einen hohen Anspruch:<br />
Weltmarktführer <strong>im</strong> 5AchsFräsen zu sein. Auf<br />
dieser Position besteht nur, wer laufend Ideen<br />
in Produkte umsetzt. Unter den Neuheiten finden<br />
sich auch solche, die für den Werkzeug und<br />
Formenbau besonders interessant sind.<br />
Österreich, der kleine Nachbar? Davon kann<br />
längst keine Rede mehr sein. Seit seinem EU<br />
Beitritt 1995 hat es das Land durch überdurchschnittliches<br />
Wachstum unter die fünf reichsten<br />
EULänder geschafft und gehört weltweit zu<br />
den zehn Industrieländern mit dem höchsten<br />
ProKopfEinkommen. Und dieser Trend soll<br />
anhalten.<br />
Was haben Fußball und der Werkzeug und<br />
Formenbau gemeinsam? Silvia Neid, Bundestrainerin<br />
der Fußballnationalmannschaft der Frauen,<br />
erläutert uns ihre Sicht der Dinge.<br />
Innovation und Technik<br />
DMG: HSCBearbeitung 18<br />
Faßnacht: Das neue Selbstbewusstsein der Formenbauer 24<br />
BBG: “EuroMold Award” in Silber 30<br />
Gegenüberstellung: Sandfräsen vs. Handformen 32<br />
Direct Texturing: Oberflächenstruktur mit Fräsmaschine 34<br />
HoloImpact: Explosiver Plagiatschutz 36<br />
Zinkdruckguss: Gießlaufsystem el<strong>im</strong>iniert Anguss 38<br />
Unternehmen stellen Neues aus der Branche vor 40<br />
Wissen und Nachwuchs<br />
Unternehmenskommunikation: Corporate Design 12<br />
Märkte und Chancen<br />
MesseVorberichte 50<br />
SKZ: Werkzeugkonstrukteure mit Zertifikat 52<br />
EuroMold 2007: Ein studentischer Messebericht 53<br />
Ländervergleich: Deutschland vs. Österreich 54<br />
Automobilzulieferindustrie: Keine Atempause 60<br />
Produkt und Design<br />
Produkte aus Metallguss: Warum? 6<br />
Menschen und Wandel<br />
Antrieb: Im Gespräch mit Silvia Neid 42<br />
Ansichten: Vom richtigen Umgang mit Geld 46<br />
Recht und Rahmen<br />
Unternehmensteuerreform <strong>2008</strong> 16<br />
Freizeit und Kultur<br />
Lyonel Feininger – ein Amerikaner <strong>im</strong> Thüringer Land 64<br />
Verband und Netzwerk<br />
Firmenvorstellung 68<br />
Neues aus dem Verband 72<br />
Editorial 3<br />
Impressum 74<br />
Vorschau 74<br />
Bildnachweise 74
Die Bobinger Firma Faßnacht hat den “Excellence<br />
in Production Award 2007” des aachener werkzeugbaus<br />
gewonnen und wird zum besten<br />
Werkzeugbau des Jahres 2007 ernannt. Dieses<br />
Ereignis war für uns mehr als genug Anlass,<br />
das <strong>VDWF</strong>Mitglied <strong>im</strong> schwäbischen Bobingen<br />
zu besuchen und mit Wolfgang Faßnacht über<br />
die Gehe<strong>im</strong>nisse seines Erfolges zu sprechen.<br />
Designern und Entwicklern steht bei der Konzeption<br />
neuer Produkte eine große Bandbreite an<br />
Materialien zur Verfügung. Wir haben uns nach<br />
gut gestalteten Produkten umgesehen, die aus<br />
Metall <strong>im</strong> Gussverfahren hergestellt wurden,<br />
und wollen wissen, welchen Einfluss die Wahl<br />
des Materials auf das Produkt hat. Geht es um<br />
die Leichtigkeit eines Teils, um eine besondere<br />
Gestaltqualität, die nur durch den Einsatz von<br />
Metall erreicht werden kann, oder eröffnet das<br />
Herstellungsverfahren besondere Konstruktions<br />
und Formmöglichkeiten?<br />
DENKEN SIE BEI<br />
SAUBEREN WERTEN<br />
AUCH AN<br />
SCHODER?<br />
Prägewerkzeuge von Schoder<br />
für gestochen scharfe, saubere Informationen<br />
auf Katalysatoren und Schalldämpfern<br />
Millionen von Teilen in der Kfz-Produktion erhalten bereits in<br />
den Gussformen Prägungen mit Teilen von Schoder.<br />
Ob auf Katalysatoren, Bremsen, Motorteilen oder <strong>im</strong> Kunststoff-<br />
Formguss – entdecken auch Sie die Vorteile extrem gehärteter<br />
Prägewerkzeuge, die Genauigkeit durch den Einsatz von Lasertechnologie<br />
und die Vielseitigkeit von Schoder.<br />
Auch bei Klein- und Kleinstserien und in der Einzelfertigung<br />
können Sie mit Schoder planen!<br />
Mehr über Codierwerkzeuge und Formteile erfahren Sie unter<br />
www.schoder.com oder in einem persönlichen Gespräch:<br />
+49 (0)6103 5071-0<br />
Schoder GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 19, 63225 Langen
Produkt und Design<br />
Produkte aus Metallguss – warum?<br />
von Dipl.Ing. Anke Lorber<br />
Designern und Entwicklern steht bei der<br />
Konzeption neuer Produkte eine große<br />
Bandbreite an Materialien zur Verfügung.<br />
Wir haben uns nach gut gestalteten<br />
Produkten umgesehen, die aus Metall<br />
<strong>im</strong> Gussverfahren hergestellt wurden, und<br />
wollen wissen, welchen Einfluss die Wahl<br />
des Materials auf das Produkt hat. Geht<br />
es um die Leichtigkeit eines Teils, um eine<br />
besondere Gestaltqualität, die nur durch<br />
den Einsatz von Metall erreicht werden<br />
kann, oder eröffnet das Herstellungsverfahren<br />
besondere Konstruktions und<br />
Formmöglichkeiten?
Chair One<br />
Die Arbeit des international bekannten Münchener<br />
Designers Konstantin Grcic bringt <strong>im</strong>mer wieder<br />
Entwürfe hervor, die die Beschränkungen, aber<br />
auch Möglichkeiten eines jeweils eingesetzten<br />
Materials aufzeigen – ein ehrlicher Umgang mit<br />
Material ist <strong>im</strong>mer das Ziel.<br />
Ein Stuhl aus Aluminiumdruckguss – das war die<br />
Idee des italienischen Herstellers Magis für eine<br />
Zusammenarbeit mit Grcic. Mit dem Entwurf<br />
des “Chair One” ist dem Designer eine besonders<br />
schwierige Gratwanderung gelungen. Der Stuhl<br />
hat durch die “offene”, skelettartige Struktur<br />
eine sichtbare Leichtigkeit und zugleich Schärfe,<br />
bietet aber trotzdem angenehmen Sitzkomfort.<br />
Die besondere geometrische Form der Sitzschale<br />
ist einprägsam – ein starkes Bild, das durch die<br />
in einem Stück gegossene Schale entsteht. Aufgelöst,<br />
perforiert, zugleich als Monolith verstanden,<br />
wird die Herstellungsmethode Mittel zur<br />
Verdeutlichung des Charakters. Undenkbar, dass<br />
einzelne Stäbe zu einem ganzen verschweißt<br />
werden.<br />
Grcic verwendete be<strong>im</strong> “Chair One” erstmals<br />
DruckgussAluminium, das mit fluoriertem Titan<br />
oberflächenbehandelt und mit einer Polyesterlackierung<br />
versehen wurde. Die Farbigkeit der<br />
Metallschale unterstützt die Signifikanz des<br />
“Chair One” – Stuhl eins, aus einem Stück.<br />
Interessanterweise ist es von Seiten der Plagiathersteller,<br />
trotz der breitgestreuten Präsenz des<br />
Produkts, bislang noch nicht möglich gewesen,<br />
den Stuhl zu kopieren. Die Komplexität einer<br />
derartigen Form und der technisch einwandfreie<br />
Umgang mit dem Alumi nium unterliegen spezifischeren<br />
Fertigungstechniken und auch höheren<br />
Kosten als z.B. bei einem Kunststoffstuhl.<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 7<br />
Mobiltelefon-Funktionstasten<br />
Der finnische Mobiltelefonhersteller Nokia hat<br />
mit dem 8800 ein Mobiltelefon mit Gehäuse aus<br />
Edelstahl vorgestellt – es geht um Wertigkeit<br />
und Langlebigkeit eines Produkts und dessen<br />
Oberfläche.<br />
Für das Produkt wurden nach Angaben des<br />
Herstellers UhrmacherTechniken verwendet.<br />
Die Funktionstasten unter dem Display sind aus<br />
Metallspritzguss, der die präzise Gestaltung der<br />
kleinen Teile ermöglichte. Ein speziell verstärktes<br />
Glas, das auch für Luxusuhren verwendet wird,<br />
bietet zusätzliche Härte und Kratzfestigkeit.<br />
“Raffinesse und edle Materialien sind die Voraussetzungen<br />
für ein modernes hochwertiges<br />
Design, das Kunden zu schätzen wissen, die<br />
großen Wert auf Qualität und Liebe zum Detail<br />
legen”, so Nokia ChefDesigner Frank Nuovo.
8 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Predator-Stollen<br />
Bleiben wir bei den Kleinteilen: Sind die Stollen<br />
kaputt, wird der ganze Schuh weggeworfen.<br />
Das war in den 50er Jahren zu Zeiten des Volllederschuhs<br />
so. Adidas hat mit dem Fußballschuh<br />
Predator mit seiner speziellen Stollenform in<br />
Zusammenarbeit mit der Firma Dynacast ein<br />
bereits bekanntes Prinzip verbessert und zugleich<br />
einen bemerkenswertes Produkt entwickelt.<br />
Die besseren Stollenschuhe der 70er und 80er<br />
Jahre hatten bereits ein wesentliches Merkmal,<br />
nämlich auswechselbare Stollen, die über ein<br />
Gewinde in der Sohle befestigt werden konnten.<br />
Leder als Material der Stollen wurde durch<br />
Aluminium, später AluminiumKunststoff<br />
Kombinationen ersetzt. Dies machte den Schuh<br />
nicht nur leichter, sondern den Spieler auch<br />
beweglicher.<br />
Die Entwicklung <strong>im</strong> Bereich der Fußballschuhe<br />
geht seit einigen Jahren weg vom fix und fertigen<br />
starren Schuh hin zum modularen Aufbau,<br />
zur individuellen Anpassungsfähigkeit in den<br />
Bereichen Sohle, Innenleben und auch Stollen.<br />
Die Stollen heutiger Prägung sind nun an die<br />
erwarteten Kräfteeinwirkungen angepasst – nun<br />
eher wie Zähne ausgestaltet und nicht mehr<br />
rund. Das sorgt für bessere Standfestigkeit<br />
und opt<strong>im</strong>iert das Eindringen und Herausführen<br />
des Schuhs aus dem Rasen. “Dynamik” ist das<br />
Stichwort und bedient sicherlich auch den Sehnerv<br />
einer sich verändernden Käufergeneration.<br />
Nach dem Verschleiß wird die Stolle einfach<br />
ausgewechselt. In die vorgeformte Sohle wird<br />
die neue eingeklinkt und durch eine Befestigungsschraube<br />
und Kontermutter mit der Sohle<br />
festgezurrt. Das geringe Gewicht ermöglicht eine<br />
<strong>im</strong> Druckgussverfahren verwendete Magnesiumlegierung.<br />
Bei all der technischen Raffinesse verkauft sich<br />
natürlich auch ein neu gestaltetes Schuhmodell<br />
mit neuer Stollenform besser als ein herkömmliches.<br />
Und die komplexen Auswechselstollen<br />
kosten natürlich auch mehr als die herkömmlichen,<br />
aus Aluminium gedrehten.<br />
Armaturen für den Sanitärbereich<br />
Antonio Citterio ist einer dieser Gestalter, der<br />
bei einer Produktentwicklung ganzheitlich denkt.<br />
Nicht nur über das Produkt <strong>im</strong> Einzelnen, sondern<br />
auch über den Raum, in dem sich das Produkt<br />
bewegt. Das verrät den Architekten <strong>im</strong> Designer.<br />
Er arbeitet für eine neue Gestaltqualität bei<br />
industriellen Produkten. Für die Firma Hansgrohe<br />
und deren Designmarke Axor entwirft Citterio<br />
eine umfangreiche Kollektion – Armaturen für<br />
Waschtische, Bidets, Wannen und Duschen unter<br />
dem Thema “Richness in Design”. Worum geht<br />
es? Den rituellen Charakter des Elements Wasser<br />
bewusst machen, um Luxus als Ausdruck für<br />
Qualität, Verarbeitung, Kennerschaft und Mehrwert.<br />
Und besonders darum, die technischen<br />
Funktionen in Einklang mit einer eigenständigen,<br />
selbstbewussten Gestaltung zu bringen und dabei<br />
ein neues Raumgefühl entstehen zu lassen.<br />
Brillanz durch perfekt gearbeitete Oberflächen,<br />
Schärfe durch eine durchgängige und präzise<br />
Kantenführung, höchste Gestaltungs und Fertigungsqualität<br />
für alle Verbindungen, Flächen und<br />
Übergänge – von eckig zu rund, so fasst Citterio<br />
die Wertigkeit dieser Kollektion zusammen.<br />
Dass Metall das richtige Material für dieses<br />
Einsatzgebiet ist, steht außer Frage. Um das<br />
beschriebene Gestaltungsziel zu erreichen, spielt<br />
natürlich auch die Fertigungsopt<strong>im</strong>ierung eine<br />
Rolle, was <strong>im</strong> Falle dieser Produktpalette unterschiedlichste<br />
Bauteile hervorbringt. Der charakteristische<br />
Kreuzgriff ist z.B. ein Metallgussteil,<br />
neben Bauteilen aus Plattenware oder verformten<br />
Rohren.
Anonymes Design: Kranhaken<br />
Viele Hersteller haben erkannt, dass ein Designer<br />
hinter einem Produkt nicht nur für eine gute<br />
Gestaltung sorgt, sondern auch ein Produkt aufwertet.<br />
Das sogenannte Autorendesign treffen<br />
wir heute in vielen Lebensbereichen an. Und<br />
man freut sich tatsächlich, wenn man Besitzer<br />
eines echten EamesStuhles ist. Das hebt ein<br />
Produkt aus seinem Massencharakter heraus.<br />
Jedoch gibt es auch eine Reihe von Produkten<br />
mit hoher Gestaltqualität, von denen man den<br />
Gestalter nicht kennt. So gesehen bei einem<br />
Kranhaken aus Metallguss. Scheinbar reduziert<br />
auf die reine Funktion des Hebens von Lasten,<br />
erhält dieses massive Stück aus Metall durch<br />
seine Formgebung eine bestechende Schönheit,<br />
die in der Einfachheit seiner selbst liegt.<br />
Cayenne-Endrohr<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 9<br />
Für ein Produktdetail des PorscheIndividualisierungsprogramms<br />
entwickelte der Sportwagenhersteller<br />
gemeinsam mit der Feinguss Blank<br />
GmbH ein Sportendrohr, für das erstmals ein<br />
Feingussteil aus Aluminium mit Edelstahlkomponenten<br />
kombiniert wurde. Gestalterisch orientierte<br />
man sich – unter Beachtung der Anforderungen<br />
an Temperatur und Korrosionsbeständigkeit –<br />
am Carrera GT. Für die entstandene komplexe<br />
Blendengeometrie lieferte der Feinguss mit seiner<br />
hohen Gestaltungsfreiheit und Genauigkeit die<br />
passende Lösung.<br />
In der abschließenden Montage der Bauteile<br />
entsteht aus der fertig lackierten Blende zusammen<br />
mit den Edelstahlbauteilen eine komplett<br />
einbaufertige Komponente. Trotz des <strong>im</strong> Vergleich<br />
zur Serienausstattung voluminösen Auftretens<br />
der Blende konnte das Gesamtgewicht des Endrohrs<br />
gehalten werden.<br />
Aufgrund der erforderlichen Funktionalität des<br />
Gussteils entstand eine komplexe Geometrie:<br />
Auflageflächen, Verbindungslaschen und Durchgangsbohrungen<br />
für die Innentrichter sowie die<br />
Aufnahme und Befestigung für das zweiluftige<br />
Edelstahlrohr summieren sich zu einem komplexen<br />
Gebilde. Die Form führt zu starken Hinterschneidungen<br />
und unterschiedlichen Wandstärken<br />
des Gussteils. Die hohe Maßgenauigkeit<br />
des Feingussverfahrens ermöglicht es, auf<br />
spanende Nachbearbeitung zu verzichten.<br />
Bis zu 210 Baugruppen pro Woche werden<br />
gefertigt. Das Werkzeug zum Spritzen der filigranen<br />
Formteile enthält 70 Einzelkomponenten.<br />
Die Wachsteile werden manuell dem Werkzeug<br />
entnommen und zu einer sogenannten Gusstraube<br />
zusammengeklebt. Diese wird dann mit<br />
der späteren Schale für das Feingießen überzogen.<br />
Nach dem Wachsausschmelzen und Brennen der<br />
Keramikschale beginnt das Fein gießen <strong>im</strong> NiederdruckVerfahren.
10 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Moka Express<br />
“Wir glauben an unsere Landschaft, menschliche<br />
Ressourcen und ihr Knowhow, an die Tradition<br />
eines Landes: Italien, voller Werte, Kultur und<br />
herausragender Schönheit.” Aus diesen Prinzipien<br />
entstehen die Produkte des italienischen Kaffee <br />
maschinenHerstellers Bialetti.<br />
Die klassische Espressokanne, auch Caffettiera<br />
genannt, ist zu einer Ikone, einem Symbol für<br />
guten Kaffee und italienischen Habitus geworden.<br />
Sie wurde <strong>im</strong> Jahr 1933 in ihrer klassischen<br />
und heute noch existierenden Bauform unter<br />
dem Namen “Moka Express” von Alfonso Bialetti<br />
entwickelt und aus Aluminium <strong>im</strong> Gussverfahren<br />
gefertigt. Das Gewinde <strong>im</strong> unteren und oberen<br />
Teil der Kanne wird nachträglich in die Form<br />
geschnitten. Das Aluminium wird schließlich<br />
nicht eloxiert, sondern bleibt roh, die Oberfläche<br />
wird lediglich geschliffen. Das Produkt altert<br />
dadurch auf angenehme Weise, es bekommt<br />
eine feine Patina, die der Kanne das verleiht,<br />
was sie ausstrahlt: Solidität, Ehrlichkeit, Reduktion<br />
auf die wesentlichen Bestandteile. Und sie<br />
produziert von jeher erstklassigen Kaffee.<br />
Die Firma Bialetti entstand 1919, als Alfonso<br />
Bialetti in Crusinallo eine Werkstatt aufmachte,<br />
um AluminiumHalbzeuge herzustellen. Mit<br />
unternehmerischem Geist wurde aus der Werkstatt<br />
bald ein DesignStudio mit Produktion<br />
für marktfertige Produkte. So verdankt die weltweit<br />
bekannte Kanne ihre Existenz der erfolgreichen<br />
Kombination aus technischer und<br />
stilistischer Innovation bei exzellentem Preis<br />
Leistungsverhältnis.<br />
Türgriff 1057<br />
Designern und Architekten gelingt es also <strong>im</strong>mer<br />
wieder, neue Formen – und vielleicht so etwas<br />
wie eine Poesie für banale Gebrauchsgegenstände<br />
zu entdecken. Der britische Designer<br />
Jasper Morrison möchte, dass der Betrachter<br />
oder Benutzer seiner Produkte den Gegenstand<br />
sofort als vertrauenswürdig empfindet.<br />
Der Münchener Designer Jan Roth exper<strong>im</strong>entierte<br />
schon früh während seines Studiums<br />
in Ulm mit Formen für Türgriffe. Er verkaufte<br />
damals zwei seiner Entwürfe an den Beschlaghersteller<br />
FSB. Später bat man ihn, weitere Entwürfe<br />
zu denken, und Jan Roth, dem “Qualität,<br />
Lebendigkeit und Schönheit” eines Produkts und<br />
Materials wichtig sind, hatte eine sehr schöne<br />
Idee, die jedoch vom Hersteller nicht verfolgt<br />
wurde: Den Griff, unter der bei FSB laufenden<br />
Nummer 1057, entwarf er unter haptischer<br />
und gestalterischer Relevanz. Und dabei war<br />
es ihm wichtig, das Material Aluminium nicht<br />
zu eloxieren, wie es üblicherweise passierte,<br />
sondern das Aluminium zu polieren. Die<br />
Eloxal schicht ist deutlich härter als Aluminium.<br />
Gibt es Kratzer, sieht das Produkt mit ebendieser<br />
Oberfläche schäbig aus. Es altert nicht<br />
mit Würde.<br />
Bei FSB allerdings trat man dem polierten Aluminium<br />
skeptisch gegenüber. Gibt es Flecken<br />
mit der Zeit, läuft das Aluminium an? Und das<br />
Eloxieren macht einen großen Teil der Wertschöpfung<br />
vieler Hersteller aus! Jan Roth versuchte<br />
es <strong>im</strong> Selbsttest und montierte den “nur”<br />
polierten Griff an der Aussenseite seiner Ateliertüre.<br />
Das ist Jahre her, und der Griff strahlt nun<br />
eben genau diese Lebendigkeit und Schönheit<br />
aus, weil sich die Oberfläche ehrlich auch an<br />
die ruppigeren Begegnungen “erinnert”.<br />
Neben der präzisen Oberflächengüte – eine Lichtreflexion<br />
auf dieser polierten Oberfläche hat<br />
einen hohen ästhetischen Wert – ermöglichte<br />
der Metall guss eine sehr weiche und überaus<br />
handschmeichlerische Form.<br />
Eine weitere frühe Idee von Roth, die bei späteren<br />
Produkten vieler Hersteller auftauchte, ist das<br />
Anbinden der Rosette an den Griff. Das ist technisch<br />
möglich und schafft einen optischen Reiz,<br />
der den Griff mehr noch als ein Funktionsstück<br />
wirken lässt. Weil die Gestalt der Klinke so vieles<br />
über das, was sich hinter einer Tür verbergen<br />
soll, aussagt, kann man froh sein, dass es diese<br />
Formenvielfalt gibt und dass es Gestalter gibt,<br />
die sich hartnäckig mit den wesentlichen Fragen<br />
hinter einem Produkt beschäftigen.
Aluminum Chair<br />
Und zum Abschluß wieder ein Stuhl: In den<br />
40er Jahren treffen wir in den USA das Designerehepaar<br />
Eames an, Charles und Ray, die <strong>im</strong>merwährend<br />
mit neuen Materialien und Herstellungstechniken<br />
exper<strong>im</strong>entieren. Während des Zweiten<br />
Weltkrieges hatte die amerikanische Aluminiumindustrie<br />
ihre Kapazität erheblich erhöht und<br />
suchte daher ab 1950 nach neuen Einsatzgebieten<br />
für das Material.<br />
Die beiden Designer nutzten als Erste den gestalterischen<br />
Spielraum von Aluminiumdruckguss<br />
<strong>im</strong> Möbelbau. Das in dieser Zeit für Einrichtungsgegenstände<br />
ungewöhnliche Material brachte<br />
durch seine technischen Eigenarten auch ästhetische<br />
Optionen mit sich, die für die Eames neu<br />
waren und für die Gestaltung eine große Rolle<br />
spielen sollten. Im Gegensatz zu den von ihnen<br />
entwickelten Formsperrholzmöbeln, bei denen<br />
alle Formen aus der Beschränkung des Materials<br />
gedacht wurden, setzte Aluminium dem Entwerfer<br />
formal gesehen keine Grenzen und war<br />
plastisch frei verformbar. Mit dem Aluminum<br />
Chair konnten die Eames also das Prinzip der<br />
Schale zugunsten einer revolutionären auf Spannung<br />
basierenden Konstruktion ersetzen.<br />
Charakteristisches Merkmal ist die intelligente<br />
Verbindung der Materialien. In den seitlichen<br />
Aluminiumprofilen wird der Bezug befestigt<br />
und frei verspannt. Somit ist dieser keine Hülle,<br />
sondern wird zum tragenden Teil der Konstruktion.<br />
Die Nut zur Aufnahme des Textils ist in<br />
die Aluformteile integriert. Die Seitenteile, mit<br />
dem eingeführten und verschraubten Textil,<br />
werden eingedreht, wobei die Verschraubung<br />
abgedeckt wird. Dann werden sie auseinandergedrückt,<br />
um die unter der Schale liegenden<br />
Spannbügel einzustecken.<br />
Das Metallgussverfahren ermöglichte für diesen<br />
Entwurf eine intelligente Ausprägung der Einzelbauteile<br />
und eine formale Ablesbarkeit des Kräfteverlaufs<br />
durch unterschiedliche Bauteildicken<br />
und geometrien. | al
Wissen und Nachwuchs<br />
Serie Unternehmenskommunikation<br />
Über die Schärfung des eigenen Profils –<br />
Exemplarisch konsequent: Corporate Design bei Festo<br />
von c3 | wortundform<br />
Individualität in der Menge: Eigentlich sind es<br />
nur kleine Unterschiede, die uns augenscheinlich<br />
unverwechselbar machen und auf einen eigenen<br />
Charakter verweisen.
Corporate Design (CD) ist ein fortlaufender Prozess und<br />
umfasst das gesamte visuelle Erscheinungsbild eines Unternehmens<br />
nach innen und nach außen. Ziel ist eine visuell<br />
eindeutig wahrnehmbare Positionierung und Profilierung<br />
eines Unternehmens, um ein unverwechselbares Erscheinungsbild<br />
zu erreichen, das Mitarbeitern und Kunden Identifikation<br />
und Orientierung anbietet. Grafische Basiselemente,<br />
Designrichtlinien sowie exemplarische Anwendungen<br />
werden in Form eines CD-Handbuchs dokumentiert<br />
und Mitarbeitern, Partnern und Agenturen als Orientierung<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Wer gesehen werden will, muss Zeichen setzen, wer in Erinnerung<br />
gerufen werden will, muss große Zeichen setzen und wer<br />
zuletzt als guter Partner gesehen werden will, muss nachhaltige<br />
Zeichen setzten, die positive Wirkung hinterlassen.<br />
All dies gehört zum Tagesgeschäft der Abteilung Corporate<br />
Design bei Festo. Vom Schriftzeichen bis zum großen Auftritt<br />
am H<strong>im</strong>mel wird gestaltet, was nach außen und innen <strong>im</strong><br />
Unternehmen sichtbar wird.<br />
So ist alles Lesbare, vom Briefbogen bis zum Stellenangebot<br />
in der Zeitung, alles Greifbare, vom pneumatischen Zylinder<br />
bis zum Kantinenbesteck, alles Begehbare, von der Pforte bis<br />
zu Ihrem Arbeitsplatz nach best<strong>im</strong>mten Gestaltungskriterien<br />
entworfen. Diese Kriterien sind wohl überlegt und in einem<br />
CorporateDesignHandbuch niedergeschrieben – hier werden<br />
die Regeln für den sichtbaren Ausdruck der Identität von Festo<br />
verankert. Dabei unterliegt das Corporate Design einer stetigen<br />
Weiterentwicklung. Laufend werden neue Gestaltungselemente<br />
aufgenommen, andere modifiziert oder aufgegeben – sehr<br />
behutsam und dabei stets die Wiedererkennung der Maßnahme<br />
vor Augen.<br />
Für die Umsetzung des CD bedarf es der Unterstützung vieler<br />
Hände und Köpfe. So ist ein gelebtes erfolgreiches Corporate<br />
Design letztlich eine Gemeinschaftsleistung nicht nur vieler<br />
Abteilungen wie Produktdesign, Grafikdesign, Markenbetreuung<br />
sowie Gebäude und Immobilien, sondern vielmehr die Gemeinschaftsleistung<br />
aller Mitarbeiter weltweit.<br />
“Nur so gelingt es, dass das CD für die Wahrnehmung unserer<br />
Werte <strong>im</strong> Familienunternehmen und unserer gelebten Kultur bei<br />
Festo einen einzigartigen visuellen Ausdruck schafft. Hierzu ist<br />
es notwendig, dass das Bild dieser Identität konsequent umgesetzt<br />
wird und über Bereichs und Ländergrenzen hinweg auch<br />
nachhaltig und konsistent vermittelt wird”, sagt Dr. Heinrich<br />
Frontzek, Leiter Corporate Communication.<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 13<br />
“Ein unverwechselbares, emotional st<strong>im</strong>miges<br />
und stabiles Erscheinungs und Markenbild ist<br />
als Rüstzeug der Zukunft für eine Marke mit<br />
Charakter wie Festo notwendig und erzielbar.”
14 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
“Nur die konsequente Vermittlung und Umsetzung<br />
der CorporateDesignVorgaben in allen<br />
Unternehmensbereichen weltweit ergeben einen<br />
in sich stringenten Markenauftritt.”<br />
“Die Produkte sind die Visitenkarte eines Unternehmens.<br />
Deshalb ist es wichtig, auch <strong>im</strong><br />
Produkt design das Corporate Design von Festo<br />
umzusetzen.”<br />
lesen können wir es nicht-<br />
CNC-Service - Einzelteilfertigung<br />
verlängerte Werkbank<br />
für den Formen-, Werkzeug-,<br />
Modell-, Prototypen und<br />
Maschinenbau<br />
Diese Werte müssen kommuniziert werden und finden in einer<br />
durchgängigen Gestaltung ihren visuellen Ausdruck. Seit der<br />
Gründung der Abteilung Corporate Design ist viel passiert.<br />
Wer die Architektur bei Festo betrachtet, findet wiederkehrende<br />
Gestaltungselemente an Türgriffen, Möbeldetails und Lichtschaltern,<br />
wie auch an den Produkten mit ihren Schaltern und Hebeln.<br />
Nicht nur die Farbigkeit, sondern ein ganzes Gestaltungsprinzip<br />
liegt dem Gesamtkonzept zugrunde.<br />
“Das Blau von Festo, die Farbe ‘Caerul’, lehnt sich dabei nicht<br />
nur an die gängige visuelle Versinnlichung der Luft an, sondern<br />
dient auch als Signalfarbe. Wichtige Funktionselemente werden<br />
durch farbliche Kennzeichnung hervorgehoben”, sagt Markus<br />
Fischer, Leiter Corporate Design.<br />
Gestaltungsgrundsätze bringen neben Möglichkeiten und Vorteilen<br />
aber auch Einschränkungen mit sich, die nicht selten für<br />
Unverständnis sorgen. Daher ist es wichtig, sich über den Sinn<br />
des Ganzen klar zu werden, um nicht <strong>im</strong> Einzelfall über die<br />
strengen Reglementierungen irritiert zu sein. Der bewusste Verzicht<br />
auf Vielfalt und Individualität ist der Preis für die Reduktion<br />
auf das Wesentliche – persönlicher Geschmack tritt dabei<br />
hinter einer einheitlichen Positionierung der Marke Festo zurück.<br />
Heute arbeitet ein Team von vier Mitarbeitern <strong>im</strong> Corporate<br />
Design, das der Abteilung Corporate Communication zugeordnet<br />
ist. Und zu gestalten gibt es vieles. Ein aktuelles Projekt hat zum<br />
Ziel, die Erstellung von PowerPointPräsentationen einfacher<br />
und einheitlicher zu machen. “Wir wollen den Mitarbeitern bessere<br />
Werkzeuge zur Verfügung stellen, die es ermöglichen, das<br />
Corporate Design schneller und effizienter umzusetzen”, erklärt<br />
Fischer, der nachhaltige Investitionen für den visuellen Auftritt<br />
gerade auch kleinen und mittelständischen Unternehmen empfiehlt.<br />
Anlass genug, dem DesignSpezialisten einige Fragen über<br />
den richtigen Weg zum passenden Außenbild zu stellen:<br />
3D-5Achs<br />
HSC Fräsen<br />
von klein, bis zu:<br />
6000x2000x1400mm bis 30t<br />
Werkzeuggestelle<br />
Drahterodieren<br />
www.ka-alber.de wzb@ka-alber.de Fax 0711/7979304 Tel. 0711/90262-0 Gutenbergstr. 7 70771 Leinfelden-Echterdingen
Herr Fischer, wann und warum ist es für ein Unternehmen<br />
wichtig, sich mit seiner allgemeinen visuelle Wahrnehmung<br />
zu befassen?<br />
Es lohnt sich <strong>im</strong>mer, sich um seine Erscheinung zu kümmern.<br />
Die visuelle Wahrnehmung prägt das Bild der Marke und somit<br />
den Auftritt des Unternehmens nach innen und nach außen.<br />
“Kleider machen Leute”, sagt der Volksmund.<br />
Wo fängt dabei “Corporate Design” an und wo hört es auf?<br />
Von den Visitienkarten der Mitarbeiter bis zur Architektur?<br />
Corporate Design bei Festo z.B. umfasst die Bereiche Architektur,<br />
Innenarchitektur, Produktdesign, Grafik, Software und Onlinegestaltung.<br />
Wobei die Abteilung Corporate Design die Richtlinien<br />
vorgibt. Die Umsetzung erfolgt in den Fachabteilungen.<br />
Was, glauben Sie, muss für ein “gutes” Erscheinungsbild<br />
in der Öffentlichkeit alles getan werden?<br />
Wichtig erscheint mir für Firmen, offen, konsistent, glaubwürdig<br />
und nachvollziehbar zu kommunizieren. Es hilft, wenn das<br />
Erscheinungsbild nicht alle Tage gewechselt wird und sich dies<br />
an den langfristigen Unternehmenszielen orientiert.<br />
Und welche Bedeutung hat ein “gutes” Erscheinungsbild<br />
für die inneren Abläufe und Vorgänge?<br />
Es schafft ein WirGefühl bei den Mitarbeitern. Arbeitsprozesse<br />
werden erleichtert und sind eindeutig geregelt. Bis hin zum<br />
gemeinsamen Einkauf, bei dem man aufgrund von einheitlichen<br />
Vorlagen Geld sparen kann.<br />
Mit “Corporate Design” wird oft – und besonders scheint<br />
dies für klein- und mittelständische Unternehmen zu<br />
gelten – großer Aufwand und ungewisser Nutzen in Verbindung<br />
gebracht. Ein Vorurteil?<br />
Gerade kleine und mittlere Unternehmen wollen unter den<br />
vielen Mitbewerbern gesehen und gehört werden, da kann ein<br />
starker Unternehmensauftritt ein Alleinstellungsmerkmal und<br />
Identifikationsfaktor sein. Aus meiner Sicht sollte der Aufwand<br />
der Größe des Unternehmens angepasst sein. Ein kleines Unternehmen<br />
hat in der Regel weniger Formulare, Drucksachen und<br />
Produkte, die nach Corporate Design gestaltet werden wollen.<br />
Euromold<br />
Award 2006<br />
Bronze<br />
3D - CNC Gravieren<br />
CNC - Senk- und Drahterodieren<br />
Startlochbohren<br />
Hochglanzpolieren<br />
HSC-5-Achs-S<strong>im</strong>ultanfräsen<br />
3D-Laserbearbeiten<br />
5-Achs-Ultraschallschleifen<br />
Wo und wie sollte ein Unternehmen be<strong>im</strong> Aufbau und<br />
der Pflege eines Erscheinungsbildes beginnen? Gibt es<br />
einen “richtigen” Weg?<br />
Be<strong>im</strong> Aufbau des Erscheinungsbildes sollte eine Bestandsanalyse<br />
am Anfang stehen. Diese zeigt die Stärken und die Schwächen<br />
des bestehenden Erscheinungsbildes auf. Eine CorporateDesign<br />
Agentur mit Erfahrung kann eine solche Analyse durchführen.<br />
Bei der Umsetzung kann Schritt für Schritt vorgegangen werden,<br />
wobei der Zeithorizont für eine Umstellung auf ein neues<br />
Erscheinungsbild nicht zu groß sein sollte.<br />
Benötigt man die Hilfe einer beratenden Agentur oder<br />
können Unternehmen diese Aufgaben auch selbst in die<br />
Hand nehmen?<br />
Eine Agentur hat vor allem den Vorteil des unvoreingenommenen<br />
Blicks und ist zumindest am Anfang noch nicht betriebsblind.<br />
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht betrachtet: Lohnen<br />
sich Investitionen in das “Corporate Design”?<br />
Alle Maßnahmen, die <strong>im</strong> Bereich Corporate Design unternommen<br />
werden, zahlen auf die Marke ein. Eine starke Marke ist einzigartig<br />
und nicht so leicht von der Konkurrenz zu kopieren. Und<br />
nicht zu vergessen: Eine Reduzierung der Formulare, Bildschirmmasken<br />
und die Beschränkung in Farbe und Form hilft auch<br />
Kosten zu sparen.<br />
Können Sie sachliche Attribute einer “guten” Unternehmenserscheinung<br />
nennen?<br />
Einzigartig, konsistent, glaubwürdig.<br />
Nichts ist für die Ewigkeit. Wie wandlungsfähig muss<br />
ein Erscheinungsbild sein?<br />
Die visuellen Grundkonstanten wie Logo, Farben und Formate<br />
sollten möglichst lange beibehalten werden. Ändern sich die<br />
Geschäftsziele, ist eine Anpassung des Erscheinungsbildes<br />
meist angeraten. Marken von Grund auf neu zu erschaffen<br />
und zu etablieren ist eine sehr teure und lange dauernde<br />
Angelegenheit.<br />
Herr Fischer, vielen Dank für das Gespräch | wuf<br />
www.leonhardt-gravuren.de --- Telefon 0 71 53 / 95 94 0<br />
Mozartstr. 26 - 73269 Hochdorf<br />
Mit uns haben<br />
Sie alle Kurven<br />
<strong>im</strong> Griff<br />
Ihr Spezialist für<br />
filigranste Geometrien <strong>im</strong><br />
Werkzeug- und Formenbau<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 15
Recht und Rahmen<br />
Unternehmensteuerreform <strong>2008</strong> und weitere<br />
Änderungen zum Jahreswechsel <strong>im</strong> Überblick<br />
von Gert Doleschel<br />
Das Jahr 2007 war einmal mehr von<br />
zahlreichen Steueränderungsgesetzen<br />
geprägt. Unter ihnen sticht das Unternehmensteuerreformgesetz<br />
<strong>2008</strong> her vor,<br />
durch das erstmals für das laufende<br />
Jahr der Körperschaftsteuersatz auf 15<br />
Prozent gesenkt sowie eine steuerliche<br />
Begünstigung nicht entnommener<br />
Gewinne bei Personenunternehmen<br />
eingeführt wird.<br />
Diesen durchaus erfreulichen Regelungen<br />
stehen jedoch empfindliche Einschränkungen<br />
gegenüber. So entfällt z.B. die<br />
degressive Abschreibung für bewegliche<br />
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens,<br />
wenn Sie das Wirtschaftsgut nach dem<br />
31. Dezember 2007 angeschafft oder hergestellt<br />
haben. Für sogenannte geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter erfolgt ein<br />
Sofortabzug für nach dem 31. Dezember<br />
2007 angefallene Aufwendungen nur<br />
noch bis zu einer Höhe von 150 Euro<br />
ohne Umsatzsteuer. Für abnutzbare<br />
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens<br />
ist <strong>im</strong> Wirtschaftsjahr der<br />
Anschaffung/Herstellung ein Sammelposten<br />
zu bilden, wenn der Wert 150<br />
Euro, aber nicht 1000 Euro (netto) übersteigt.<br />
Dieser ist <strong>im</strong> Wirtschaftsjahr der<br />
Bildung und in den folgenden 4 Jahren<br />
mit jeweils 1/5 aufzulösen. Die Gewerbesteuer<br />
ist, soweit sie für Kalenderjahre<br />
ab 2007 festgesetzt wird, nicht mehr als<br />
Betriebsausgabe abzugsfähig. Der Umfang<br />
der Hinzurechnung von Finanzierungsanteilen<br />
zum Gewerbeertrag hat sich<br />
deutlich erhöht. Neben der Hinzurechnung<br />
sämtlicher Schuldzinsen erhöhen<br />
nunmehr u.a. auch Renten, Miet und<br />
Pachtzinsen für bewegliche und unbewegliche<br />
Wirtschaftsgüter zu einem<br />
gewissen Anteil den Gewerbeertrag.<br />
Ein Freibetrag von 100000 Euro soll<br />
die sich möglicherweise ergebende Substanzbesteuerung<br />
abmildern.<br />
Eine Verschärfung der Rechtslage hinsichtlich<br />
der Möglichkeiten des Verlustabzugs<br />
hat sich auch ergeben, wenn<br />
Anteile an einer verlustbehafteten Kapitalgesellschaft<br />
nach dem 31. Dezember 2007<br />
erworben werden. Ab dem Kalenderjahr<br />
2009 wird ein Steuersatz von 25 Prozent<br />
zuzüglich Solidaritätszuschlag und<br />
Kirchen steuer mit Abgeltungswirkung<br />
auf Kapitaleinkünfte (z.B. Zinsen, Dividenden,<br />
Gewinne aus der Veräußerung<br />
von Wertpapieren) erhoben. Es besteht<br />
allerdings die Möglichkeit, die Einbeziehung<br />
dieser Einkünfte <strong>im</strong> Rahmen der<br />
Einkommensteuerveranlagung zu beantragen.<br />
Besteuert wird der Bruttoertrag.<br />
Fremdfinanzierungskosten und sonstige<br />
Aufwendungen sind durch den Ansatz<br />
eines Pauschbetrags von 801 Euro bzw.<br />
1602 Euro bei Ehegatten abgegolten. Ein<br />
Abzug ist durch Option zur Teileinkünfte<br />
Besteuerung, die unter best<strong>im</strong>mten Voraussetzungen<br />
beantragt werden kann,<br />
zu erreichen.<br />
Das Jahressteuergesetz <strong>2008</strong> umfasst<br />
mehr als 200 Einzelregelungen. Hervorzuheben<br />
sind die Einschränkungen der<br />
Möglichkeiten der Vermögensübergabe<br />
gegen Versorgungsleistungen sowie<br />
die Neufassung der Missbrauchsbekämpfungsvorschriften.<br />
Am 23. Mai 2007 hat das Bundeskabinett<br />
den Regierungsentwurf des Gesetzes<br />
zur Modernisierung des GmbHRechts<br />
und zur Bekämpfung von Missbräuchen<br />
(MoMiG) beschlossen. Vorgesehen sind<br />
neben der Herabsetzung des Mindest<br />
Stammkapitals von 25000 Euro auf<br />
10000 Euro eine Vereinfachung der<br />
Gründungsvorschriften. Die GmbH<br />
Gründung muss nicht mehr notariell<br />
beurkundet werden, wenn die gesetzliche<br />
Mustersatzung verwendet wird. Es wird<br />
eine “Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)”<br />
eingeführt. Deren Stammkapital<br />
kann weniger als 10000 Euro<br />
betragen. Aus dem Jahresüberschuss sind<br />
jedoch mindestens ein Viertel in eine<br />
gesetzliche Rücklage, die nur zur Kapitalerhöhung<br />
auf 10000 Euro verwendet<br />
werden darf, einzustellen.<br />
Das Gesetz zur weiteren Stärkung des<br />
bürgerlichen Engagements bringt rückwirkend<br />
zum 1. Januar 2007 umfangreiche<br />
Änderungen <strong>im</strong> Spenden und<br />
Gemeinnützigkeitsrecht.<br />
Die Reform des Erbschaft und Schenkungsteuergesetzes<br />
sowie des Bewertungsrechts<br />
konnte <strong>im</strong> abgelaufenen<br />
Kalenderjahr nicht voll zogen werden.<br />
Die entsprechende Gesetzesverkündung<br />
wird frühestens am 30. März <strong>2008</strong><br />
erfolgen. Vorgesehen sind eine deutliche<br />
Erhöhung der persönlichen Freibeträge<br />
für Ehegatten auf 500000 Euro (bisher<br />
307000 Euro), für Kinder auf 400000<br />
Euro (bisher 205000 Euro) und für Enkel<br />
auf 200000 Euro (bisher 51200 Euro).<br />
Dem gegenüber wird sich künftig die<br />
Bewertung des Grundvermögens an den<br />
Verkehrswerten orientieren. Noch nicht<br />
abschließend geklärt ist die Bewertung<br />
des Betriebsvermögens.
Nachdem die frühere Unterscheidung<br />
zwischen produktivem und unproduktivem<br />
Vermögen wegen zahlreicher<br />
Abgrenzungsschwierigkeiten aufgegeben<br />
wurde, soll nunmehr zur Verschonung<br />
des Unternehmensvermögens (Ansatz<br />
Verkehrswert/gemeiner Wert) ein<br />
Abschlag für begünstigtes Vermögen<br />
von 85 Prozent unter Berücksichtigung<br />
einer gleitenden Freigrenze von 150000<br />
Euro eingeführt werden. Voraussetzung<br />
dafür soll allerdings sein, dass die maßgebliche<br />
jährliche Lohnsumme des Unternehmens<br />
innerhalb von 10 Jahren nach<br />
dem Erwerb in keinem Jahr geringer<br />
sein darf als 70 Prozent der indexierten<br />
Ausgangslohnsumme (durchschnittliche<br />
Lohnsumme der letzten 5 vor dem Zeitpunkt<br />
der Entstehung der Steuer endenden<br />
Wirtschaftsjahre) bzw. das Unter<br />
nehmen innerhalb von 15 Jahren weder<br />
veräußert noch aufgegeben wird (Behaltensfrist).<br />
Für jedes Jahr, in dem die<br />
Lohnsumme 70 Prozent der indexierten<br />
Ausgangslohnsumme unterschreitet,<br />
vermindert sich der sogenannte Verschonungsabschlag<br />
um 1/10 mit Wirkung<br />
für die Vergangenheit. Bei einem Verstoß<br />
gegen die Behaltensfrist fällt der Verschonungsabschlag<br />
mit Wirkung für<br />
die Vergangenheit vollständig weg.<br />
Das REITGesetz ist rückwirkend zum<br />
1. Januar 2007 in Kraft getreten. Geregelt<br />
ist u.a., dass der Gewinn aus dem Verkauf<br />
von Grundstücken, die mindestens<br />
5 Jahre zum Anlagevermögen eines<br />
inländischen Betriebsvermögens des<br />
Veräußerers gehört haben, nur zur Hälfte<br />
zu versteuern ist, wenn der Erwerb durch<br />
eine REITAG vor dem 1. Januar 2010<br />
erfolgt. Die anschließende Rückmietung<br />
durch den Veräußerer soll unschädlich<br />
sein.<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 17<br />
Wir wünschen Ihnen bei der Umsetzung<br />
der bestehenden und geplanten Gesetzesänderungen<br />
die nötige Gelassenheit,<br />
Ihnen persönlich anlässlich des Jahreswechsels<br />
Glück und Gesundheit für die<br />
Zukunft. |<br />
Dipl.Kfm. Gert Doleschel & Partner<br />
Steuerberatungsgesellschaft<br />
Gerstmayrstraße 6<br />
89233 NeuUlm<br />
Telefon +49 (0)731 979980<br />
Telefax +49 (0)731 9799820<br />
info@steuerkanzleidoleschel.de<br />
www.steuerkanzleidoleschel.de
Innovation und Technik
Mit sieben Produktlinien <strong>im</strong> Fräsen unterstreicht der Gildemeister<br />
Konzern einen hohen Anspruch: Weltmarktführer <strong>im</strong> 5Achs<br />
Fräsen zu sein. Auf dieser Position besteht nur, wer laufend<br />
Ideen in Produkte umsetzt. Angefangen vom Design bis zu<br />
neuen Modellen tut sich daher <strong>2008</strong> bei DMG einiges. Unter den<br />
Neuheiten finden sich auch solche, die für den Werkzeug und<br />
Formenbau besonders interessant sind.<br />
Zunächst ein Blick zurück: Mitte der neunziger Jahre wird nach<br />
Übernahme von Deckel Maho durch den GildemeisterKonzern<br />
der Traditionsstandort München schrittweise aufgelöst und<br />
nach Geretsried ausgelagert. 2004 übernehmen die Deckel Maho<br />
Pfronten GmbH und die Deckel Maho Seebach GmbH die Produkt<br />
und Entwicklungsverantwortung für die horizontalen und<br />
vertikalen Fräszentren des Geretsrieder Werks. In der Folge wird<br />
die Produktion auf vertikale Bearbeitungszentren der DMCV<br />
Generation und auf die neuen HSClinearMaschinen fokussiert.<br />
Die Produktion in Geretsried beschränkt sich auf die Montage,<br />
die mechanische Fertigung der Maschinenkomponenten befindet<br />
sich in Pfronten bzw. Seebach/Thüringen. Am Standort Geretsried<br />
befinden sich außerdem die DMG Gebrauchtmaschinen<br />
GmbH, die DMG München Vertriebs und Service GmbH,<br />
die DMG TrainingsAkademie sowie die neu gegründete DMG<br />
Spareparts GmbH.<br />
Am Auftragseingang ist die wachsende Bedeutung der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung,<br />
vor allem auch <strong>im</strong> Werkzeug<br />
und Formenbau, deutlich abzulesen. Bereits 20 Prozent der<br />
Aufträge kommen aus diesem Anwendungsbereich; der genannte<br />
Anteil entfällt mithin auf die Maschinen der HSClinearBaureihe<br />
(HSC 20 linear, HSC 55 linear, HSC 75 linear, HSC 105 linear).<br />
Maschinen <strong>im</strong> neuen Design<br />
Kleider machen Leute – Maschinendesign dient der Funktionalität.<br />
Am neuen Erscheinungsbild der DMCV sowie HSCMaschinen<br />
aus Geretsried und anderer Baureihen aus dem Hause DMG<br />
fallen auf den ersten Blick die großen Sicherheitsglasscheiben<br />
auf, flächenbündig in die Maschinenkabine integriert. Der<br />
Maschinenzustand wird nicht mehr nur mittels Signallampe<br />
angezeigt, sondern darüber hinaus mit Hilfe einer <strong>im</strong> vorderen<br />
Bereich der Kabine umlaufenden Lichtlinie (“Lightline”). Diese<br />
Linie verändert ihre Farbe, je nachdem, in welchem Status sich<br />
die Maschine befindet.<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 19<br />
Deckel Maho Seebach forciert HSCBearbeitung<br />
von Richard Läpple<br />
Der Kunde liefert ein Werkstück, DMG die<br />
komplette Bearbeitungslösung. Michael Zanth,<br />
Leitung Vertrieb und Technik bei der Deckel<br />
Maho Seebach GmbH (links), <strong>im</strong> Gespräch mit<br />
dem <strong>VDWF</strong>Geschäftsführer Willi Schmid be<strong>im</strong><br />
Werksbesuch in Geretsried.
20 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Die neue HSC 55 linear von DMG ist ein kompaktes<br />
PortalBearbeitungszentrum. Für die<br />
5AchsBearbeitung verfügt die Maschine über<br />
einen DrehSchwenktisch mit 400x400mm<br />
Aufspannfläche.<br />
Blick in die Spänefördereinrichtung eines Vertikalfräszentrums<br />
Werkzeugbau ERZ<br />
Industriestraße 5<br />
89150 Laichingen<br />
Telefon: 0 73 33 - 92 24 36<br />
Telefax: 0 73 33 - 92 24 38<br />
info@wzb-erz.de<br />
www.wzb-erz.de<br />
Wir sind ein innovativer Formenbau,<br />
der die an uns gestellten Anforderungen<br />
überprüft und mit Abst<strong>im</strong>mung<br />
des Kunden die opt<strong>im</strong>ale<br />
Lösung auswählt.<br />
Höchste Qualitätsansprüche und<br />
Termintreue werden von einem<br />
motivierten Team garantiert.<br />
Beratung und Entwicklung<br />
Wir begleiten Sie von der Produktentwicklung<br />
über Auswahl und<br />
Einsatz von Formenbautechnologie,<br />
sowie Serienherstellung. Mit Vorschlägen<br />
und Herstellung von<br />
Handlingsystemen in Kombination<br />
Mehr Komfort gibt es auch in puncto Bedienung. Ein neues<br />
ErgolineBedienpult verfügt über einen Bildschirm in 19Zoll<br />
CADD<strong>im</strong>ension. Der Anwender hat damit erstmals die Möglichkeit,<br />
die Bedienung der Maschine seinen Bedürfnissen anzupassen,<br />
wie man das vom PC her kennt; Stichwort Nutzerprofil.<br />
Softkeys können mit häufig benötigten Bildschirminhalten und<br />
Bediensequenzen belegt werden. Ferner loggen sich die Bediener<br />
nun per Smartkey in die Maschine ein – und zwar mit vorher<br />
individuell festgelegtem Berechtigungsprofil. Markus Rehm,<br />
Geschäftsführer Deckel Maho Seebach, erläutert: “Der Trend zu<br />
<strong>im</strong>mer komplexeren Maschinen ist ungebrochen. Multitasking,<br />
Automationsfunktionen, fünf Achsen usw. sind Dinge, die von<br />
den Bedienern viel abverlangen. Es ist daher nur konsequent,<br />
wenn unterschiedlich qualifizierten Mitarbeitern ein unterschiedlicher<br />
Funktionsumfang zur Verfügung gestellt wird. Fehlbedienungen<br />
werden dadurch vermieden, Maschine und Prozess<br />
geschützt.”<br />
Paradebeispiel für den augenblicklichen Stand bei vertikalen<br />
Fräszentren ist die auf der EMO 2007 vorgestellte HSC 55 linear.<br />
Das neue PortalBAZ zeigt, dass es in der HSCBearbeitung<br />
<strong>im</strong>mer kompakter wird. “Die HSC 55 linear schließt mit einem<br />
Arbeitsbereich von 450 x 600 x 400 mm die Lücke zwischen der<br />
kleinen HSC 20 linear und der größeren HSC 75 linear”, betont<br />
Markus Rehm; er fährt fort: “Wir sehen einen steigenden Bedarf<br />
<strong>im</strong> Bereich kompakter, HSCfähiger Bearbeitungszentren.” Die<br />
Maschine kann flexibel für Schrupp und Schlichtbearbeitungen<br />
eingesetzt werden. Neben den bereits beschriebenen neuen<br />
Designmerkmalen gehört eine Spindel mit 28000 1/min und<br />
HSK63AAufnahme zur Standardausrüstung. Wie der Name<br />
schon andeutet, verfügen alle Achsen über Linearantriebe, hinzu<br />
kommen PräzisionsLinearmaßstäbe. Der Anwender kann, wie<br />
bei DMG üblich, vom Grundmodell ausgehend eine ganze Reihe<br />
Optionen aus einem Baukasten auswählen, um die Maschine<br />
auf seine Bedürfnisse abzust<strong>im</strong>men. So werden neben der<br />
Standardspindel Hochgeschwindigkeitsspindeln bis 60000 1/min<br />
angeboten.<br />
mit vorhandenen oder Neubeschaffung<br />
der Serienspritzmaschine.<br />
CAD/CAM<br />
Durchgängiges System mit folgenden<br />
Schnittstellen:<br />
VDA/FS, IGES, STEP, DXF, DWG,<br />
SAT, Read PTC, Magics STL FIX<br />
Formenbau<br />
Herstellung von Ein- oder Mehrkavitätenformen,<br />
mit höchsten Qualitätsansprüchen<br />
unter Einhaltung des mit<br />
dem Kunden getroffenen Terminplans.<br />
Branchen<br />
• Elektroindustrie<br />
• Kommunikationstechnik<br />
• Textilindustrie<br />
• Automotive<br />
Dienstleistung<br />
• Fünf-Achsiges CNC-HSC-Fräsen<br />
von 1200 x 700 mm<br />
• Flachschleifen von 1200 x 600 mm<br />
• Bemustern aller gebauten<br />
Formen mit unseren Partnern<br />
• Lieferung der Serienteile durch<br />
unsere Tochterfirma
Es steht sowohl eine 3AchsAusführung wie auch eine Variante<br />
mit DrehSchwenktisch für die 5Achs(S<strong>im</strong>ultan)Bearbeitung<br />
zur Auswahl. Der DrehSchwenktisch hat eine Aufspannfläche<br />
von 400 x 400mm und eignet sich für Werkstücke bis 200kg.<br />
Das Konzept dieses Tisches mit TorqueMotoren (Drehgeschwindigkeiten<br />
bis 120 U/min) und integrierter hydraulischer Klemmung<br />
ist neu und wurde zum Patent angemeldet.<br />
Aufgrund der verfügbaren Spindeldrehzahlen kommt die HSC 55<br />
linear auch für die Bearbeitung von Graphit in Frage. Die Gestaltung<br />
des Arbeitsraumes trägt dieser Verwendung besonders<br />
Rechnung. Um einen freien Spänefall zu gewährleisten, wurden<br />
Störkanten el<strong>im</strong>iniert. Antriebe und Führungen befinden sich<br />
außerhalb des Arbeitsraumes und sind somit gegen Prozesseinflüsse<br />
geschützt. Weitere Optionen betreffen die Werkzeugmagazinierung<br />
(bis zu 120 Plätze sind möglich) oder die Automatisierung,<br />
wobei Palettenspeichersysteme ebenso zum Repertoire<br />
gehören wie Roboterlösungen. “Wir wollen mit dieser Maschine<br />
unser Profil in der HSCBearbeitung schärfen”, resümiert der<br />
Geschäftsführer.<br />
Nicht nur Maschinenanbieter<br />
“Die HSCMaschine ist die HighEndMaschine <strong>im</strong> Werkzeug<br />
und Formenbau”, fährt der Maschinenspezialist fort. Er sagt dies<br />
nicht ohne den Hinweis, dass zum High Speed Cutting freilich<br />
auch das geeignete Werkzeug, die Werkzeugaufnahme, die entsprechende<br />
Software und andere Dinge gehören. Aus diesem<br />
Grunde verstehe man sich bei Deckel Maho Seebach in Geretsried<br />
nicht nur als Maschinenanbieter, sondern als Kompetenzpartner<br />
und Anbieter kompletter Bearbeitungslösungen, besonders<br />
auch für den HSCBereich. Dazu gehört beispielsweise,<br />
dass HSCSeminare organisiert werden. “Das sind keine Verkaufsveranstaltungen”,<br />
betont Markus Rehm, “kompetente<br />
Industriepartner geben ihr Wissen über alle nur denkbaren<br />
HSCThemen an die Interessenten weiter; Letztere sind nicht<br />
nur DMGKunden.”<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
• Werner Mühleisen<br />
• Volker Schmid<br />
• Markus Bay<br />
Wir sind Ihr innovativer Formenbau, der mit seiner Produktpalette von Einkomponenten-,<br />
Mehrkomponenten-, Multikavität-, Dreh- und Etagenwerkweugen, Prototypen-<br />
und Vorserienwerkzeuge – bis zu einer Größe von 1.000 mm x 1.200 mm und einem<br />
Gewicht von bis zu 5 t – hochwertige Spritzgießformen fertigt.<br />
Seit Jahren sind wir speziell <strong>im</strong> Bereich der Zweikomponentenformen ein kompetenter<br />
Partner für jedes Problem. Durch unsere VDA 6.4-Zertifizierung sind Termintreue und<br />
Qualität keine leeren Versprechungen.<br />
Auch ein durchgängiges CAD/CAM-System und verbunden mit einer hauseigenen<br />
Konstruktion mit Moldflow-Analyse sowie der neuesten Maschinentechnologie<br />
sichern diesen Anspruch, den wir an uns selbst <strong>im</strong> höchsten Maße stellen.<br />
In der Lohnfertigung decken wir den Bereich HSC-Fräsen und die dazugehörige Datenaufbereitung<br />
sowie Lohnerodieren mit Elektrodenfertigung ab.<br />
Formenbau Rapp GmbH · Blumenstr. 13 · 74369 Löchgau · Tel. 0 71 43 / 21 055 · info@formenbau-rapp.de · www.formenbau-rapp.de<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 21<br />
Das ErgolinePanel des neuen Maschinendesigns<br />
von DMG bietet einen 19ZollBildschirm, Softkeys<br />
für einen individuellen Funktionszugriff und<br />
eine BedienerIdentifizierung per Smartkey.
22 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
In der Montage bei der Deckel Maho Seebach<br />
GmbH in Geretsried<br />
Der hohe Stellenwert von Beratungsdienstleistungen wird auch<br />
daran deutlich, dass nahezu die Hälfte der Mitarbeiter <strong>im</strong> HSC<br />
Vertriebsteam in der Anwendungstechnik tätig sind. Eine ihrer<br />
Aufgaben: Entwicklung individueller Bearbeitungskonzepte. Vom<br />
Kunden kommen oft nur die 3DDaten, Deckel Maho Seebach<br />
liefert die Bearbeitung mit Maschine, Zubehör und sämtlichen<br />
Parametern. “Diese Marktnähe bedeutet, das wir die gesamte<br />
Prozesskette beherrschen müssen, nicht nur die Maschine”, hebt<br />
Markus Rehm hervor. Er setzt hinzu: “Wir sehen unsere Stärke<br />
zum einen in der Produktvielfalt und Qualität, zum anderen in<br />
der Prozesskompetenz und Nähe zum Kunden. Nähe zum Kunden<br />
heißt für uns, dass wir auf individuelle Wünsche und Sonderoptionen<br />
eingehen.”<br />
Die Qualität der Produkte wird entscheidend durch innovative<br />
Detaillösungen geprägt. Dazu gehören beispielsweise die Linearantriebe<br />
mit gewichtsabhängiger Beschleunigungskontrolle. Kein<br />
anderer Werkzeugmaschinenhersteller setzt so konsequent auf<br />
Linearantriebe wie DMG. Hinzu kommen Softwarelösungen wie<br />
die Virtual Machine, mit der komplexe Prozesse noch vor dem<br />
ersten Span am Rechner s<strong>im</strong>uliert und opt<strong>im</strong>iert werden können.<br />
“Der Einstieg in komplizierte Technologien wie das 5AchsFräsen,<br />
noch dazu in der HSCVersion, muss heute so einfach und so<br />
sicher wie möglich sein”, bringt es der Geschäftsführer auf den<br />
Punkt.<br />
Einen vergleichbar großen Entwicklungsschritt wie in den 90er<br />
Jahren, als das High Speed Cutting aufkam, wird es in absehbarer<br />
Zeit wohl nicht geben. Der Anwender darf in den kommenden<br />
Jahren jedoch mit zahlreichen weiteren Opt<strong>im</strong>ierungen<br />
rechnen. Die Automation wird dabei noch zunehmen. Deckel<br />
Maho Seebach hat daher ein eigenes, platzsparendes Palettensystem<br />
entwickelt. Ein Trend: Die vollautomatisch bewegten<br />
Werkstücke werden <strong>im</strong>mer größer. “Wir haben heute schon<br />
Kunden, die mit einem Transfergewicht von 500kg arbeiten”,<br />
erklärt Markus Rehm. | Richard Läpple, Tübingen
Mit Hilfe der Virtual Machine von DMG wird die<br />
Maschinenumgebung komplett am Bildschirm<br />
dargestellt, Basis für das Collision Monitoring<br />
und andere S<strong>im</strong>ulationen.<br />
Markus Rehm, Geschäftsführer Deckel Maho<br />
Seebach GmbH: “Der Trend zu <strong>im</strong>mer komplexeren<br />
Maschinen ist ungebrochen. Multitasking,<br />
Automationsfunktionen, fünf Achsen usw. sind<br />
Dinge, die von den Bedienern viel abverlangen.<br />
Es ist daher nur konsequent, wenn unterschiedlich<br />
qualifizierten Mitarbeitern ein unterschiedlicher<br />
Funktionsumfang zur Verfügung gestellt<br />
wird. Fehlbedienungen werden dadurch vermieden,<br />
Maschine und Prozess geschützt.”<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 23<br />
NEWS • www.erowa.com • INFOS<br />
<br />
<br />
<br />
ab<br />
39.000,–
24 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Wolfgang Faßnacht empfängt seine Besucher<br />
mit einer eigenen kleinen Ruhmeshalle direkt<br />
am Eingang des Betriebes. Hier sind seine Auszeichnungen<br />
in der Kategorie “Externer Werkzeugbau<br />
unter 100 Mitarbeiter” 2005 und zum<br />
Gesamtsieger 2007 zu bewundern.
Das neue Selbstbewusstsein der Formenbauer<br />
von Dipl.Ing. (FH) Tobias Knipping<br />
Am 4. Dezember 2007 gewinnt die Firma Faßnacht aus Bobingen<br />
den “Excellence in Production Award” des aachener werkzeugbaus<br />
und wird zum besten Werkzeugbau des Jahres 2007<br />
ernannt. Nach mehreren Anläufen auf diesen Titel, die der Firma<br />
2005 bereits den Sieg in der Kategorie “Externer Werkzeugbau<br />
unter 100 Mitarbeiter” eingebracht hat, geht für Firmengründer<br />
und Inhaber Wolfgang Faßnacht nun endlich ein Traum in<br />
Erfüllung, auf den er seit vielen Jahren hinarbeitete.<br />
Dieses Ereignis war für uns mehr als genug Anlass, das <strong>VDWF</strong><br />
Mitglied <strong>im</strong> schwäbischen Bobingen zu besuchen und mit Wolfgang<br />
Faßnacht über die Gehe<strong>im</strong>nisse seines Erfolges zu sprechen.<br />
Anton Schweiger, Vizepräsident des <strong>VDWF</strong> und ebenfalls<br />
langjährig erfolgreicher Teilnehmer be<strong>im</strong> Aachener Wettbewerb,<br />
und Willi Schmid, Geschäftsführer des <strong>VDWF</strong>, trafen einen Firmeninhaber,<br />
der seine Besucher herzlich und voller Stolz auf sich<br />
und seine 15 Mitarbeiter durch die Fertigung führte.<br />
Vor allem fiel uns das enorme Selbstbewusstsein auf, das<br />
Wolfgang Faßnacht besitzt. Diese Eigenschaft, die man heute<br />
in vielen Werkzeug und Formenbaubetrieben nicht mehr so<br />
ausgeprägt findet, ist sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg der<br />
Firma Faßnacht und könnte als Vorbild für die gesamte Branche<br />
dienen, die in den vergangenen Jahren viel von ihrem früheren<br />
Stolz einbüßen musste.<br />
Anton Schweiger: Guten Tag Herr Faßnacht, Gratulation zum<br />
Gewinn der Auszeichnung “Werkzeugbau des Jahres 2007”. In der<br />
Auswertung des Aachener Benchmarks habe ich gesehen, dass<br />
Sie als Sieger des Wettbewerbs in Ihrem Betrieb nur einschichtig<br />
fahren. Wie kann das bei den heutigen Kostenstrukturen funktionieren?<br />
Wolfgang Faßnacht: Schichtarbeit bringt keinen Mehrwert<br />
für den Kunden, bei uns wird einschichtig gefahren, damit<br />
die Qualität nicht leidet. Wenn diese nicht st<strong>im</strong>mt, dann geht<br />
der Umsatz nach unten. Außerdem habe ich, wenn die Qualität<br />
nicht st<strong>im</strong>mt, einen höheren Nacharbeitsanteil und dadurch<br />
auch mehr Kosten. Gleichzeitig sinkt bei mehr Nacharbeit auch<br />
die Produktivität des Unternehmens, was die Kosten weiter in<br />
die Höhe treibt. Wir leisten uns sogar den Luxus, während der<br />
Urlaubszeit unserer Mitarbeiter die jeweiligen Maschinen stehen<br />
zu lassen. Auch dies erscheint auf den ersten Blick unsinnig,<br />
durch die deutlich geringeren Probleme in der Fertigungssteuerung<br />
werden die Nachteile jedoch wieder kompensiert.<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 25<br />
Willi Schmid: Heutzutage stellt sich für einen Werkzeug und<br />
Formenbauer die grundsätzliche Frage, ob er nur den Werkzeug<br />
und Formenbau anbietet oder auch den ganzen Service um das<br />
Kerngeschäft herum. Angefangen be<strong>im</strong> Engineering bis hin zum<br />
Serienanlauf be<strong>im</strong> Kunden. Wie handhaben Sie diese Problematik?<br />
Sind Sie bei der Entwicklung mit dabei oder steigen Sie erst<br />
be<strong>im</strong> reinen Formenbau ein?<br />
WF: Das ist unterschiedlich. Wir versuchen größtenteils, uns so<br />
lange wie möglich aus dem Engineering herauszuhalten. Denn<br />
eines der Probleme unserer Branche sehe ich persönlich darin,<br />
dass seitens der Kunden <strong>im</strong>mer mehr gefordert wird, gleichzeitig<br />
die Preise aber <strong>im</strong>mer niedriger werden sollten ...<br />
WS: ... aber was mache ich als Ihr Wettbewerber, wenn ich Ihnen<br />
den Auftrag wegnehmen möchte? Entweder biete ich dem<br />
Kunden mehr, oder ich muss günstiger sein.<br />
WF: Natürlich kann ich diese Spielregeln nicht aufhalten,<br />
aber ich kann versuchen, diese zu umgehen, indem ich als<br />
“Macher” Teilprojekte des Werkzeugs außer Haus vergebe.<br />
Die Sublieferanten (Konstruktion, Engineering etc.) rechnen<br />
dann direkt mit dem Kunden ab. Wir rechnen heute schon so<br />
viel in den Werkzeugpreis mit rein, da freut sich doch jeder<br />
Kunde, denn normaler weise müsste er für die gleiche Aufgabe,<br />
die ihm jetzt der Werkzeugmacher abn<strong>im</strong>mt, einen Konstrukteur,<br />
einen Entwickler etc. beauftragen. Aber wir brauchen den<br />
Auftrag, also machen wir es. Das ist zurzeit unser größtes<br />
Problem. Wir haben ein ähnliches Problem bei der Bemusterung.<br />
Manche Kunden verlangen von uns, dass wir in eine Spritzgießmaschine<br />
investieren sollen. Ich brauche Ihnen wohl nicht<br />
erzählen, was das für Kosten sind.<br />
WS: Aber ich wette mit Ihnen, dass Sie bis in zehn Jahren eine<br />
Spritzgießmaschine hier <strong>im</strong> Hause haben. Ich habe mich 30<br />
Jahre lang gegen dieses Thema gewehrt, heute habe ich selbst<br />
eine Spritzgießmaschine und bemustere bei mir <strong>im</strong> Haus.<br />
WF: Ich sehe das anders, ich bin überzeugt, dass es günstiger<br />
ist, die Werkzeuge außer Haus bemustern zu lassen, wir machen<br />
dies bereits seit mehreren Jahren so, und es funktioniert sehr<br />
gut. Eventuell haben wir da einen Vorteil, dass es <strong>im</strong> Augsburger<br />
Raum sehr viele Spritzereien gibt. Da kommt man auch unter,<br />
wenn man kurzfristig eine Musterung zu machen hat. Wenn<br />
wir dem Druck unserer Kunden nach einer eigenen Spritzgießmaschine<br />
nachgeben würden, würden diese nur noch mehr ihrer<br />
Probleme auf den Werkzeugmacher abschieben.
26 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Das Selbstverständnis der Firma Faßnacht spiegelt<br />
sich auch in der Kleidung wieder. Fast die gesamte<br />
Belegschaft weist auf den Gesamtsieg 2007 hin.<br />
Wolfgang Faßnacht zeigt Willi Schmid, Geschäftsführer<br />
des <strong>VDWF</strong> (rechts), und Anton Schweiger,<br />
Vizepräsident des <strong>VDWF</strong> (Mitte), seinen Betrieb.<br />
WS: Das liegt aber mitunter auch daran, dass wir Werkzeugmacher<br />
das zu unserem Slogan gemacht haben. Bei fast allen<br />
Werkzeugmachern hört oder liest man doch, dass diese von der<br />
Idee bis zum Produkt alles machen. Die Kunden wären ja blöd,<br />
wenn sie das nicht ausnutzen würden.<br />
WF: Genau da sehe ich aber das Problem, warum die Margen<br />
<strong>im</strong>mer geringer werden. Parallel dazu stelle ich in letzter Zeit<br />
<strong>im</strong>mer häufiger fest, dass die Mitarbeiter unserer Kunden <strong>im</strong><br />
spritztechnischen Verständnis massiv schlechter werden. Dies<br />
liegt wohl daran, dass die Firmen keinen qualifizierten Nachwuchs<br />
mehr bekommen oder keine Zeit mehr haben, den<br />
Nachwuchs entsprechend auszubilden. Die daraus entstehenden<br />
Probleme werden wiederum häufig auf den Werkzeugmacher<br />
abgewälzt, der dann sein Wissen und sein Geld hineinstecken<br />
muss, um den Kunden nicht zu verlieren. Außerdem sind wir<br />
Werkzeugmacher auch in der schlechten Lage, dass wir nicht<br />
wissen, was der Kunde mit dem entsprechenden Werkzeug<br />
gemacht hat. Wenn ein Kern abgerissen ist, weil dem Kunden<br />
ein Teil in der Maschine hängen geblieben ist, dann sagt einem<br />
das keiner, aber die Kosten haben wir zu tragen.<br />
AS: Heutzutage zählt doch auf dem Markt vor allem der Preis<br />
eines Werkzeugs. Wie schaffen Sie es, trotz des enorm großen<br />
Wettbewerbs so erfolgreich zu agieren?<br />
WF: Wir haben bei uns <strong>im</strong> Haus den Vorteil unserer Größe<br />
und unseres langjährigen und sehr erfahrenen Personalstamms.<br />
In den letzten 17 Jahren habe ich nur 2 Mitarbeiter verloren.<br />
Parallel dazu habe ich beobachtet, dass bis zur Musterung die<br />
Werkzeuge der Wettbewerber nicht besser oder schlechter<br />
sind als unsere. Aber dann bekommt man ein Prüfprotokoll,<br />
und wenn man die Punkte, die dort angemerkt sind, nur zum<br />
Teil oder unvollständig abarbeitet, ergeben sich dann ganz<br />
schnell fünf bis sechs Korrekturschleifen. Und an solch einem<br />
Werkzeug kann man kein Geld mehr verdienen. Bis zur Bemusterung<br />
sind alle Werkzeugmacher sehr ähnlich, was die Qualität<br />
angeht, danach trennt sich die Spreu vom Weizen. Und genau<br />
an dieser Stelle des Produktionsprozesses gehen die Margen der<br />
Werkzeug und Formenbauer verloren. Deswegen sind wir bei<br />
uns <strong>im</strong> Hause penibel genau hinterher, dass die Opt<strong>im</strong>ierungen<br />
nach der Musterung peinlichst genau und vollständig abgearbeitet<br />
werden.<br />
WS: In der Vergangenheit haben die Werkzeugmacher viel von<br />
ihrem Stolz und ihrem Selbstbewusstsein verloren, weil sie aufgrund<br />
des großen Konkurrenzdrucks und der schlechten Auftragslage<br />
reihenweise gegeneinander ausgespielt wurden. Sehen<br />
Sie eine Chance, dass der Werkzeug und Formenbau in Deutschland<br />
wieder zu seiner alten Stärke und zu seinem Selbstbewusstsein<br />
zurückfindet?<br />
WF: Wir waren sicherlich die letzten zwei Jahre am Boden,<br />
diese Flaute hat uns aber in der Entwicklung deutlich nach<br />
vorne gebracht. Wir sind nun vernünftiger geworden, weil man
uns dazu gezwungen hat. Wir sind nicht schlechter in dem, was<br />
wir getan haben, die Umstände waren schlechter. Aber ich denke,<br />
dass wir alle unsere Hausaufgaben gemacht haben, wir müssen<br />
weiter schauen, wo wir besser werden können, wo wir Dinge<br />
und Prozesse weitergestalten können, wir müssen nur aufpassen,<br />
dass wir jetzt nicht frech werden, wo die Zeiten wieder besser<br />
werden. Aber mehr Selbstbewusstsein dürfen die Werkzeug<br />
und Formenbauer in Deutschland sicherlich wieder entwickeln.<br />
Auch sehe ich ein großes Problem in den bunten Blüten, die<br />
die Zertifizierung mit sich gebracht hat. Maßnahmenpläne,<br />
Eskalationsschemata, tägliche Fortschrittsberichte, Bilderdokumentationen<br />
– alles Kosten für den Werkzeugmacher, die vom<br />
Kunden nicht bezahlt werden.<br />
AS: Da haben Sie ja schon recht, aber man kann sich an der<br />
Stelle nur effektiv zur Wehr setzen. wenn jedes Werkzeug<br />
termingetreu abgeliefert wird. Aus der Auswertung habe ich<br />
entnommen, dass Sie in der Termintreue sehr weit vorne sind,<br />
da können Sie sich schon einiges mehr erlauben.<br />
WF: Auch wir liefern nicht alle Werkzeuge termingetreu ab. Ich<br />
habe die Erfahrung gemacht, dass man mit den Kunden reden<br />
kann. Wenn ich gleich <strong>im</strong> Vorfeld sage, dass ich eine Woche<br />
länger brauche, dann ist diese, wenn das Gesamtprojekt st<strong>im</strong>mt,<br />
sehr schnell wieder vergessen. Wenn ich aber keine ordentliche<br />
Arbeit abliefere und die Qualität leidet, das bleibt ewig hängen.<br />
Vor allem aber bedeutet ein schlampig gearbeitetes Werkzeug<br />
in der Nacharbeit zusätzliche Kosten, die einem dann – wie<br />
anfänglich schon erwähnt – wieder die Marge auffressen.<br />
WS: Man muss fairerweise sagen, dass es auch Kunden gibt,<br />
mit denen man sehr gut reden kann. Aber mit unserer Ehrlichkeit,<br />
setzen wir uns allzu oft selbst unter Druck. Wir sind also an der<br />
momentanen Situation nicht schuldlos.<br />
WF: Da haben Sie recht. Aber wenn man sieht, was manche<br />
Formenbauerkollegen heute treiben, da zieht es einem die<br />
Schuhe aus, und man braucht sich nicht zu wundern, warum<br />
die Kunden z.T. eben kleinlich und fordernd werden. Wir bei uns<br />
haben den Vorteil, dass wir in den Korrekturschleifen sehr<br />
Wenn‘s mal wieder brennt...<br />
...sind wir für Sie da!<br />
Dieselstraße 4<br />
89129 Langenau<br />
Telefon 0 73 45 / 96 76 -0<br />
Telefax 0 73 45 / 96 76 -29<br />
www.erodiertechnik.de<br />
info@erodiertechnik.de<br />
Werkzeug- und Formenbau<br />
• Drahterodieren<br />
• Senkerodieren<br />
• Startlochbohren <strong>im</strong> Werkzeug-<br />
und Formenbau<br />
Leistungen<br />
• Draht- und Senkerodieren für<br />
den Formenbau<br />
• Schnittwerkzeuge<br />
• Vorserien- und Serienteile<br />
• Prototypen<br />
• Elektrodenfertigung<br />
• Startlochbohren ab Ø 0,25 mm<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 27<br />
Ein AchtfachWerkzeug für Hilti in der<br />
Bearbeitung<br />
Equipment<br />
4 Drahterodiermaschinen<br />
(mit Plattenwechsler)<br />
4 Senkerodiermaschinen<br />
2 Startlochbohrmaschinen<br />
Datenaustausch:<br />
DXF · VDA-FS · IGES<br />
DWG · DWT · GEO<br />
Wir bieten Ihnen ein nahezu<br />
grenzenloses Spektrum an<br />
Möglichkeiten –<br />
fordern Sie uns!<br />
Natürlich nicht nur<br />
wenn‘s brennt!
28 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Seine Elektroden stellt Faßnacht größtenteils<br />
selbst her. “So baut man Kompetenzen auf und<br />
hat die Qualität selbst <strong>im</strong> Griff.”<br />
Die “Asservatenkammer”: Im Besprechungsz<strong>im</strong>mer<br />
finden sich die Produkte vergangener Jahre, die<br />
mit FaßnachtWerkzeugen hergestellt wurden.<br />
schnell sind. Das wird uns von den Kunden oft hoch angerechnet,<br />
da wir an dieser Stelle des Zeitplans eventuell in der Herstellung<br />
verlorene Zeit wieder einholen. Außerdem wissen unsere Kunden<br />
ganz genau, dass wir, wenn es zeitlich eng wird, sehr offen<br />
kommunizieren.<br />
AS: Was halten Sie denn von der Aussage, dass ein guter<br />
Werkzeugbauer keinen Auftrag aus kapazitativen Gründen<br />
ablehnen darf?<br />
WF: Ich denke, dass gerade die guten Werkzeug und Formenbauer<br />
auch mal einen Auftrag ablehnen, wenn dieser in der<br />
Fertigung nicht unterzubringen ist. Nur die guten Werkzeug<br />
und Formenbauer haben ihre Fertigungsplanung und ihre<br />
Ressourcenkontrolle so gut <strong>im</strong> Griff, dass sie abschätzen können,<br />
ob ein Auftrag noch terminlich machbar ist oder nicht. Außerdem<br />
muss es <strong>im</strong>mer ein Angebot mit dem höchsten Preis geben,<br />
damit die Wettbewerber etwas mehr verdienen können.<br />
WS: Um noch einmal auf das eigene Technikum zu kommen –<br />
denken Sie nicht, dass das Knowhow des Werkzeugmachers<br />
dadurch höher wird und er somit den Kunden einen Mehrwert<br />
verkaufen kann, wenn er die Schwierigkeiten <strong>im</strong> Umgang mit<br />
den Formen kennt?<br />
WF: Herr Schmid, da haben Sie schon recht. Aber ich mache<br />
die Formen, um damit Geld zu verdienen.<br />
AS: Aber die Lastenhefte, die wir bekommen, sind ja auch noch<br />
da, und das sind Angstlastenhefte, weil die Kunden so viele<br />
schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die Einkäufer sind aber<br />
auch nicht mehr bereit, dem Werkzeugmacher an der Stelle<br />
entgegenzukommen, weil es ja viel bequemer ist, sich auf sein<br />
Lastenheft zu berufen.<br />
WF: Selbst einige Einkäufer geben ja heute schon zu, dass die<br />
Lastenhefte eine Sammlung negativer Erfahrungen sind, aber<br />
ändern werden die Kunden ihre Lastenhefte trotzdem nicht.<br />
Eigentlich sollte jedes Lastenheft auf das spezifische Werkzeug<br />
zugeschnitten werden, dem es beiliegt, aber wer macht das<br />
schon? Um die Kunden über besonders unsinnige Forderungen<br />
in den Lastenheften aufzuklären, machen wir ihnen manchmal<br />
zwei Angebote: einmal ein Angebot für ein funktionierendes<br />
Werkzeug und einmal eins für ein Werkzeug gemäß Pflichtenheft.<br />
Das hilft in den meisten Fällen.<br />
AS: Herr Faßnacht, wir danken Ihnen vielmals für das Interview<br />
und wünschen Ihnen und Ihrer Firma weiterhin alles Gute und<br />
viel Erfolg für die kommenden Jahre. | Dipl.Ing. (FH) Tobias<br />
Knipping, Schwendi
Schweiger GmbH & Co. KG erfolgreich<br />
Neben dem Gesamtsieger des Wettbewerbs,<br />
dem Faßnacht Formenbau aus Bobingen, war<br />
ein weiteres <strong>VDWF</strong>Verbandsmitglied be<strong>im</strong> letztjährigen<br />
“Excellence in Production Award” erfolgreich.<br />
Die Firma des <strong>VDWF</strong>Vizepräsidenten<br />
Anton Schweiger, die Schweiger GmbH & Co. KG<br />
aus Uffing am Staffelsee, belegte in der Kategorie<br />
“Externer Werkzeugbau unter 100 Mitarbeiter”<br />
den sechsten Platz.<br />
Die Firma Schweiger gewann ein unter den “Top<br />
20”Teilnehmern ausgelostes Benchmarking, das<br />
<strong>im</strong> nächsten Jahr von den Mitarbeitern des<br />
FraunhoferInstituts für Produktionstechnologie<br />
IPT bei der Firma durchgeführt werden wird.<br />
Gerade die Auswertung der Ergebnisse ist für<br />
Anton Schweiger der Grund, jährlich an dem<br />
Wettbewerb teilzunehmen. “Zwar ist der Aufwand<br />
sehr groß, bis man die geforderten<br />
Zahlen und Daten beisammen hat”, sagt Anton<br />
Schweiger, “aber durch die Analyse, die es mir<br />
erlaubt, meine Stärken und Schwächen gegenüber<br />
dem Wettbewerb zu erkennen, wird dieser<br />
Aufwand mehr als wettgemacht.”<br />
Wie erfolgreich die Auswertung dieser Zahlen<br />
sein kann, lässt sich sehr deutlich an den Fortschritten<br />
der Firma Schweiger <strong>im</strong> Wettbewerb<br />
feststellen: Musste man sich bei der ersten Teilnahme<br />
<strong>im</strong> Jahr 2005 noch mit einem neunten<br />
Platz zufriedengeben, wurde in den Folgejahren<br />
jedes Mal ein besserer Platz erzielt – eine Serie,<br />
die nach Anton Schweigers Geschmack weitergehen<br />
könnte.<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 29<br />
NEWS • www.erowa.com • INFOS<br />
Mit einem Roboter<br />
auf Schienen fahren?<br />
Genau, aber nur wenn er<br />
auch schnell vorwärts kommt<br />
und genau auf Position<br />
fährt.<br />
Egal ob Einzel- oder Mehrmaschinenautomation,Tooling,<br />
Messtechnik oder Software<br />
– EROWA ist der richtige<br />
Partner für Sie!<br />
Rund um die Maschine ist<br />
EROWA der richtige Partner.<br />
EROWA System Technologien GmbH<br />
D-90556 Cadolzburg b. Nbg.<br />
Tel. 09103 7900-0<br />
Fax 09103 7900-10<br />
e-mail: info@erowa.de<br />
www.erowa.com<br />
Systemlösungen aus einer Hand<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
Standardisieren Organisieren Automatisieren Integrieren
30 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
BBG gewinnt mit Photovoltaik/Solarthermie<br />
Komb<strong>im</strong>odul den silbernen “EuroMold Award”<br />
von Dipl.Ing. (FH) Tobias Knipping<br />
Großer Erfolg für die BBG auf der diesjährigen<br />
EuroMold, der Weltmesse für<br />
Werkzeug und Formenbau, Design und<br />
Produktentwicklung, in Frankfurt: Das<br />
Mindelhe<strong>im</strong>er Unternehmen kam mit<br />
dem eingereichten Photovoltaik/SolarthermieKomb<strong>im</strong>odul<br />
“PVTherm 160”<br />
auf den zweiten Platz und erhielt dafür<br />
den “EuroMold Award” in Silber. Für die<br />
Werkzeug, Maschinen und Anlagenbauer<br />
war es die zweite Bewerbung<br />
um den “Oskar der Produktentwicklungsszene”,<br />
wie die Veranstalter den<br />
begehrten Preis selber nennen.<br />
Top Qualität bei kürzesten Lieferzeiten <strong>im</strong> Werkzeug- und Formenbau<br />
It´s T<strong>im</strong>e to Market - Mit Ihrem Produkt schneller zum Kunden<br />
Festool GmbH<br />
FO-WB<br />
Hardy Autenrieth<br />
Leiter Werkzeugbau<br />
Weilhe<strong>im</strong>er Str. 32<br />
73272 Neidlingen<br />
Telefon 07023 / 14-362<br />
aur@tts-festool.com<br />
wzb.festool.de<br />
Das “PVTherm 160” ermöglicht auf<br />
einer Fläche die gleichzeitige Nutzung<br />
der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung,<br />
Heizungsunterstützung und<br />
Stromerzeugung. Damit vereint es die<br />
Vorteile der bislang getrennten Elemente<br />
Solarkollektor und Photovoltaikmodul<br />
in einem Bauteil. Die Idee stammt aus<br />
dem Solarzentrum Allgäu, AltdorfBiessenhofen<br />
bei Kempten, BBG hat aus den<br />
Einzelkomponenten ein fertigungsgerechtes<br />
Bauteil entwickelt und baut<br />
Werkzeuge, Maschinen und Anlagen,<br />
mit denen die “PVTherm”Komb<strong>im</strong>odule<br />
in Serie hergestellt werden können.<br />
Der Produktlebenszyklus vieler Erzeugnisse wird <strong>im</strong>mer kürzer.<br />
Die Dauer von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt steht<br />
hierbei <strong>im</strong> Fokus. Je schneller Umsatz realisiert wird, desto höher<br />
ist die Rentabilität! Ein großer Anteil in der Entwicklungszeit<br />
wird zur Erstellung von Formwerkzeugen und Betriebs-<br />
mittel benötigt. Wir helfen Ihnen Zeit zu sparen.<br />
Beispiel eines Spritzgusswerkzeugs:<br />
Aufspanngröße 246 mm x 196 mm, 2 Schieber<br />
Preis ca. 14.000 €<br />
Herstelldauer unter 2 Wochen, incl. 3-D Konstruktion<br />
Excellence in Production<br />
TOP 20<br />
2006
Gemeinsam nahmen die Geschäftsführer<br />
der beteiligten Unternehmen, Willi Bihler<br />
für das Solarzentrum Allgäu und Hans<br />
Brander für BBG, be<strong>im</strong> Messefest am<br />
6. Dezember 2007 die begehrte Auszeichnung<br />
entgegen. Bereits vor der Bekanntgabe<br />
der Gewinner war das Interesse<br />
an dem Modul sehr lebhaft. Nebenbei<br />
informierten sich die Besucher über die<br />
Qualitäten von BBG als Bauteilentwickler,<br />
Werkzeug, Maschinen und Anlagenbauer<br />
für die Solarbranche.<br />
Auch die langjährigen Kunden aus der<br />
Automobilbranche entdeckten interessante<br />
Neuheiten. Zahlreiche Fachleute<br />
überzeugten sich von der kompakten<br />
Bauweise der neuen, hydraulikfreien<br />
Schäumwerkzeuge mit elektrisch angetriebenen<br />
Schiebern. Sie ergänzen die<br />
bereits angebotenen, rein elektrisch<br />
betriebenen Formenträger. Im Zusammenspiel<br />
von beiden kann die Elektrik<br />
ihre Vorteile bei Schnelligkeit und Sauberkeit<br />
in vollem Umfang ausspielen:<br />
Der Vorgang des “Entlüftens” entfällt,<br />
wenn die Schieber in einem Werkzeug<br />
elektrisch betrieben werden, auf schmutzende<br />
Hydrauliköle kann verzichtet<br />
werden. Auch die nahezu hundertprozentige<br />
Reproduzierbarkeit ist ein<br />
Vorteil bei den hydraulikfreien Schäumwerkzeugen.<br />
Seine bislang überwiegend aus der<br />
Automobilzulieferbranche stammenden<br />
Kunden beliefert BBG weltweit, der<br />
Exportanteil betrug 2006 über 70 Prozent,<br />
wobei der asiatische Markt eine<br />
wichtige Rolle spielt. Zu den Abnehmern<br />
zählen zahlreiche international produzierende<br />
Unternehmen. 2006 erzielte<br />
das von dem geschäftsführenden<br />
Gesellschafter Hans Brandner geleitete<br />
Familien unternehmen aus Mindelhe<strong>im</strong><br />
<strong>im</strong> Allgäu mit 60 Mitarbeitern einen<br />
Umsatz von rund 7 Millionen Euro.|<br />
Dipl.Ing. (FH) Tobias Knipping, Schwendi<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 31<br />
Die Geschäftsführer Hans Brandner (links) von<br />
dem <strong>VDWF</strong>Verbandsmitglied BBG und Willi<br />
Bihler (rechts) vom Solarzentrum Allgäu erhielten<br />
am 6. Dezember 2007 in Frankfurt, während<br />
der Messe, den silbernen “EuroMold Award”<br />
überreicht.<br />
Immer die passende Feder, ab Lager oder individuell<br />
Federnkatalog Online<br />
www.federnshop.com<br />
Federn direkt ab Lager in über 10.000 Baugrössen,<br />
oder individuell nach Ihren Anforderungen bis 12 mm<br />
Drahtdurchmesser in Kleinmengen und Großserien.<br />
Fordern Sie kostenlos unseren aktuellen Federnkatalog<br />
in Papierform und auf CD-ROM an, oder kontaktieren<br />
Sie direkt unseren Verkauf unter<br />
Telefon 0 71 23 / 9 60-192<br />
Telefax 0 71 23 / 9 60-195<br />
verkauf@gutekunst-co.com<br />
www.federnshop.com<br />
Gutekunst + Co. Federnfabriken<br />
Carl-Zeiss-Straße 15 · D-72555 Metzingen<br />
Immer die passende Feder
32 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Sandfräsen –<br />
die bessere Alternative zum Handformen?<br />
von Christian Bothur, Giesserei Erfahrungsaustausch 4/2007<br />
Konkurrenz für das Handformen: Durch Sandfräsen<br />
lassen sich insbesondere bei großen<br />
abzugießenden Modellen schneller und präziser<br />
Formen erstellen.<br />
Es gibt zwei konventionelle Verfahren, um Sandformen<br />
herzustellen: das Handformen und das<br />
Maschinenformen. Be<strong>im</strong> Handformen verdichtet<br />
der Gießere<strong>im</strong>itarbeiter per Hand den Sand – ein<br />
meist mit einem Bindemittel versehener Quarzsand<br />
– um das abzugießende Modell herum.<br />
Be<strong>im</strong> Maschinenformen verdichten spezielle<br />
Maschinen, die Formautomaten, teil oder vollautomatisch<br />
den Sand um das abzugießende<br />
Modell. Das Handformen findet Anwendung,<br />
wenn es sich bei der herzustellenden Gussform<br />
um ein Einzelstück handelt, die Stückmenge<br />
sehr gering ist, die Gussteile sehr groß sind<br />
oder es sich um komplizierte Gussstücke handelt,<br />
die Formautomaten technisch nicht bewältigen<br />
beziehungsweise wirtschaftlich nicht produzieren<br />
können. Treffen diese Kriterien nicht zu, ist<br />
das Maschinenformen die bessere Wahl.<br />
Mit 5AchsFräsmaschinen schnell und<br />
kostengünstig Sandformen herstellen:<br />
Sandformen werden nach zwei Verfahren<br />
gefertigt: durch Handformen<br />
und Maschinenformen. Beide haben ihre<br />
Berechtigung. Eine ernst zu nehmende<br />
Alternative insbesondere für das Handformen<br />
ist jedoch schon heute das Sandfräsen.<br />
Wir sprachen mit Quang Son Tran,<br />
Vertriebsleiter bei der EEW Maschinenbau<br />
GmbH in Schönberg, über Einsatzfelder,<br />
Vorteile und Zukunft dieses Verfahrens –<br />
EEW ist ein Hersteller von 5AchsHochgeschwindigkeitsBearbeitungszentren.<br />
Herr Tran, welche Nachteile haben<br />
konventionelle Verfahren bei der<br />
Herstellung von Sandformen?<br />
Das Handformen hat mehrere Nachteile:<br />
Es bedarf erfahrener Gießere<strong>im</strong>itarbeiter<br />
und ist zeitaufwendig. Außerdem ist<br />
es weniger präzise, da der Gießere<strong>im</strong>itarbeiter<br />
in der Regel nicht verhindern<br />
kann, dass sich das Modell be<strong>im</strong> “An<br />
klopfen” des Sandes in der Position leicht<br />
verändert. Die Folge sind ungewollte<br />
Toleranzen. Zudem ist die Oberfläche<br />
des Gussstückes meist rauer als be<strong>im</strong><br />
Maschinenformen, weil der Sand nicht<br />
so stark verdichtet werden kann. Aber<br />
auch das Maschinenformen ist mit<br />
Nachteilen verbunden. Die Größe der<br />
Formautomaten ist begrenzt – entsprechend<br />
auch das Ausmaß der Sandformen.<br />
Auch für komplizierte Gussstücke ist ein<br />
Formautomat oft nicht geeignet. Da eine<br />
solche Maschine hohe Rüstkosten mit<br />
sich bringt, lohnt sich der Einsatz bei<br />
kleiner Stückzahl oder Einzelstücken<br />
unter Umständen nicht.<br />
Welche Vorteile hat das Sandfräsen<br />
<strong>im</strong> Vergleich zu den konventionellen<br />
Technologien?<br />
Im Prinzip kann jede 5AchsFräsmaschine<br />
zum Sandfräsen genutzt werden,<br />
sofern diese auch unter den maschinenwidrigen<br />
Bedingungen eines Sandfräs<br />
Umfeldes zuverlässig arbeitet. Die Hauptidee<br />
des Sandfräsens ist, die Form für<br />
das herzustellende Gussstück ohne<br />
Modell herzustellen. Das heißt, die Form<br />
wird direkt in den Sand gefräst, was die<br />
Herstellungszeit relevant verkürzt. Da in<br />
vielen Fällen die Daten für das Gussstück<br />
bereits als CADDatei in digitalem Format<br />
vorliegen, kann ein erfahrener CAMMitarbeiter<br />
in überschaubarer Zeit das Fräsprogramm<br />
auf Basis der vorliegenden<br />
3DGeometrie des Gussteils erzeugen.<br />
Dieses kann dann von der Fräsmaschine<br />
präzise abgear beitet werden.
In der Serienfertigung von Gussstücken<br />
bis zu einer best<strong>im</strong>mten Größe wird<br />
dennoch ein Formautomat dem Sandfräsen<br />
überlegen sein, da die Herstellung<br />
bei vergleichbarer Präzision <strong>im</strong>mer noch<br />
wesentlich schneller ist. Das Sandfräsen<br />
ist jedoch insbesondere bei großen abzugießenden<br />
Modellen die bessere Alternative<br />
zum Handformen, weil sich damit<br />
schneller und präziser Formen erstellen<br />
lassen.<br />
Welche Eigenschaften sollten Fräsmaschinen<br />
haben, um effektiv eingesetzt<br />
werden zu können?<br />
Prinzipiell ist jede 5AchsFräsmaschine<br />
zum Sandfräsen verwendbar. Sie muss<br />
jedoch robust genug sein, um in einer<br />
“sandigen” Umgebung zu funktionieren.<br />
Vor dem Hintergrund, dass mit dem<br />
Sandfräsen große Gussformen in kürzerer<br />
Zeit hergestellt werden sollen, ist es sinnvoll,<br />
5AchsFräsmaschinen einzusetzen,<br />
die in einem großen Arbeitsbereich tatsächlich<br />
hohe Fräsgeschwindigkeiten<br />
erreichen. Konventionelle Fräsmaschinen<br />
mit Stahlportal können dies nicht leisten<br />
– anders die 5AchsFräsmaschine HSM<br />
Modal: Alle beweglichen Teile dieser<br />
Maschine, insbesondere das Portal und<br />
die Maschinenpinole (zAchse), bestehen<br />
<strong>im</strong> Wesentlichen aus Kohlefaser und<br />
AluminiumSandwich. Diese Materialien<br />
vereinigen zwei Eigenschaften: geringes<br />
Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität<br />
und Steifigkeit. Dadurch ist die Maschine<br />
in der Lage, Formen nicht nur präzise,<br />
sondern auch schnell zu fräsen.<br />
Hinzu kommt, dass sich das Portal der<br />
Maschine aufgrund der Gitterstruktur<br />
und des verwendeten Materials vergrößern<br />
lässt – standardmäßig über<br />
20 Meter in der Länge, bis zu 9 Meter<br />
in der Breite und bis zu 4 Meter in der<br />
Höhe. Somit sind dem Arbeitsbereich der<br />
Maschine kaum Grenzen gesetzt. Auch<br />
für das Fräsen sehr großer Sandformen<br />
lässt sich die Maschine konfigurieren.<br />
Wie werden sich die Technologien<br />
in den nächsten Jahren entwickeln?<br />
In den letzten zwei bis drei Jahren ist die<br />
Gießereibranche offener für das Thema<br />
Sandfräsen geworden. Dennoch ist die<br />
Anzahl der Gießereien, die dieses Verfahren<br />
anwenden, sehr überschaubar.<br />
Im deutschsprachigen Raum dürfte sie<br />
<strong>im</strong> einstelligen Bereich liegen. Die Gründe<br />
für die Zurückhaltung der meisten Gießereien<br />
sind vielfältig: Die verantwortlichen<br />
Mitarbeiter haben aufgrund der Auftragslage<br />
wenig Zeit, sich intensiv mit<br />
der Technologie auseinanderzusetzen.<br />
Der Einsatz von Sandfräsen verändert<br />
teilweise den gewohnten Arbeitsprozess,<br />
was organisatorische Veränderungen vor<br />
der Einführung der Technologie erfordert.<br />
Angesichts des relativ hohen Investitionsaufwands<br />
gilt es also für eine Gießerei,<br />
Kosten und Nutzen genau abzuwägen.<br />
Dennoch ist abzusehen, dass in den<br />
nächsten Jahren mehr und mehr Gießereien<br />
in die Technologie des Sandfräsens<br />
investieren werden, da der Wettbewerb<br />
um Kunden und Fachkräfte dies zunehmend<br />
erzwingen wird. So werden die<br />
innovativen Gießereien mit Sandfräs<br />
Technologie qualitativ hochwertige Gussstücke<br />
schneller liefern können. Und die<br />
moderneren Betriebe werden es leichter<br />
haben, gut ausgebildete Mitarbeiter zu<br />
finden und an sich zu binden. Denn vor<br />
allem jüngere Fachkräfte werden es vorziehen,<br />
das Produktionsziel mit Hilfe<br />
von Maschine und Computer statt durch<br />
schwere körperliche Arbeit zu erreichen. |<br />
Christian Bothur, Mönchengladbach<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 33
34 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Direct Texturing – mit der Fräsmaschine zur<br />
“geätzten” Oberflächenstruktur<br />
von Dipl.Ing. (FH) Tobias Knipping<br />
Zahllose Gegenstände des alltäglichen<br />
Lebens sind mit texturierten Oberflächen<br />
gestaltet. Lederähnliche Oberflächen<br />
(Narbungen), wie sie <strong>im</strong> Innenraum von<br />
Automobilen häufig verwendet werden,<br />
sind sicherlich das bekannteste Beispiel.<br />
Texturen verleihen Kunststoffoberflächen<br />
eine ansprechende Optik und eine angenehme<br />
Haptik.<br />
Bisher werden texturierte Oberflächen<br />
geätzt oder durch ein aufwendiges<br />
galvanisches Verfahren in die Form<br />
eingebracht. Hierzu werden nach der<br />
Werkzeugkonstruktion eine Prägewalze,<br />
ein Belederungsmodell und eine Texturfolie<br />
hergestellt.<br />
Das Belederungsmodell wird von Hand<br />
mit der Folie bezogen. Von diesem Modell<br />
wird dann eine Silikonform hergestellt,<br />
die als Grundlage für ein Badmodell<br />
dient, das wiederum für den galvanischen<br />
Aufbau der Formschale genutzt wird.<br />
Abschließend wird manuell die Kühlung<br />
in die Formschale eingebracht, bevor<br />
der Einsatz in die Endmontage kommt.<br />
Nachteilig ist bei diesem Verfahren zum<br />
einen die sehr lange Herstelldauer und<br />
zum anderen die Tatsache, dass es nur<br />
wenige Firmen gibt, welche die erforderliche<br />
Kenntnis zur Herstellung texturierter<br />
Oberflächen haben. Sollten sich die<br />
Bauteildaten während dieses Prozesses<br />
ändern, ist ein Neubeginn ab dem Belederungsmodell<br />
unumgänglich.<br />
Be<strong>im</strong> Direct Texturing wird nach der Werkzeugkonstruktion<br />
die Textur <strong>im</strong> CAD<br />
Programm auf der Oberfläche generiert.<br />
Hierzu werden Textur und Dekorelemente<br />
in grafischen Formaten in die CAD<br />
Daten <strong>im</strong>plementiert. Anschließend wird<br />
über ein CAMProgramm eine NCDatei<br />
generiert, welches die texturierte Oberfläche<br />
über eine HSCFräsmaschine<br />
in den Formeinsatz einbringt.<br />
Alternativ kann auch ein Datensatz<br />
für Lasergravieranlagen erstellt werden.<br />
Momentan einziger Nachteil dieses Verfahrens<br />
ist, dass aufgrund der enormen<br />
Datenmenge der NCDatei zurzeit nur<br />
texturierte Flächen bis zu einer Größe<br />
von max<strong>im</strong>al 300x200mm realisiert<br />
werden können. Größere Speichermedien<br />
und eine weitere Anpassung des Prozesses<br />
werden die Kapazität jedoch in naher<br />
Zukunft deutlich erweitern.<br />
Die vielen Vorteile des Direct Texturing<br />
liegen jedoch auf der Hand. Gegenüber<br />
dem bisher angewandten Verfahren<br />
der galvanischen Texturierung können<br />
Zeiteinsparungen von bis zu 60 Prozent<br />
erreicht werden. Auch die hundertprozentige<br />
Reproduzierbarkeit von Formeinsätzen<br />
und die Tatsache, dass alle<br />
Bearbeitungsschritte <strong>im</strong> eigenen Formenbau<br />
realisiert werden können, sind<br />
weitere Stärken des Direct Texturing.<br />
Individuelle Dekore oder Vorlagen aus<br />
der Natur können über hochauflösende<br />
Scanverfahren für diese Technologie<br />
aufbereitet werden. Dem Kunden der<br />
Formenbauer gegenüber erlaubt das<br />
junge Verfahren eine deutlich gestiegene<br />
Gestaltungsfreiheit und ein längeres<br />
Änderungsmanagement. Auch dem<br />
Einsatz deutlich resistenterer Werkstoffe<br />
für Formeinsätze, die nicht galvanisch<br />
bearbeitet werden können, steht mit<br />
Direct Texturing nichts mehr <strong>im</strong> Wege.<br />
Bauteilübergreifende Gestaltung ist<br />
möglich.<br />
Und da die Oberfläche als Datensatz<br />
beschrieben ist, können zur Evaluierung<br />
schon vor der Formenherstellung mit<br />
hochauflösenden RapidPrototypingverfahren<br />
Muster erstellt werden. |<br />
Dipl.Ing. (FH) Tobias Knipping, Schwendi
Hitachi Tool bietet für jeden Fräsertyp die<br />
größte Auswahl verschiedener Nutzlängen,<br />
Durchmesser und Eckenradien.<br />
Das ermöglicht höchste Vorschübe und konturnahes<br />
Fräsen in jeder Bearbeitungsstufe ohne<br />
spätere Nach bearbeitung. Fertigungs zeiten<br />
werden dadurch bis zu 50% verkürzt.<br />
www.high-speed-cutting.com<br />
Besuchen Sie uns auf der<br />
Düsseldorf · 31.3. – 4.4.<br />
Halle 3 · Stand D 30
HoloImpact: Explosiver Plagiatschutz<br />
von Günter Helferich, Christian Anselment, Dr. Bernd Bader und Dr. Lars Ziegler, FraunhoferInstitut für<br />
Chemische Technologie ICT, Till Scholz und Dr. Jörg Seewig, Institut für Mess und Regelungstechnik IMR,<br />
Universität Hannover, sowie Günter Beichert, HoloSupport, Pattensen<br />
Gesellschaftliche Veränderungen wie<br />
Globalisierung, erhöhte Mobilität oder<br />
die Verbreitung neuer Technologien wie<br />
das Internet haben zumeist konträre<br />
Gesichter. Zunehmende Markenpiraterie,<br />
Grauhandel und Plagiate gehören leider<br />
zu den hässlichen Aspekten solcher<br />
Errungenschaften. Die Produktpiraterie<br />
beschränkt sich schon lange nicht mehr<br />
auf Textilien und Uhren, sondern nach<br />
Schätzungen der Internationalen Handelskammer<br />
werden etwa 10 Prozent<br />
des gesamten Welthandelsvolumens mit<br />
gefälschten Produkten erzielt. Allein in<br />
Deutschland gehen dadurch jährlich ca.<br />
70000 Arbeitsplätze verloren, europaweit<br />
sind es etwa 300000. Neben der Konsumgüterindustrie<br />
sind mittlerweile auch<br />
Pharmazie, Lebensmittel und die Investitionsgüterindustrie,<br />
aber insbesondere<br />
der lukrative Ersatzteilmarkt massiv<br />
von Plagiaten betroffen. Dieser Markt ist<br />
jedoch lebenswichtig für die OEM, da sie<br />
darüber ihre hohen Entwicklungskosten<br />
refinanzieren. Darüber hinaus verliert der<br />
Originalhersteller durch minderwertige<br />
Plagiate nicht nur Marktanteile, sondern<br />
viel schl<strong>im</strong>mer noch: Es leidet auch das<br />
Renommee.<br />
Zukünftig sind übergreifende und langfristig<br />
angelegte Strategien erforderlich,<br />
welche die gesamte Wertschöpfungskette<br />
umfassen. Ziel ist es, einerseits Produktpiraterie<br />
frühzeitig zu erkennen und<br />
andererseits den Technologieklau durch<br />
Demontage und Analyse zu verhindern.<br />
Zur Kennzeichnung des Originalprodukts<br />
reicht ein Firmenemblem schon lange<br />
nicht mehr; aber auch die gern verwendeten<br />
HologrammSiegel sind nicht<br />
fälschungssicher. Deshalb sind Kombinationen<br />
von sichtbaren und verborgenen<br />
fälschungssicheren Sicherheitsmerkmalen<br />
produktspezifisch zu entwickeln und dem<br />
jeweiligen Industriezweig bereitzustellen.<br />
Sprengprägen<br />
Ein verblüffendes Verfahren zur Abformung<br />
sogar relativ weicher, nahezu<br />
beliebig strukturierter Materialien in<br />
Metall ist das Sprengprägen. Die strukturierte<br />
Vorlage wird direkt auf die Werkstück<br />
oder Werkzeugoberfläche gelegt<br />
und mittels eines hohen Impulses (hier<br />
durch einen Explosivstoff) ins Metall<br />
übertragen. Die Stoßwelle bewirkt eine<br />
zusätzliche Härtesteigerung des geprägten<br />
Materials. Auch ein zwischen Sprengstoff<br />
und Metallplatte gelegtes Laubblatt –<br />
oder eine andere beliebig strukturierte<br />
Vorlage – führt zu einer detaillierten<br />
Prägung; sogar das dünnste Adergeflecht<br />
ist zu erkennen.<br />
Die Auflösung, die man be<strong>im</strong> “Sprengprägen”<br />
erreichen kann, reicht bis in<br />
den zweistelligen Nanometerbereich.<br />
Natürliche Nano und Mikrostrukturen<br />
wie menschliches Haar, Lotusblätter oder<br />
Mottenaugen sowie auch Grobstrukturen<br />
wie Holz, Leder oder Textil lassen sich<br />
durch den hohen Detonations<strong>im</strong>puls<br />
in die Metalloberfläche einprägen. Die<br />
Strukturvorlage wird dabei zerstört.<br />
Damit ist dieser Vorgang nicht kopierfähig<br />
– selbst wenn man identische<br />
Vorlagen verwenden würde –, da ein<br />
“komplexer” Vorgang wie eine Prägung<br />
mittels Detonation sich niemals <strong>im</strong> Detail<br />
wiederholen lässt. Somit ist eine Sprengprägung<br />
“per se” der ideale Piraterieschutz.<br />
Sprenggeprägte Naturvorlagen –<br />
Blätter oder Federn unterschiedlicher Art<br />
und Größe – wurden der Fachwelt bereits<br />
präsentiert.<br />
BMBF-Projekt “Holo-Impact”<br />
Zu den fälschungssicheren Produktkennzeichen<br />
zählen Kippfarben, da die Farbfrequenzen<br />
nur ein einziges Mal vergeben<br />
werden. Mehr als 60 Währungen der Welt<br />
werden so geschützt. Auch auf RFID<br />
hinterlegte asymmetrisch verschlüsselte<br />
Daten bieten die Möglichkeit, ein Produkt<br />
eindeutig zu identifizieren. Hierzu müssen<br />
diese jedoch mit dem Produkt untrennbar<br />
verbunden werden können. Hier setzt<br />
das vom BMBF geförderte Projekt “Nanostrukturieren<br />
von Metalloberflächen<br />
mittels holografischer Prägevorlagen”<br />
an. Ein wichtiger Meilenstein des Anfang<br />
Mai 2006 begonnenen BMBFProjekts<br />
wurde von den Wissenschaftlern erfolgreich<br />
umgesetzt: Eine plane Fläche eines<br />
aus Stahl gefertigten Einsatzes für ein<br />
Spritzgießwerkzeug wurde mit Hologrammstrukturen<br />
versehen, um spritzgegossene<br />
Kunststoffbauteile visuell<br />
und nicht entfernbar zu kennzeichnen.<br />
Zur Erzeugung holografischer Strukturen<br />
sind derzeitig mehrere Prozessstufen<br />
notwendig, um z.B. ein Firmenlogo, eine<br />
Kennzeichnung oder auch verschlüsselte<br />
Daten über ein lasergestütztes Verfahren<br />
in ein fotoempfindliches Material (z.B.<br />
Fotoresist) zu übertragen. Durch galvanisches<br />
Abformen werden daraus dann<br />
Mastersh<strong>im</strong>s aus Nickel hergestellt. Aufgrund<br />
der geringen Härte des Nickelhologramms<br />
werden vom Mastersh<strong>im</strong><br />
üblicherweise mehrere Tochtersh<strong>im</strong>s<br />
wiederum durch galvanisches Abformen<br />
erzeugt. Diese Tochtersh<strong>im</strong>s können nun<br />
schließlich als strukturgebendes Werkzeug<br />
<strong>im</strong> Prägeprozess verwendet werden,<br />
wobei sich am besten weiche Spezialfolien<br />
prägen lassen; allerdings bei<br />
geringer Stand zeit der Prägewalzen und<br />
mit dem Nachteil der indirekten Produktkennzeichnung<br />
über die Verpackung.
Mit Unterstützung der Projektpartner<br />
aus Industrie und Wissenschaft wurde<br />
am Fraunhofer ICT eine Techno logie<br />
entwickelt, um die Struktur eines Nickelsh<strong>im</strong>s<br />
in ein Spritzgießwerkzeug zu übertragen<br />
und Kunststoffprodukte mit deutlich<br />
sichtbarem Hologramm in Serie zu<br />
fertigen. Damit sind alle Bauteile über<br />
den in Kunststoff eingegossenen Fingerprint<br />
eindeutig zu identifizieren.<br />
Parallel wurde am IMR eine Software<br />
entwickelt, die es ermöglicht, aus digitalen<br />
Bildern, die als Höhenkarte verwendet<br />
werden, digitale Hologrammstrukturen zu<br />
erstellen. Somit ist es möglich, benutzerdefinierte<br />
Strukturen zu erstellen, die<br />
sich zum Beispiel als dreid<strong>im</strong>ensionaler<br />
“Strichcode” mit entsprechend hoher<br />
Informationsdichte verwenden lassen.<br />
Auf der EuroMold, die Anfang Dezember<br />
in Frankfurt stattfand, stieß das Fraunhofer<br />
ICT mit der Weltneuheit “Hologrammstrukturierte<br />
Stahleinsätze” auf<br />
großes Interesse. Auf dem Fraunhofer<br />
Messestand wurden mittels einer Spritzgießmaschine<br />
ca. 6000 Frisbees, die<br />
durch eine sprenggeprägte und eine<br />
gelaserte Oberflächenstruktur veredelt<br />
waren, abgeformt und an die Messebesucher<br />
verteilt. Anfragen kamen vor<br />
allem von Besuchern, die Hologramme<br />
als Plagiatschutz einsetzen wollen.<br />
Ziel des zweiten Meilensteins, der bis<br />
Ende Januar 2009 erreicht werden soll,<br />
ist es, zylindrische Stahlober flächen durch<br />
Sprengprägen mit holografischen Nanostrukturen<br />
zu versehen und anschließend<br />
oberflächentopo grafisch zu charakterisieren.<br />
Aus diesen sollen direkt gekennzeichnete<br />
Metallgehäuse oder auch Prägewalzen<br />
für Kunststoffe hergestellt werden.<br />
Letztere haben eine deutlich verbesserte<br />
Standzeit <strong>im</strong> Vergleich zu den bisherigen<br />
aus Nickelwerkstoffen.<br />
Mit den Projektergebnissen sollen eine<br />
international führende Position auf<br />
dem Gebiet der Nanostrukturierung von<br />
Metalloberflächen sowie die Sicherung<br />
und Schaffung zukunftsträchtiger<br />
Arbeitsplätze am Technologiestandort<br />
Deutschland resultieren. | gh<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 37<br />
Form und Ergebnis: die sprenggeprägte Struktur<br />
<strong>im</strong> Werkzeug (oben) und das Abbild <strong>im</strong> Produkt<br />
Bei der Entwicklung am Fraunhofer ICT waren<br />
Partner aus der Industrie – die Firmen Neumann,<br />
topac, Rieger und Kugler – sowie aus der Wissenschaft<br />
– das IMR – eingebunden.<br />
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung<br />
(BMBF) sowie der Projektträger Deutsches<br />
Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. (DLR)<br />
unterstützen das Projekt “Nanostrukturieren<br />
von Metalloberflächen mittels holografischer<br />
Prägevorlagen (HoloImpact)”. Die Laufzeit des<br />
Projekts beträgt drei Jahre: vom 1. Mai 2006 bis<br />
zum 30. April 2009.
38 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Gießlaufsystem el<strong>im</strong>iniert Anguss nahezu komplett<br />
von Manfred Lerch<br />
Bislang sahen opt<strong>im</strong>ierte Angussverteiler so aus…<br />
…nach der nahezu kompletten El<strong>im</strong>inierung<br />
des Angusssystems durch FGS bleibt davon<br />
kaum noch etwas.<br />
Be<strong>im</strong> Druckgießen von Zink ist der<br />
Oskar Frech GmbH + Co. KG mit der<br />
neu entwickelten Werkzeugtechnologie<br />
FGS ein entscheidender Schritt in<br />
Sachen Zeit- und Kosteneinsparung<br />
sowie Qualitätsverbesserung gelungen.<br />
Min<strong>im</strong>aler Anguss <strong>im</strong> Warmkammerprozess<br />
reduziert das Kreislaufmaterial.<br />
Das wiederum führt zu niedrigerem<br />
Schmelzaufwand mit weniger Abbrand<br />
und damit zu geringeren Energie- und<br />
Handlingkosten.<br />
Bislang war be<strong>im</strong> ZinkDruckgießen der<br />
Angussverteiler als Kaltverteiler Stand<br />
der Technik. Die Folge war, dass durch<br />
die Angussverteiler relativ viel Kreislaufmaterial<br />
entstand. Dies führte durch das<br />
erneute Einschmelzen und den Abbrand<br />
zu erheblichem Zeit und Kostenaufwand.<br />
Die Zinkpreise und Energiekosten<br />
sind allerdings weiter auf dem Vormarsch<br />
und stellen so die ZinkDruckgießer vor<br />
große Herausforderungen. Auch deshalb<br />
haben sich die Verantwortlichen bei der<br />
Oskar Frech KG in Schorndorf, allen voran<br />
Dietmar Gerwig, Leiter Produktlinie Werkzeuge,<br />
vor zwei Jahren ein hohes Ziel<br />
gesteckt: das Angusssystem sollte el<strong>im</strong>iniert<br />
werden. Be<strong>im</strong> derzeitigen Stand<br />
der Entwicklung des neuen FGS (Frech<br />
GatingSystem) ist bereits ein enorm<br />
wichtiger Schritt zu mehr Produktivität<br />
und Kosteneinsparung zu verzeichnen:<br />
“Unsere Standards hinsichtlich Angusstechnik<br />
haben vor dieser Entwicklung<br />
ja ohnehin schon Maßstäbe gesetzt. Mit<br />
FGS ist es uns aber nun gelungen, den<br />
Anguss äußerst stark zu min<strong>im</strong>ieren. Der<br />
große Vorteil für den Anwender ist, dass<br />
sich damit das Kreislaufmaterial erheblich<br />
reduzieren lässt.”<br />
Realisiert wird dies durch ein neu entwickeltes<br />
Gießlaufsystem <strong>im</strong> Werkzeug.<br />
Das heißt, <strong>im</strong> herkömmlichen Verfahren<br />
fährt der Gießkolben nach Füllung der<br />
Form wieder in die Ausgangsposition<br />
über der Einlaufbohrung zurück. Die<br />
Form wird geöffnet, der Angussverteiler<br />
abgetrennt und die Schmelze fließt<br />
zurück. Mit FGS dagegen wird die<br />
Schmelze kontinuierlich auf einem<br />
Niveau gehalten und so die Übergabe<br />
zwischen Werkzeug und Maschine auf<br />
ein Min<strong>im</strong>um reduziert. Als absolutes<br />
Novum kann in diesem Zusammenhang<br />
das Gießlaufsystem gesehen werden,<br />
das die Schmelze mit konstanter Temperatur<br />
von der Mundstückspitze bis zum<br />
Anschnitt führt.<br />
Für diese konstruktive Lösung war entsprechendes<br />
Knowhow in den Angussblöcken<br />
des Werkzeugs sowie den Übergängen<br />
in die Blöcke Voraussetzung.<br />
Zumal die niedrige Viskosität von Zink<br />
entsprechende Schnittstellen erfordert.<br />
Deshalb wurden hier auch alle Komponenten<br />
mehrteilig und modular aufgebaut.<br />
Das Komplettpaket führt zum Erfolg<br />
Die Werkzeugtechnologie FGS mit dem<br />
neu entwickelten Gießlaufsystem soll in<br />
der Zukunft als Modul für den Formenbau<br />
erhältlich sein. Um das Anguss system zu<br />
min<strong>im</strong>ieren, muss aber auch das Konzept<br />
an der Druckgussmaschine entsprechend<br />
ausgelegt werden. Selbst wenn die Neuentwicklung<br />
bereits ihre seriennahe Reife<br />
erreicht hat, sieht Dietmar Gerwig deren<br />
Einsatz ausschließlich anwendungsspezifisch.<br />
Zunächst ist es so, dass dieses<br />
kombinierte Werkzeugsystem auf Frech
Maschinen funktioniert, weil ja auch<br />
der Steuerungsablauf an der Maschine<br />
geändert und die entsprechende Regeleinheit<br />
integriert werden muss. Vorrangig<br />
bieten sich dafür FrechMaschinen<br />
der neueren Generation an. Eine Inve stition,<br />
die sich neben Zeit und Kostenvorteilen<br />
auch hinsichtlich Qualitätsverbesserung<br />
rechnet. Ein konkretes Beispiel:<br />
Bei einem ZinkDruckgussteil aus der<br />
Beschlagindustrie, gegossen mit einem<br />
VierfachfachWerkzeug, konnte der Anguss<br />
von 28 auf 16 Gramm und der Luftanteil<br />
<strong>im</strong> System von 2,6 auf 0,75 Prozent<br />
reduziert werden. Dies ist von besonderer<br />
Bedeutung für Teile mit definierten Festigkeitsanforderungen.<br />
Außerdem konnte <strong>im</strong><br />
konkreten Beispiel das Kreislaufmaterial<br />
um 43 Prozent min<strong>im</strong>iert werden. In der<br />
Summe sind das mehrere Tonnen Zink<br />
<strong>im</strong> Jahr. Ein Wert der selbstverständlich<br />
auch von der Geometrie des Druckgussteils<br />
abhängig ist, sich, nach Auskunft<br />
von Dietmar Gerwig, mit FGS und entsprechenden<br />
Stückzahlen aber <strong>im</strong>mer bei<br />
mindestens 40 Prozent bewegt. Nun ist<br />
Kreislaufmaterial zwar kein Material, das<br />
verloren geht, aber vorgehalten werden<br />
muss. So bewirken erneutes Rückschmelzen<br />
und der Abbrand nicht unerhebliche<br />
Kosten. Hinzu kommt das Handling<br />
der abgetrennten Anguss verteiler (mit<br />
FGS fallen die Zinkteile fertig von der<br />
Maschine). Als weiterer positiver Effekt<br />
verkürzen sich die Zykluszeiten durch<br />
FGS. <strong>2008</strong> wird das FrechGatingSystem<br />
bereits bei aktuellen KundenWerkzeugen<br />
umgesetzt. Verständlich, dass die Zink<br />
Druckgießer gespannt darauf warten. |<br />
Manfred Lerch, Filderstadt<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 39<br />
Die Oskar Frech GmbH + Co. KG ist einer der<br />
führenden Hersteller von Warm und KaltkammerDruckgießmaschinen,<br />
Druckgießformen,<br />
Automationszubehör und Komplettlösungen<br />
für die Druckgießbranche. In 19 internationalen<br />
Tochtergesellschaften und PartnerFirmen<br />
werden ca. 700 Mitarbeiter beschäftigt. Das<br />
Unternehmen setzte in der Vergangenheit<br />
mit seinen Produkten Standards, wie z.B. mit<br />
der ersten serienmäßig gebauten Magnesium<br />
WarmkammerDruckgießmaschine (1966) oder<br />
mit der ersten elektrisch angetriebenen Druckgießmaschine<br />
(1999).<br />
Die Oskar Frech GmbH + Co.KG wurde anlässlich<br />
der EuroMold für die Entwicklung von FGS mit<br />
dem “EuroMold Award” in Bronze ausgezeichnet.<br />
Die Vorteile von FSG in der Übersicht<br />
Prozesskosten: Kürzere Zykluszeiten, weniger<br />
Verschleiß an Werkzeug und Maschine und kein<br />
Handling der Angussverteiler erforderlich – die<br />
Werkstücke fallen fertig aus der Maschine.<br />
Energiekosten: Reduktion des Kreislaufmaterials<br />
um mindestens 40 Prozent. Damit Min<strong>im</strong>ierung<br />
von Rückschmelz und Logistikkosten und<br />
Abbrand.<br />
Qualität: Reduzierung der Luftanteile verbessert<br />
vor allem die Teilequalität in oberflächensensiblen<br />
Bereichen.<br />
Spezialhärterei für Werkzeug- und Formenbau
Unternehmen stellen Neues aus der Branche vor<br />
Schnelligkeit und Effizienz mit<br />
den 3-D-Mäusen von 3Dconnexion<br />
Baupläne, technische Zeichnungen<br />
oder mechanische Konstruktionen lassen<br />
sich ab sofort mit den 3DMäusen von<br />
3Dconnexion in TurboCAD Deluxe 14<br />
schneller und effizienter erstellen. Die<br />
innovativen 3DMäuse – SpacePilot,<br />
SpaceExplorer, SpaceTraveler und Space<br />
Navigator – unterstützen außerdem die<br />
IMSI/Design Produkte TurboCAD Pro 14,<br />
eine Applikation für 3DOberflächen<br />
und Volumenkörpermodellierung, sowie<br />
TurboSketch Studio, ein Plugin auf der<br />
Basis von LightWorks für die Erstellung<br />
fotorealistischer Modelle mit Google<br />
SketchUp.<br />
CADKonstrukteure, die mit TurboCAD<br />
und TurboSketch Studio arbeiten, können<br />
jetzt von allen Vorteilen der Steuerung<br />
mit einer 3DMaus profitieren: Im<br />
Gegen satz zu herkömmlichen Computermäusen,<br />
die sich nur in zwei D<strong>im</strong>ensionen<br />
bewegen lassen, ermöglichen die 3D<br />
Mäuse eine intuitive und einfache Steuerung<br />
von 3DObjekten und Modellen.<br />
Mit Hilfe der 3DMaus verschiebt, dreht<br />
oder zoomt der Anwender 3DModelle<br />
einfach und schnell. Dank der intuitiven<br />
Steuerung mit einer 3DMaus werden<br />
Konstruktionsprozesse stark vereinfacht<br />
und der Workflow wird wesentlich produktiver<br />
und effizienter als nur mit StandardMaus<br />
und Tastatur.<br />
www.3dconnexion.de<br />
Neue Kunststoffwerkstoffe<br />
zum Laser-Sintern von EOS<br />
Der Hersteller für LaserSinterAnlagen<br />
bietet neue Kunststoffwerkstoffe mit<br />
besonderen mechanischen Eigenschaften:<br />
Das neue schlagzähe naturfarbene<br />
Polyamid Pr<strong>im</strong>ePart DC bietet eine Reißdehnung<br />
von bis zu 50 Prozent. Mit einer<br />
Zugfestigkeit von 48 MPa und einem<br />
ZugEModul von 1550 MPa sind die<br />
mechanischen Kennwerte vergleichbar<br />
mit dem bewährten PA 2200. Da Pr<strong>im</strong>e<br />
Part DC besonders schlagunempfindlich<br />
ist, eignet es sich insbesondere für AutomobilKomponenten<br />
<strong>im</strong> Innenraum.<br />
Ein weiteres neues Material ist Pr<strong>im</strong>ePart<br />
ST. Der flexible Werkstoff erreicht eine<br />
Bruchdehnung von bis zu 250 Prozent.<br />
Produkte aus diesem Material werden <strong>im</strong><br />
LaserSinterProzess gasdicht aufgebaut.<br />
Das macht eine anschließende Infiltration<br />
überflüssig – die Komponenten können<br />
direkt eingesetzt werden. Das ist derzeit<br />
mit keinem anderen flexiblen Werkstoff<br />
möglich, der <strong>im</strong> Schichtbauverfahren<br />
hergestellt wird. Potentielle Anwendungen<br />
sind Dichtungen und Schläuche.<br />
Auch die Farbauswahl wird in Zukunft<br />
größer: PA 2202 black und PA 2203 grey<br />
sind Polyamide, die Pigmente enthalten<br />
und vollständig durchgefärbt sind. Das<br />
macht die Bauteile unempfindlich gegen<br />
Kratzer, Abrieb und Verschmutzungen.<br />
www.eos.info<br />
Hasco zeigt erweitertes<br />
Schieberelemente-Sort<strong>im</strong>ent<br />
Alle Elemente des neuen SchieberProgramms<br />
sind aus derselben Grundidee<br />
entstanden und praxisnah entwickelt<br />
worden. Mit ihrer hohen Präzision sind<br />
gleiche Teile gegeneinander austauschbar<br />
oder mit gleicher Abmessung in anderem<br />
Werkstoff verfügbar.<br />
Die in Baukastentechnik erhältlichen<br />
Schieberelemente von Hasco machen<br />
Schieberlösungen variabel, Kosten kalkulierbarer<br />
und vereinfachen konstruktive<br />
Lösungen. Besonders in engen Einbausituationen<br />
sind gesteuerte Schieberfunktionen<br />
direkt aus der Werkzeugbewegung<br />
oft wünschenswert, ohne dafür<br />
einen hohen konstruktiven Aufwand<br />
betreiben zu müssen.<br />
Das Sort<strong>im</strong>ent besteht aus TNutgeführten<br />
Schiebergrundelementen, die konturgebend<br />
direkt oder mit Kontur versehen<br />
auch wechselbar eingesetzt werden<br />
können. Für kleine Hübe und Formflächen<br />
gibt es Schieberführungen, die über<br />
Hebelmechanismen und Schräganker<br />
Funktionen die Anoder Entformung auf<br />
einfache Weise ermöglichen. Mit den<br />
verschiedenen Ausführungen des Schieberbaukastenprogramms<br />
Z1800 ff. sind<br />
Konturgebungen und Entformungsfunktionen<br />
in den unterschiedlichsten Konstruktionsanforderungen<br />
rund um den<br />
Artikel darstellbar.<br />
www.hasco.com
Flexibles und robustes Honwerkzeug<br />
von Sartorius<br />
Der Werkzeugspezialist aus Ratingen<br />
bietet in der Produktgruppe “Schleifen<br />
und Trennen” ein flexibles und selbst<br />
zentrierendes Honwerkzeug nach neuester<br />
Technologie an. Durch die flexible<br />
Konstruktion der Bürste passen sich<br />
die Schleifmittelkugeln der Oberfläche<br />
an. Das neue Honwerkzeug NovoflexB<br />
von Osborn eignet sich zum Kantenbrechen,<br />
zur Endbearbeitung von Oberflächen<br />
und ist auch in unrunden Bohrungen<br />
einsetzbar. Das Werkzeug erzeugt<br />
eine gleichmäßig feingeschliffene Oberfläche,<br />
die frei von kaltverformten und<br />
deformierten Materialien ist.<br />
Durch die einfache Handhabung ist ein<br />
Einsatz auf Handbohrmaschinen als<br />
auch in Honmaschinen und Automaten<br />
möglich. H. Sartorius Nachf. bietet das<br />
Werkzeug mit einem Besatzmaterial aus<br />
Siliziumkarbid in den Korngrößen 120<br />
und 180 an. Der Durchmesserbereich<br />
der NovoflexB Honbürste beginnt bei<br />
9,0 mm und endet bei 64,0 mm. Wichtig<br />
bei der technischen Anwendung ist die<br />
Berücksichtigung eines Bürstenübermaßes<br />
von etwa 10 Prozent zur eigentlichen<br />
Bohrung.<br />
www.sartoriuswerkzeuge.de<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 41<br />
Zoller-Barcode-System für<br />
die Werkzeugvoreinstellung<br />
Das Arbeiten mit Barcode bringt Sicherheit:<br />
Menschliche Eingabefehler werden<br />
vermieden, die Informationsflut hinter<br />
den schwarzen Strichen wird durch den<br />
Scanvorgang fehlerfrei eingelesen. Durch<br />
den Einsatz eines BarcodeSystems bei<br />
der Werkzeugbereitstellung erhöht sich<br />
die Prozesssicherheit auf nahezu hundert<br />
Prozent. Mit dem Einsatz eines Barcode<br />
Systems ist jedes Werkzeug eindeutig<br />
identifizierbar. Stillstandszeiten durch<br />
Maschinencrash wegen falscher Werkzeugdaten<br />
entfallen. Ein Wiederverwenden<br />
der Werkzeuge ohne nochmaliges Vermessen<br />
wird möglich.<br />
Bei Zoller verbirgt sich hinter dem auf<br />
dem Werkzeug in Form eines Etiketts<br />
oder Ausdrucks aufgebrachten Strichcode<br />
die Bezeichnung und Nummerierung.<br />
An Zoller Einstell und Messgeräten sind<br />
entsprechende BarcodeLeser installiert,<br />
die auf dem Werkzeug die hinterlegten<br />
Werkzeugdaten aufrufen. Ebenfalls sind<br />
Zoller Einstell und Messgeräte in der<br />
Lage, BarcodeEtiketten zur Aufbringung<br />
an Werkzeugen auszudrucken.<br />
Am Werkzeugwagen befindet sich pro<br />
Fertigungsauftrag ein Einrichteblatt mit<br />
Barcode. Mittels Scan des Codes wird<br />
das Einrichteblatt am Monitor der “pilot<br />
3.0”Steuerung aufgerufen und kann<br />
vom Bediener abgearbeitet werden.<br />
www.zoller.info
Menschen und Wandel<br />
Als Spielerin gewann Silvia Neid (links) mit dem<br />
TSV Siegen und der SSG 09 Bergisch Gladbach<br />
sieben Deutsche Meisterschaften und sechs DFB<br />
Pokaltitel. Außerdem wurde sie mit der Nationalmannschaft<br />
1989, 1991 und 1995 Europameisterin<br />
und 1995 Vizeweltmeisterin. Als Assistentin der<br />
damaligen Bundestrainerin Tina TheuneMeyer<br />
wurde sie in Folge 1997, 2001 und 2005 Europameisterin.<br />
2007 übernahm Silvia Neid selbst das<br />
Amt der Bundestrainerin und gewann <strong>im</strong> September<br />
2007 die FrauenfußballWeltmeisterschaft.<br />
Ende 2007 wurde Neid von Bundespräsident<br />
Horst Köhler mit dem Bundesverdienstkreuz<br />
am Bande und dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet.
“Wenn Gegner Schwächen von uns aufdecken,<br />
wissen wir, woran wir zu arbeiten haben”<br />
Fabian Diehr <strong>im</strong> Gespräch mit Silvia Neid<br />
Was haben Fußball und der Werkzeug- und Formenbau<br />
gemeinsam? Wettbewerbsorientierung, Teamplay, Leistungswille,<br />
Durchsetzungsvermögen, aber auch die Bewältigung<br />
von Rückschlägen – diese Liste ließe sich noch<br />
lange weiterführen. All dies sind Themen, die die Menschen<br />
in den beiden genannten Bereichen beschäftigen.<br />
Ganz besonders interessant wird es, wenn innerhalb eines<br />
scheinbar geschlossenen Kreises ein neuer Akteur mit<br />
großen Erfolgen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit<br />
rückt. Silvia Neid, Bundestrainerin der Fußballnationalmannschaft<br />
der Frauen, erläutert uns ihre Sicht der Dinge.<br />
Frau Neid, was bringen Sie mit “moralischem Handeln”<br />
in Verbindung? Sehen Sie Unterschiede als Privatperson<br />
und als Sportlerin?<br />
Silvia Neid: Ich kann Ihnen zur ersten Frage leider keine philosophische<br />
Interpretation liefern. Aber wenn Sie mit “moralischem<br />
Handeln” auf das Verhalten in Bezug auf Anstand und Sittlichkeit<br />
anspielen, so gibt es ja <strong>im</strong> Alltag wie auch <strong>im</strong> Sport klare<br />
Regeln, auf deren Grundlage man dies bewerten kann. Ich selbst<br />
lege großen Wert auf einen korrekten Umgang miteinander –<br />
sowohl <strong>im</strong> Privatleben als auch auf dem Fußballplatz, sowohl<br />
gegenüber der eigenen Mitspielerin als auch gegenüber einer<br />
Gegenspielerin. Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen<br />
dem Handeln <strong>im</strong> zivilen Leben und <strong>im</strong> Fußball. Ein banales<br />
Beispiel: Während es mir die Regel erlaubt, <strong>im</strong> Fußball meinen<br />
Körper einzusetzen, um an den Ball zu kommen, würde ich meinen<br />
Körper <strong>im</strong> Supermarkt nicht einsetzen, um an ein Päckchen<br />
Butter zu kommen.<br />
Dem ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog wird<br />
folgender Satz nachgesagt: “Man kann stolz auf das sein,<br />
was man geleistet hat, nicht auf das, was man ist.” Sind<br />
Sie stolz auf Ihre Leistungen? Spielt die Zugehörigkeit<br />
zu einer Nation dabei eine Rolle?<br />
Wenn ich auf solche Erfolge wie den Gewinn einer Weltmeisterschaft<br />
oder Europameisterschaft zurückblicke, dann bin ich<br />
schon stolz auf das, was ich geleistet habe. Das ist ja eine sehr<br />
positive Bestätigung der Arbeit. Welche Auswirkung es auf die<br />
Leistung hat, dass wir als deutsche Nationalmannschaft auftreten,<br />
ist natürlich schwer zu messen. Aber ich weiß von unseren<br />
Spielerinnen, dass sie gerne für Deutschland spielen, dass es für<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 43<br />
sie eine Ehre ist, das DFBTrikot zu tragen. Und es ist auch allen<br />
bewusst, dass es eine gewisse Verantwortung ist, unser Land<br />
zu repräsentieren. Schließlich spielt man in der Nationalmannschaft<br />
nicht mal nur so für sich, sondern da fiebern ganz viele<br />
Leute mit, und darunter sind auch einige, die uns nicht nur die<br />
Daumen drücken, sondern die sich auch mit uns identifizieren.<br />
Sie waren früher als Großhandelskauffrau tätig und sind<br />
jetzt Trainerin. Karriere- und Verdienstmöglichkeiten<br />
stehen bei den meisten Menschen <strong>im</strong> Zentrum ihres<br />
beruflichen Engagements. Wie würden Sie Ihre Ziele<br />
und Motive beschreiben?<br />
Es mag zwar ein wenig abgedroschen klingen, aber ich bin<br />
wirklich in der glücklichen Situation, mein Hobby zum Beruf<br />
gemacht zu haben. Ich habe schon <strong>im</strong>mer Fußball gespielt. Ich<br />
liebe diesen Sport. Von daher ist es mir auch nicht schwergefallen,<br />
viel in ihn zu investieren. Insofern war und ist mein Motiv<br />
die Freude und der Spaß an der Sache. Darüber hinaus bin ich<br />
ehrgeizig genug, um viele Ziele zu haben. Und <strong>im</strong> Frauenfußball<br />
findet man einige Gelegenheiten, um sich zu bewähren. In<br />
diesem Jahr nehmen wir an den Olympischen Spielen in Peking<br />
teil, 2009 findet die Europameisterschaft in Finnland statt und<br />
2011 sind wir Gastgeber bei der Weltmeisterschaft.<br />
Wie gehen Sie mit Erfolgen und Niederlagen um?<br />
Unmittelbar erst einmal sehr menschlich. Ich freue und ärgere<br />
mich wie jeder andere auch über Siege und Niederlagen. Aber<br />
die Bewertung findet natürlich nicht rein emotional statt. Schon<br />
während eines Spiels muss ich schließlich analysieren, warum<br />
das Spiel so und nicht anders läuft. Es geht ja darum, vielleicht<br />
auch während einer Begegnung der Partie noch eine andere<br />
Richtung zu geben, mit Umstellungen oder Einwechselungen<br />
oder taktischen Änderungen. Entsprechend behandele ich die<br />
Spiele <strong>im</strong> Nachgang. Ich gehe mit meinem Trainerteam die<br />
Spiele noch mal komplett durch. Bei Siegen sind wir durchaus<br />
kritisch, denn nicht alles, was glänzt, muss aus Gold sein. Und<br />
Niederlagen sind sehr hilfreich, was die Weiterentwicklung einzelner<br />
Spielerinnen und der Mannschaft angeht. Wenn Gegner<br />
Schwächen von uns aufdecken, wissen wir, woran wir zu arbeiten<br />
haben.
44 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
“... es ist zunächst einmal eine Frage der Akzeptanz.<br />
Wenn das Vertrauen da ist, hören die<br />
Spielerinnen auch zu. Außerdem ist es wichtig,<br />
klare Ansagen zu machen. Und man sollte sachlich<br />
bleiben. Wenn man sich zu sehr ärgert, verschwendet<br />
man seine Energie.”<br />
Oftmals werden wirtschaftliche Entscheidungen aus dem<br />
menschlichen Gefühl heraus getroffen, obwohl rationale<br />
Analysen andere Wege zeigen würden. Wie sieht das bei<br />
Ihnen aus?<br />
Ich muss ja hauptsächlich sportliche Entscheidungen treffen.<br />
Aber für die schaffe ich schon eine fundierte Grundlage. Wer<br />
Argumente hat, wirkt schließlich überzeugender.<br />
Welche Rolle spielen be<strong>im</strong> Erreichen eines Zieles das Festhalten<br />
an einer Strategie einerseits und flexibles Variieren<br />
andererseits?<br />
Das hängt ganz von der Strategie ab. Wenn sie gut ist, wenn<br />
die Protagonisten davon überzeugt sind, kann man daran festhalten.<br />
Dann überwindet man auch kleine Rückschläge. Aber es<br />
wird niemand an einer Strategie festhalten, die einen sehenden<br />
Auges in den Misserfolg führt. Allerdings bin ich auch kein<br />
Freund von ruckartigen, extremen Richtungsänderungen. Eine<br />
Strategie sollte auch eine gewisse Variabilität beinhalten.<br />
Wie “menschlich” darf ein Trainer in angespannten<br />
Situationen sein?<br />
Auch eine Trainerin muss mal ihren angestauten Druck ablassen<br />
dürfen. Dazu ist Fußball ja auch eine zu emotionale Sache. Aber<br />
das sollte nicht überhandnehmen. Ich sehe es als Aufgabe einer<br />
Trainerin an, ein Spiel aufmerksam und sehr sachlich zu verfolgen,<br />
um gegebenenfalls noch einmal Einfluss auf die Begegnung<br />
nehmen zu können.<br />
Wie erreicht man seine Spieler – gerade in Extremsituationen<br />
– noch?<br />
Es ist zunächst einmal eine Frage der Akzeptanz. Wenn das<br />
Vertrauen da ist, hören die Spielerinnen auch zu. Außerdem<br />
ist es wichtig, klare Ansagen zu machen. Und man sollte sachlich<br />
bleiben.<br />
Thema Teamarbeit. Nach dem WM-Finale gegen Brasilien<br />
wurde in den Medien oft resümiert, dass letztlich die beste<br />
Mannschaft über das Ensemble der besten Einzelspielerinnen<br />
siegte. Wie sollte ein Team aus Ihrer Sicht idealerweise<br />
beschaffen sein?<br />
Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber es st<strong>im</strong>mt schon,<br />
dass wir in China ein sehr gut funktionierendes Kollektiv hatten.<br />
Wie viele Individualisten verträgt ein Team?<br />
Jede Spielerin sollte fähig sein, für Überraschungsmomente<br />
zu sorgen. Die Grundordnung sollte darüber aber nicht verloren<br />
gehen.<br />
Welchen Stellenwert haben bzw. sollten vermeintlich<br />
deutsche Tugenden wie “Fleiß”, “Durchhaltevermögen”,<br />
“Kampfbetontheit <strong>im</strong> Spiel” haben?<br />
Das sind sicherlich Eigenschaften, die wir bei der WM gezeigt<br />
haben, sie sind wichtig, aber damit allein kann man heutzutage<br />
kein Spiel mehr gewinnen.
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 45<br />
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Spielweise einer<br />
Nationalmannschaft und den kulturell und sozial gelebten<br />
Werten einer Gesellschaft? Oder ist das alles nur eine<br />
Frage der Betreuung und des Umgangs zwischen Coach<br />
und Spielern?<br />
Es gibt unterschiedliche Mentalitäten und verschiedene Temperamente,<br />
aber das Spielsystem sollte sich nicht daran orientieren.<br />
Das muss von den Spielerinnen umgesetzt werden können<br />
und effektiv sein.<br />
Auch die Jungen in Ihrem Team wie S<strong>im</strong>one Laudehr,<br />
Annike Krahn oder die mehrfach als Joker gebrachte<br />
Fatmire Bajramaj integrierten sich an der Seite der Routiniers<br />
wie Birgit Prinz, Renate Lingor oder Kerstin Stegemann<br />
– Glück, harte Arbeit, individuelles Können oder<br />
von allem etwas?<br />
Können und harte Arbeit.<br />
“Die Zukunft des Fußballs ist weiblich” sagte FIFA-<br />
Präsident Josef Blatter. Würden Sie bitte eine Prognose<br />
riskieren, inwieweit diese Aussage in zehn Jahren Wirklichkeit<br />
geworden ist?<br />
Die Aussage von Sepp Blatter bezog sich darauf, dass viele<br />
Mädchen Interesse haben, Fußball zu spielen, dies aber noch<br />
nicht tun. Von daher sieht er großes Potential <strong>im</strong> Frauenfußball.<br />
Be<strong>im</strong> DFB teilt man diese Meinung. Und die Zahlen geben uns<br />
ja auch recht. Der Mädchenfußball ist in der Mitgliederstatistik<br />
des DFB das am stärksten wachsende Segment. Wir hatten in<br />
den vergangenen Jahren <strong>im</strong>mer um die 20 Prozent Zuwachs<br />
in diesem Bereich. Und ich denke, dass die Entwicklung auch<br />
in den kommenden Jahren weiter positiv sein wird. Wir haben<br />
mit der Nationalmannschaft ein sehr erfolgreiches Aushängeschild,<br />
viele Spielerinnen sind Vorbilder für die Mädchen, und<br />
ich bin opt<strong>im</strong>istisch, dass wir mit der WM 2011 <strong>im</strong> eigenen Land<br />
noch weitere Mädchen für den Fußball begeistern können.<br />
Ist es für Sie als Frau vorstellbar, in absehbarer Zeit eine<br />
Männermannschaft zu trainieren? Wo würden Sie Probleme<br />
sehen?<br />
Vorstellen kann ich mir das schon. Es gibt viele Frauen, die ein<br />
entsprechendes Fachwissen haben. Aber ich weiß nicht, wie<br />
groß die Akzeptanz einer Trainerin bei männlichen Spielern ist.<br />
Ich selbst habe ja gerade erst meinen Vertrag be<strong>im</strong> DFB bis 2013<br />
verlängert. Und derzeit kann ich mir keinen besseren Job vorstellen.<br />
Nächste Ziele: die Olympischen Spiele in Peking – was<br />
möchten Sie erreichen?<br />
Wir wollen eine Medaille gewinnen.<br />
Da drücke ich Ihnen wahrscheinlich nicht als Einziger die<br />
Daumen. Herzlichen Dank für das Interview. | Fabian Diehr,<br />
München<br />
Wir bringen<br />
SIe in Bestform ...<br />
Schweiger GmbH & Co. KG<br />
Werkzeug- und Formenbau<br />
Rigistraße 6<br />
82449 Uffing am Staffelsee<br />
Tel.: 08846 / 9203-0<br />
www.schweiger-formenbau.de
Was keinen Spaß macht, macht auch nicht reich –<br />
vom richtigen Umgang mit Geld<br />
von Dr. Stefan Brunner, Bio 6/2007<br />
Fast 50 Prozent der Deutschen bekommt be<strong>im</strong> Thema<br />
“Geld” schlechte Laune. Ein Umdenken scheint hier<br />
dringend geboten.<br />
“Forget the piano!”, rief der legendäre Jazzpianist Keith Jarrett<br />
kürzlich seinem Münchner Publikum zu. Er wollte die Aufmerksamkeit<br />
von seinen Fingern weg auf die Musik lenken. “Forget<br />
the money”, könnte der adäquate Appell an all jene lauten, die<br />
wie hypnotisiert Woche für Woche auf die Lottozahlen auf dem<br />
Bildschirm starren.<br />
Sein Leben neu organisieren und dem Geld die Macht nehmen,<br />
so könnte es funktionieren. Ohnehin würde ein plötzlicher Geldsegen<br />
womöglich nur Chaos anrichten. Denn Reichsein muss<br />
gelernt werden. In ihrem Buch “Einkaufsratgeber für Millionäre”<br />
schreibt Bärbel Mohr, dass 98 Prozent aller Menschen, die zu<br />
unerwartetem Wohlstand gelangen – etwa durch eine Erbschaft<br />
oder einen Gewinn –, binnen eines Jahres wieder pleite sind und<br />
oft weniger haben als zuvor. Jeder Fünfte zwischen 21 und<br />
24 ist heute bei uns verschuldet. Mehr ökonomisches Verantwortungsgefühl<br />
schon in der Schule zu verankern lautet des halb<br />
eine Forderung der Gegenwart.<br />
Um sich zu schützen, vergibt Muhammad Yunus, Friedensnobelpreisträger<br />
und Inhaber der GrameenBank in Bangladesh,<br />
Kredite nur an Menschen, die vorher erfolgreich an einer Schulung<br />
<strong>im</strong> Umgang mit Geld teilgenommen haben. Ein anderer<br />
Ansatz, um das Verhältnis zum Geld zu heilen, kommt von<br />
Martin SchmidtBredow: neues Geld erfinden. Als Sieger ging<br />
er mit seiner Idee aus einem städtischen Ideenwettbewerb für<br />
ein zukunftsfähiges München hervor. Seine “Zeitbank” könnte<br />
zum neuen Generationenvertrag avancieren, hieß es in einem<br />
Zeitungsbericht. Das Prinzip: Die Zeit, die jemand für einen<br />
anderen aufwendet – zum Beispiel für das Reparieren der Waschmaschine,<br />
den ComputerCrashKurs, das Fensterputzen, die<br />
Kinderbetreuung –, wird seinem Konto bei der Zeitbank gutgeschrieben.<br />
Das Zeitguthaben kann er dann bei Bedarf wieder<br />
“abbuchen”, etwa Jahrzehnte später für Pflegeleistungen <strong>im</strong><br />
hohen Alter.<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 47<br />
Die meisten Menschen streben ein Leben lang<br />
nach einem dicken Bankkonto. Doch wirklich reich<br />
können wir nur dann werden, wenn wir unsere<br />
Einstellung zum Geld ändern.<br />
Wirtschaftsprofessor Muhammad Yunus gründete<br />
die GrameenBank. Sie vergibt faire Kredite<br />
an arme Bewohner in Bangladesh – vor allem an<br />
Frauen. Das Modell ist so erfolgreich, dass<br />
es inzwischen international kopiert wird. 2006<br />
erhielt Yunus den Friedensnobelpreis.
48 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Professor Günter Faltin von der Freien Universität<br />
Berlin wurde mit seiner Idee der “Teekampagne”<br />
Marktführer <strong>im</strong> deutschen Teeversandhandel. Er<br />
ist auch Initiator des Wiederaufforstungsprojekts<br />
des World Wide Fund for Nature (WWF) für Darjeeling/Indien.<br />
Ein Teil der Gewinne aus der “Teekampagne”<br />
wird hierfür verwendet.<br />
Götz Werner (links) gründete die dmDrogeriemarktkette.<br />
Seine Meinung: Nur Arbeit, die Spaß<br />
macht, bringt auch Geld. In dmDrogeriemärkten<br />
finden Kunden auch guten Service und Angestellte<br />
ungewöhnlich positive Arbeitsbedingungen.<br />
Es ist die Langfristigkeit, die SchmidtBredows Idee vom bereits<br />
bewährten Vorgehen diverser Tauschringe unterscheidet. Aus<br />
dieser Langfristigkeit heraus entsteht aber auch eine neue<br />
Gewichtung. Der DiplomKaufmann und Komplementärwährungsberater<br />
sieht darin die Chance der Altersabsicherung<br />
und betont, dass keine Inflation der Welt das angesparte Zeitguthaben<br />
beeinträchtigen könne.<br />
Das Geld habe nämlich die Tendenz, dorthin zu fließen, wo<br />
die höchste Rendite ist: vom einkommensschwachen zum<br />
einkommensstarken Sektor. “Seit 20 Jahren findet diese<br />
Umver teilung von unten nach oben statt”, so SchmidtBredow.<br />
Bei seinem Modell dagegen würde jeder profitieren.<br />
Rund 26000 Menschen lässt die globalisierte Wirtschaft täglich<br />
verhungern, schreibt Prof. Dr. Wolfgang Berger vom Karlsruher<br />
Business Reframing Institut. Der Geldbedarf steigt in unserer<br />
Welt unaufhörlich, so dass viele Staaten ihre Zinsen nur noch<br />
bezahlen können, wenn man ihnen dafür neue Kredite gewährt.<br />
Weltweite Wirtschaftskrisen seien daher unumgänglich.<br />
Um die Weltwirtschaftskrise zu überwinden, gründeten Züricher<br />
Geschäftsleute 1934 eine neue Währung, eine Zweitwährung<br />
neben dem Schweizer Franken: den WIRFranken (CHW). Diese<br />
Komplementärwährung macht heute Milliardenumsätze ausschließlich<br />
in dieser Währung. 20 Prozent der Schweizer Mittelständler<br />
sind Mitglied. Dieser geschlossene ErsatzgeldKreislauf,<br />
der von den Weltfinanzmärkten unberührt bleibt, machte Schule<br />
und wird in verschiedenen Ländern in diversen Abwandlungen<br />
praktiziert. So zum Beispiel Fureai Kippu, eine Alterspflege<br />
Währung in Japan.<br />
Ein Grundeinkommen für alle?<br />
Einen spektakulären wie umstrittenen Zugang zur kollektiven,<br />
finanziellen Zufriedenheit sucht Götz Werner und fordert ein<br />
Grundeinkommen für alle. Werner ist Professor für “Unternehmertum”,<br />
überzeugter Anthroposoph und Gründer der Drogeriemarktkette<br />
dm. Dort floss seine Haltung von Anfang an als<br />
Firmenphilosophie ein. 1200 Euro sollten jedem – finanziert aus<br />
einer Steuerreform – monatlich gezahlt werden. Bedingungen<br />
seien daran für den Einzelnen nicht geknüpft. Das wäre eine<br />
positive Veränderung unserer Realität, in der zumindest die<br />
Bedürftigen eher Almosenempfänger und Bittsteller seien.<br />
Eine solche finanzielle Situation könnte tägliche Zufriedenheit<br />
generieren, so Götz Werner. Denn statt zu arbeiten, um Geld<br />
zu verdienen, würde man arbeiten, weil man Interesse und Spaß<br />
an der Arbeit hat. Die Wahl des Ausbildungsfachs fiele nicht auf<br />
die bestdotierte Branche, sondern wäre geprägt von der Begeisterung<br />
für die Aufgabe. Lethargie und Faulheit befürchtet Götz<br />
in einem solchen ArbeitsLohnModell nicht. Er geht davon aus,<br />
dass die meisten Menschen arbeiten wollen.
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 49<br />
In seinem Unternehmen wird übrigens nicht von “Personalkosten”<br />
gesprochen, die jeden Angestellten als Belastung deutet,<br />
sondern von “Kreativposten” und “Mitarbeitereinkommen”.<br />
Reagiert man mit Skepsis, so erwidert er mit der Frage: “Kennen<br />
Sie einen Unter nehmer, der Mitarbeiter einstellt, um Kosten<br />
zu produzieren?”<br />
Seinen Angestellten bietet der 63Jährige ungewöhnliche<br />
Arbeitsbedingungen: Die einzelnen Filialen entscheiden weitgehend<br />
selbst über Sort<strong>im</strong>ent, Dienstpläne, Personaleinstellung<br />
und sogar Gehälter. Auszubildende absolvieren während ihrer<br />
Lehrzeit mehrere Theaterprojekte, die die Teamfähigkeit fördern<br />
sollen. Für seine Firmenpolitik erhielt der Vater von sieben<br />
Kindern verschiedene Auszeichnungen, darunter auch das<br />
Bundesverdienstkreuz.<br />
Wie sich mit Ökonomie Geld verdienen lässt<br />
Nicht nur die Unternehmenskultur, auch eine Geschäftsidee<br />
selbst lässt sich anders, und gerade dadurch ausgesprochen<br />
erfolgreich, denken. Das zeigt das Beispiel von Günter Faltin.<br />
Der Professor der Freien Universität Berlin hat nebenher einen<br />
Teehandel aufgebaut und verkauft inzwischen jährlich mehr als<br />
400 Tonnen Darjeeling an 170000 Kunden. Seit 1996 ist seine<br />
“Teekampagne” das größte Teeversandhaus der Bundesrepublik.<br />
Warum? Das Prinzip klingt denkbar einfach: nur eine, nämlich<br />
die beste Teesorte, nur eine Größe, nämlich die Großpackung,<br />
und zudem keine Zwischenhändler.<br />
Daraus ergibt sich das herausragende PreisLeistungsVerhältnis.<br />
“Das Prinzip heißt”, so Wirtschaftspädagoge Faltin, “von den<br />
Funktionen her zu denken, statt den Konventionen zu folgen.<br />
Sucht man systematisch nach den Faktoren, die ein Produkt<br />
wie Tee bei uns so teuer machen, stößt man fast zwangsläufig<br />
auf diese Lösung. Sie sieht schräg aus, ergibt aber Sinn, weil<br />
sie radikal Kosten spart. Der etablierte Handel mit Tee sieht nur<br />
deswegen nicht schräg aus, weil man sich daran gewöhnt hat.”<br />
Die Gewinne erlauben es Faltin, nachhaltig zu reinvestieren,<br />
etwa in die Wiederaufforstung in Darjeeling und in die Einhaltung<br />
hoher Sozialstandards. Außerdem werde jede einzelne<br />
Charge auf Chemierückstände geprüft. Die Ergebnisse finden<br />
sich auf jeder Teetüte.<br />
Einmal mehr steht also der Gedanke <strong>im</strong> Vordergrund, dass nicht<br />
das Geld leitet, sondern die Idee, das Produkt. Daraus wiederum<br />
ergibt sich ganz am Ende dann der Geldstrom. “Es ist nicht der<br />
Unternehmer, der die Löhne zahlt”, wusste schon Henry Ford, der<br />
Gründer der gleichnamigen Autofirma. “Er übergibt nur das Geld.<br />
Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt.” | Dr. Stefan Brunner<br />
Werkzeug- und Formenbau<br />
für Fortgeschrittene.<br />
»Wissen wo es langgeht.«<br />
1958 – <strong>2008</strong><br />
50 Jahre<br />
Werkzeug- und Formenbau<br />
für Fortgeschrittene<br />
Die hohen Anforderungen moderner<br />
Prozess- ketten und straffer Zeitpläne lassen für<br />
Umwege keinen Spielraum mehr. Wählen Sie also einen Werkzeugund<br />
Formenbauer der weiß, wo es langgeht. Wir haben in 50 Jahren<br />
eine Menge Erfahrungen gesammelt. Zuhören, Analysieren, Bewerten,<br />
Beraten ist unser Kommunikationskonzept in der Zusammenarbeit mit<br />
unseren Kunden. 50 Jahre Erfahrung sprechen für sich. Fordern Sie<br />
unsere Broschüre an und überzeugen Sie sich von unserer Kompetenz:<br />
Fon 07172.9 27 99-0<br />
Alfred Härer GmbH · Kiesäckerstraße 9 · D-73547 Lorch<br />
Fon 07172.9 27 99-0 · Fax 07172.9 27 99-49 · www.haerer-formenbau.de
Märkte und Chancen<br />
MesseVorberichte<br />
Euroguss – 11. bis 13. März <strong>2008</strong><br />
Schon vor Eröffnung der internationalen<br />
Fachmesse für Druckgießtechnik <strong>im</strong><br />
Messe zentrum Nürnberg ist die Euroguss<br />
auf Erfolgskurs. Sie legt bei Fläche und<br />
Neuausstellern <strong>im</strong> Vergleich zur Veranstaltung<br />
2006 deutlich zu. “Schon heute<br />
ist die neu hinzugenommene Halle 11 fast<br />
vollständig belegt. Auch in Halle 12 gibt<br />
es nicht mehr viele freie Flächen”, erklärt<br />
Bettina Focke, Projektverantwortliche<br />
der Euroguss bei der NürnbergMesse und<br />
freut sich über den enormen Zuspruch<br />
der Aussteller. “Wir merken das Interesse<br />
der internationalen Aussteller. Schon heute<br />
sind es 68 neue ausstellende Unternehmen<br />
aus aller Welt.”, blickt Bettina Focke<br />
zuversichtlich in die Zukunft. Parallel<br />
zur Fachausstellung findet der 8. Internationale<br />
Deutsche Druckgusstag statt.<br />
Drei Tage lang können sich hier die<br />
Druckgießprofis in hochkarätigen Vorträgen<br />
umfassend informieren.<br />
“Aussteller und Fachbesucher sollen sich<br />
hier einfach wohlfühlen. Ganz gewiss<br />
wird der kompakte Charakter und das<br />
besondere sowie professionelle Ambiente<br />
der Euroguss auch mit der zusätzlichen<br />
Halle 11 erhalten bleiben”, betont Focke.<br />
“Im Vergleich zur Vorveranstaltung 2006<br />
liegen wir heute bereits 15 Prozent über<br />
dem Flächenvolumen, und wir werden<br />
bis zuletzt weiter akquirieren, damit die<br />
Fachwelt hier das ganze Segment Druckgießtechnik<br />
an einem Platz konzentriert<br />
abgebildet bekommt”, so Focke weiter.<br />
Die Fachwelt soll die Messe wie bereits<br />
bei den vergangenen Veranstaltungen<br />
als ihre Plattform nutzen, um miteinander<br />
in <strong>Dialog</strong> zu treten und sich über aktuelle<br />
Trends und Entwicklungen der Branche<br />
auszutauschen.<br />
Metav – 31. März bis 4. April <strong>2008</strong><br />
Bei der diesjährigen Metav in Düsseldorf<br />
werden über 500 Aussteller aus 17 Ländern<br />
erwartet, die sich auf mehr als<br />
40000 m 2 Nettoausstellungsfläche präsentieren<br />
werden. Die Messe hat sich<br />
in den geraden Jahren als das größte<br />
internationale Technologieschaufenster<br />
der gesamten Fertigungstechnik und<br />
Automatisierung in Deutschland für<br />
Hersteller und Kunden aus Europa fest<br />
etabliert. <strong>2008</strong> wird sie für Besucher und<br />
Aussteller doppelt attraktiv, da zum gleichen<br />
Termin die beiden internationalen<br />
Leitmessen wire – Internationale Fachmesse<br />
Draht und Kabel – und Tube –<br />
Internationale RohrFachmesse – stattfinden<br />
werden.<br />
Gemeinsam werden sie das komplette<br />
Messegelände in Düsseldorf belegen und<br />
ein Forum für weit mehr als 100000<br />
internationale Fachbesucher bieten. Die<br />
unvermindert hohe Investitionsbereitschaft<br />
der Abnehmer und die umfassende<br />
Internationalität der Besucher geben<br />
über die ohnehin gute Investitionsgüternachfrage<br />
hinaus noch zusätzliche Markt<strong>im</strong>pulse<br />
für die MetavAussteller.<br />
KMO – 9. bis 12. April <strong>2008</strong><br />
Zwei Monate vor dem Start der 18. Ausgabe<br />
der Bad Salzuflener KunststoffverarbeitungsMesse<br />
KMO <strong>2008</strong> ist die<br />
Messe Ostwestfalen GmbH bei den Ausstellerbuchungen<br />
<strong>im</strong> Plan. Gegenüber<br />
der letzten KMO <strong>im</strong> Jahr 2006 gibt es bei<br />
den Ausstellern <strong>im</strong> Kernmaschinenbau<br />
allerdings erkennbare Verschiebungen. Die<br />
europäischen Hersteller von Spritzgießmaschinen<br />
scheinen sich noch mehr auf<br />
den Export, insbesondere nach Asien,<br />
zu konzentrieren. Genau den entgegengesetzten<br />
Weg wollen offenbar mehrere<br />
asiatische Hersteller nehmen, die ein<br />
wachsendes Interesse am deutschen<br />
Markt zeigen.<br />
Wenig Veränderung gibt es bei den Herstellern<br />
von PeripherieMaschinen, die<br />
der KMO treu bleiben. Gleiches gilt für<br />
die Aussteller aus dem Rohstoffbereich.<br />
Künftig will die Messegesellschaft über<br />
das aktuelle Portfolio hinaus noch die<br />
Zulieferindustrie der MaschinenHersteller<br />
stärker einbinden. Damit soll die KMO<br />
als erweiterte Spezialmesse für die Verarbeiter<br />
in der Region noch interessanter<br />
werden. Auch der diesmal kostenfreie<br />
Eintritt, nach vorheriger BesucherRegistrierung,<br />
die kurzen Wege und die intensive<br />
Arbeitsatmosphäre sollen wieder<br />
gut 10000 Fachbesucher anziehen.
Control – 22. bis 25. April <strong>2008</strong><br />
Im Frühjahr <strong>2008</strong> findet die Control erstmals<br />
in der Landesmesse Stuttgart statt.<br />
Schon jetzt zeichnen sich eine Rekord<br />
Beteiligung, ein erheblicher Flächenzuwachs<br />
und eine verstärkte Internationalisierung<br />
ab.<br />
In Absprache mit den Ausstellern, dem<br />
Ausstellerbeirat und der Landesmesse<br />
Stuttgart wird die 22. Control etwas<br />
früher, nämlich vom 22. bis 25. April<br />
stattfinden. Als die weltweit wichtigste<br />
Fachmesse für die Qualitätssicherung<br />
stellt die Control somit den Auftakt ins<br />
FachmessenJahr <strong>2008</strong> dar. Die Besucher<br />
werden damit über die Neu heiten des<br />
Jahres informiert und schließlich eröffnen<br />
sich ihnen – zeitlich betrachtet – mehr<br />
Möglichkeiten für Geschäftsabschlüsse<br />
noch <strong>im</strong> ersten Halbjahr.<br />
Hatten schon die vergangenen Veranstaltungen<br />
in der Messe Sinshe<strong>im</strong> ein<br />
umfassendes Informationsportfolio<br />
zu bieten, wird das Informations und<br />
Kommunikationsangebot zur Control<br />
in Stuttgart nochmals erweitert. Wie<br />
gehabt, finden unter der fachlichen<br />
Leitung von DGQ und TQU die stark<br />
beachteten und bewährten Fach seminare<br />
statt, diesmal <strong>im</strong> neuen Inter nationalen<br />
Congresscenter Stuttgart ICS.<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 51<br />
Rapid.Tech – 27. bis 28. Mai <strong>2008</strong><br />
Bereits zum fünften Mal lädt vom 27.<br />
bis 28. Mai <strong>2008</strong> die Rapid.Tech zum<br />
bereichsübergreifenden Erfahrungsaustausch<br />
über das Rapid Manufacturing<br />
nach Erfurt ein. Der bewährte Dreiklang<br />
aus praxisnaher Fachausstellung, parallel<br />
laufender Anwendertagung und dem<br />
Konstrukteurstag findet ebenso eine<br />
Fortsetzung wie der 2007 gestartete<br />
Wettbewerb “Student Design Award for<br />
Rapid Manufacturing” für Studenten und<br />
Absolventen von DesignStudiengängen.<br />
Die Kompaktheit des modernen Messezentrums<br />
erweist sich gerade bei Fachmessen<br />
wie der Rapid.Tech mehr als<br />
günstig. Während die Hallen als Bühne<br />
für klassische Industrie ausstellungen dienen,<br />
laufen <strong>im</strong> CongressCenter parallel<br />
Tagungen oder Workshops. Auf diese<br />
Weise lassen sich die Informationen zu<br />
den während der Messe gezeigten Produkten<br />
und Dienst leistungen vertiefen.<br />
So etablierte sich in Erfurt auch eine<br />
Austauschplattform für Maschinenhersteller,<br />
Konstrukteure und Anwender des<br />
Rapid Manufacturing. Der Stand der<br />
Dinge wird möglichst praxisnah, also an<br />
Maschinen und Bau teilen demonstriert,<br />
die aktuelle Entwicklung aus erster Hand<br />
vermittelt und mit Fachleuten diskutiert.<br />
| tk<br />
Jetzt<br />
Mitglied<br />
werden
52 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Werkzeugkonstrukteure mit Zertifikat<br />
von Dipl.Ing. (FH) Tobias Knipping<br />
Der nächste Lehrgang findet vom 18. August bis<br />
zum 9. Oktober <strong>2008</strong> statt. Die Prüfung ist am<br />
10. Oktober <strong>2008</strong>.<br />
Seit mittlerweile drei Jahren bietet das<br />
Süddeutsche KunststoffZentrum (SKZ)<br />
in Würzburg in Zusammenarbeit mit dem<br />
<strong>VDWF</strong> den Lehrgang “Der geprüfte Werkzeugkonstrukteur<br />
für Spritzgießwerkzeuge”<br />
an. Dieser Lehrgang ist für Fachleute<br />
mit einschlägiger Ausbildung, die<br />
sich ein erweitertes Gesichtsfeld für das<br />
komplexe Thema erarbeiten wollen. Nach<br />
bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmer<br />
ein Zertifikat, welches den Konstrukteuren<br />
deutlich verbesserte Einstiegs<br />
und Aufstiegschancen ermöglicht.<br />
Auch 2007 haben namhafte Firmen, wie<br />
Hofmann Werkzeugbau GmbH aus Lichtenfels,<br />
die Schweiger GmbH aus Uffing<br />
am Staffelsee, oder die Helmut Schnurr<br />
GmbH aus Bischofswiesen, sowie zwei<br />
Formenbaufirmen aus dem benachbarten<br />
Österreich ihre jungen Hoffnungsträger<br />
der Konstruktion ins SKZ nach Würzburg<br />
geschickt, damit sie den Lehrgang absolvieren<br />
und ihr bereits vorhandenes<br />
Wissen weiter vertiefen und ausbauen.<br />
Der Lehrgang vermittelt einen Überblick<br />
über die Spritzgießtechnik, Werkstoffkunde<br />
Kunststoff und Metall sowie die<br />
wichtigen Konstruktionsregeln der Kunststofftechnik.<br />
Großen Wert wird darauf<br />
gelegt, dass das theoretisch erworbene<br />
Wissen anhand von adäquaten praktischen<br />
Übungen vertieft wird. Hier wurden<br />
vor allem die konkrete Beispiele<br />
um die fünf Aufgaben der Spritzgießwerkzeuge<br />
von den Teilnehmern des<br />
Lehrgangs mit großem Eifer bearbeitet.<br />
Die Fachvorträge wurden mit Berichten<br />
zur S<strong>im</strong>ulation von Kunststoffteil und<br />
Werkzeug sowie Lösungsmöglichkeiten<br />
für die Entformung diffiziler Kunststoffteile<br />
ergänzt.<br />
Große Bedeutung wird in dem Lehrgang<br />
auch dem Thema “Kommunikation” zugewiesen.<br />
Vor allem für einen Beruf, der<br />
ständig zwischen Kunde, Lieferant und<br />
verschiedenen Fertigungsabteilungen<br />
mit seiner Konstruktion “vermittelt”,<br />
gehört eine kommunikative Grundausbildung<br />
zum unabdingbaren Handwerkszeug.<br />
Den Abschluss des achtwöchigen Lehrgangs<br />
bildete die Prüfung, die sich<br />
aus einem theoretischen Teil und einer<br />
mündliche Prüfung zusammensetzt, die<br />
beide bestanden werden müssen. Die<br />
mündlichen Prüfung wird von unabhängigen<br />
Fachleuten aus der Praxis abgenommen,<br />
die auf eine langjährige Erfahrung<br />
zurückgreifen können.<br />
Mit dem Lehrgang “Der geprüfte Werkzeugkonstrukteur<br />
für Spritzgießwerkzeuge”<br />
stellt das SKZ in Zusammenarbeit<br />
mit dem <strong>VDWF</strong> eine Möglichkeit bereit,<br />
über den Tellerrand des eigenen Betriebs<br />
hinauszuschauen. Die Teilnehmer lernen<br />
nicht nur, was zurzeit Stand der Technik<br />
ist, sondern sie lernen durch die Kommunikation<br />
mit den anderen Teilnehmern<br />
auch, wie in anderen Betrieben konstruiert<br />
wird. | Dipl.Ing. (FH) Tobias Knipping,<br />
Schwendi
MesseNachbericht EuroMold 2007<br />
von Prof. Dr.Ing. Thomas Garbrecht<br />
Ein subjektiver Blick auf die EuroMold:<br />
Professor Garbrecht besuchte mit fünf<br />
seiner Studenten die Messe und führte<br />
<strong>im</strong> Anschluss ein Gespräch mit den<br />
angehenden Ingenieuren:<br />
Professor Garbrecht: Was hat Ihnen<br />
besonders an der EuroMold gefallen?<br />
Beeindruckend war das Aufgebot an<br />
Firmen. Es war wirklich alles mit Rang<br />
und Namen <strong>im</strong> Werkzeug und Formenbau<br />
da. Bemerkenswert war auch die<br />
internationale Vielfalt der Unternehmen.<br />
Konnten Sie alles sehen, was<br />
Sie sehen wollten?<br />
Natürlich haben wir versucht, so viel wie<br />
möglich an Informationen und Eindrücken<br />
mitzunehmen, jedoch ist ein Tag viel zu<br />
kurz, um sich die gesamte Messe ausführlich<br />
anzuschauen.<br />
Wie war die Besetzung der Stände?<br />
Sehr positiv ist uns aufgefallen, dass<br />
an den Ständen sehr oft Fachpersonal<br />
anwesend war, mit dem man sich konkret<br />
z.B. über Projektarbeiten unterhalten<br />
konnte. Sehr angenehm war auch, dass<br />
uns <strong>im</strong>mer genügend Zeit gewidmet<br />
wurde und auf unsere Fragen eingegangen<br />
wurde, obwohl wir ja offensichtlich<br />
keine potentiellen Kunden sind.<br />
St<strong>im</strong>mt, aber dafür potentielle<br />
zukünftige Mitarbeiter …<br />
Natürlich bietet sich bei einem Fachgespräch<br />
auch <strong>im</strong>mer die Möglichkeit, für<br />
anstehende Praktika und Diplomarbeiten<br />
Kontakte zu knüpfen. Zusätzlich konnte<br />
man sich auch mit Firmen auseinandersetzen,<br />
die man bisher nicht kannte.<br />
Mit einem originellen Messeauftritt kann<br />
eben nicht nur das Interesse der Kunden<br />
geweckt werden.<br />
Wie bewerten Sie die St<strong>im</strong>mung <strong>im</strong><br />
deutschen Werkzeug- und Formenbau?<br />
Trotz des zunehmenden Konkurrenzdrucks<br />
aus dem Ausland scheint der<br />
deutsche Werkzeugbau sehr zuversichtlich<br />
und tritt hier auch sehr selbstbewusst<br />
auf. Zu Recht, wie wir finden. Auch<br />
nach dem, was wir heute gesehen haben,<br />
müssen sich die deutschen Firmen nicht<br />
vor der Konkurrenz verstecken.<br />
Fanden Sie denn auch etwas verbesserungsfähig<br />
an der Messe?<br />
Klar, große Maschinen sind schwer zu<br />
transportieren, trotzdem hatten wir uns<br />
erhofft, auch mal einige der größeren<br />
Werkzeuge <strong>im</strong> Einsatz zu sehen, besonders<br />
auf dem Gebiet der Umformtechnik.<br />
Und besonders <strong>im</strong> Bereich der Zerspanungstechnik<br />
waren die Stände wenig<br />
originell, da hat man doch oft das Gleiche<br />
gesehen. Aber das wurde an anderer<br />
Stelle wieder ausgeglichen und so war<br />
die Messe <strong>im</strong> Großen und Ganzen schon<br />
sehr vielseitig.<br />
Noch ein kurzes abschließendes Fazit?<br />
Es war sehr interessant, so viele Firmen<br />
auf kleinstem Raum versammelt zu<br />
sehen. Auch der fachliche Aspekt kam<br />
nicht zu kurz, und wir empfehlen jedem,<br />
der sich für Werkzeug und Formenbau<br />
interessiert, sich auf keinen Fall die Euro<br />
Mold <strong>2008</strong> entgehen zu lassen. Wir<br />
werden wieder mit dabei sein.<br />
Vielen Dank für das Interview. | tog<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 53<br />
Die EuroMold 2007 in Zahlen<br />
61720 Fachbesucher aus 83 Ländern sind nach<br />
Frankfurt gekommen, um sich auf der 14. Euro<br />
Mold über die neuesten Produkte, Konzepte und<br />
Strategien zu informieren. Damit ist die Besucherzahl<br />
<strong>im</strong> Vergleich zum vergangenen Jahr um<br />
2,1 Prozent gestiegen.<br />
Der Bereich Design ist in den vergangenen Jahren<br />
stetig gewachsen. Im vergangenen Jahr kamen<br />
8 Prozent aller Besucher aus dem Bereich<br />
Design – damit bildete diese Besuchergruppe<br />
insgesamt die fünftgrößte. Diesem Umstand<br />
wurde auch in diesem Jahr Rechnung getragen;<br />
mit dem Sonderthema design+engineering und<br />
der Plattform Design Talents, wo junge Designer<br />
oder Firmen, die es erst kurze Zeit gibt, sich, ihre<br />
Ideen und ihre Produkte präsentieren konnten.<br />
Die meisten ausländischen Aussteller kamen<br />
in diesem Jahr aus China (21,36 Prozent), dann<br />
folgten die Länder Italien (10,23) und Südkorea<br />
(6,58). Die weitere Verteilung sieht wie folgt aus:<br />
Großbritannien (4,94), Schweiz (4,75), Frankreich<br />
(4,02), Spanien (4,02), Niederlande (3,83), Türkei<br />
(3,83), USA (3,83), Österreich (3,10), Taiwan (3,10),<br />
Indien (2,92), Hongkong (2,55) und Portugal<br />
(2,55). Die verschiedenen Bereiche waren wie<br />
folgt vertreten: Werkzeug und Formenbau<br />
(25,08 Prozent), gefolgt vom Bereich Modell<br />
und Prototypenbau (9,58) und dem Industriesektor<br />
Rapid Prototyping und Rapid Tooling<br />
(8,60). Danach folgten die Industriebereiche<br />
Engineering (8,40), Soft und Hardware (7,76),<br />
Werkzeug maschinen (6,88), Werkzeuge (6,58),<br />
Design (6,54), QS & Automatisierung (4,57),<br />
Werkstoffe (4,37), Zubehör (3,73), Ver und<br />
Nachbearbeitung (2,41), Beschichtung (1,72),<br />
Peripheriegeräte (0,59), Sonstige (3,0).
Deutschland und Österreich – ein ungleiches Paar?<br />
Werkzeug und Formenbau: ein Ländervergleich<br />
von Ute Harland<br />
Österreich, der kleine Nachbar? Davon kann längst keine Rede<br />
mehr sein. Seit seinem EUBeitritt 1995 hat es das Land durch<br />
überdurchschnittliches Wachstum unter die fünf reichsten EU<br />
Länder geschafft und gehört weltweit zu den zehn Industrieländern<br />
mit dem höchsten ProKopfEinkommen. Und dieser Trend<br />
soll anhalten – vor allem dank der unvermindert steigenden<br />
Nachfrage.<br />
Diese Nachfrage stammt nicht nur aus dem eigenen Land, sondern<br />
insbesondere auch aus dem Ausland. Zweistellige Wachstumsraten<br />
bei der Güterausfuhr waren in den letzten Jahren<br />
keine Seltenheit, Exporte machten teilweise über 40 Prozent des<br />
BIP aus. Dabei weist das Land eine ausgeglichene Handelsbilanz<br />
auf, denn auch seine Importe legten entsprechend zu. So gilt<br />
Österreich innerhalb Europas als Wirtschaftsstandort mit besonders<br />
hoher Marktattraktivität.<br />
Diese positive Entwicklung betrifft auch den österreichischen<br />
Werkzeug und Formenbau. Er hat sich mit seinem regionalen<br />
Schwerpunkt in den Bundesländern Ober und Niederösterreich<br />
zu einer zukunftsträchtigen Hightechbranche entwickelt. Mit<br />
hohen Investitionen in Qualifizierung, Ausbildung, Forschung<br />
und Entwicklung (die F&EQuote liegt bei 3 Prozent) konnte er<br />
sich internationale Geltung erarbeiten. Sein großer Vorteil <strong>im</strong><br />
internationalen Wettbewerb ist, dass viele Unternehmen Marktnischen<br />
besetzen, in denen sie nicht selten weltweit Marktführer<br />
sind. Dabei ist die Branche – ähnlich wie in Deutschland – nach<br />
wie vor mittelständisch geprägt: Etwa 65 Prozent der Unternehmen<br />
haben unter 20 Mitarbeiter, weitere 30 Prozent beschäftigen<br />
20 bis 250 Mitarbeiter.<br />
Schweiz<br />
Ansprechpartner und Kontakte<br />
KunststoffCluster<br />
Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter<br />
Vereinigung Österreichischer<br />
Kunststoffverarbeiter (VÖK)<br />
Gesellschaft zur Förderung<br />
der Kunststofftechnik (GFKT)<br />
Fachverband der chemischen Industrie<br />
Österreichs (FCIO)<br />
Deutsche Handelskammer in Österreich<br />
Italien<br />
Deutschland<br />
Vorarlberg<br />
Tirol<br />
Tirol<br />
Oberösterreich<br />
Salzburg Steiermark<br />
Kärnten<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 55<br />
www.kunststoffcluster.at<br />
www.kunststoffverarbeiter.at<br />
www.kunststoff.or.at<br />
www.lkttgm.at<br />
www.kunststoffe.fcio.at<br />
www.dhk.at<br />
Tschechien<br />
Slowenien<br />
Niederösterreich<br />
Wien<br />
Burgenland<br />
Slowakei<br />
Ungarn
56 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Zahlen und Fakten zu Österreich<br />
(Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft)<br />
Bruttoinlandsprodukt (2006)<br />
2007, geschätzt<br />
<strong>2008</strong>, prognostiziert<br />
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf<br />
Durchschnittslohn (2006)<br />
Inflation (2006)<br />
2007, geschätzt<br />
<strong>2008</strong>, prognostiziert<br />
Importe aus Deutschland (2006)<br />
<strong>im</strong> 1. Halbjahr 2007<br />
Exporte nach Deutschland (2006)<br />
<strong>im</strong> 1. Halbjahr 2007<br />
Umsatz <strong>im</strong> Maschinenbau (Jan.–Sept. 2006)<br />
Umsatz mit Werkzeugmaschinen (Jan.–Sept. 2006)<br />
Umsatz der Kunststoffbranche (2006)<br />
Wachstum der Maschinenbau branche (2000 bis 2006)<br />
Wachstum der Kunststoffbranche (2000 bis 2006)<br />
Firmen in der Kunststoffbranche<br />
davon in Oberösterreich<br />
Importe von Kunststoffen (2006)<br />
davon aus Deutschland<br />
Exporte von Kunststoffen nach Deutschland (2006)<br />
Importe von Kunststoffwaren (2006)<br />
Exporte von Kunststoffwaren (2006)<br />
Hightech für die Baubranche: Neben Sanitärprodukten<br />
und Halbzeugen für den Ausbau spielen<br />
vorgefertigte Bauteile wie Fassadenhalter, Dichtungen<br />
oder die Fassade selbst eine <strong>im</strong>mer wichtigere<br />
Rolle: Die doppelt gekrümmte, punktgehaltene<br />
Glasfläche des Festspielhauses in St. Pölten<br />
setzt sich aus mehr als 600 ungleichen Dreiecken<br />
und Trapezen zusammen. Um die Exaktheit der<br />
1700 m 2 großen, komplexen Außenhaut zu garantieren,<br />
wurden die keramisch beschichteten Scheiben<br />
bei der steyrischen Eckelt Glas GmbH direkt<br />
vom 3DDatensatz berechnet und zugeschnitten.<br />
257,9 Mrd. Euro<br />
272,7 Mrd. Euro<br />
284,7 Mrd. Euro<br />
31140 Euro<br />
2710 Euro<br />
1,5 Prozent<br />
1,9 Prozent<br />
2,0 Prozent<br />
49,5 Mrd. Euro<br />
26,2 Mrd. Euro<br />
30,3 Mrd. Euro<br />
16,3 Mrd. Euro<br />
11,3 Mrd. Euro<br />
391 Mio. Euro<br />
13 Mrd. Euro<br />
45,3 Prozent<br />
21,6 Prozent<br />
600<br />
220<br />
3 Mrd. Euro<br />
1,4 Mrd. Euro<br />
736,6 Mio. Euro<br />
2,1 Mrd. Euro<br />
2,7 Mrd. Euro<br />
Folgen der Globalisierung<br />
Seine geografische Lage in der Mitte Europas macht Österreich<br />
zu einer Drehscheibe für den Handel mit Zentral und Osteuropa.<br />
Die Öffnung der Blockgrenzen verlief für die österreichische<br />
Branche jedoch zwiespältig: Einerseits wuchsen die Absatzmöglichkeiten,<br />
andererseits stieg der Wettbewerbsdruck. Nach Einschätzung<br />
von Branchenexperten liegt die Zukunft in dieser<br />
Situation bei qualitativ hochwertigen, in der Fertigung komplizierten<br />
Produkten, die eine intensive Forschungs und Entwicklungsarbeit<br />
erfordern. Bei standardisierten Massenprodukten<br />
dagegen schrumpfe das Marktpotential. So schätzt auch Guntram<br />
Meusburger, Geschäftsführer des <strong>VDWF</strong>Mitglieds Meusburger<br />
Formaufbauten GmbH & Co KG aus Wolfurt, die Lage ein: “In<br />
Zukunft wird sicherlich die Spezialisierung auf hoch technologische<br />
Werkzeuge, hohe Qualität, Flexibilität und AfterSales<br />
Betreuung <strong>im</strong>mer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Stärken<br />
des österreichischen Werkzeug und Formenbaus liegen <strong>im</strong><br />
hohen Knowhow der Mitarbeiter, in der guten Ausbildung, in<br />
der Flexibilität und in der Nähe zu den Kunden.”<br />
Der österreichische Werkzeug und Formenbau profitiert vor<br />
allem von einer stabilen Nachfrage aus der stetig wachsenden<br />
einhe<strong>im</strong>ischen Bauwirtschaft (ein Drittel der gesamten Nachfrage)<br />
und der Verpackungsindustrie (ein Viertel der Nachfrage).<br />
Es folgen die elektronische und elektrotechnische Industrie<br />
sowie die Kfz, Möbel, Kunstfaser, Ski und Haushaltswarenindustrie.<br />
Teilweise können einhe<strong>im</strong>ische Unternehmen die<br />
Nachfrage nicht vollständig decken, oder sie bieten nicht die<br />
gesamte Produktpalette an – dann sind Einfuhren unentbehrlich.<br />
Ausländische Anbieter halten deshalb hohe Marktanteile in<br />
Österreich. 87 Prozent aller Einfuhren stammen aus der Europäischen<br />
Union, der wichtigste Einfuhrpartner ist mit weitem<br />
Abstand Deutschland (fast die Hälfte aller Importe) vor Italien,<br />
der Schweiz, Frankreich und den USA.<br />
Internationale Ausrichtung<br />
Andererseits ist der österreichische Markt für viele Spezialprodukte<br />
begrenzt, weshalb sich viele Unternehmen am Export orientieren.<br />
Die Ausfuhrquote beträgt durchschnittlich ein Drittel,<br />
manche Betriebe produzieren sogar fast ausschließlich für ausländische<br />
Märkte. Größter Abnehmer ist wiederum Deutschland<br />
(etwa ein Drittel aller Exporte) vor der Tschechischen Republik<br />
und den USA (jeweils 6–7 Prozent). Überdurchschnittlich wuchsen<br />
die Ausfuhren in den letzten Jahren nach Russland, Japan<br />
und in die Türkei, allerdings gehen nach wie vor nur 5–6 Prozent<br />
aller Exporte in diese drei Länder.
Auf diesem internationalen Markt arbeiten deutsche und österreichische<br />
Werkzeug und Formenbauer eng zusammen. Meusburger:<br />
“Deutsche Zweigniederlassungen haben für die Branche<br />
in Österreich eine große Bedeutung. Dank der Nähe zum Osten,<br />
der guten OstWestLogistik und auch steuerlicher Vorteile siedeln<br />
sich viele deutsche, meist international tätige Unternehmen<br />
in Österreich an.” Der österreichische Staat unterstützt solche<br />
Ansiedelungen, indem er den Wirtschaftsstandort Österreich<br />
attraktiv gestaltet: durch eine gut ausgebaute Infrastruktur und<br />
geringere Lohnkosten als in Deutschland. Auch die Unternehmensteuern<br />
sind in Österreich unternehmensfreundlicher<br />
gestaltet. Die Körperschaftsteuer beträgt 25 Prozent, die<br />
gesamte Abgabenquote liegt bei etwa 40 Prozent, darunter ein<br />
verhältnismäßig hoher Anteil ertragsunabhängiger Steuern.<br />
Die steuerlichen Regelungen für die grenzüberschreitende<br />
Geschäftstätigkeit und für den Erbfall sind ebenfalls günstiger<br />
als in Deutschland.<br />
Hochwertige Ausbildung<br />
Das Lob der Branche genießt auch die Ausbildung in Österreich.<br />
Die Ausbildung zum Werkzeugmechaniker etwa läuft dort –<br />
ähnlich wie in Deutschland – in einem dualen System aus 80 Prozent<br />
Betrieb und 20 Prozent Berufsschule ab, allerdings in zwei<br />
verschiedenen Ausbildungsrichtungen: der Werkzeugbautechnik<br />
mit Schwerpunkt Stanz und Schneidetechnik (Lehrzeit 3,5 Jahre)<br />
und der Werkzeugmechanik (Lehrzeit 4 Jahre). Meusburger lobt:<br />
“Das Bildungs und Ausbildungssystem ist auf einem guten<br />
Wege. Schulen wie die Höheren Technischen Lehranstalten sind<br />
in ganz Österreich gut vertreten und bilden auf einem sehr<br />
hohen Niveau aus. Speziell die enge, praxisnahe Zusammenarbeit<br />
mit der he<strong>im</strong>ischen Industrie wird nun verstärkt umgesetzt.”<br />
Darüber hinaus finden sich in Österreich <strong>im</strong> Bereich Werkzeug<br />
und Formenbau auch neuartige Fortbildungsmodelle. Eins davon<br />
rief 2003 gemeinsam mit anderen Unternehmen aus der Region<br />
Josef Haidlmair, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter<br />
der Haidlmair Werkzeugbau GmbH aus Nussbach, ins Leben: die<br />
private Kremstaler Technische Lehrakademie (KTLA). Hier können<br />
leistungsstarke Lehrlinge in fünf Jahren berufsbegleitend eine<br />
Ausbildung zum Produktionstechniker und anschließend eine<br />
externe Reife und Diplomprüfung auf dem Niveau einer Höheren<br />
Technischen Lehranstalt (HTL) absolvieren. Nach drei weiteren<br />
Jahren facheinschlägiger Praxis erhalten sie den Berufstitel<br />
Ingenieur, weitere Fortbildungen bis zum DiplomIngenieur (FH)<br />
sind möglich. Die Partnerbetriebe finanzieren die KTLA, wählen<br />
die Teilnehmer der Fortbildung aus, stellen einen Teil des Lehrpersonals<br />
und sichern sich damit genau auf ihre Bedürfnisse hin<br />
ausgebildete Mitarbeiter.<br />
Eine Stärke der österreichischen Branche sind<br />
auch innovative Verpackungsprodukte für<br />
Getränke, Lebensmittel, Pharmaprodukte, Kosmetika<br />
und Haushaltswaren.<br />
Drei Beispiele der oberösterreichischen Greiner<br />
Gruppe, die unter anderem zu den wichtigsten<br />
europäischen Verpackungsherstellern zählt:<br />
LebensmittelVerpackungen aus einer KunststoffKartonKombination,<br />
eine Zweikomponentenverpackung<br />
für ein Fertiggericht und unten<br />
eine Kanülenabdeckung, die mit einem Filmscharnier<br />
über die gebrauchte Nadel geklappt<br />
werden kann und somit die Gefahr versehentlicher<br />
Stichverletzungen min<strong>im</strong>iert.
58 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Nicht der Ski selbst, sondern gerade das Zubehör<br />
beinhaltet eine Vielzahl von Komponenten, die<br />
industriell in Serie gefertigt werden.<br />
Sollen die deutschen Werkzeug- und Formenbauer<br />
nach österreichischem Vorbild<br />
an einer Privatschule ausgebildet werden?<br />
(Quelle: <strong>VDWF</strong>Onlineumfrage, Januar <strong>2008</strong>)<br />
Ja<br />
Nein<br />
Kann ich nicht beurteilen<br />
4<br />
23 Prozent 100<br />
72<br />
Netzwerke für Kunststoffverarbeiter<br />
Einen eigenen Verband für die Werkzeug und Formenbauerbranche<br />
gibt es in Österreich nicht. Viele Unternehmen haben<br />
sich aber branchenübergreifenden Netzwerken der Kunststoffverarbeiter<br />
angeschlossen. Eines der bekanntesten davon ist der<br />
KunststoffCluster, eine Initiative der Bundesländer Oberösterreich,<br />
Niederösterreich und Salzburg. Ihm gehören etwa 400<br />
Mitglieder mit insgesamt 61500 Beschäftigten und 13,2 Mrd.<br />
Euro Umsatz an. Der KunststoffCluster fördert, initiiert und<br />
koordiniert die Zusammenarbeit von Unternehmen und TechnologietransferEinrichtungen<br />
<strong>im</strong> Kunststoffsektor. Damit will er<br />
die Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit<br />
insbesondere kleiner und mittlerer Betriebe steigern. Dafür stellt<br />
er eine Kommunikationsplattform <strong>im</strong> Internet zur Verfügung,<br />
veranstaltet Fachtagungen, Schulungen und Firmenbesichtigungen,<br />
unterstützt seine Mitglieder bei der Internationalisierung<br />
und betreibt Marketing für den KunststoffStandort Österreich.<br />
Weiterhin gibt es mit der Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter<br />
als Fachorganisation der Wirtschaftskammer Österreich eine<br />
gesetzliche Interessenvertretung aller Gewerbetreibenden <strong>im</strong><br />
Kunststoffverarbeiterhandwerk. Sie fördert die berufliche Aus<br />
und Weiterbildung, informiert, berät und betreibt Branchenmarketing.<br />
Die unabhängige Vereinigung Österreichischer Kunststoffverarbeiter<br />
schließlich versteht sich als berufliche und gesellschaftliche<br />
Plattform der österreichischen Kunststoffwirtschaft. In<br />
erster Linie führt sie abendliche Veranstaltungen durch und<br />
verleiht aus einem eigenen Fonds Stipendien an den Branchennachwuchs.<br />
Zusätzlich betreibt sie ein Internetportal, bietet<br />
Serviceleistungen an, führt Ausbildungen zum Kunststofftechniker,<br />
Kunststoffverarbeiter und Kunststoffingenieur durch und vertritt<br />
ihre Mitglieder in Branchengremien.<br />
Der österreichische Werkzeug und Formenbau ist also mit seiner<br />
internationalen Ausrichtung und seiner Konzentration auf<br />
best<strong>im</strong>mte Stärken, Nischen und Qualifikationen auf einem<br />
guten Weg, seinen Platz in der globalisierten Wirtschaft zu finden.<br />
Von einer Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen<br />
profitieren beide Seiten. | Ute Harland, FischbachtalLichtenberg
COMPOSITES EUROPE <strong>2008</strong><br />
3. Europäische 3. Europäische Fachmesse Fachmesse & & Forum Forum für für Verbundwerkstoffe, Technologie und und Anwendungen<br />
Die größte Messe<br />
<strong>im</strong> größten Markt<br />
www.aluminium-messe.com<br />
In Kooperation mit:<br />
COMPOSITES EUROPE <strong>2008</strong><br />
Die größte Messe<br />
<strong>im</strong> größten Markt<br />
www.aluminium-messe.com<br />
In Kooperation mit:<br />
23.-25. September <strong>2008</strong> Messe Essen<br />
23.-25. September <strong>2008</strong> Messe Essen<br />
www.composites-europe.com<br />
www.composites-europe.com<br />
Reed Exhibitions Deutschland GmbH • Projekt COMPOSITES EUROPE<br />
Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf • Tel: +49 (0)211 – 90 191 224 • info@composites-europe.de
60 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Globale Daumenschrauben:<br />
Keine Atempause für die Automobilzulieferindustrie<br />
von Claus Kaelber<br />
Björn Alber,<br />
Karl Alber Werkzeug- und Maschinenbau<br />
Die Studie spiegelt wohl doch die Realität wieder,<br />
wobei <strong>im</strong> Werkzeug und Formenbau in den letzten<br />
drei Jahren die Preisnachlässe wohl eher <strong>im</strong> zweistelligen<br />
Bereich waren. Und das bei Betriebsmittelprojekten<br />
mit Stückzahl 1!<br />
Speziell <strong>im</strong> Großformen und Werkzeugbau, wo die<br />
Anzahl der anbietenden Werkzeugbauer sich fast<br />
an einer, max<strong>im</strong>al an zwei Händen abzählen lässt,<br />
werden <strong>im</strong> Moment meines Wissens nach <strong>im</strong>mer<br />
noch keine nennenswerten Preisaufschläge erwirkt.<br />
Trotz gestiegener Preise bei Material und Normalien.<br />
Das ist in Anbetracht der hohen Anforderungen der<br />
Automobilindustrie kaum nachvollziehbar und zeigt,<br />
dass es in Deutschland noch kein funktionierendes<br />
Netzwerk in dieser Branche gibt.<br />
Das viel zitierte Formenbaunetzwerk in Portugal<br />
wäre ein Ansatzpunkt, unsere Position zu stärken –<br />
auch, weil man gemeinsam Großprojekte anbieten<br />
könnte. In Deutschland müssen wir aber auf eine<br />
solche Entwicklung <strong>im</strong> besten Fall noch viele Jahre<br />
warten. Das Einzelkämpferdenken und die hohen<br />
Qualitätsstandards hierzulande machen Deutschland<br />
für die Einkäufer sicherlich zum Paradies.<br />
Zudem fehlen vielerorts die einfachen Aufträge,<br />
wodurch die komplexen Werkzeuge in Deutschland<br />
in den letzten Jahren <strong>im</strong> Preis gesunken sind.<br />
Fast überall das gleiche Bild: Die Rendite dümpelt dahin.<br />
Zumindest zeigt sie nicht die Entwicklung, die globale<br />
Investoren von führenden Automobilherstellern erwarten.<br />
Höchste Zeit für das Management, zu handeln, letztlich<br />
wird der Erfolg der Unternehmensführung <strong>im</strong>mer mehr<br />
an kapitalmarktrelevanten Kennzahlen gemessen, egal<br />
wie gut und erfolgreich die Produkte sonst am Markt sind.<br />
Einschnitte in die Forschungsbudgets, Abbau be<strong>im</strong> Personal,<br />
weitere Organisationsrationalisierungen und nicht<br />
zuletzt nochmals höherer Druck auf die Zulieferindustrie<br />
sind die Folgen. Wohin führt diese Entwicklung?<br />
Den extrem verschärften weltweiten Wettbewerb in der Automobilzulieferindustrie<br />
haben die zur italienischen UniCredit<br />
Group gehörende HypoVereinsbank und Spezialisten der Unternehmensberatung<br />
Oliver Wyman Ende vergangenen Jahres <strong>im</strong><br />
Rahmen einer Studie unter die Lupe genommen. Die Kernaussage<br />
ihrer Analyse: Trotz ansehnlicher Wachstumsraten von<br />
rund drei Prozent jährlich gibt es keinen Grund für eine Atempause<br />
in den Unternehmen der Branche. In den Bereichen<br />
Kundenorientierung, Kostenopt<strong>im</strong>ierung und Innovationsprozesse<br />
zeigten nach Aussage der Autoren lediglich einige<br />
global aufgestellte Unternehmen tatsächliche Zukunftsfähigkeit.<br />
Der Rest der Zulieferer hinke gefährlich hinterher.<br />
Vordergründig auf eine opt<strong>im</strong>ale Kostenposition oder eine<br />
Führung in der Technologieentwicklung zu setzen reiche der<br />
Studie zufolge allein nicht mehr aus. Um sich in der Spitzenposition<br />
der Branche finden zu können, sei es zwingend notwendig,<br />
in allen Bereichen, gemeint sind damit auch vernetzte<br />
Organisationsabläufe, Kundenorientierung und die Qualifikation<br />
der Mitarbeiter, in unmittelbarer Nähe des opt<strong>im</strong>al Machbaren<br />
zu operieren. Besonders mit Blick auf die langfristige wirtschaftliche<br />
Erfolgsentwicklung der Branche kommt einer Gesamtsicht<br />
wachsende Bedeutung zu.<br />
Die Perspektiven der Unternehmen sehen nach Einschätzung<br />
der Autoren freilich ziemlich unterschiedlich aus. Das führende<br />
Viertel der Branche konnte “bei allen Leistungskennzahlen<br />
(Rohertrag, Gesamtkapitalrendite, operativer Gewinn und<br />
Umsatz) weiter zulegen. Die Zulieferer <strong>im</strong> unteren Viertel<br />
erreichten 2001 noch eine durchschnittliche Gesamtkapitalrendite<br />
von 2,9 Prozent. 2005 war sie auf minus 1 Prozent<br />
gesunken und der operative Gewinn lag bei minus 0,5 Prozent.”
Und dabei spielt die bereits angesprochene Langfristigkeit<br />
wirtschaftlicher Ertragsorientierung eine besondere Rolle.<br />
Besonders die <strong>im</strong> “Besitz von Finanzinvestoren befindlichen<br />
Automobilzulieferer (haben) ihre Konkurrenz in den vergangenen<br />
Jahren hinter sich gelassen”. Sie können mit 6,8 Prozent Gesamtkapitalrendite<br />
nahezu doppelt so gute Zahlen wie der Durchschnitt<br />
der in Familienbesitz agierenden Firmen aufweisen.<br />
Die Studien verweist dabei auf folgenden Zusammenhang:<br />
Fast 60 Prozent der “Familienunternehmen sind bereit, auch<br />
langfristig eine unterdurchschnittliche Leistung zu akzeptieren,<br />
solange die Eigenständigkeit gesichert ist. Nachhaltigkeit wird<br />
hier <strong>im</strong> Sinne von Unabhängigkeit verstanden.” Finanzinvestoren<br />
sind nach Angabe der Studie hingegen nur zu einem geringen<br />
Teil bereit, langfristigen wirtschaftlichen Erfolg auf Kosten<br />
anderer Interessen und Ziele zu gefährden. Dass andere strategische<br />
Erwartungen auch eine Rolle spielen könnten, wird<br />
nicht zum Ausdruck gebracht.<br />
Grundsätzlich habe die Studie aber gezeigt, so die Autoren,<br />
dass für die Unternehmen innerhalb der Branche <strong>im</strong> Wesentlichen<br />
die “gleichen Erfolgsfaktoren gelten, unabhängig von<br />
Unternehmensgröße, Geschäftsmodell oder Tätigkeitsfeld”.<br />
Und der Wettbewerbsdruck wird noch zunehmen, obgleich<br />
“die Forderungen der Automobilhersteller nach Preissenkungen<br />
mehrheitlich die Kostensenkungsmöglichkeiten der Zulieferer”<br />
übersteigen, wie die Studie klar einräumt. Mit anderen Worten:<br />
Den Letzten beißen irgendwann die Hunde. Momentan gehen<br />
jene Unternehmen noch am besten mit dem Druck um, die<br />
erfolgreich Standorte in Ländern mit vergleichsweise geringen<br />
Lohnkosten aufbauen konnten.<br />
Aber auch bei “LowCostProdukten”, erklären die Autoren der<br />
Studie, “muss bereits be<strong>im</strong> Entwicklungskonzept der Zielpreis<br />
<strong>im</strong> Vordergrund stehen”. Zudem gelte es für derartige Produkte<br />
geeignete Kapazitäten erst neu aufzubauen. Nachvollziehbarerweise<br />
haben kleine und mittelständische Unternehmen die<br />
größten Probleme mit diesen Entwicklungen, da sie befürchten,<br />
die Risiken einer Internationalisierungsoffensive könnten die<br />
eigenen Ressourcen überbeanspruchen. Die Folge: Man konzentriert<br />
sich auf europäische Standorte und, so die Studie, wartet<br />
weiteren Druck der OEMs erst mal ab. Die großen Zulieferer hingegen<br />
können vielfach bereits in den neuen Wachstumsmärkten<br />
selbst entwickeln, produzieren und verkaufen.<br />
Thomas Schmid,<br />
Schenk & Schmid Werkzeugbau<br />
Der Korridor wird <strong>im</strong>mer enger. In der Konsequenz<br />
bleibt das Risiko, aber auch die summierten ökonomischen<br />
Vorgaben für ein Projekt am letzten Glied<br />
bei den Werkzeug und Formenbauern hängen. Die<br />
“Daumenschrauben” werden mit hohen Gewinnforderungen<br />
ganz oben angesetzt, und der Druck<br />
verteilt sich dann und wird nach unten weitergegeben.<br />
Gleichzeitig lastet zunehmend auch die<br />
Forderung nach kreativen Lösungsvorschlägen auf<br />
dem Werkzeug und Formenbau.<br />
Lassen Sie es mich mit Biathlon ausdrücken: Selbst<br />
wenn man gut läuft, darf man sich be<strong>im</strong> Schießen<br />
keine Fehler erlauben, wenn man vorne mit dabei<br />
sein möchte – und mit “Fehlschüssen” meine ich<br />
nicht ganze Projekte, sondern auch nur einzelne<br />
Faktoren innerhalb eines Auftrags. Wenn man<br />
Ehrenrunden drehen muss, wird das ganze Unternehmen<br />
sehr schnell unlukrativ. Und wenn <strong>im</strong><br />
Tagesgeschäft alles hundertprozentig funktionieren<br />
muss und jeder Arbeitsschritt genau durchgeplant<br />
und kalkuliert ist, besteht kein Platz mehr zu exper<strong>im</strong>entieren,<br />
geschweige denn durch Fehler zu lernen<br />
und etwas falsch machen zu dürfen.<br />
Der Preisdruck ist an einem Punkt angelangt, wo<br />
er in der Planung und Fertigung nicht mehr zu<br />
Innovationen zwingt, um wirtschaftlich zu bleiben,<br />
sondern er hemmt uns in dem, was wir in unserer<br />
Branche bisher besonders gut konnten, nämlich<br />
konstruktiv nachzudenken und kreativ zu sein.<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 61
62 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Norbert Pylipp,<br />
Kurt Wünsch Werkzeugbau<br />
Auch für uns ist Wirtschaftlichkeit notwendig zur<br />
Weiterentwicklung unseres Unternehmens und zur<br />
Sicherstellung der Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter,<br />
deshalb werden wir weiterhin sinnvoll investieren,<br />
unsere Prozesse opt<strong>im</strong>ieren und unsere Kundenund<br />
Partnerbeziehungen pflegen. Allerdings können<br />
große Unternehmen, die sich in der Hand von<br />
Finanzinvestoren befinden, nur eingeschränkt als<br />
Vorbild dienen. Zum einen, weil große Unternehmen<br />
gerne auf Kosten der Kleinen ihre eigenen Renditen<br />
steigern. Wer kennt nicht einen Einkäuferspruch<br />
der Art: “Drei Prozent sind doch eine gute Marge”,<br />
während das eigene Unternehmen gerade die<br />
Renditeerwartung von sechs Prozent auf zehn<br />
bis zwölf Prozent gesteigert hat. Zum anderen<br />
ist der mittelständische Geschäftsmann selten<br />
bereit für das letzte Renditeprozent, seine gesellschaftliche<br />
und soziale Verantwortung zu verkaufen.<br />
Wir arbeiten und leben mit unseren Mitarbeitern<br />
und wollen dies auch weiterhin mit gutem Gewissen<br />
tun.<br />
Druck in der europäischen Zuliefer industrie<br />
(Quelle: Oliver Wyman/HypoVereinsbank)<br />
Turboladerkomponenten<br />
Tankanlagen<br />
Schmiedeteile<br />
Blechteile<br />
Konnektoren<br />
Dichtungen<br />
Spiegelaktuatoren<br />
Aluminiumkomponenten<br />
Elektrische Stecker<br />
Hydraulikmodule<br />
Aluminiumräder<br />
Kinematikteile Innenraum<br />
1,0% Preisnachlass pro Jahr<br />
1,3<br />
1,5<br />
2,0<br />
2,1<br />
2,5<br />
2,8<br />
3,0<br />
3,0<br />
3,0<br />
3,5<br />
4,0<br />
Die Studie verweist aber noch auf einen weiteren Bereich,<br />
in dem die meisten Zulieferunternehmen noch Aufholbedarf<br />
haben. Gerade die Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Interessen<br />
der Kunden war bisher stark die Perspektive der OEMs<br />
gerichtet. Weil aber die Autofahrer selbst, gewissermaßen am<br />
eigentlichen Ende einer langen Entwicklungs und Produktionskette,<br />
nicht nur ausschließlich von den Automobilherstellern<br />
betreut werden sollten, empfehlen die Spezialisten den Zulieferern,<br />
vermehrt die Wünsche der Endkunden unter die Lupe<br />
zu nehmen und daraus von sich aus neue Produktinitiativen<br />
abzuleiten.<br />
Insgesamt also wenig Zeit und kaum Spielraum, sich eine<br />
Verschnaufpause zu gönnen. Nur die “wenigsten Zulieferer<br />
(sehen) noch Reserven für etwaige Fehltritte”, analysieren die<br />
Autoren. Die formulierten Empfehlungen werden deshalb den<br />
meisten Unternehmen der Branche gut bekannt vorkommen:<br />
Erstens bei der Identifikation von Einsparpotentialen vorab<br />
keine Tabubereiche benennen, zweitens gemeinsam <strong>im</strong> europäischen<br />
Verbund mit den OEMs den Technologievorsprung halten,<br />
drittens die neuen LowCostMärkte <strong>im</strong> Auge behalten und<br />
eigene Lösungen dafür entwickeln, viertens an einer stärkeren<br />
Ausrichtung an den Bedürfnissen und Wünschen des Endkunden<br />
arbeiten, fünftens innerhalb der Branche intensiver<br />
vernetzt operieren und sechstens die Chancen der Globalisierung<br />
trotz aller Herausforderungen nicht aus dem Blick<br />
verlieren.<br />
Die Studie “Hochleistungsbranche Automobilzulieferer” der<br />
HypoVereinsbank und der Strategieberatung Oliver Wyman<br />
untersuchte 50 unternehmerische Erfolgsfaktoren in speziellem<br />
Bezug zur Automobilzulieferindustrie. Es wurden mehr als 40<br />
Geschäftsführer und Vorstände zu zukünftigen Erfolgs kriterien<br />
interviewt. Eine parallel durchgeführte Analyse verband die<br />
genannten Faktoren mit den wirtschaftlichen Daten von fast<br />
100 überwiegend nicht börsennotierten europäischen Zulieferern.<br />
| Claus Kaelber, München
Foto: Carlos Furman<br />
[‘taƞgo] gemeinsam Energie entfalten<br />
ohne sich zu behindern
Freizeit und Kultur<br />
“Gelmeroda XIII” von 1936 (Öl auf Leinwand,<br />
100 x 80 cm) war das letzte Bild aus einer Serie<br />
von Ölgemälden der Kirche in Gelmeroda. Dieses<br />
Motiv faszinierte Lyonel Feininger mehr als<br />
jedes andere. Bereits 1906 skizzierte er die Kirche,<br />
von der neben den Gemälden auch etliche<br />
Aquarelle, Zeichnungen und Grafiken entstanden.
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 65<br />
Lyonel Feininger – ein Amerikaner <strong>im</strong> Thüringer Land.<br />
Die obsessive Suche nach Maß und Einheit<br />
von Roland Mischke<br />
Um Goethe und Schiller geht es hier nicht. Sondern um sanfte<br />
Hügel und Waldinseln, Pappelparaden und Streuobstwiesen,<br />
kleinteilige Dörfer, die sich <strong>im</strong> Grün verstecken, von weitem<br />
nur an ihren trutzigen, protestantischen Gotteshäusern und<br />
von nahem an ihrem typischen Thüringer Fachwerk zu erkennen.<br />
Wer sich Zeit für sie n<strong>im</strong>mt, erlebt Überraschungen. Wie einst<br />
Lyonel Feininger, der Amerikaner in Thüringen. Mehr als zwei<br />
Jahrzehnte wohnte er in We<strong>im</strong>ar, lehrte dort als Formmeister<br />
der Druckerei am Bauhaus. Aber so oft er konnte, strampelte<br />
er mit seinem Fahrrad durch die Umgebung der Klassikerstadt,<br />
“auf Wegen, die <strong>im</strong>mer mal <strong>im</strong> H<strong>im</strong>mel enden”, wie er notierte.<br />
Er fühlte sich diesem Landschaftsraum so stark verbunden,<br />
dass er ihn auch für seine deutschen Freunde erschloss. Seit<br />
den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde es schick,<br />
nach We<strong>im</strong>ar zu reisen, um das We<strong>im</strong>arer Land zu erkunden.<br />
Es ist das Kontrastprogramm zum Städtchen, in dem alle Straßen<br />
und Häuser auf Größen verweisen, die dort gewohnt, gedichtet,<br />
komponiert oder philosophiert haben. Es ist der Weg zum Landvolk,<br />
zu einfachen, herzlichen Leuten, die skeptisch auf das<br />
vibrierende We<strong>im</strong>ar mit seinen Festivals, dem SchillerCafé und<br />
dem GoetheSchnuller, der in der TouristInformation zum Kauf<br />
angeboten wird, schauen. Sie sind bodenständig, dem Leben<br />
zugewandt, die Kunst ist nur eine Randerscheinung.<br />
Die Älteren unter ihnen, die den Künstler noch kennengelernt<br />
oder gesehen haben, sprechen mit Hochachtung von Lyonel<br />
Feininger. “Er brachte <strong>im</strong>mer ein Klappstühlchen mit”, erinnert<br />
sich eine betagte Frau auf der Bank vor dem Gelmerodaer<br />
Feuer wehrhaus. “Auf seinen Knien hatte er einen Zeichenblock,<br />
in der Hand spitze Bleistifte, und wenn er sich eine Zigarre<br />
anzündete, blies er dicke Rauchwolken in die Luft.”<br />
Gelmeroda war für den Amerikaner ein Zauberwort. Keinen Weg<br />
als den leichten Hang hinauf in das kleine, fünf Kilometer von<br />
We<strong>im</strong>ar entfernte Dorf hat er so oft genommen. Die Kirche zog<br />
ihn magisch an. “Ich habe dort eineinhalb Stunden herumgezeichnet”,<br />
schrieb er an seine Frau, “<strong>im</strong>mer an der Kirche, die<br />
wundervoll ist.”<br />
Im BauhausAtelier Paul Klees in We<strong>im</strong>ar, 1. April<br />
1925: Die Bauhausmeister (v. l.) Lyonel Feininger,<br />
Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer, Georg<br />
Muche und Paul Klee.<br />
Der Architekt Peter Mittmann transportierte 1998<br />
mit seiner Lichtskulptur das ursprüngliche Motiv<br />
der Bilder Feiningers in die reale Welt. “Die Lichtskulptur<br />
ist keine übliche Gebäudeanstrahlung,<br />
sondern mit dem Gebäude und der umgebenden<br />
Lichthülle kommunizierende eigenständige Lichtkunst”,<br />
erklärt Mittmann sein Werk.
66 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Der New Yorker Künstler, Jahrgang 1871, Sohn deutscher Auswanderer,<br />
kam als 16Jähriger nach Deutschland, um Musik zu<br />
studieren. Aber die Malerei wurde zu seiner Passion. In Berlin<br />
verliebte er sich in die Kunststudentin Julia Berg, 1908 heiratete<br />
er sie. Die Mutter seiner Kinder stammte aus We<strong>im</strong>ar, unterwies<br />
ihn in den Grundzügen der Malerei und führte ihm das We<strong>im</strong>arer<br />
Land als Motivkreis vor. Julia Berg war Jüdin, weshalb der Kunstprofessor<br />
Feininger trotz seiner “arischen” Vorfahren von den<br />
Nazis attackiert wurde. 1937 emigrierte er depr<strong>im</strong>iert mit Frau<br />
und drei Söhnen in die USA. Nachdem der Maler sich in New<br />
York ein Atelier zugelegt hatte, malte er trotzdem weiter an<br />
seinen Bildern aus der Alten Welt. Rund 10000 Skizzen hatte<br />
er aus dem We<strong>im</strong>arer Land mitgebracht, nach diesen Vorlagen<br />
entstanden Ölbilder, Aquarelle, Kohlezeichnungen und druckgrafische<br />
Werke. Die meisten befinden sich heute in Privatsammlungen,<br />
sein berühmtestes Ölgemälde, “Gelmeroda XIII”<br />
von 1936, hängt <strong>im</strong> New York Metropolitan Museum of Art.<br />
Gelmeroda war endgültig zum Schaffensmittelpunkt Lyonel<br />
Feiningers geworden. “Gelmeroda morgens, mittags und abends”<br />
lautete sein Credo. Feininger wurde in der amerikanischen Welt<br />
nicht wieder he<strong>im</strong>isch. Noch rund 20 Jahre nachdem er We<strong>im</strong>ar<br />
verlassen hatte, malte er <strong>im</strong>mer noch krumme Fachwerkbauten,<br />
Gassen und vor allem die Kirchen <strong>im</strong> We<strong>im</strong>arer Land. 1956 starb<br />
der Künstler, wenige Tage zuvor hatte er noch bekannt, in der<br />
WolkenkratzerStadt “von hundert staubigen, krummen thüringischen<br />
Dörfern” zu träumen.<br />
Wer in Gelmeroda herumläuft, versteht nicht gleich, warum<br />
der Ort den Maler so faszinieren konnte. Das Dorf ist grau, die<br />
Kirche mausgrau, einzig die vergoldete Metallkugel und die<br />
Wetterfahne auf ihrer Spitze strahlen bescheidenen Glanz aus.<br />
Doch gerade das Unscheinbare des Gotteshauses und der dörflichen<br />
Umgebung inspirierten den Künstler. Hunderte von Skizzen<br />
und über hundert Bilder hat er von der Kirche aus dem 12. Jahrhundert<br />
angefertigt, wobei die Phantasie regelmäßig mit ihm<br />
durchging. Der quadratischen Kirchturmuhr verpasste er ein<br />
giftiges Absinthgrün, brachte die Fenster zum Gl<strong>im</strong>men, ließ<br />
die geduckten Bauernhäuser ringsum zu flüchtigen Schemen<br />
schrumpfen. Manchmal erhob er die Zwergkirche gar kühn zur<br />
Kathedrale, deren Spitze sich tief in den H<strong>im</strong>mel bohrt.<br />
Die Gelmerodaer sind stolz darauf, dass der Amerikaner seinen<br />
künstlerischen Dreh und Angelpunkt in ihrem Dorf fand. Eine<br />
bescheidene touristische Infrastruktur entstand mit einem Hotel<br />
nahe der Kirche, Prospekten <strong>im</strong> Gotteshaus, und jeden Donnerstag<br />
bis Samstag ist die Kirche nachts beleuchtet. Das würde Feininger<br />
gefallen. Die Installation stammt vom Jenaer Lichtkünstler Peter<br />
Mittmann, mit HochdruckHalogenMetalldampfScheinwerfern<br />
bestrahlt er die Fassaden von unten. Durch das blaue und grüne<br />
Licht entstehen kristalline Facetten wie auf Feiningers Gemälden.<br />
Die Imagination des Künstlers wird Realität – am meisten am<br />
Abend, wenn der Nebel aus Feldern und Gärten aufsteigt und<br />
das Kirchlein umwabert. | Roland Mischke, Dietzenbach
“Das Schaffen in unserer Kunst ist uns oberstes<br />
Lebensgesetz; ja, wir leben ja nur, wenn wir<br />
gestalten: also arbeiten wir, trotz aller Sorgen,<br />
doch weiter und erhalten unseren Geist klar<br />
und rein <strong>im</strong> Werk.”<br />
Lyonel Feininger, hier <strong>im</strong> “Selbstbildnis mit Tonpfeife”<br />
von 1910 (Öl auf Leinwand), beschäftigte<br />
sich <strong>im</strong>mer wieder mit der Kirche in Gelmeroda,<br />
mit dem spitzen Turmdach und den eigenwilligen<br />
Proportionen und der asymmetrisch angebrachten<br />
Turmuhr. Er stellte sie aus unterschiedlichen<br />
Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Techniken<br />
dar. Allein 11 Ölgemälde entstanden – links oben<br />
z.B. “Gelmeroda IX” von 1926 – , über 25 Aquarelle<br />
und Zeichnungen sowie eine große Anzahl von<br />
Druckgrafiken – links unten z.B. der Holzschnitt<br />
“Gelmeroda (mit Tanne)” von 1918.<br />
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 67<br />
BLUE LINE<br />
BLUE LINE<br />
WWW.MILLUTENSIL.COM<br />
WWW.MILLUTENSIL.COM<br />
HERSTELLER HERSTELLER VON ZUVERLÄSSIGKEIT<br />
VON ZUVERLÄSSIGKEIT<br />
ZUVERLÄSSIGKEI<br />
DIE DIE KRAFT DIE KRAFT AUS 50 50 AUS JAHREN 50 JAHREN ERFAHRUNG<br />
ERFAHRU<br />
TUSCHIERPRESSEN<br />
TUSCHIERPRESSEN<br />
DIE DIE HOCHGENAUE DIE HOCHGENAUE LÖSUNG LÖSUNG UM UM IHRE UM FORMEN<br />
IHRE FORMEN<br />
EINFACH EINFACH ZU ZU PRÜFEN ZU PRÜFEN UND TUSCHIEREN UND TUSCHIEREN MIT MIT MIT<br />
DER HÖCHSTEN DER HÖCHSTEN QUALITÄTSGARANTIE.<br />
QUALITÄTSGARANTIE.<br />
UNSERE VERTRETUNGEN UNSERE VERTRETUNGEN VERTRETUNGEN IN IN DEUTSCHLAND:<br />
IN DEUTSCHLAND:<br />
DREMO Werkzeugmaschinen DREMO Werkzeugmaschinen Vertriebs Vertriebs GmbH<br />
GmbH<br />
& & Co Co Zerspanungstechnik & Co Zerspanungstechnik KG KG KG<br />
Herr Herr Gasteier,<br />
Herr Gasteier,<br />
Feuerweg Feuerweg 22, 22, D-90518 22, D-90518 Altdorf bei Altdorf bei Nürnberg, bei Nürnberg, Bayern<br />
Bayern<br />
tel. tel. +49 +49 9187 tel. 9187 +49 80683, 9187 fax 80683, fax +49 +49 9187 fax 9187 +49 7554<br />
9187 7554<br />
e-mail: info@dremo-wzm.de<br />
e-mail: info@dremo-wzm.de<br />
ESCHENBRÜCHER ESCHENBRÜCHER Werksvertretungen Werksvertretungen für für Werkzeugmaschinen<br />
für Werkzeugmaschinen<br />
Herr Herr Eschenbrücher,<br />
Herr Eschenbrücher,<br />
Hildeshe<strong>im</strong>er Hildeshe<strong>im</strong>er Str. Str. 42, 42, D-38159 Str. D-38159 42, D-38159 Vechelde,<br />
Vechelde,<br />
Niedersachsen/Schleswig-Holstein<br />
Niedersachsen/Schleswig-Holstein<br />
tel. tel. +49 +49 5302 tel. 5302 +49 2037, 5302 fax fax 2037, +49 +49 5302 fax 5302 +49 70531<br />
5302 70531<br />
e-mail: E-W-werkzeugmaschinen@t-online.de<br />
e-mail: E-W-werkzeugmaschinen@t-online.de<br />
BERND MÜLLER BERND MÜLLER MÜLLER Industrievertretungen<br />
Industrievertretungen<br />
Herr Herr B. B. Müller, Herr Müller, B. Müller,<br />
Mendener Mendener Strasse 1, Strasse 1, D-51105 1, D-51105 Köln, Rheinland Köln, Rheinland Ruhrgebiet<br />
Ruhrgebiet<br />
tel. tel. +49 +49 221 tel. 221 +49 836356, 221 836356, fax fax +49 +49 221 fax 221 +49 831409<br />
221 831409<br />
e-mail: bmi@bernd-mueller-koeln.de<br />
e-mail: bmi@bernd-mueller-koeln.de<br />
WT WT Werkzeugmaschinen WT Werkzeugmaschinen GmbH<br />
GmbH<br />
Herr Herr Seitz,<br />
Herr Seitz,<br />
Ulmerstrasse Ulmerstrasse 70 70 D-73037 70 D-73037 Göppingen, Göppingen, Württemberg<br />
Württemberg<br />
tel. tel. +49 +49 7161 tel. 7161 +49 6565 7161 150, 6565 fax fax 150, +49 +49 7161 fax 7161 +49 6565 7161 140 140 6565 140<br />
www.wt-werkzeugmaschinen.de<br />
www.wt-werkzeugmaschinen.de<br />
e-mail: info@wt-werkzeugmaschinen.de<br />
e-mail: info@wt-werkzeugmaschinen.de<br />
WWZ VERTRIEB WWZ VERTRIEB GmbH Werkzeugmaschinen<br />
GmbH Werkzeugmaschinen<br />
Herr Herr Bauer,<br />
Herr Bauer,<br />
An An der der Allee An Allee der 9, 9, D-99848 Allee D-99848 9, D-99848 Wutha Farnroda, Wutha Farnroda, Neue Bundesländer<br />
Neue Bundesländer<br />
tel. tel. +49 +49 36921 tel. 36921 +49 230, 36921 230, fax fax 230, +49 +49 36921 fax 36921 +49 23111 36921 23111 23111<br />
e-mail: info@wwz-vertrieb.de<br />
e-mail: info@wwz-vertrieb.de<br />
Büro: Corso Büro: Buenos Corso Aires, Buenos Aires, 92 92 Aires, - 20124 - 20124 92 - Miláno 20124 Miláno - Italia Miláno - Italia - It<br />
Tel. Tel. +39 +39 Tel. 02.29404390 +39 02.29404390 - Fax - Fax +39 +39 - Fax 02.2043268<br />
+39 02.20432<br />
www.millutensil.com www.millutensil.com e-mail: info@millutensil.com<br />
e-mail: info@millutensil.com<br />
info@millutensil.c<br />
Werk: Via Via Werk: delle Via Industrie, delle Industrie, 10 10 - 26010 - 26010 10 - Izano 26010 Izano (CR) (CR) Izano - Italia - Italia (CR) - It<br />
creartcom.it<br />
creartcom.it
Alfred Härer GmbH –<br />
Gipfelstürmer seit einem halben Jahrhundert<br />
Wer in den Bergen um die Stauferstadt<br />
Lorch umherwandert, dem fallen<br />
best<strong>im</strong>mt sehr bald die vielen Klettersportler<br />
auf, die dort ihrer Passion nachgehen.<br />
Wer nahe genug herangeht, um<br />
die Aufschrift auf den TShirts zu lesen,<br />
wird das Firmenlogo der Alfred Härer<br />
GmbH auf diesen TShirts finden. Eine<br />
Kletterschule – weit gefehlt!<br />
Der mittelständische Betrieb aus Lorch<br />
Weitmars stellt seit 1958 Druckgussformen<br />
für Aluminium und Magnesium<br />
sowie technische Kunststoffteile für<br />
Motorkomponenten her. Doch nicht<br />
nur in der Freizeitgestaltung, die sowohl<br />
von den Geschäftsführern als auch von<br />
einem Teil der Belegschaft mit Begeisterung<br />
betrieben wird, geht es hoch hinaus,<br />
auch das Unternehmen, welches heute<br />
in der dritten Generation von der Familie<br />
Härer geleitet wird, befindet sich seit 50<br />
Jahren auf einem kontinuierlichen Weg<br />
nach oben.<br />
1958 <strong>im</strong> schwäbischen Schorndorf<br />
gegründet, wanderte das Unternehmen<br />
<strong>im</strong> Jahr 1979 aus Expansionsgründen<br />
nach Lorch aus. Heute beschäftigt die<br />
Firma ein hochkompetentes Team von<br />
49 Mitarbeitern und erwirtschaftete <strong>im</strong><br />
vergangenen Jahr einen Umsatz von<br />
6 Mio. Euro.<br />
Zuhören, Analysieren, Bewerten<br />
und Beraten<br />
Diese vier Worte prägen das Leitmotiv<br />
der Alfred Härer GmbH, welches sowohl<br />
in der Kommunikation nach innen als<br />
auch in der Kommunikation mit Kunden<br />
und Geschäftspartnern gilt. Für die Mitarbeiter<br />
ist es ganz getreu dem Leitsatz<br />
enorm wichtig, dem Kunden so früh wie<br />
möglich beratend zur Seite zu stehen, um<br />
das bestmögliche Produkt zu generieren.<br />
Die Kunden können dabei auf die jahrelange<br />
Erfahrung des Unternehmens <strong>im</strong><br />
Konstruktionsbereich und auf das große<br />
Wissen der Mitarbeiter <strong>im</strong> Bereich der<br />
Produktentwicklung zurückgreifen. Durch<br />
die Beratung des Kunden hinsichtlich<br />
Gießprozess und Geometrie können nicht<br />
nur deutliche Reduzierungen der Zykluszeiten,<br />
sondern auch höhere Ausbringungsraten<br />
und homogenere Teile erreicht<br />
werden. 90 Prozent der Kunden nutzen<br />
bereits diesen Service zur Opt<strong>im</strong>ierung<br />
ihrer eigenen Gießprozesse.<br />
Innerhalb der Härer GmbH gibt es mehrere<br />
Kompetenzteams, die sich aus den<br />
unterschiedlichen Abteilungen Einkauf,<br />
Konstruktion, Fertigung und Qualitätsmanagement<br />
zusammensetzen, um Problemstellungen<br />
über alle Prozessbereiche<br />
hinweg zu analysieren und dem Kunden<br />
opt<strong>im</strong>al zu beraten.<br />
Außerdem schätzen viele Kunden, dass<br />
dieser Service nicht nur bei der Vergabe<br />
von Aufträgen, sondern über die gesamte<br />
Zeitdauer eines Projekts und darüber hinaus<br />
Bestand hat. Für die Firma Härer<br />
beginnt der Prozess der Werkzeugentstehung<br />
be<strong>im</strong> Kunden und hört auch be<strong>im</strong><br />
Kunden wieder auf. Hinzu kommt die<br />
Tatsache, dass man bei der Alfred Härer<br />
GmbH auch am Telefon <strong>im</strong>mer mit einem<br />
passenden Ansprechpartner für die jeweilige<br />
Problemstellung verbunden wird.<br />
Probleme werden nicht hin und her diskutiert,<br />
sondern schnell und kompetent<br />
gelöst.
Kernkompetenz Druckgussformen<br />
Die Kernkompetenzen der Alfred Härer<br />
GmbH liegen <strong>im</strong> Bereich der Druckgussformen<br />
für Aluminium und Magnesiumlegierungen.<br />
Auch technische Kunststoffteile<br />
für dem Motorenbereich sowie<br />
Pressformen für die Recyclingindustrie<br />
gehören zum Standardprogramm angebotener<br />
Projekte.<br />
Aus der Mischung angebotener Formen,<br />
vom Druckguss über den Spritzguss<br />
bis hin zum Pressformenbau, ergeben<br />
sich für die Kunden wertvolle KnowhowVorteile,<br />
die bei jedem Projekt zum<br />
Tragen kommen. Ein Großteil der Kunden<br />
der Alfred Härer GmbH kommt aus der<br />
Automobilindustrie, aber auch Kunden<br />
aus anderen Sparten werden von den<br />
Projektteams betreut. Der Exportanteil<br />
liegt derzeit bei 15–20 Prozent, wodurch<br />
Schwankungen auf dem inländischen<br />
Markt kompensiert werden können.<br />
Inspiration und Prozess<br />
Neue Aufträge durchlaufen bei der Alfred<br />
Härer GmbH stets einen festen Ablauf.<br />
Die Überprüfung und Weiterentwicklung<br />
dieser Abläufe wird durch die bestehenden<br />
Zertifikate nach DIN EN ISO 9001 und<br />
DIN EN ISO 9000:2000 gewährleistet.<br />
Besonderen Wert wird auf eine hohe<br />
Durchgängigkeit der Daten innerhalb des<br />
Betriebs gelegt. Unterstützt wird dieses<br />
Vorhaben durch die hauseigene Softwarelösung,<br />
welche die innerbetrieb lichen<br />
Vorgänge steuert und koordiniert.<br />
Ganz in der Tradition mittelständischer<br />
Familienunternehmen, gibt es bei der<br />
Alfred Härer GmbH sehr kurze Wege, eine<br />
schlanke Verwaltung und ein kommunikatives<br />
Miteinander, was in Zeiten <strong>im</strong>mer<br />
schnellerer Prozesse und Verfahren ein<br />
unschätzbarer Vorteil für die Kunden der<br />
Firma darstellt.<br />
Parallel dazu bieten die familiären Strukturen<br />
für die Kunden den Vorteil, dass<br />
Entscheidungen zeitnah getroffen werden,<br />
wodurch sich Zeit und Reibungsverluste<br />
min<strong>im</strong>ieren lassen. Die hervorragende<br />
Kommunikation innerhalb der<br />
Firma wird von vielen Kunden <strong>im</strong>mer<br />
wieder gelobt und hervorgehoben. Auch<br />
die starke Verzahnung der einzelnen<br />
Fertigungsprozesse bis hin zur finalen<br />
Form ist ein wichtiger Aspekt für die<br />
Kundschaft, die sich zu 80 Prozent aus<br />
Stammkunden zusammensetzt.<br />
Entgegen den freizeitlichen Aktivitäten<br />
stehen die Mitarbeiter der Alfred Härer<br />
GmbH bei ihrer täglichen Arbeit mit beiden<br />
Füßen auf festem Boden. Synergien<br />
ergeben sich aber trotzdem – den Willen<br />
und die Fähigkeit, in Bereiche vorzustoßen,<br />
wo die Luft schon merklich dünner wird.<br />
HaererAZ_<strong>VDWF</strong>03-06-100x280.qxd 23.08.2<br />
Die Geschäftsleitung der Alfred Härer GmbH:<br />
Ulrich Härer, Siegfried Härer und Hans Höchsmann<br />
(von links)<br />
Alfred Härer GmbH<br />
Kiesäckerstraße 9<br />
73547 Lorch<br />
Telefon +49 (0)7172 927990<br />
Telefax +49 (0)7172 9279949<br />
info@haererformenbau.de<br />
www.haererformenbau.de<br />
Werkzeugbau – Formenbau
Z<strong>im</strong>mer Werkzeugbau GmbH & Co.KG –<br />
durch die Produkte überzeugend<br />
Mitten <strong>im</strong> thüringischen Wald, zwischen<br />
Fulda und Erfurt, liegt in der kleinen<br />
Gemeinde FlohSeligenthal, Ortsteil<br />
StruthHelmershof, der Werkzeugbau<br />
Z<strong>im</strong>mer. Gemeinsam mit einem hochmotivierten<br />
Team von 19 Mitarbeitern<br />
fertigt hier die Familie Z<strong>im</strong>mer hauptsächlich<br />
Spritzgusswerkzeuge für die<br />
Kunststoff ver arbeitende Industrie, namhafte<br />
Automobilhersteller und zulieferer,<br />
Elektrogeräte und Schreibwarenindustrie,<br />
Haushaltsgerätehersteller, Medizintechnik<br />
und für den Modellbau.<br />
Qualität steht an erster Stelle bei der<br />
Firma Z<strong>im</strong>mer, die 1990 nach der Wiedervereinigung<br />
gegründet wurde. Zuvor<br />
war Wolfgang Z<strong>im</strong>mer jahrelang als Werkzeugmacher<br />
für das damalige VEB WerkzeugKombinat<br />
Schmalkalden, Abteilung<br />
Werkzeugbau “Am Bad“ tätig. Mit dem<br />
Erwerb einer ersten Drahterodiermaschine<br />
und ersten Kundenakquisen aus dem<br />
Ruhrgebiet wurde der Grundstein für die<br />
Selbständigkeit gelegt. Auch die turbulenten<br />
Jahre 1992 und 1993 konnten die<br />
junge Firma nicht von ihrem steilen Weg<br />
nach oben abbringen. Vielmehr erreichte<br />
man in diesen Jahren durch strategische<br />
Investitionen, dass man vom Aufstieg der<br />
Region in den kommenden Jahren voll<br />
profitieren konnte.<br />
Die steigende Auslastung und permanente<br />
Neuinvestitionen in einen modernen<br />
Maschinenpark machten <strong>im</strong> Jahr<br />
1998 den Neubau des heutigen Firmensitzes<br />
notwendig. In dem Neubau wurden<br />
die neuesten Logistikkonzepte angewandt,<br />
wodurch sich kurze Wege und<br />
Durchlaufzeiten ergeben. Neben modernster<br />
Technik steht be<strong>im</strong> Werkzeugbau<br />
Z<strong>im</strong>mer jedoch auch der Mensch <strong>im</strong><br />
Mittelpunkt. Die langjährige Erfahrung<br />
der Mitarbeiter und deren exzellente<br />
Kenntnisse der Werkzeuge ermöglichen<br />
es, auch schwierigste Problemstellungen<br />
innerhalb kürzester Zeit für die Kunden<br />
zu realisieren. Eine kontinuierliche Aus<br />
und Weiterbildung sichert der Firma ihr<br />
Knowhow.<br />
Einen Mehrwert für den Kunden bietet<br />
die Firma, die seit dem Jahr 2007 nach<br />
DIN ISO 9001:2000 zertifiziert ist, auch<br />
durch den vollkl<strong>im</strong>atisierten Messraum.<br />
Hier können nicht nur Erstmusterprüf–<br />
berichte angefertigt werden, auch die<br />
Datenrückführung ist auf der modernen<br />
VideoCheck 3DMessmaschine (Werth)<br />
möglich. Eine Vermessung der aktiven<br />
Teile eines jeden Neuwerkzeugs sichert<br />
dem Kunden höchste Qualität und Rückführbarkeit<br />
<strong>im</strong> Entstehungsprozess eines<br />
Werkzeugs.<br />
Besonders stolz ist man bei der Firma<br />
Z<strong>im</strong>mer darauf, dass ein Großteil der<br />
Kunden dem Werkzeugbau bereits seit<br />
vielen Jahren treu ist. Auch die Zeiten der<br />
Kaltakquise sind lange vorbei. Viele der<br />
Kunden, die man in den vergangenen<br />
Jahren dazugewinnen konnte, sind über<br />
Empfehlungen anderer Kunden auf die<br />
Firma Z<strong>im</strong>mer aufmerksam geworden.<br />
Dass diese der Firma treu blieben, ist auf<br />
den Grundsatz der Firma zurückzuführen<br />
– durch die Produkte überzeugend.<br />
Z<strong>im</strong>mer Werkzeugbau GmbH & Co. KG<br />
Am Wiedich 15 a<br />
98593 FlohSeligenthal<br />
Telefon +49 (0)3683 79720<br />
Telefax +49 (0)3683 797272<br />
info@z<strong>im</strong>merwerkzeugbau.de<br />
www.z<strong>im</strong>merwerkzeugbau.de
Karl Alber Werkzeug und Maschinenbau e.K. –<br />
5AchsHSCFräsdienstleistung<br />
Karl Alber Werkzeug und Maschinenbau<br />
e.K. fertigt hochgenaue Einzelteile für<br />
den Werkzeug, Formen, Modell und<br />
Maschinenbau – vom Kleinteil bis hin<br />
zum 30TonnenFormteil z.B. für Spritzgusswerkzeuge<br />
zur Herstellung von Stoßstangen<br />
oder Instrumententafeln. Formaufbauten<br />
und Hochgenauigkeitsgestelle<br />
für den Folgeverbundwerkzeugbau stehen<br />
ebenso auf der Bearbeitungsliste. Das<br />
Technologiespektrum umfasst in diesem<br />
Bereich das 5AchsFräsen genauso<br />
wie das HSC3DFräsen und die Hartbearbeitung<br />
von Stempeln und Matrizen<br />
mit 60 HRC Härte.<br />
Im Prototypen oder CubingModellbau<br />
sind ebenfalls jahrelange Bearbeitungserfahrungen<br />
vorhanden. Auch in der<br />
Herstellung von Vorrichtungen für die<br />
Montage und Handlingtechnik wurden<br />
sehr viele Kundenwünsche erfolgreich<br />
umgesetzt. In diesem Segment verlassen<br />
hier 1:1 Kotflügel, Motorhauben oder<br />
BodengruppenMessmodelle aus Alu<br />
sowie Vakuumfräs, Klebe und Montagevorrichtungen<br />
die Maschinen.<br />
Der Maschinenbau wird mit hochgenauen<br />
Einzelteilen wie Spindelkästen,<br />
Getriebegehäusen, Maschinengrundgestellen<br />
oder Greifern beliefert. In allen<br />
Bereichen ist die vorhandene 5Achs<br />
Bearbeitung ein wichtiges Mittel, um<br />
kosten und termingerecht die umfangreichen<br />
Kundenvorgaben zu erfüllen.<br />
Die 3DCAD/CAMTechnik ist bei Karl<br />
Alber bereits seit 18 Jahren <strong>im</strong> Einsatz und<br />
bildet heute den Mittelpunkt der Produktion.<br />
Durch diese Plattform werden die<br />
unterschiedlichsten Kundenteile schnell<br />
und effizient teilweise auch direkt neben<br />
der Maschine programmiert. Anhand<br />
von original CATIA3DDaten werden<br />
über Farbtoleranzvorgaben zeichnungslos<br />
Teile bearbeitet.<br />
Karl Alber Werkzeug<br />
und Maschinenbau e.K.<br />
Gutenbergstraße 7<br />
70771 LeinfeldenEchterdingen<br />
Telefon +49 (0)711 902620<br />
Telefax +49 (0)711 7979304<br />
wzb@kaalber.de<br />
www.kaalber.de
Verband und Netzwerk<br />
Margot Schenk, ist 60 – Runder<br />
Geburtstag für die gute Seele<br />
des Verbands<br />
Am 5. Januar <strong>2008</strong> feierte Margot Schenk<br />
ihr sechzigstes Wiegenfest, das <strong>im</strong> Kreise<br />
Ihrer Familie bis spät in die Nacht dauerte.<br />
Doch obwohl Margot Schenk nun<br />
die sechs vorne stehen hat, wird sie dem<br />
Verband hoffentlich noch lange Jahre<br />
erhalten bleiben, den sie seit der Gründung<br />
1993 <strong>im</strong>mer aktiv begleitet hat.<br />
Sie war 1993 – damals noch als Geschäftsführerin<br />
der Schenk & Schmid GmbH –<br />
als Gründungsmitglied dabei und seit<br />
dem Jahre 1994 für den Verband auf<br />
Messen und diversen Veranstaltungen<br />
tätig, die Sie gemeinsam mit anderen<br />
Unternehmerfrauen organisierte. Durch<br />
die langen Jahre be<strong>im</strong> Verband sind<br />
aus vielen Mitgliedern gute Freunde<br />
geworden. Sie alle haben die liebevolle<br />
Art Margot Schenks kennen gelernt und<br />
schätzen an Ihr, dass Sie hinter jedem<br />
Gesprächspartner in erster Linie den<br />
Menschen sieht und nicht Positionen,<br />
Titel oder Aussehen.<br />
Seit 2003 ist Margot Schenk freiberuflich<br />
be<strong>im</strong> <strong>VDWF</strong> in der Geschäftsstelle aktiv.<br />
Hier kümmert Sie sich nicht nur um die<br />
finanziellen Angelegenheiten, die Telefonzentrale<br />
und die Messeorganisation, sondern<br />
trägt durch ihre integrative Art sehr<br />
zum Zusammenhalt des Verbandes bei.<br />
Vor allem der reibungslose ServiceAblauf<br />
bei Messen ist allein ihrem Engagement<br />
zu verdanken. Trotz des großen Trubels,<br />
der bei solchen Veranstaltungen <strong>im</strong>mer<br />
herrscht, hat Sie für jeden ein Lächeln,<br />
ein aufmunterndes Wort oder – wenn<br />
es sein muss – auch mal ein Pflaster<br />
zur Hand. Auch die von Margot Schenk<br />
gestalteten Standfeste der letzen Jahre<br />
werden wohl allen Teilnehmern in positiver<br />
Erinnerung sein.<br />
Wir wünschen Margot Schenk für das<br />
nächste Lebensjahrzehnt alles Liebe und<br />
Gute, Gesundheit und Gottes Segen.<br />
Besuchen Sie uns auf der Euroguss<br />
In diesem Jahr wird der <strong>VDWF</strong> erstmalig<br />
auf der Messe Euroguss ausstellen, die<br />
vom 11. bis 13. März <strong>2008</strong> auf dem<br />
Gelände der Messe Nürnberg stattfinden<br />
wird. Gemeinsam mit den Verbandsmitgliedern<br />
Festool Werkzeugbau aus Neidlingen,<br />
sowie deren Partnergießerei Polak,<br />
die ebenfalls Mitglied der TTSGruppe<br />
ist, der Härterei Werz GmbH aus Trochtelfingen,<br />
der Firma proPlanTool aus Espelkamp<br />
und dem Organisationsbüro<br />
Herbert Bübel aus Nürnberg, wird der<br />
<strong>VDWF</strong> in der Halle 12, Stand 455 ausstellen.<br />
Damit schließen wir eine Lücke in der<br />
Liste angebotener Messen und sind sehr<br />
zuversichtlich, dass wir auch die kommenden<br />
Jahre mit einem Gemeinschaftsstand<br />
auf dieser Messe ausstellen werden.<br />
Werkzeugbau Erz erhält nach erfolgreichem<br />
Audit das <strong>VDWF</strong>-Zertifikat<br />
DIN EN ISO 9001:2000<br />
Einen besondern Grund, auf der diesjährigen<br />
EuroMold mit einem Gläschen<br />
Champagner anzustoßen, hatte David<br />
Erz vom Werkzeugbau Erz in Laichingen.<br />
In der Woche vor der Messe hat David<br />
Erz zusammen mit Harald Podratz, von<br />
der offiziellen Zertifizierungsstelle des<br />
<strong>VDWF</strong>, das Audit erfolgreich durchgeführt.<br />
Auf der EuroMold wurde David Erz in<br />
einer feierlichen Zeremonie das <strong>VDWF</strong> <br />
QualitätsZertifikat überreicht. Das Qualitätsmanagementsystem<br />
der Firmen<br />
Werkzeugbau Erz und PTKErz GmbH &<br />
Co. KG wurde nach den Regeln der DIN<br />
EN ISO 9001:2000 auditiert. Aufgrund<br />
der erfolgreichen Audits wurden die<br />
Zertifikate erteilt.<br />
Dipl.Ing. Harald Podratz ist seit mehreren<br />
Jahren als Zertifizierungsauditor für<br />
den <strong>VDWF</strong> tätig. Als Auditor ist er unter<br />
anderem auch für die DQS tätig. Somit<br />
kann er auf eine langjährige Erfahrung<br />
<strong>im</strong> Qualitätsmanagementbereich zurückgreifen.<br />
Mehrere Verbandsmitglieder<br />
profitieren von dieser Erfahrung und<br />
lassen ihre Audits von Harald Podratz<br />
durchführen.
<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong> 73<br />
Würzburger Werkzeugtage <strong>2008</strong><br />
gemeinsam mit Hauptversammlung<br />
des <strong>VDWF</strong><br />
Die diesjährige Hauptversammlung des<br />
<strong>VDWF</strong> wird mit einem ganz besonderen<br />
Veranstaltungsprogramm für die Mitglieder<br />
ausgerüstet sein. Zur Feier des<br />
15 jährigen Bestehens des <strong>VDWF</strong> wird<br />
erstmalig in seiner Geschichte die Hauptversammlung<br />
gemeinsam mit den Würzburger<br />
Werkzeugtagen stattfinden.<br />
Die Würzburger Werkzeugtage, die in<br />
diesem Jahr bereits das 15. Jubiläum<br />
feiern, werden vom 7. bis 8. Mai <strong>2008</strong><br />
wieder zahlreiche Fachbesucher auf<br />
die Festung Marienberg in Würzburg<br />
locken. Hochkarätige Referenten aus<br />
Industrie und Wirtschaft setzen Trends<br />
und zeigen Wege für den Deutschen<br />
Werkzeug und Formenbau auf.<br />
Parallel zu den Würzburger Werkzeugtagen<br />
wird am 7. Mai <strong>2008</strong> die Hauptversammlung<br />
des <strong>VDWF</strong> stattfinden.<br />
Reichlich Gelegenheit, sich mit Geschäftspartnern<br />
und Kollegen auszutauschen<br />
haben die Besucher beider Veranstaltungen<br />
auf der gemeinsamen Abendveranstaltung.<br />
Wir laden Sie ein, Teil eines der wichtigsten<br />
Branchenereignisse <strong>2008</strong> zu werden,<br />
dessen richtungsweisende Trends Sie<br />
auf keinen Fall verpassen sollten. Weitere<br />
Informationen erhalten Sie <strong>im</strong> Internet<br />
unter skz.de und www.vdwf.de | tk<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Der Verband Deutscher<br />
Werkzeug- und Formenbauer<br />
sucht einen Geschäftsstellenleiter<br />
(m/w) für das<br />
Verbandsbüro in Schwendi.<br />
Zu den Aufgaben gehören:<br />
Vorbereitung von Messen und Tagungen<br />
Repräsentation auf Veranstaltungen<br />
Bearbeitung von Anfragen an den Verband<br />
Moderation von Arbeitskreisen<br />
Zusammenarbeit und Abst<strong>im</strong>mung<br />
mit der Redaktion des Verbandsmagazins<br />
Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit<br />
Finanzmanagement des Verbands<br />
Durchführung von Studien<br />
Idealerweise haben Sie Erfahrung aus der<br />
Branche des Werkzeug- und Formenbaus.<br />
Sie beherrschen die englische Sprache fließend,<br />
haben gute Kenntnisse in den klassischen<br />
Office-Programmen, reisen gern und<br />
besitzen den Führerschein.<br />
Sie arbeiten direkt dem Geschäftsführer<br />
und den Vorständen des Verbands zu.<br />
Ihre ausführliche Bewerbung richten<br />
Sie bitte unter Nennung Ihres Gehaltswunsches<br />
an den Geschäftsführer des<br />
Verbands Deutscher Werkzeug- und<br />
Formenbauer: Willi Schmid, Gerberwiesen<br />
3, 88477 Schwendi.
74 <strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> 1/<strong>2008</strong><br />
Termine und Veranstaltungen<br />
Plastics USA<br />
Chicago, USA, 4.–6. März<br />
4. Coachulting-Forum<br />
StuttgartFellbach, 6. März<br />
Euroguss<br />
Nürnberg, 11.–13. März<br />
Metav<br />
Düsseldorf, 31. März–4. April<br />
KMO<br />
Bad Salzuflen, 9.–12. April<br />
ChinaPlas<br />
Schanghai, China, 17.–20. April<br />
Control<br />
Stuttgart, 22.–25. April<br />
Resale<br />
Karlsruhe, 23.–25. April<br />
15. Würzburger Werkzeugtage<br />
Würzburg, 7.–8. Mai<br />
Plastex<br />
Brünn, Tschechien, 13.–16. Mai<br />
Rapid.Tech<br />
Erfurt, 27.–28. Mai<br />
PlastPol<br />
Kielce, Polen, 27.–29. Mai<br />
Interpart<br />
Karlsruhe, 3.–5. Juni<br />
RosMould<br />
Moskau, Russland, 17.–19. Juni<br />
Interplast Thailand<br />
Bangkok, Thailand,19.–22. Juni<br />
Verlag und Herausgeber<br />
<strong>VDWF</strong> – Verband Deutscher<br />
Werkzeug und Formenbauer e.V.<br />
Gerberwiesen 3<br />
88477 Schwendi<br />
Telefon +49 (0)7353 9842299<br />
Telefax +49 (0)7353 9842298<br />
info@vdwf.de, www.vdwf.de<br />
Präsident Prof. Dr.Ing. Thomas Garbrecht<br />
Geschäftsführer Willi Schmid<br />
Redaktion <strong>VDWF</strong> mit c3|wortundform<br />
Verantwortlicher Redakteur (i.S.d.P.)<br />
Dipl.Ing. (FH) Tobias Knipping (tk), <strong>VDWF</strong>, Schwendi<br />
Gestaltung und Technik<br />
c3|wortundform<br />
Entenbachstraße 35<br />
81541 München<br />
Telefon +49 (0)89 62500535<br />
Telefax +49 (0)89 62500536<br />
ask@wortundform.de, www.wortundform.de<br />
Herstellung<br />
Medienhaus Kastner AG<br />
Schloßhof 2–6<br />
85283 Wolnzach<br />
Telefon +49 (0)8442 92530<br />
Telefax +49 (0)8442 2289<br />
kastner@kastner.de, www.kastner.de<br />
Anzeigen<br />
Redaktionsbüro<br />
Christine Reisinger (verantwortlich)<br />
Portenschlagerweg 14<br />
85276 Pfaffenhofen<br />
Telefon +49 (0)8441 784191<br />
Telefax +49 (0)8441 784192<br />
werbung@vdwf.de<br />
Mediadaten www.media.vdwf.de<br />
AGB www.agb.vdwf.de<br />
Erscheinungsweise viermal <strong>im</strong> Jahr<br />
Druckauflage 12 000 Exemplare<br />
Verbreitete Auflage 10446 Exemplare<br />
(Angaben des 4. Quartals 2007)<br />
Der Informationsgesellschaft zur<br />
Feststellung der Verbreitung von<br />
Werbeträgern (IVW) angeschlossen<br />
Preise<br />
Einzelheft: 9,50 Euro, JahresAbonnement <strong>im</strong><br />
Inland über vier Aus gaben: 25 Euro (inklusive<br />
Porto und Versand). Das Abonnement kann<br />
unter www.vdwf.de bestellt werden. Für die<br />
Mitglieder des <strong>VDWF</strong> erfolgt der Bezug der<br />
Zeitschrift <strong>im</strong> Rahmen ihrer Mitgliedschaft<br />
ohne gesonderte Berechnung.<br />
“<strong>VDWF</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong>” 2/<strong>2008</strong> erscheint am<br />
24. Juni u. a. mit folgenden Themen:<br />
Gestaltung <strong>im</strong> und unter Wasser: Naval Design<br />
Kommunikation: vom Umgang miteinander<br />
Anwendungen: Rapidverfahren <strong>im</strong>Vergleich<br />
Innovationen: Neues aus der Lasertechnik<br />
Bildnachweise<br />
Titel: c3|wortundform<br />
Seite 4 unten: <strong>im</strong>ago/Ulmer<br />
Seite 5 oben: c3 | wortundform<br />
Seite 6, 7 links: Konstantin Grcic<br />
Seite 7 rechts: Nokia<br />
Seite 8 links: Dynacast<br />
Seite 8 rechts: Hansgrohe<br />
Seite 9 Mitte, 9 unten: Blank<br />
Seite 9 rechts: Porsche<br />
Seite 10 links, 10 oben: c3 | wortundform<br />
Seite 10 rechts: Fsb<br />
Seite 11: Vitra<br />
Seite 19, 22, 24–28: c3 | wortundform<br />
Seite 20: Richard Läpple<br />
Seite 32 –33: EEW<br />
Seite 36–37 Hintergrund: topac<br />
Seite 37: Fraunhofer ICT<br />
Seite 42: <strong>im</strong>ago/Cinque<br />
Seite 44 oben: <strong>im</strong>ago/Ulmer<br />
Seite 44 unten: <strong>im</strong>ago/Alfred harder<br />
Seite 46: vsipic.com/Reymerswaele<br />
Seite 47 oben: Disney<br />
Seite 47 unten: GrameenBank<br />
Seite 48 oben: Ratiodrink<br />
Seite 48 unten: dm<br />
Seite 51 rechts, 58 unten: photocase.de<br />
Seite 64, 65 oben, 66 oben: AKG<br />
Seite 64 unten: Peter Mittmann
Weltmesse für Werkzeug- und Formenbau,<br />
Design und Produktentwicklung<br />
3. - 6. Dezember <strong>2008</strong><br />
Messegelände<br />
Frankfurt / Main,<br />
Germany<br />
“Vom Design über den<br />
Prototyp bis zur Serie”<br />
Werden Sie Aussteller!<br />
www.euromold.com<br />
EuroMold Pavilion in Russland und China<br />
17. - 19. Juni <strong>2008</strong><br />
International Mould Making and Technologies<br />
Exhibition, Russland, www.rosmould.com<br />
24. - 26. Sep. <strong>2008</strong><br />
International Convention & Exhibition Centre<br />
Guangzhou, China, www.asiamold.de<br />
Veranstalter: DEMAT GmbH, Postfach 110 611, D-60041 Frankfurt / Main, Germany<br />
Tel.: + 49-(0) 69 - 274 003-0, Fax: + 49-(0) 69 - 274 003-40, E-mail: euromold@demat.com
Warum ist Ihr<br />
Mitbewerber schneller?*<br />
5 achsig<br />
Bearbeitungszeit: 6 h 20 min<br />
3 achsig<br />
Bearbeitungszeit: 24 h 30 min<br />
*Er hat WorkNC 5-Achs Fräsen! 06102-7144-0 · sescoi.de