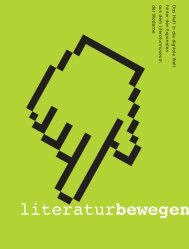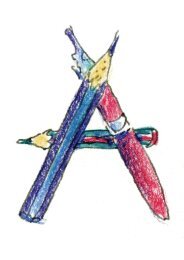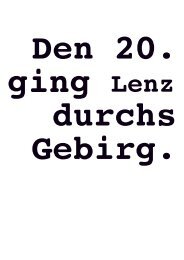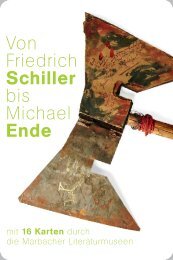Forschungswerkstatt: Celan liest Hölderlin
Forschungswerkstatt. Celan liest Hölderlin Paul Celan besaß rund 6.000 Bücher. Davon sind heute 4.697 (inklusive Zeitschriftenheften und Sonderdrucken) im Deutschen Literaturarchiv Marbach als geschlossene Sammlung aufgestellt und in einem Online-Katalog erschlossen, darunter auch unterschiedliche Ausgaben mit Hölderlins Texten und verschiedene Interpretationen. In vielen dieser Bände gibt es An- und Unterstreichungen, Randnotizen, Lesezeichen, Orts- und Datums- angaben, so dass sich Celans Leseprozesse und die Zusammenhänge mit seiner eigenen Arbeit als Schriftsteller und Übersetzer rekonstruieren lassen. Kommentierung: Michael Woll mit Unterstützung von Katja Buchholz und freundlicher Genehmigung von Bertrand Badiou. Gestaltung Andreas Jung und Diethard Keppler im Rahmen von "Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie" (23.5.2020 bis 1.8.2021 im Literaturmuseum der Moderne, Deutsches Literaturarchiv Marbach).
Forschungswerkstatt. Celan liest Hölderlin
Paul Celan besaß rund 6.000 Bücher. Davon sind heute 4.697 (inklusive Zeitschriftenheften
und Sonderdrucken) im Deutschen Literaturarchiv Marbach als geschlossene Sammlung aufgestellt und in einem Online-Katalog erschlossen, darunter
auch unterschiedliche Ausgaben mit Hölderlins Texten und verschiedene Interpretationen. In vielen dieser Bände gibt es An- und Unterstreichungen, Randnotizen, Lesezeichen, Orts- und Datums- angaben, so dass sich Celans Leseprozesse und die Zusammenhänge mit seiner eigenen Arbeit als Schriftsteller und Übersetzer rekonstruieren lassen.
Kommentierung: Michael Woll mit Unterstützung von Katja Buchholz und freundlicher Genehmigung von Bertrand Badiou. Gestaltung Andreas Jung und Diethard Keppler im Rahmen von "Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie" (23.5.2020 bis 1.8.2021 im Literaturmuseum der Moderne, Deutsches Literaturarchiv Marbach).
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1<br />
Friedrich <strong>Hölderlin</strong>s Werke,<br />
Tempel-Klassiker,<br />
hg. von Karl Justus Obenauer,<br />
Berlin/Leipzig 1928.<br />
Neben den <strong>Hölderlin</strong>-Ausgaben von Beißner<br />
<br />
<br />
Klassiker-Ausgabe. Ihr Herausgeber Karl
2<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
eingetragen. Dort steht die Passage aus<br />
Hyperion
3<br />
<br />
<br />
<br />
Friedensfeier<br />
<br />
<br />
<br />
-<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Paris.
4<br />
Friedrich <strong>Hölderlin</strong>, Sämtliche Werke.<br />
Historisch-kritische Ausgabe, begonnen<br />
durch Norbert v. Hellingrath, fortgeführt<br />
durch Friedrich Seebass und Ludwig von
5<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hyperion
6<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Menschenbeifall.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Der eindimensionale Mensch
7<br />
<br />
<br />
Friedensfeier <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Versöhnender, der du nimmergeglaubt...
8/1<br />
Friedrich <strong>Hölderlin</strong>, Sämtliche Werke.<br />
Kleine Stuttgarter Ausgabe,<br />
hg. von Friedrich Beißner,<br />
<br />
Neben der Großen Stuttgarter Ausgabe<br />
<br />
<br />
Kleine Stuttgarter Ausgabe
8/2
9<br />
<br />
<br />
<br />
Der Rhein.<br />
<br />
Engführung<br />
<br />
Rhein
10<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
In <strong>Hölderlin</strong>s Anmerkungen zum Oedipus
11<br />
<br />
<br />
-
12<br />
<br />
von Frida Arnold, hg. von Karl Viëtor,<br />
Leipzig 1921.<br />
<br />
<br />
<strong>Hölderlin</strong> idealisierte seine Geliebte<br />
<br />
Hyperion<br />
Briefe<br />
der Diotima
13<br />
Friedrich <strong>Hölderlin</strong>, Empedokles, hg. mit<br />
einer Einführung von Friedrich Seebaß,<br />
<br />
<br />
<br />
Der Tod des Empedokles <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Denk Dir<br />
<br />
Muschelhaufen
14<br />
Fête de la paix, übersetzt von<br />
Jean Bollack, 1955/56.<br />
<br />
<strong>Hölderlin</strong>s Friedensfeier <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Le Périgord. Darin kehren<br />
<br />
<br />
Andenken
15<br />
Friedrich <strong>Hölderlin</strong>, Friedensfeier,<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Friedensfeier auf einer<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Das Friedensfeier
16<br />
Friedrich <strong>Hölderlin</strong>, Remarques sur Œdipe /<br />
Remarques sur Antogone, Übersetzung und Anmerkungen<br />
von François Fédier, mit einem<br />
Vorwort von Jean Beaufret, Paris 1965.<br />
<br />
und <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
arbeitet als Brief über den „Humanismus“
17<br />
<br />
<br />
Revue de<br />
Poésie
18<br />
Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild:<br />
parva aesthetica, Frankfurt a.M. 1967.<br />
<br />
<br />
-<br />
<br />
Ohne Leitbild<br />
<br />
Einst hab<br />
ich die Muse gefragt...<br />
<br />
<br />
<br />
Gespräch im Gebirg
19<br />
Beda Allemann, <strong>Hölderlin</strong> und Heidegger,<br />
<br />
Mit Widmung von Allemann an Paul und<br />
Gisèle <strong>Celan</strong> vom 2.7.1959, mit<br />
Anstreichungen, einer Notiz von <strong>Celan</strong><br />
sowie einer bei S. 98/99 eingelegten<br />
gestempelten Briefmarke.<br />
<strong>Celan</strong> lernte den Literaturwissenschaftler<br />
Allemann in Paris kennen, wo dieser zur<br />
selben Zeit wie <strong>Celan</strong> 1957/58 Lektor<br />
an der École Normale Supérieure war. <strong>Celan</strong><br />
diskutierte mit ihm intensiv textphilologische<br />
Fragen und bestimmte ihn 1967 zum<br />
editorischen Betreuer seines literarischen<br />
Nachlasses.
20<br />
Adolf Beck und Paul Raabe (Hgg.),<br />
<strong>Hölderlin</strong>. Eine Chronik in Text und Bild,<br />
<br />
– ohne Markierungen –<br />
Der Band, der zu <strong>Hölderlin</strong>s 200. Geburtstag<br />
im Jahr 1970 erschien, versammelt<br />
neben Bilddokumenten und einer chronologischen<br />
Darstellung von <strong>Hölderlin</strong>s Leben<br />
auch Rezeptionszeugnisse, darunter <strong>Celan</strong>s<br />
Tübingen, Jänner.
21<br />
Bernhard Böschenstein, <strong>Hölderlin</strong>s<br />
<br />
Mit Widmung von Böschenstein an <strong>Celan</strong>,<br />
28.11.1959.<br />
Die Hymne Der Rhein gehört zu den Gedichten<br />
von <strong>Hölderlin</strong>, mit denen sich <strong>Celan</strong> am<br />
intensivsten beschäftigte – auch im Dialog<br />
mit Bernhard Böschenstein, der mit<br />
dieser Studie bei dem Schweizer Germanisten<br />
Emil Staiger promoviert wurde.
22<br />
Bernhard Böschenstein, Konkordanz zu<br />
<br />
des zweiten Bandes der Großen Stuttgarter<br />
<br />
Mit Widmung von Böschenstein an <strong>Celan</strong>,<br />
30.6.1964.<br />
Bernhard Böschenstein widmet <strong>Celan</strong> ein Exemplar<br />
seiner Zusammenstellung von Wörtern<br />
und ihrem Vorkommen in <strong>Hölderlin</strong>s Dichtung:<br />
„Für Paul <strong>Celan</strong>, dem es gehört.“ Damit<br />
<br />
Exemplar dieser Konkordanz gemeint, sondern<br />
im übertragenen Sinn auch <strong>Hölderlin</strong>s Werk<br />
selbst. Im Juni 1964 ist Böschenstein<br />
Hochschulassistent in Göttingen und kommt<br />
gerade von einem Lehrauftrag in Harvard<br />
zurück. Im gleichen Jahr geht er nach Genf,<br />
wo er bis zum Ende seiner akademischen<br />
Laufbahn bleiben wird. Böschenstein ist<br />
<br />
licher Lesung einladen wird: Am 21. März<br />
1970 <strong>liest</strong> <strong>Celan</strong> zur Feier von <strong>Hölderlin</strong>s<br />
200. Geburtstag in Stuttgart.
23<br />
<br />
– Böschenstein, Bernhard: <strong>Hölderlin</strong>s<br />
späteste Gedichte, mit hs. Widmung<br />
Böschensteins an Paul und Gisèle <strong>Celan</strong><br />
– Böschenstein, Bernhard: Rezension von<br />
<strong>Hölderlin</strong>-Studien Pellegrinis und<br />
Jaccottets.<br />
– Hamburger, Michael: Die Aufnahme<br />
<strong>Hölderlin</strong>s in England, mit hs. Widmung<br />
Hamburgers für <strong>Celan</strong>.<br />
Sonderdrucke in <strong>Celan</strong>s Besitz mit<br />
Widmungen von Bernhard Böschenstein und<br />
Michael Hamburger.<br />
<br />
Jahrbuch selbst, sondern einzelne Aufsätze:<br />
Bernhard Böschenstein schickt ihm seinen<br />
Aufsatz über <strong>Hölderlin</strong>s späteste Gedichte<br />
sowie seine Rezension zu zwei neuen <strong>Hölderlin</strong>-Studien<br />
und der deutsch-britische Dichter<br />
und Übersetzer Michael Hamburger seinen<br />
Beitrag Die Aufnahme <strong>Hölderlin</strong>s in England.<br />
Die Beschäftigung mit der aktuellen Forschung<br />
ist ein wesentlicher Bestandteil von<br />
<strong>Celan</strong>s Auseinandersetzung mit <strong>Hölderlin</strong>.
24<br />
Heidegger, Martin: Erläuterungen zu<br />
<strong>Hölderlin</strong>s Dichtung, mit hs. Widmung<br />
von Klaus und Nani Demus an <strong>Celan</strong>,<br />
<br />
Mit Widmung von Klaus und<br />
Nani Demus an <strong>Celan</strong>.<br />
Neben einzelnen Bänden der <strong>Hölderlin</strong>-Gesamtausgabe<br />
von Friedrich Beißner gehört auch<br />
Sekundärliteratur zu den Buchgeschenken, die<br />
<strong>Celan</strong> von dem Ehepaar Demus erhält. Bei<br />
dieser Widmung zu <strong>Celan</strong>s Geburtstag 1953 hat<br />
Klaus Demus für seine Frau Nani mit unterzeichnet.<br />
In dem Band sind keine Markierungen<br />
von <strong>Celan</strong> vorhanden – dasselbe gilt für<br />
die französische Übersetzung von Heideggers<br />
Buch, die 1962 unter dem Titel Approche de<br />
<strong>Hölderlin</strong> erscheint und ebenfalls in <strong>Celan</strong>s<br />
Bibliothek vorhanden ist.
25<br />
Heidegger, Martin: Einführung in die<br />
<br />
<br />
Mit Namenszug, Datumsvermerk 7.10.1954,<br />
Anstreichungen und Randnotizen von <strong>Celan</strong>.<br />
Heideggers Einführung in die Metaphysik<br />
wird von <strong>Celan</strong> intensiv gelesen und an-<br />
<br />
Vermerk „-i-“, mit dem <strong>Celan</strong> wichtige<br />
Gedanken und Einfälle markiert. Das Lesedatum<br />
auf der letzten Seite steht unter<br />
einem <strong>Hölderlin</strong>-Zitat. Die Ortsangabe<br />
„La Ciotat“ verweist auf einen Ort am Mittelmeer<br />
östlich von Marseille, wo <strong>Celan</strong><br />
wenige Wochen zuvor sein <strong>Hölderlin</strong>-Gedicht<br />
Andenken geschrieben hatte.
26<br />
Jaspers, Karl: Strindberg et van Gogh:<br />
Swedenborg, Hoelderlin, 1953.<br />
Mit Anstreichungen sowie Orts- und<br />
Datumsvermerk Paris 12.6.1962 von <strong>Celan</strong>,<br />
sowie zwei bei S. 138/139 eingelegten<br />
ungestempelten Briefmarken teilweise nicht<br />
aufgeschnitten.<br />
In dem Band des Philosophen Karl Jaspers<br />
las <strong>Celan</strong> ausschließlich den Beitrag von<br />
Maurice Blanchot „La folie par excellence“<br />
<br />
<br />
zwischen den Sprachen vor: im Sinne der<br />
<br />
<br />
In Blanchots Aufsatz streicht er unter<br />
<br />
Poesie und Krankheit bei <strong>Hölderlin</strong> an.
27<br />
Alfred Kelletat, Das <strong>Hölderlin</strong>haus<br />
<br />
Mit Gruß von Kelletat an <strong>Celan</strong>.<br />
Bei seinem ersten Besuch in Tübingen<br />
1955 lernt <strong>Celan</strong> den Geschäftsführer der<br />
<strong>Hölderlin</strong>-Gesellschaft Alfred Kelletat<br />
kennen. Der Turm, in dem <strong>Hölderlin</strong> die<br />
zweite Hälfte seines Lebens verbrachte,<br />
beschäftigt Paul <strong>Celan</strong> von Beginn an.<br />
Er taucht nicht nur im Gedicht Tübingen,<br />
Jänner <br />
schwimmende <strong>Hölderlin</strong>türme“. In einem<br />
Brief an den französischen Dichter<br />
und Übersetzer René Char wird der Turm<br />
zum Symbol einer positiven Seite von<br />
Deutschland: „...cette tour qui, elle
28<br />
Werner Kirchner, <strong>Hölderlin</strong>.<br />
Aufsätze zu seiner Homburger Zeit, hg.<br />
<br />
Mit Widmung des Herausgebers Kelletat<br />
an <strong>Celan</strong>, 6.12.1967.<br />
Der Sammelband des Gymnasiallehrers und<br />
<strong>Hölderlin</strong>forschers Werner Kirchner wird<br />
nach dessen Tod von Alfred Kelletat, dem<br />
Geschäftsführer der <strong>Hölderlin</strong>-Gesellschaft,<br />
herausgegeben. Kelletat sendet den Band<br />
an <strong>Celan</strong>, „gedenkend und grüßend“. Ein<br />
Jahr zuvor hatte sich Kelletat auch wissenschaftlich<br />
mit <strong>Celan</strong> beschäftigt: In<br />
der Fachzeitschrift Der Deutschunterricht<br />
erschien 1966 Kelletats Accessus zu Paul<br />
<strong>Celan</strong>s „Sprachgitter“.
29<br />
Wilhelm Michel, Das Leben Friedrich<br />
<br />
Mit Anstreichungen und Randnotizen<br />
von <strong>Celan</strong>.<br />
Als <strong>Celan</strong> sich im April 1970 das Leben<br />
nimmt, liegt die erstmals 1940 erschienene<br />
<strong>Hölderlin</strong>-Biographie von Wilhelm Michel<br />
auf seinem Schreibtisch, aufgeschlagen bei<br />
einem von <strong>Celan</strong> unterstrichenen Brentano-<br />
Zitat, das mit den Worten beginnt: „Manchmal<br />
wird dieser Genius dunkel und versinkt<br />
in den bitteren Brunnen seines Herzens“.<br />
Auch die Worte eines Zeitgenossen, die er<br />
in seinem Gedicht Ich trink Wein<br />
lin,<br />
der immer halbverrückt ist, zackert<br />
auch am Pindar.“<br />
Michels <strong>Hölderlin</strong>-Biographie ist in dieser<br />
Ausstellung auch im Original zu sehen.
30<br />
Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße<br />
Betrachtungen, mit einem Nachwort von<br />
<br />
Mit Anstreichungen und Randnotizen<br />
von <strong>Celan</strong>.<br />
Friedrich Nietzsches Unzeitgemäße Betrachtungen<br />
<strong>liest</strong> <strong>Celan</strong> sehr intensiv, vor allem<br />
im zweiten Teil Vom Nutzen und Nachteil<br />
der Historie für das Lebenreiche<br />
Anstreichungen. Eine davon bezieht<br />
sich auf <strong>Hölderlin</strong>. Nietzsche gehört zu<br />
den Autoren, die <strong>Hölderlin</strong> schon lange vor<br />
<br />
tion Norbert von Hellingraths lasen: Schon<br />
in einem Schulaufsatz im Jahr 1861 wählt<br />
er ihn zu seinem Lieblingsdichter.
31<br />
Peter Szondi: <strong>Hölderlin</strong>-Studien.<br />
Mit einem Traktat über philologische<br />
<br />
Mit einer Anstreichung.<br />
Der Literaturwissenschaftler Peter<br />
Szondi entwickelt seine literarische<br />
Hermeneutik in Auseinandersetzung<br />
mit <strong>Hölderlin</strong>s und <strong>Celan</strong>s Texten.<br />
Auf Szondis <strong>Hölderlin</strong>-Studien folgen<br />
noch die <strong>Celan</strong>-Studien – sie erscheinen<br />
erst nach <strong>Celan</strong>s und auch nach Szondis<br />
Tod, herausgegeben von dem gemeinsamen<br />
Freund Jean Bollack.
32<br />
Der kranke <strong>Hölderlin</strong>. Urkunden und Dichtungen<br />
aus der Zeit seiner Umnachtung,<br />
zum Buche vereinigt durch Erich Trummler,<br />
<br />
Mit Widmung von Klaus Reichert und<br />
Anstreichungen.<br />
Der Literaturwissenschaftler, Übersetzer<br />
und Lyriker Klaus Reichert ist <strong>Celan</strong>s<br />
Lektor beim Suhrkamp Verlag. In seiner<br />
Widmung des Bandes Der kranke <strong>Hölderlin</strong><br />
vom 15.10.1967 bezieht er sich auf <strong>Celan</strong>s<br />
Gedicht Tübingen, Jänner, in dem das<br />
<strong>Hölderlin</strong>-Zitat „Pallaksch, Pallaksch“<br />
vorkommt. In dem Band sind unter anderem<br />
Stellen aus dem Bericht Wilhelm Waiblingers<br />
über <strong>Hölderlin</strong> im Turm angestrichen.<br />
<strong>Celan</strong> zitiert daraus später in einem in<br />
dieser Ausstellung im Original ausgestellten<br />
Brief an Gisela Dischner.