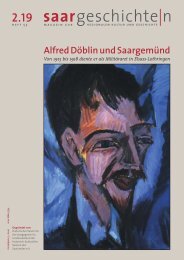Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
saargeschichte|n<br />
<strong>58</strong> | <strong>59</strong> hefte 1|2_20 magazin zur regionalen kultur und geschichte<br />
hector und paris<br />
ein spektakulärer fall zu beginn des »saarhunderts«<br />
Einzelpreis 10,– EUR 16. Jahrgang<br />
doppelausgabe<br />
100<br />
seiten
Erscheint<br />
Dezember<br />
<strong>2020</strong><br />
Kleine Abbildung:<br />
<strong>Ausgabe</strong> I – 2017<br />
Nach dem erfolgreichen Restart des Landkreis-Neunkirchen-Buches im Jahr 2017, wird<br />
demnächst der zweite Band des beliebten Buches erscheinen. In der 2. <strong>Ausgabe</strong> finden Sie einen Sonderteil<br />
zum 150-jährigen Bestehen der Kreissparkasse Neunkirchen sowie viele weitere spannende Berichte zur<br />
Geschichte und Entwicklung des Landkreises.<br />
Sie erhalten die Bände im Buchhandel, bei Amazon oder direkt www.edition-schaumberg.de<br />
Das Landkreis-Neunkirchen-Buch, <strong>Ausgabe</strong> I – 2017<br />
288 Seiten, Festeinband, großes Format, durchgeh.farbig, ISBN 978-3-941095-47-2, 25,00 EUR<br />
Das Landkreis-Neunkirchen-Buch, <strong>Ausgabe</strong> II – <strong>2020</strong><br />
288 Seiten, Ausführung wie <strong>Ausgabe</strong> I, ISBN 978-3-941095-70-0, 25,00 EUR; lieferbar ab August<br />
Brunnenstraße 15 · 66646 Marpingen · Telefon 06853 502380 · info@edition-schaumberg.de<br />
www.edition-schaumberg.de
das ding aus der saargeschichte<br />
Er gehört zum vielleicht größten Kunstschatz, den Saarlouis<br />
seit mehr als dreihundert Jahren in seinen Mauern<br />
verwahrt. Gobelinbezüge aus der königlichen Manufacture<br />
d’Aubusson schmücken Sitz und Rückenlehne dieses einen<br />
von insgesamt zwölf chaises à la reine, die Ende des 17. Jahrhunderts<br />
als Patengeschenk in die neu erbaute Festungsstadt<br />
Ludwigs XIV. geliefert wurden. Wie die Sessel, so sind<br />
auch die dazugehörigen Wandteppiche aus Gobelin mit<br />
Schwertlilien geschmückt, den floralen Insignien des Herrschaftshauses<br />
der Bourbonen. Einst verliehen Gobelinstühle<br />
und Teppiche dem Präsidialgericht am heutigen Großen<br />
Markt in Saarlouis besonderen Glanz, noch heute sind<br />
die Prachtstücke fast am gleichen Ort, nämlich im Gobelinsaal<br />
des Rathauses, zu bewundern.<br />
Auch die goldfarbenen Holzgestelle der Stühle, einst in<br />
einer Metzer Werkstatt gefertigt, mit ihren Blumen- und<br />
Muschelapplikationen das Zeitalter des Rokoko vorwegnehmend,<br />
haben Macht und Pracht des Sonnenkönigs bis<br />
heute in der französischsten Stadt des Saarlandes erhalten.<br />
Nur einmal, Anfang des 20. Jahrhunderts, war dieses kulturelle<br />
Erbe Saarlouis‘ ernsthaft gefährdet. Nachdem die preußischen<br />
Stadtväter selbst kurz mit dem Gedanken gespielt<br />
hatten, die mittlerweile 18 Sessel zu verkaufen, um die leeren<br />
Kassen zu füllen, machte die französische Besatzung im<br />
Frühjahr 1919 kurzen Prozess. Sie requirierte das gesamte<br />
Gobelin-Ensemble, weil sich Saarlouis in der nationalen<br />
Frage nach dem Ersten Weltkrieg nicht »französisch«<br />
genug gezeigt hatte.<br />
Die chaises à la reine stehen damit am Beginn jenes<br />
Säkulums, das wir heute als das erste Jahrhundert<br />
saarländischer Eigenständigkeit feiern können.<br />
Nach einer kurzen Odyssee kehrten die Sessel<br />
nach Saarlouis zurück, möglicherweise auch<br />
deshalb, weil dort ein Jahr lang der frankophile<br />
Arzt und spätere Minister Jakob Hector<br />
als Bürgermeister amtierte. Hector ist vor allem<br />
mit einem nach ihm benannten Prozess in die<br />
saarländische Geschichte eingegangen.<br />
Wie sich dieser legendäre Prozess in die Historie<br />
des Landes zwischen Deutschland und Frankreich<br />
einordnen lässt, das wird in der Titelstory<br />
dieser <strong>Ausgabe</strong> erstmals ausführlich thematisiert.<br />
Foto: Sascha Schmidt
impressum<br />
inhalt<br />
Herausgeber Edition Schaumberg, Brunnenstr. 15,<br />
66646 Marpingen, info@edition-schaumberg.de,<br />
www.edition-schaumberg.de<br />
Gegründet 2005 vom Historischen Verein für die<br />
Saargegend e.V. und vom Landesverband der historisch-kulturellen<br />
Vereine des Saarlandes e.V.<br />
Redaktion Ruth Bauer, Dr. Paul Burgard, Tobias<br />
Fuchs, Bernhard W. Planz, Dr. Jutta Schwan<br />
Redaktionsanschrift Brunnenstraße 15, 66646<br />
Marpingen, info@edition-schaumberg.de (Redaktion<br />
<strong>Saargeschichten</strong>)<br />
Anzeigenverwaltung ANZEIGEN.DE GmbH,<br />
Wolfram Schindler, Osthofenstraße 17, 66399<br />
Mandelbachtal (Ommersheim), 06803 9<strong>58</strong>0677,<br />
0178.8953500<br />
Gesamtherstellung Edition Schaumberg<br />
ISSN 1866-573x<br />
Erscheinungsweise Viermal jährlich im März, Juni,<br />
September, Dezember.<br />
Einzelausgabe 5,– EUR, Bei Bestellung über den Verlag<br />
zzgl. Versandkosten; Doppelausgabe 10,– EUR.<br />
Jahresabonnement 22,– EUR (incl. Versand innerhalb<br />
Deutschland); Ausland zzgl. anfallende Versandkosten.<br />
Hinweis zu den Beiträgen Namentlich gekennzeichnete<br />
Beiträge geben nicht unbedingt die<br />
Meinung der Redaktion wieder. Der Verlag haftet<br />
nicht für unverlangt eingereichte Manuskripte und<br />
Fotos. Die Redaktion behält sich vor, nach Absprache<br />
mit dem jeweiligen Autor, insbesondere in Überschriften<br />
eingreifen zu dürfen. Mit der Annahme zur<br />
Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag das<br />
kostenlose Nutzungsrecht für die Zeitschrift saargeschichte|n.<br />
Eingeschlossen sind auch das Recht<br />
zur Herstellung elektronischer Versionen und zur<br />
Einspeicherung in Datenbanken sowie das Recht zu<br />
deren Vervielfältigung und Verbreitung online oder<br />
offline ohne zusätzliche Vergütung. Alle in dieser<br />
Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich<br />
geschützt.<br />
Das Ding aus der Saargeschichte 3<br />
Klaus-Peter Henz Fortuna im Wareswald 5<br />
Bärbel Kuhn, Andreas Schorr Eine frühe Karte des Saargebiets 11<br />
Paul Burgard Hector und Paris, Saarlouis und Berlin 14<br />
Ein Minister vor Gericht: Was der spektakuläre »Fall Hector«<br />
über die Anfänge des Saarlandes erzählt<br />
Florian Bührer Mit dem Rütlischwur heim ins Reich! 44<br />
Der Abstimmungskampf von 1935 und seine eidgenössischen Vorbilder<br />
Ralph Schock Seines Zeichens Dichter 51<br />
Der Kölner Expressionist Johannes Theodor Kuhlemann und Saarbrücken<br />
Kristine Marschall Von der Industriebrache zum postmodernen Ökopark 56<br />
Der Bürgerpark Hafeninsel in Saarbrücken-Malstatt<br />
Joachim Conrad »Bei Kameraden und Vorgesetzten stets beliebt« 64<br />
Das Schicksal der Dillinger Ernst und Otto Schmeyer –<br />
nach ihren Feldbriefen erzählt<br />
Hans-Christian Hermann Der lange Schatten des Abstimmungskampfes 72<br />
Ein schwieriges Erbe: Zur Entstehungsgeschichte des<br />
Deutsch-Französischen Gartens<br />
Sabine Graf Europadämm(er)ung in Saarbrücken 83<br />
Zwei Teppiche und ein Bildprogramm<br />
Ausstellungen + Neue Publikationen 94<br />
Ach du liebe Zeit … Die Glosse in den saargeschichte|n 96<br />
saargeschichte|n bildet … 98<br />
Hinweis zum Titelbild<br />
Truppenparade auf dem Großen<br />
Markt in Saarlouis am Französischen<br />
Nationalfeiertag 1919. (Ausschnitt).<br />
Im Mittelpunkt der Aufnahme und der<br />
Parade steht die mit einer Tricolore<br />
geschmückte Militärkommandatur.<br />
(StA SLS, Bildersammlung)
fortuna im wareswald<br />
saargeschichte|n 7<br />
von klaus-peter henz<br />
Seit 2001 finden nun schon archäologische Ausgrabungen<br />
im gallo-römischen Vicus Wareswald<br />
statt, einer kleinen, ländlichen Siedlung aus römischer<br />
Zeit. Der Begriff Vicus meint eine ländliche<br />
Siedlung, häufig entlang der nun in Stein ausgebauten<br />
Handelsrouten. »Gallo-römisch« verweist<br />
auf die auch nach der römischen Eroberung<br />
des Gebietes weiterhin ansässige einheimischkeltische<br />
Bevölkerung, die in einem »Romanisierung«<br />
genannten Prozess römische Lebensart<br />
annimmt ohne die keltischen Wurzeln gänzlich<br />
abzulegen.<br />
Gelegen am Fuße des Schaumbergs, erstreckt<br />
sich der Ort auf Gemarkungen der Gemeinden<br />
Tholey, Oberthal und Marpingen. Durchgeführt<br />
werden die Ausgrabungen durch die Terrex<br />
gGmbH, einer Grabungsgesellschaft des Landkreises<br />
St. Wendel und der Gemeinden Marpingen,<br />
Nonnweiler, Oberthal und Tholey. [1] Neben<br />
[1] Die archäologischen Grabungen werden von der Terrex<br />
gGmbH in Kooperation mit der WiAF gGmbH durchgeführt.<br />
Die Grabungsgenehmigung erteilt das Landesdenkmalamt<br />
des Saarlandes als Fachaufsichtsbehörde.<br />
Wohnhäusern, teils mit Fußbodenheizungen,<br />
Badezimmern und Wandmalereien ausgestattet,<br />
konnten auch Gebäude ausgegraben werden, die<br />
von Händlern und Handwerkern genutzt worden<br />
waren, Berufsgruppen, die typischerweise<br />
einen solchen gallo-römischen Vicus bewohnen.<br />
In der Siedlung herrschte insbesondere im 2./3.<br />
Jhd. ein relativer Wohlstand, der sich in der hohen<br />
Anzahl der umlaufenden Münzen zeigt, die auf<br />
regen Handel schließen lassen. Insbesondere die<br />
Ausbeutung der Rötel-Vorkommen, die auf den<br />
Gemarkungen Oberthal und Theley anzutreffen<br />
sind und seine Weiterverarbeitung zu einem<br />
einheitlich geformten Handelsgut, den »Rötel-<br />
Stiften« war wohl ein bedeutender Produktionszweig<br />
im Vicus. Hunderte solcher Stifte wurden<br />
während der Ausgrabungen geborgen. [2]<br />
Sicher spielte auch der Handel mit landwirtschaftlichen<br />
Erzeugnissen eine bedeutende Rolle.<br />
Die Produktion dieser Güter übernahmen landwirtschaftliche<br />
Gehöfte, die sog. »villae rusticae«,<br />
die sich um einen vicus gruppierten. Die<br />
[2] Glansdorp (2011), 25f.<br />
Der Wareswald in<br />
der Landschaft. Ganz<br />
rechts der heutige<br />
Parkplatz mit Standort<br />
des Pfeilergrabmals,<br />
in der Mitte<br />
die Tempelbauten<br />
und das »Haus der<br />
Fortuna«, links der<br />
Siedlungskern mit<br />
Wohnbebauung.<br />
(Foto: A.Groß)
Die moderne Visualisierung<br />
des Pfeilergrabmals<br />
aus dem 2.<br />
Jhd.n. Chr. Sie führt<br />
dem Betrachter die<br />
beeindruckende<br />
Größe des ursprünglichen<br />
Monumentes<br />
vor Augen. (Foto:<br />
A.Groß)<br />
Rechts: Opfergabenbringer<br />
mit Vogel auf<br />
dem linken Arm. Das<br />
kleine Sandsteinrelief<br />
war sicher eine Weihung<br />
in den Tempel.<br />
(Foto: M. Schäfer)<br />
Besitzer der Latifundien erlangten teilweise großen<br />
Wohlstand, den sie auch präsentierten. So<br />
entstanden etwa repräsentative Grabbauten um<br />
den Reichtum einer solchen Familie zu zeigen.<br />
Auch im Wareswald lassen sich solche Gehöfte<br />
nachweisen, in deren unmittelbarer Nähe ein sog.<br />
Pfeilergrabmal entdeckt wurde. Der ca. 12 Meter<br />
hohe aus Sandstein erbaute Pfeiler war rundum<br />
mit Reliefs verziert, die wohl Szenen der antiken<br />
Mythologie zeigen, wohl auch die Familienmitglieder<br />
abbildete und viele Darstellungen aus<br />
einem Weinberg beinhaltete. [3] Die gründliche<br />
Zerstörung des Monumentes – das immense<br />
Steinmaterial weckte in nachantiker Zeit große<br />
Begehrlichkeiten – lässt eine Rekonstruktion des<br />
Dargestellten jedoch nicht mehr zu. Nach dem<br />
Abbau der Steinblöcke wurden die störenden, da<br />
vorspringenden Reliefs abgeschlagen und verblieben<br />
am Ort. Das Monument war in eine ca.<br />
12 x 12 m messende Umfriedung eingestellt und<br />
stand in unmittelbarer Nähe einer Straße, die ver-<br />
mutlich vom Gutshof kommend am Pfeilergrab<br />
vorbei auf die Durchgangsstraße der Siedlung im<br />
Wareswald führte. An der Straße zugewandten<br />
Seite war eine Inschrift angebracht, von deren<br />
Existenz lediglich ein erhaltener Buchstabe zeugt.<br />
Die Überreste mindestens eines weiteren, aber<br />
deutlich kleineren Grabmonumentes unweit des<br />
großen Pfeilers weist darauf hin, dass hier die<br />
verstorbenen Familienmitglieder aus der »villa<br />
rustica« in Gräbern mit zum Teil monumentaler<br />
Architektur innerhalb eines kleinen Friedhofs<br />
beigesetzt worden sind. Vor allem die Stilanalyse<br />
der figürlichen und vegetabilen Relieffragmente<br />
legen eine Errichtung des Monumentes in der 2.<br />
Hälfte des 2. Jhd. n. Chr. nahe. [4]<br />
Der heutige Besucher kann an Ort und Stelle eine<br />
sog. Visualisierung des Monumentes in Augen-<br />
[3] Henz/Klöckner (2009), 69–88.<br />
[4] Henz/Klöckner (2009), 87f.<br />
Luftbildaufnahme der<br />
Tempel im Wareswald.<br />
der große<br />
Tempels rechts war<br />
dem Gott Mars (Cnabetius?)<br />
geweiht.<br />
Direkt daneben<br />
(auf dem Bild links<br />
anschließend) ist<br />
seit der Grabungskampagne<br />
2019 die<br />
Existenz eines zweiten<br />
Umgangstempels<br />
bekannt geworden.<br />
(Foto: A.Groß)
saargeschichte|n 9<br />
schein nehmen und wird auf Infotafeln über die<br />
Darstellungen informiert.<br />
Die Heiligtümer im Wareswald<br />
Bereits mehrere Jahrzehnte zuvor war ca. 150<br />
Meter östlich des großen Pfeilers ein Tempel<br />
errichtet worden, der dem Mars, wahrscheinlich<br />
dem Mars Cnabetius geweiht war. 11,60 m x 14,20<br />
m misst die Cella – der Hauptraum des Tempels<br />
mit der Götterstatue –, um die mit einem Abstand<br />
von ca. 3,80 m ein weiteres Mauergeviert von<br />
19,50 m x 22,80 m angelegt wurde. Der so entstehende<br />
Umgang verleiht diesem Tempeltyp<br />
seinen Namen. Er gehört zu den sog. »gallo-römischen<br />
Umgangstempeln, die auch und gerade<br />
im Gebiet der Treverer weite Verbreitung fanden.<br />
Funde bronzener Figürchen des Gottes Mars<br />
im Tempel führen zur Zuschreibung des Heiligtums<br />
an diesen Gott. Darüber hinaus erwähnt<br />
eine Weiheinschrift, bereits im 19. Jhd. »aus dem<br />
Varuswalde« gefunden, den »Mars Cnabetius«,<br />
den lokalen Genius. Es ist daher durchaus wahrscheinlich,<br />
dass diese Gottheit in unserem Tempel<br />
verehrt worden ist.<br />
Zahlreiche Funde, die im Tempel geborgen wurden,<br />
beleuchten die Kultpraxis im Heiligtum.<br />
Neben einem kleinen Sandsteinrelief, das einen<br />
Adoranten mit Vogel als Opfergabe zeigt oder der<br />
Darstellung eines Molossers, einem Kampfhund,<br />
der auch im Krieg eingesetzt werden konnte und<br />
sicher zu einer Figurengruppe gehörte, sind vor<br />
allem eiserne Lanzenspitzen zu erwähnen, die in<br />
großer Zahl geopfert worden waren. Sie belegen<br />
die Fortführung der Weihungen solcher Lanzenspitzen<br />
in der römischen Kaiserzeit im Gebiet des<br />
keltischen Stammes der Treverer. [5]<br />
Auch Münzen gehören zum Fundgut. Die große<br />
Mehrzahl der Stücke stammt aus dem 2. bis 4.<br />
Jhd. n. Chr. Die Münzreihe legt eine Gründung des<br />
[5] Adler (2018), 66–69.<br />
Tempels am Anfang des 2. Jhd. n. Chr nahe und<br />
zeigt darüber hinaus, dass hier die Ausübung des<br />
Kultes bis an das Ende des 4. Jhd. n.Chr. andauerte.<br />
Der Mars-Tempel war nur eines von mehreren<br />
Heiligtümern in einem »Heiligen Bezirk«. Aus<br />
den aktuellen Grabungen der Kampagne 2019<br />
stammen die Mauern eines zweiten Umgangstempels,<br />
in Struktur und Ausdehnung dem Mars-<br />
Tempel ähnlich. Sie werden von Studierenden der<br />
Kennesaw State University of Georgia unter der<br />
Leitung von Prof. Philip Kiernan untersucht. Seit<br />
zwei Jahren besteht eine Kooperation der Terrex<br />
gGmbH mit der amerikanischen Universität, die<br />
ihren Sitz in Kennesaw, Atlanta hat.<br />
Wann der Tempel gebaut wurde und wem hier<br />
die Opfernden Gaben brachten, sollen weitere<br />
Grabungskampagnen zeigen.<br />
Das Gebäude »G«<br />
Nach umfangreichen Rodungsarbeiten im<br />
Gelände nördlich der Tempelanlagen ergab sich<br />
die Möglichkeit, die Fläche archäologisch zu<br />
sondieren und einige sog. Suchschnitte anzulegen.<br />
Unmittelbar unter dem Waldboden, der<br />
von einem Bagger entfernt wurde, tauchten<br />
erste Mauersteine, Bruchstücke römischer Dachziegel<br />
und Keramikscherben im Boden auf. Die<br />
während der anschließenden Ausgrabungsarbeiten<br />
gefundenen Mauerstücke ließen rasch<br />
ein Gebäude erkennen, dessen Ausdehnung<br />
allerdings noch unbekannt ist, da sich die Außenmauern<br />
über die derzeitigen Grabungsgrenzen<br />
hinaus erstrecken. Daher kann für eine nordöstlich<br />
verlaufende Mauer lediglich eine Mindestausdehnung<br />
von 15 m ermittelt werden. Die<br />
Mauer verläuft parallel zur Hangkante. Eine<br />
zweite Mauer geht im rechten Winkel davon ab<br />
und läuft in südöstlicher Richtung hangaufwärts<br />
unter die heutige Asphaltstraße. Auch hier lässt<br />
sich die Ausdehnung noch nicht bestimmen. Die<br />
Mauerstärke von durchgehend ca. 80 cm weist<br />
Links: Bronzefigur<br />
eines Molossers, eines<br />
Kampfhundes, der in<br />
römischer Zeit auch<br />
in der Arena eingesetzt<br />
wurde. Der<br />
Hund allgemein gilt<br />
als Attributtier des<br />
Gottes Mars, dem die<br />
Weihung wohl galt.<br />
(Foto: M. Schäfer)<br />
Rechts: Eiserne<br />
Lanzenspitzen, die<br />
meist mit dem hölzernen<br />
Schaft im Tempel<br />
geweiht wurden. Sie<br />
belegen die Weiterführung<br />
der an sich<br />
keltischen Sitte des<br />
Waffenopfes auch im<br />
2. Jhd. n. Chr. bei den<br />
keltischen Treverern.<br />
(Foto: M. Schäfer)
Oben links: Das<br />
neu aufgefundene<br />
Gebäude »G« in<br />
einer Luftaufnahme,<br />
unmittelbar an und<br />
vielleicht unter der<br />
modernen Straße<br />
gelegen. (Foto: A.<br />
Groß)<br />
Oben Mitte: Detailaufnahme<br />
des<br />
Gebäudes »G«. In der<br />
Bildmitte rechts ist<br />
der kleine Raum mit<br />
Fußbodenheizung<br />
zu erkennen, dessen<br />
Boden aus Dachziegeln<br />
in Zweitverwendung<br />
besteht. In<br />
der Bildmitte ist ein<br />
wohl später hinzugefügter<br />
Einbau zu<br />
sehen.<br />
dabei auf eine zweigeschossigen Bau hin. Die vorläufigen<br />
Grabungsergebnisse lassen erkennen,<br />
dass mindestens ein weiterer Raum zu einem<br />
späteren Zeitpunkt dem Bau hinzugefügt und<br />
mit einer Fußbodenheizung versehen worden<br />
war. Das Gebäude wurde offensichtlich mehrfach<br />
umgebaut und in seiner inneren Ausstattung<br />
verändert, unter anderem durch den Einbau<br />
mehrerer Mauern. Bemerkenswert ist auch, dass<br />
der Außenbereich des Gebäudes, hangabwärts<br />
gelegen, als Park oder Garten gestaltet gewesen<br />
sein könnte. Während der Ausgrabungen jedenfalls<br />
wurden eine Art Durchgang zu einer Freitreppe<br />
aus großen, sorgfältig behauenen Sandsteinen)<br />
sowie eine Trockenmauer aufgedeckt,<br />
die als Terrassenmauer gedient haben könnte.<br />
Gebäudemauern fanden sich in diesem Bereich<br />
indes nicht. Auch hier hoffen die Archäologen auf<br />
weitere Erkenntnisse durch die geplanten Untersuchungen<br />
der Kampagne <strong>2020</strong>.<br />
Das Gebäude, soweit es bislang ausgegraben<br />
wurde, war offensichtlich voll unterkellert, die<br />
Kellerböden mehrfach erneuert, der Keller später<br />
mit Brandschutt verfüllt worden In diesem<br />
Bereich fanden sich auch viele Bruchstücke großer<br />
Vorratsgefäße, aber auch ein Anteil an Feinkeramik<br />
sowie die Reste einiger feiner Glasgefäße,<br />
die meist in das 2./3. Jhd. n. Chr. datiert<br />
werden können. In diese Zeit wird vorläufig auch<br />
die Nutzung des Gebäudes datiert. Die einzige<br />
bisher gefundene Münze, ist zwar ein Denar des<br />
Kaisers Vespasian, geprägt 72/73 n. Chr.), allerdings<br />
ist das Stück stark abgegriffen und war<br />
sicherlich eine lange Zeit im Umlauf, bevor es im<br />
Wareswald in den Boden gelangte.<br />
Die Statue der Fortuna<br />
Eine besondere Überraschung bot sich den Ausgräbern<br />
dann beim Freilegen der Südwest-Ecke<br />
des Gebäudes. Inmitten des Brandschuttes, wohl<br />
Oben rechts: Die<br />
Sandsteinfigur der<br />
Fortuna in Fundlage<br />
im Gebäude »G«.<br />
Freitreppe aus großen<br />
Sandsteinblöcken<br />
gesetzt. Der Außenbereich<br />
des Gebäudes<br />
wies neben der<br />
Treppe auch trocken<br />
gesetzte Terrassenmauern<br />
auf, die darauf<br />
hinweisen, dass<br />
das Gelände offensichtlich<br />
als Gartenanlage<br />
genutzt<br />
wurde. (Fotos: Terrex<br />
gGmbH)
saargeschichte|n 11<br />
zwischen den Resten des hölzernen Inventars<br />
eines abgebrannten Wohnraumes, lag eine noch<br />
ca. 35 cm hohe Figur aus Sandstein, die sich nach<br />
sorgfältiger Freilegung, Einmessung und Bergung<br />
als eine Statue der Fortuna, der römischen<br />
Göttin des Schicksals und des Glücks, herausstellte.<br />
Zu erkennen gibt sich die Göttin durch<br />
das Füllhorn, das sie an ihrer linken Seite trägt<br />
sowie durch das, nur in Teilen erhaltene Steuerruder<br />
zu ihrer Rechten. Einige Teile, so auch der<br />
Kopf sind abgebrochen.<br />
Die Figur weist deutliche Brandspuren auf, die<br />
sich als bandförmige Verfärbung schräg über<br />
den Rücken ziehen und auch auf der Vorderseite<br />
am linken Arm, am linken Bein und am Saum<br />
des Gewandes zu beobachten sind. Auch an den<br />
Bruchstellen der Skulptur und am Halsansatz<br />
des abgebrochenen Kopfes sind die Brandspuren<br />
zu verfolgen, die Figur ist daher im bereits zerbrochenen<br />
Zustand mit den heißen Materialien<br />
des Brandschuttes in Berührung gekommen. Solche<br />
Götter-Figuren wurden häufig in den sog.<br />
Lararien aufgestellt, Hausaltären, die der täglichen<br />
Religionsausübung dienten und in denen<br />
neben dem Lar, dem Beschützer des Hauses,<br />
mannigfaltigen Gottheiten Opfergaben dargebracht<br />
wurden.<br />
Das Füllhorn, das die reich gewandete Figur im<br />
linken Arm hält, weist bereits auf die Göttin<br />
Fortuna hin, zumal ihr als zweites Attribut an<br />
ihrer Rechten ein Steuerruder eines Schiffes beigegeben<br />
ist. Mit diesen Attributen ist die Göttin<br />
auf zahlreichen Münzen der römischen Kaiserzeit<br />
abgebildet und wird dann häufig als »fortuna<br />
redux« bezeichnet, als die »Rückführende«,<br />
die vor allem von Soldaten um eine gute Rückkehr<br />
aus Krieg oder Stationierung in fernen Ländern<br />
gebeten wurde. Jedoch scheint ein solch<br />
»soldatischer« Aspekt nicht so recht in eine zivile<br />
Kleinsiedlung, wie wir sie im Wareswald vor uns<br />
haben, zu passen. Denkbar wäre immerhin ein<br />
Veteran als Stifter, der sich im vicus Wareswald<br />
nach seiner Entlassung niedergelassen hatte und<br />
das Stück in einem Tempel aufstellen ließ.<br />
Die einzige Münze,<br />
die bislang geborgen<br />
werden konnte: ein<br />
Denar des Kaisers<br />
Vespasian, geprägt<br />
72/73 n. Chr. Die<br />
Rückseite zeigt die<br />
Kultwerkzeuge der<br />
Auguren: simpulum,<br />
aspergillum, Opferkanne<br />
und lituus.<br />
Foto: A. Didas<br />
Unmittelbar nach<br />
der Bergung zeigt<br />
sich die vorzügliche<br />
künstlerische Arbeit<br />
an der Figur. Die<br />
Beschädigungen<br />
im Kopfbereich<br />
und an der rechten<br />
Körperseite sind<br />
zu erkennen. (Foto:<br />
Terrex gGmbH)
Links: Nach der Restaurierung<br />
in den<br />
Werkstätten des<br />
Landesdenkmalamtes<br />
treten die Brandspuren<br />
deutlich zu<br />
Tage. (Foto: N. Kasparek,<br />
LDA)<br />
Rechts: Die Statue<br />
der Fortuna in der<br />
Sonderausstellung im<br />
Museum für Vor- und<br />
Frühgeschichte Saarbrücken.<br />
Restaurierter<br />
Zustand.<br />
Im Frühjahr <strong>2020</strong><br />
wurde ein Köpfchen<br />
aus Sandstein<br />
im Bauschutt<br />
der Ausgrabungen<br />
gefunden. Ob er zur<br />
ausgegrabenen Fortuna<br />
gehört, wird sich<br />
zeigen?<br />
(Foto: LDA)<br />
Die Figur ist aus gelblichem, hellem und feinkörnigem<br />
Sandstein hergestellt. Die Provenienz<br />
des Steines wurde bislang nicht ermittelt. Mit<br />
großem Geschick und Können hat der Bildhauer<br />
die Göttin geformt. Proportionen und die Standstellung<br />
im sog. Kontrapost mit zurückgesetztem<br />
linkem Fuß und rechtem Standbein, der darauf<br />
ruhenden schräg gestellten Hüfte und dem in<br />
Gegenrichtung schwingenden Oberkörper bis<br />
in die Schultern gekonnt ausgeführt. Die sehr<br />
gute Qualität der Bildhauerarbeit zeigt sich ins-<br />
besondere in der Darstellung der Gewänder. Über<br />
dem ärmellosen Chiton aus dünnem Stoff liegt<br />
der Mantel, der über die linke gelegt ist und zur<br />
rechten Hüfte hinabgeführt wird und von dort,<br />
den Oberkörper freilassend zur rechten Schulter<br />
verläuft. Das Gewand zieht in reichem Faltenwurf<br />
bis zu den Füßen. Die übereinander liegenden<br />
Kleidungsstücke sind in ihrer Stofflichkeit<br />
herausgearbeitet, dünne Stoffbahnen von dickeren<br />
unterschieden, die Faltenwürfe detailliert<br />
dargestellt. Die hohe künstlerische Qualität der<br />
Skulptur spricht dafür, die Entstehung in einer<br />
renommierten Werkstatt, eventuell in Trier im 2.<br />
Jhd. n. Chr., anzunehmen.<br />
Der Kopf der Fortuna?<br />
Seit Mai <strong>2020</strong> laufen die Grabungen im Gebäude<br />
»G« weiter. Hochinteressante Ergebnisse sind<br />
hierbei zu erwarten. Ganz aktuell wurde im<br />
Brandschutt ein kleiner Frauenkopf aus Sandstein<br />
gefunden, aus der Schicht also, aus der<br />
auch schon die Fortuna-Statue stammt. Der Kopf<br />
wurde umgehend in die Restaurierungswerkstätten<br />
des Landesdenkmalamtes gebracht, wo<br />
er nun zunächst restauriert wird. Erst danach<br />
wird es möglich sein, die Zusammengehörigkeit<br />
der Figur des letzten Jahres mit dem aktuellen<br />
Fund zu vergleichen.
eine frühe karte des saargebiets<br />
saargeschichte|n 13<br />
von bärbel kuhn und andreas schorr<br />
Mit dem Friedensvertrag von Versailles vom<br />
28. Juni 1919 wurde das neu gebildete »Saarbeckengebiet«<br />
für 15 Jahre vom Deutschen Reich<br />
abgetrennt und unter die Verwaltung des frisch<br />
konstituierten Völkerbunds gestellt. Die vorliegende<br />
Karte aus Privatbesitz [1] darf wohl als ein<br />
frühes regionales Zeugnis zur Popularisierung<br />
des neuen Gebietes gelten. Sie erschien im Verlag<br />
der Gebrüder Hofer in Saarbrücken, der auch<br />
die »Saarbrücker Zeitung« herausgab. Die Karte<br />
wurde zum Preis von 50 Pfennig angeboten,<br />
wahrscheinlich in den Verkaufsstellen der »Saarbrücker<br />
Zeitung«. Da die Karte nach ersten<br />
Recherchen in regionalen Archiven nicht nachgewiesen<br />
ist und bislang in einschlägigen Werken<br />
nicht erwähnt wurde, war sie vermutlich<br />
nicht in hoher Auflage gedruckt worden.<br />
Auf der Karte wurden unterschiedliche Typen von<br />
Grenzen beziehungsweise Grenzabschnitten eingezeichnet<br />
und in der Kartenlegende benannt.<br />
Unter anderem ist von einer »örtlich noch zu<br />
bestimmenden Grenze« die Rede. Gemeint<br />
ist die östliche Grenze des Saargebietes. Die<br />
gestrichelte Linie bezeugt den damals noch provisorischen<br />
Charakter dieses Abschnitts. Das wird<br />
vor allem westlich von Zweibrücken sichtbar: Hier<br />
hat die Grenze abgerundete Formen und gleicht<br />
nicht einer Zickzacklinie wie etwa im Hochwald,<br />
wo sie den Gemarkungsgrenzen der Gemeinden<br />
folgt. Die Karte stammt damit aus der Zeit vor<br />
dem Abschluss der Grenzvermessung, also zwischen<br />
der Unterzeichnung des Versailler Vertrags<br />
[1] Die Karte wurde erstmals publiziert in Kuhn, Bärbel: Beharrung<br />
und Aufbruch in bewegten Zeiten. Wiesbach im<br />
Saargebiet der Völkerbundzeit (1919–1935), in: Wiesbach.<br />
Geschichte eines saarländischen Dorfes, hg. von der Gemeinde<br />
Eppelborn durch Kuhn, Bärbel; Maas, Hans Günther;<br />
Schorr, Andreas (St. Ingbert 2018) S. 223–239, hier S.<br />
224 (Gesamtkarte in Verkleinerung) und S. 225 (Ausschnitt<br />
mittleres Saarland).<br />
(28. Juni 1919) und der urkundlichen Grenzfestlegung<br />
für das »Saargebiet« (21. Dezember 1921),<br />
als der östliche Grenzverlauf genau geregelt<br />
wurde. Weiter gibt die Preisangabe in Pfennigen,<br />
als Hundertstel-Unterteilung der zunächst weiter<br />
geltenden Mark des Deutschen Reiches, einen<br />
Hinweis auf die Entstehung in der frühen Phase<br />
des Saargebiets, vor der Einführung des französischen<br />
Franken als alleiniges Zahlungsmittel am<br />
1. Juni 1923.<br />
In § 48 des Versailler Vertrages wurden die Prinzipien<br />
für die Grenzziehung des neuen Gebildes<br />
festgelegt: »Ein Ausschuß von fünf Mitgliedern,<br />
von denen eines von Frankreich, eines von<br />
Deutschland und drei von dem Rate des Völkerbunds,<br />
welch letzterer seine Wahl unter den<br />
Staatsangehörigen anderer Mächte zu treffen<br />
hat, ernannt werden, tritt binnen zwei Wochen<br />
nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags<br />
zusammen, um an Ort und Stelle den Verlauf<br />
der […] Grenzlinie festzulegen. Wo dieser Verlauf<br />
nicht mit den Verwaltungsgrenzen zusammenfällt,<br />
wird der Ausschuß bemüht sein, dem<br />
angegebenen Verlauf unter möglichster Berücksichtigung<br />
der örtlichen Wirtschaftsinteressen<br />
und der bestehenden Gemeindegrenzen nahezukommen.«<br />
[2]<br />
Der Ausschuss bestand dann neben dem französischen<br />
und dem deutschen Delegierten aus<br />
einem britischen, einem brasilianischen und<br />
einem japanischen Vertreter. Mit der am 21.<br />
Dezember 1921 in Paris unterzeichneten Urkunde<br />
legte er die Grenzziehung fest. [3] Die Umgrenzung<br />
[2] Hier zitiert nach: http://www.documentarchiv.de/wr/<br />
vv03.html (zuletzt gesehen am 27. April <strong>2020</strong>).<br />
[3] Urkunde publiziert in: Amtsblatt der Regierungskommission<br />
des Saargebietes 1928, S. 179–192, Landesarchiv<br />
Saarbrücken, Inv.-Nr. 901/Z40, online: http://ndkio.homepage.t-online.de/grenzprotokoll.htm<br />
(zuletzt gesehen<br />
am 27. April <strong>2020</strong>).
des Saargebiets richtete sich nicht nach den<br />
preußischen und bayerischen Landkreisen, sondern<br />
nach damals hochmodernen wirtschaftsgeografischen<br />
Gesichtspunkten: den Kohlelagerstätten,<br />
den Industriestandorten sowie den<br />
Wohngebieten der Bergarbeiter. [4] Nach dem Versailler<br />
Vertrag sollte die Grenze nach Süden und<br />
Südwesten die im selben Vertragswerk nach den<br />
Verhältnissen des Jahres 1870 wiederhergestellte<br />
französische Staatsgrenze sein. Die Kriterien<br />
für die Festsetzung der neuen Grenzabschnitte<br />
gegen das Deutsch Reich waren unterschiedlich:<br />
Die Grenze im Nordosten und Osten sollte nach<br />
topografischen Punkten, im Nordwesten und Norden<br />
entlang von Verwaltungsgrenzen gezogen<br />
[4] Vgl. zu den Grenzziehungen auch Aust, Bruno; Herrmann,<br />
Hans-Walter; Quasten, Heinz: Das Werden des Saarlandes<br />
– 500 Jahre in Karten (= Veröffentlichungen des Instituts<br />
für Landeskunde im Saarland. Band 45) (Saarbrücken<br />
2008) Karten 30, 31, 57.<br />
werden. Für die vorliegende Karte lässt der Titel<br />
»Karte des Saarlandes« aufhorchen, denn offiziell<br />
hieß die Region in der Zeit der Völkerbundverwaltung<br />
»Saargebiet«, einer Klammerform<br />
aus »Saarbeckengebiet«, französisch Territoire du<br />
Bassin de la Sarre. Nach weiteren Überprüfungen<br />
und technischen Korrekturen wurde die Grenzziehung<br />
1928 im Amtsblatt der Regierungskommission<br />
des Saargebietes veröffentlicht.<br />
Neben der Bezeichnung »Saarland« lassen<br />
sich auf der Karte einige weitere Hinweise finden,<br />
die auf eine eigene, im damaligen Sinne<br />
»deutsche« Perspektive des Saarbrücker Verlags<br />
schließen lassen, die nicht im Einklang mit<br />
den Auffassungen der Völkerbundverwaltung<br />
sowie der französischen Wirtschaftsregierung<br />
und Militärverwaltung stehen konnte: Auf eine<br />
Beschriftung »Deutsches Reich« im nordwestlichen<br />
Anschluss an das Gebiet wurde verzichtet.<br />
Da sich die Bevölkerung des Saargebiets weiterhin<br />
als deutsch und somit als Teil des Deutschen
Reiches verstand, könnte ein Motiv für diese wohl<br />
bewusst gewählte Darstellungsweise sein, dass<br />
eine Grenze zum »Reich« erst gar nicht benannt<br />
werden sollte. Aber auch die Rückkehr des Reichslands<br />
Elsass-Lothringen nach Frankreich war<br />
offenbar noch zu neu, um bereits akzeptiert zu<br />
werden. Es finden sich westlich der Saargebietsgrenze<br />
sowohl die Bezeichnung »Elsass-Lothringen«<br />
(und nicht etwa »Frankreich«) als auch die<br />
damals allgemein geläufigen deutschen Ortsnamenformen<br />
wie zum Beispiel »Busendorf«<br />
statt Bouzonville und »Kammern« statt Lachambre.<br />
Die neue beziehungsweise wieder errichtete<br />
Grenze zu Frankreich wurde in der Kartenlegende<br />
als »lothringische Grenze« bezeichnet.<br />
Weiter fällt auf, dass die Grenzen der Landkreise<br />
auf der Karte fehlen. Die Zerschneidung der seit<br />
dem frühen 19. Jahrhundert bestehenden Kreise<br />
schlug politisch hohe Wellen und wurde von vielen<br />
Menschen beiderseits der neuen Trennungslinie<br />
als schmerzlich empfunden. Die beim Deutschen<br />
Reich verbliebenen Teile wurden dort ganz<br />
bewusst als »Restkreise« verwaltet und ihre amtlichen<br />
Namen erinnerten an die aus der Sicht des<br />
Deutschen Reiches vorläufig eingebüßten Kreisstädte:<br />
»Kreis Merzig-Wadern (Rest)« mit Sitz in<br />
Wadern und »Kreis Sankt Wendel-Baumholder<br />
(Rest)« mit Sitz in Baumholder. Ob die Grenzen<br />
der Landkreise aus gestalterischen Gründen,<br />
also der Übersichtlichkeit der Darstellung, oder<br />
aus politischer Absicht nicht in die Karte aufgenommen<br />
wurden, muss offenbleiben.<br />
Eingezeichnet wurde hingegen als dünn<br />
gestrichelte Linie die ehemalige, im Saargebiet<br />
weitgehend bedeutungslos gewordene bayerisch-preußische<br />
Grenze. Sie wurde in der<br />
Kartenlegende als »Pfalzgrenze« bezeichnet und<br />
damals offenbar noch als relevant angesehen.<br />
Vielleicht war sie auch als Merkposten gedacht,<br />
denn man stellte sich nichts Anderes vor als eine<br />
Rückkehr der jeweiligen Teile des Saargebiets zu<br />
Preußen und Bayern, was jedoch nach der Rückgliederung<br />
ins Deutsche Reich im Jahr 1935 nicht<br />
geschah. Anekdotisch und in Ortsneckereien wird<br />
bis heute auf saarländische »Preußen« und »Bayern«<br />
Bezug genommen. Anstatt der Kreisgrenzen<br />
übernehmen auf der Karte die eingezeichneten<br />
Straßen und Bahnlinien die orientierende Funktion<br />
im Raum und verweisen – wohl ungewollt –<br />
auf die französische Absicht, mit dem Saargebiet<br />
eine neue politische Einheit auf wirtschaftsgeografischer<br />
Grundlage zu schaffen und aus den<br />
älteren Zusammenhängen herauszulösen.<br />
saargeschichte|n 15<br />
Erfolgs-<br />
Geschichte<br />
dittgen<br />
Wegbereiter seit 1897.<br />
dittgen Bauunternehmen GmbH<br />
Saarbrücker Straße 99 | D-66839 Schmelz | Telefon 06887/307-0 | www.dittgen.de<br />
Telefax 06887/307-199
hector und paris,<br />
saarlouis und berlin<br />
Ein Minister vor Gericht:<br />
Was der spektakuläre »Fall Hector« über die Anfänge des Saarlandes erzählt<br />
von paul burgard<br />
Wer sich mit der saarländischen Geschichte des 20. Jahrhunderts befasst, wird<br />
mit Sicherheit ziemlich schnell auf seinen Namen stoßen. Allerdings hat sich<br />
der Arzt und Politiker Jakob Hector nur in zweiter Linie durch seine Tätigkeit<br />
als Bürgermeister von Saarlouis und Minister der internationalen Regierungskommission<br />
im kollektiven Gedächtnis des Landes verewigt. Fast zum Mythos<br />
gewordene Erinnerungen ranken sich vielmehr um eine gerichtliche Auseinandersetzung,<br />
die im Jahr 1923 für internationales Aufsehen sorgte. Viele der<br />
wichtigsten Kapitel des jetzt als »Saarhundert« gefeierten Säkulums lassen sich<br />
am Beispiel dieses außergewöhnlichen Prozesses erzählen: die Entstehung eines<br />
eigenen Saar-Staates, die Wechselfälle der deutsch-französischen Beziehungen,<br />
die Grundlagen saarländischer Identität und nicht zuletzt der Wandel von<br />
Erinnerung und Geschichtsbildern.<br />
Niemand kann sagen, die Saarlouiser hätten keinen guten Platz für die<br />
Erinnerung an ihren Doktor gefunden. [1] In einem gutbürgerlichen Viertel<br />
haben sie sie benamt, die Dr.-Jakob-Hector-Straße, einseitig bebaut mit<br />
18 Häusern, vom Verkehr der parallel verlaufenden Wallerfanger Straße<br />
durch eine Doppelreihe Laubbäume abgeschirmt. Die hundert Meter<br />
entfernte Klinik vom Roten Kreuz (dessen saarländischer Ehrenpräsident<br />
Hector war) ist ein ebenso würdiger Nachbar wie die<br />
Straße für Robert Koch, die unmittelbar neben Jakob Hector ganz<br />
nebenbei auch zeigt, dass man mit Professur und Nobelpreis das<br />
[1] Der Fall Hector ist in der Literatur bisher erstaunlich wenig beachtet worden.<br />
Zwar wurde er in Abhandlungen zur Zeit des Völkerbundes quasi als Symptom<br />
der Zeit immer wieder thematisiert, aber nie als eigenständiges Kapitel für den<br />
Einblick in die 1920er Jahre analysiert. Nicht einmal eine etwas ausführlichere<br />
faktische Darlegung hat seit der Darstellungen in den zeitgenössischen<br />
Medien und Kampfschriften mehr stattgefunden. Am ausführlichsten<br />
und durchaus quellennächsten ist noch die entsprechende Passage in<br />
Hermann Röchling, Wir halten die Saar!, Berlin 1934, S. 81–88 gelungen.<br />
Siehe zum Fall Hector auch Ludwig Linsmayer, Politische Kultur im<br />
Saargebiet 1920–1932, St. Ingbert 1992, S.205f.; Peter Lempert, »Das<br />
Saarland den Saarländern«. Die frankophilen Bestrebungen im Saargebiet<br />
1918–1935, Köln 1985, hier v.a. S. 40–46. Beim »Klassiker« zur<br />
Völkerbundszeit von Maria Zenner, Parteien und Politik im Saargebiet<br />
unter dem Völkerbundsregime, Saarbrücken 1966, spielt der Fall<br />
Hector nur am Rande eine Rolle. Auch bei Hans Jörg Schu, Chronik der<br />
Stadt Saarlouis 1679–2005. Ein chronologischer Bericht über die Entwicklung<br />
der Festungsstadt, Saarlouis 2010, wird Bürgermeister Hector<br />
kaum und der Fall des Ministers überhaupt nicht thematisiert.
saargeschichte|n 17<br />
kompensatorische »Dr.« vor dem Namen nicht<br />
mehr braucht, um vor aller Welt zu dokumentieren,<br />
dass der einzig wahre Doktor nur ein Mediziner<br />
sein kann. Im Saarlouiser Straßennetz wird<br />
Hector nicht nur in einen prominenten medizinischen<br />
Kontext eingebettet. Parallel- und<br />
Anschlussstraße bringen ihn auch in Verbindung<br />
mit der kommunalen Politik, und zwar – ob<br />
gewollt oder nicht – mit deren französischer<br />
Variante. Ferdinand Heil und Michel Reneauld,<br />
die Namensgeber besagter Straßen, führen den<br />
Betrachter nämlich zurück in jene Zeit, als Saarlouis<br />
von Paris aus regiert wurde, Heil als erster<br />
Maire der Sonnenkönigsstadt überhaupt, Reneauld<br />
als Stadtoberhaupt in der Ära Napoleons,<br />
dessen General er auch war. Arzt und Politiker<br />
zwischen Saarlouis und Paris, so könnte man die<br />
Botschaft über die Vita Hectors also durchaus<br />
aus dem Stadtplan der heimlichen Hauptstadt<br />
des Saarlandes herauslesen. Was gar nicht so<br />
weit von der historischen Wahrheit entfernt ist,<br />
nicht einmal das mit der heimlichen Hauptstadt.<br />
Jung, dynamisch, erfolgreich – und preußisch?<br />
Dass er nach dem Ersten Weltkrieg zu den führenden<br />
Männern gehören würde, die mit der<br />
französischen Besatzungsmacht kooperierten,<br />
dass er mit Unterstützung aus Paris zum Minister<br />
werden und später an der Spitze frankophiler<br />
Bewegungen stehen sollte, dass er bereits 1930 die<br />
Staatsbürgerschaft der Grande Nation erwerben<br />
würde und 1935 mit seiner Familie ins französische<br />
Exil gehen musste: Das alles war Jakob Hector<br />
keineswegs ins Stammbuch geschrieben. Als<br />
Hector 1872 im heute zu Dillingen gehörenden<br />
Dorf Pachten geboren wurde, grassierte auch an<br />
der mittleren Saar eher das preußische als das<br />
französische Fieber. Zwar gehörte Pachten bis 1815<br />
zum Herzogtum Lothringen, besaß Dillingen mit<br />
seinem Eisenwerk eine lange französische Tradition,<br />
die wie jene des benachbarten Saarlouis<br />
bis ins 17. Jahrhundert zurückführte. Aber das<br />
alles war zur Zeit von Jakobs Geburt schon seit<br />
sechs Jahrzehnten aus und vorbei. Längst hatten<br />
die Preußen das Land in Besitz genommen und<br />
auch kulturell »kolonisiert«, waren die französischen<br />
durch preußische Truppen in der Garnison<br />
Saarlouis abgelöst worden, hatte vor<br />
allem die Reichsgründung den nationalen<br />
Kompass an der Saar endgültig<br />
in Richtung Berlin eingenordet. Wenn<br />
eines den Menschen im Saarlouiser<br />
Land in der nun beginnenden<br />
Ära des Kaiserreichs besonders am Herzen<br />
lag, dann war es zu zeigen, wie deutsch sie<br />
waren – und wie sehr sie sich vom französischen<br />
»Erbfeind« jenseits der Grenze unterschieden.<br />
Leider sind die biografischen Überlieferungen<br />
zum jungen Jakob Hector ziemlich dürftig. Insofern<br />
ist es schwer zu sagen, wo und wie der aufstrebende<br />
Mann aus Pachten seinen kulturellen<br />
Standort im Zeitalter von Nationalismus und<br />
Imperialismus fand. Fest steht, dass der Sohn<br />
eines Bauern einen bildungsbürgerlichen Aufstieg<br />
schaffte, der für einen wie ihn in dieser Zeit<br />
und in diesem Saar-Land nicht alltäglich war. Das<br />
Gymnasium besuchte er fernab der Heimat, im<br />
westfälischen Rheine, das dortige Dionysianum,<br />
eine ehemalige Franziskanerschule, seit 1861<br />
preußisches Vollgymnasium, war vermutlich aus<br />
konfessionellen wie aus ökonomischen Gründen<br />
eine geeignete Lernstätte für das jüngste<br />
von neun Kindern eines saarländischen Bauern.<br />
Als er 1895 in der Stadt an der Ems sein Abitur<br />
absolvierte, war der Pachtener bereits 23 Jahre<br />
alt, der Weg von der saarländischen Dorfschule<br />
zum westfälischen Gymnasium verlief also nicht<br />
Die Dezennaltabelle<br />
der Bürgermeisterei<br />
Fraulautern, zu der<br />
Pachten gehörte,<br />
zeigt, dass Jacob<br />
Hector an einem<br />
ungewöhnlichen<br />
Datum geboren<br />
wurde: am 29. Februar<br />
1872 (LA SB,<br />
Bestand Dezennaltabellen)
Im dritten Haus von<br />
links, am Großen<br />
Markt 16, lebte und<br />
arbeitete Jacob Hector<br />
mit Familie bis<br />
zu seiner Emigration<br />
1935.<br />
(StA SLS, Sammlung<br />
Postkarten)<br />
ganz geradlinig. Nach dem Abitur zog es Hector<br />
zum Medizinstudium nach Deutschland und in<br />
die Schweiz. An den renommierten Universitäten<br />
von Heidelberg, Gießen, Würzburg, München und<br />
Lausanne lernte er die ärztliche Heilkunst, ehe er<br />
1900 in Berlin approbiert und ebendort 1901 promoviert<br />
wurde. Nicht ganz gewöhnlich war ein<br />
solch ausgedehntes akademisches Itinerar im<br />
Kaiserreich, zumal für einen unbemittelten Dorfjungen,<br />
was womöglich für eine Unterstützung<br />
durch (katholische?) Stipendien spricht. Nicht<br />
ganz gewöhnlich für einen jungen Arzt war es<br />
aber auch, dass Hector das erste Jahr des neuen<br />
Jahrhunderts, das erste seiner langen medizinischen<br />
Karriere, auf Schiffen verbrachte. Auf den<br />
Dampfern des Norddeutschen Lloyd hatte er<br />
sich im August 1900 als Schiffsarzt verdingt, war<br />
für das leibliche Wohl einer eher besser situierten<br />
Gesellschaft auf Weltreisen nach Nord- und<br />
Südamerika, Afrika und Fernost verantwortlich.<br />
Zurück in der Heimat, ließ er sich kurz nach seiner<br />
Heirat im Herbst 1901 mit Haus und Arztpraxis<br />
am Großen Markt in Saarlouis nieder, im Zentrum<br />
der französischsten Stadt des Saarlands. Mit<br />
Ausnahme eines gut zehnjährigen Exils in Frankreich<br />
hat Hector hier ein halbes Jahrhundert lang<br />
als praktischer Arzt gewirkt, bis zur Emigration<br />
1935 im Haus Nr. 16, nach der Rückkehr 1946 in der<br />
Nummer 7. [2]<br />
[2] Hans Peter Klauck, Die Bürgermeister der Stadt Saarlouis<br />
1683–2005, in: Unsere Heimat 30, 2005, S. 12–30<br />
(hier S. 23); ders., Jakob Hector, in: Saarland-Biografien<br />
(www.saarland-biografien.de); ders., Die Einwohner der<br />
Stadt Saarlouis 1851–1902. Teilband 6, A–H, Saarlouis<br />
2012, S. 552f. Nachrufe waren in der in SVZ v. 6. Februar 54<br />
und der SZ v. 7. Februar 54 abgedruckt. Vgl. auch Andres,<br />
Hecor und die Saarfrage (wie Anm. 42). Zum Dionysianum<br />
vgl. Festschrift des Gymnasium Dionysianum in<br />
Rheine. Den Freunden der Schule als Erinnerungsgabe<br />
an die Dreihundertjahrfeier im Jahre 19<strong>59</strong>, Rheine 19<strong>59</strong>.<br />
Die Abiturientenliste von 1895 mit Hector S. 351. Die<br />
Wohnungen Hectors am Großen Markt nach den Adressbüchern<br />
von Saarlouis 1909 und 1925 sowie für die<br />
Nachkriegszeit nach den Briefwechseln in der LEA-Akte<br />
(LA SB, LEA 14261).<br />
Nur ein paar Meter entfernt von Haus und Praxis,<br />
zwei Häuser neben der Ludwigskirche, begann<br />
auch Hectors politische Karriere. Hier befand<br />
sich nämlich das alte Saarlouiser Rathaus, in dessen<br />
Ratssaal er am 13. Januar 1913 als Stadtverordneter<br />
einziehen konnte, in dem er allerdings,<br />
anders als hie und da zu lesen, niemals als Beigeordneter<br />
agierte. Die Wahl zu einem von 26<br />
Saarlouiser Stadtverordneten zeigt dennoch, wie<br />
schnell sich Hector in der Stadtgesellschaft etabliert<br />
hatte, vor allem in deren besseren Kreisen:<br />
Kommunalpolitik war vor dem Ersten Weltkrieg<br />
in Preußen noch eine Honoratioren vorbehaltene<br />
Veranstaltung. Dass ein Arzt mit gut gehender<br />
Praxis zu eben dieser besseren Gesellschaft<br />
gehörte, war spätestens im 20. Jahrhundert allerdings<br />
quasi zur Selbstverständlichkeit geworden.<br />
Bei diesem Werdegang ist es eigentlich kaum<br />
ersichtlich, wie der junge Jakob Hector seine<br />
»Liebe« zu Frankreich entdeckt haben könnte.<br />
Eine Vita mit den beschriebenen Stationen<br />
schloss im Gegenteil die Entfaltung einer wie<br />
auch immer gearteten Frankophilie im Normalfall<br />
sogar aus. Sowohl die höheren Schulen (auch<br />
vor dem katholischen Dionysianum in Rheine<br />
stand ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal) als auch<br />
die Universitäten waren im Kaiserreich eher<br />
Brutstätten eines mehr oder weniger aggressiven<br />
Nationalismus, den man unter dem Einfluss<br />
genau so gesinnter Kommilitonen fern<br />
der Alltagserfahrungen in der deutsch-französischen<br />
Heimat nicht anders als selbstverständlich<br />
empfinden mochte. Sollte – wovon wir ebenfalls<br />
nichts wissen, was aber vor dem Start einer<br />
akademischen Ausbildung in den 1890ern fast<br />
als must have galt – Hector auch seinen Militärdienst<br />
als Einjährig-Freiwilliger abgeleistet<br />
haben, müsste das einen preußisch-deutschen<br />
Patriotismus noch stärker fundamentiert haben.<br />
Auch das Jahr mit dem Norddeutschen Lloyd hat,<br />
anders als das heute gerne kommuniziert wird,<br />
nicht per se zum Erlernen von Weltoffenheit im<br />
modernen Sinne beigetragen: Sogar die zivilen<br />
Passagierschiffe dampften im Zeitalter der wilhelminischen<br />
Flotteneuphorie und der kurz vor<br />
Hectors Dienstantritt beim Lloyd gehaltenen<br />
Hunnenrede Wilhelms II. vor allem mit imperialistisch-kolonialem<br />
Antrieb. Schließlich dürfte<br />
es im Sinne eines beruflichen und kommunalpolitischen<br />
Fortkommens im kaiserzeitlichen<br />
Saarlouis besser gewesen sein, wenn man nicht
saargeschichte|n 19<br />
zu sehr mit den französischen Stadtgründern<br />
und deren Nachkommen sympathisierte. [3]<br />
Wenn die zeitgenössischen Aussagen und in<br />
deren Gefolge die Lokalgeschichte der historischen<br />
Wahrheit nur einigermaßen nahekommen,<br />
dann war Jakob Hectors »frankophile<br />
Einstellung« schon recht bald nach dem verheerenden<br />
Weltkrieg im Saarlouiser Land allseits<br />
bekannt. Möglicherweise hat also der Weltkrieg<br />
selbst zu einem Gesinnungswandel beigetragen.<br />
Aber auch das muss vor dem Hintergrund des<br />
allgemeinen Szenarios eine fast schon kontrafaktische<br />
Spekulation bleiben. Denn erstens wissen<br />
wir nicht, ob – und wenn ja: in welcher Form<br />
– Hector überhaupt am Ersten Weltkrieg teilgenommen<br />
hat; im August 1914 war er bereits 42<br />
Jahre alt, damit allerdings prinzipiell noch wehrpflichtig.<br />
Zieht man die Protokolle der Stadtverordnetenversammlungen<br />
zu Rate, dann zeigt<br />
sich, dass Hector – nachdem er bis dahin nie<br />
gefehlt hatte – zwischen Juli 1914 und Herbst<br />
1915 nur zweimal an Sitzungen teilnahm und wie<br />
andere Kollegen während des Krieges des Öfteren<br />
absent war. Möglich also, dass er als Arzt<br />
jenseits der Front zeitweise gebraucht wurde,<br />
unwahrscheinlich hingegen, dass er selbst – wie<br />
das bei anderen manchmal vermerkt wurde –<br />
[3] Zur Entstehung von Nationalismus in Schulunterricht:<br />
Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte.<br />
Dritter Band: Von der »Deutschen Doppelrevolution« bis<br />
zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849–1914, München<br />
1995, S. 405ff.; 938-945; 1002ff.; zum Lloyd vgl. Reinhold<br />
Thiel. Die Geschichte des Norddeutschen Lloyd 1857–<br />
1970 in fünf Bänden. Band II, 1884–1899, Bremen 2002;<br />
Arnold Kludas, Die Seeschiffe des Norddeutschen Lloyd<br />
1920 bis 1970. Band 2, Herford 1992.<br />
fehlte, weil er »im Felde« [4] stand. Aber selbst<br />
wenn Hector im aktiven Einsatz gewesen wäre,<br />
hätte das nicht zwangsläufig »friedensstiftend«<br />
gewirkt, haben die grausamen Fronterfahrungen<br />
im Ersten Weltkrieg bekanntlich sogar eher dazu<br />
beigetragen, die feindlichen Gefühle zwischen<br />
Deutschen und Franzosen zu vergrößern, als sie<br />
abzubauen. Kluge und humanitär gesinnte Köpfe<br />
mochten damals, nach dieser »Urkatastrophe«,<br />
über neue Wege der Völkerverständigung nachdenken.<br />
Ohne allerdings die nationalen Prioritäten<br />
dabei aufzugeben. Die Visionen des durch<br />
und durch deutschen Sozialdemokraten Max<br />
Braun haben dafür im Saargebiet ein gutes Beispiel<br />
gegeben. Freilich glaubte Braun an ein<br />
runderneuertes Europa mit seinen revolutionierten<br />
Kernstaaten: einem (sozial)demokratisch<br />
gewandelten Deutschen Reich und einem Frankreich,<br />
in dem die imperialistisch-kapitalistischen<br />
Kräfte endlich aus der bereits existierenden<br />
Demokratie verschwunden sein würden. [5]<br />
[4] Schon vor der Mobilmachung, am 16. Juli 1914, fehlte<br />
Hector allerdings zum ersten Mal überhaupt. Die Frequenz<br />
der Versammlungen nahm während des Krieges<br />
nicht ab, die Zahl der abwesenden Verordneten lag jedoch<br />
oft zwischen fünf und zehn Personen. In den späteren<br />
Kriegsjahren wurden auch die entschuldigt und<br />
unentschuldigt fehlenden Verordneten notiert, zu letzteren<br />
gehörte Hector hie und da. (StA SLS, Beschlussbücher<br />
1913–1920, S. 197 u. 481 als Beispiele für differenzierte<br />
Anwesenheitslisten).<br />
[5] Zu Max Braun, seinen nationalen und frühen europäischen<br />
Vorstellungen vgl. ders., Unsere Hoffnungen und<br />
Ziele, in: Fritz Kloevekorn (Hg.), Das Saargebiet, seine<br />
Struktur, seine Probleme, Saarbrücken 1929, S. 549–555.<br />
Im alten Saarlouiser<br />
Rathaus (links, heute<br />
ist hier die Buchhandlung<br />
Bock &<br />
Seip) lenkte Jacob<br />
Hecor ein Jahr lang<br />
als kommissarischer<br />
Bürgermeister die<br />
Geschicke der Stadt<br />
Saarlouis. Im Haus<br />
Nr. 7 (rechts neben<br />
der Ludwigstraße;<br />
heute Gebäude der<br />
Sparkasse) befanden<br />
sich nach 1946 Wohnung<br />
und Praxis von<br />
Dr. Hector. (StA SLS,<br />
Sammlung Postkarten)
Beginn der<br />
Besatzungszeit: Franz.<br />
Truppen zu Fuß und<br />
zu Pferde haben mit<br />
Geschützen und<br />
Fahrzeugen am 23.<br />
November 18 auf dem<br />
Großen Markt Aufstellung<br />
genommen.<br />
(StA SLS, Bildersammlung)<br />
Zwischen Compiègne und Versailles<br />
Als die französischen Truppen wenige Tage nach<br />
dem Waffenstillstand im Saarland einzogen,<br />
schienen diese Bataillone eher den alten Kräften<br />
in Paris zu gehorchen. Obwohl mit Georges<br />
Clemenceaus ein linksbürgerlicher Politiker die<br />
Regierungsgeschäfte lenkte, blieben rechtskonservative<br />
Kräfte mit oder ohne Regierungsamt<br />
einflussreich, sie waren es vor allem auch,<br />
die auf einen harten Kurs gegenüber dem Kriegsverlierer<br />
Deutschland drängten. Ganz davon<br />
abgesehen spielten die Militärs aller Nationen<br />
ohnehin oft gerne nach eigenen, nicht unbedingt<br />
auf friedliche Völkerversöhnung zielenden Regeln,<br />
ein kalter Nachkrieg, der nicht selten auf Kosten<br />
der Bevölkerung ging. Im Saargebiet, dessen<br />
besondere Rolle in der Nachkriegsordnung sich<br />
bereits in den ersten Monaten des Waffenstillstands<br />
abzeichnete, gab es derartige Übergriffe<br />
auch. Freilich hielten sie sich bei genauerem Hinschauen<br />
doch in sehr viel zivilisierteren Grenzen,<br />
als es die Zeitgenossen empfunden haben mochten<br />
und als es der propagandistische Nachhall<br />
der zwanziger Jahre nach außen vermittelte.<br />
Was dem Konflikt seine besondere Schubkraft<br />
gab, was ihn nachhaltig mit negativer Energie<br />
auflud und die öffentliche Meinung mit den<br />
schlimmsten Phantasien konfrontierte, das war<br />
vor allem die nationale Frage. Oder präziser die<br />
Frage des Nationalgefühls, jenes eigentlich erst<br />
im 19. Jahrhundert entstandenen Sentiments,<br />
das umso explosiver wirkte, je mehr es in einer<br />
gleichsam physisch aggregierten Form daherkam.<br />
Also buchstäblich körperlich spürbar war<br />
und dementsprechend aus und mit der Natur des<br />
Menschen begründet werden konnte. »Was denn<br />
für Blut eigentlich in seinen Adern rollt«, fragte<br />
der Leitartikler in der Saar-Zeitung mit einer<br />
damals überhaupt nicht anders als rhetorisch zu<br />
verstehenden Frage an die Adresse eines Kollegen<br />
im frankophilen Saarlouiser Journal, »Internationales?«<br />
[6] Weil Nationalität über Fleisch<br />
und Blut definiert wurde, war es auch »natürlich«,<br />
dass man nur eine einzige nationale Identität<br />
haben konnte, und zwar diejenige, die einem<br />
angeboren war, deren Wahrung aufs engste mit<br />
der persönlichen Ehre zusammenhing und die es<br />
notfalls unter Einsatz von Leib und Leben zu verteidigen<br />
galt. Umgekehrt gab es in einer solchen<br />
Gedanken- und Gefühlswelt, in einer buchstäblich<br />
verkörperten Nationalität, viele Gefahren<br />
der Verunreinigung und Infizierung mit Fremdkörpern,<br />
die bis hin zu jener »Perversion« führen<br />
konnten, die eigene Nationalität in Frage zu stellen<br />
oder gar zu wechseln.<br />
Um nationale Identität, um deren ehrenhafte<br />
Verteidigung und die vielfältigen Gefahren,<br />
denen sie ausgesetzt war, ging es auch in der<br />
saarländischen Besatzungszeit 1918/19 – gerade<br />
im preußisch-französischen Saarlouis. Am<br />
21. November 1918, so erzählen es die Quellen<br />
im Weißbuch der Regierung von 1921, verließen<br />
die letzten deutschen Truppen Saarlouis, verabschiedet<br />
von den Einheimischen mit Blumen,<br />
Girlanden und Ehrenpforten. Wenige Stunden<br />
später standen schon die Soldaten des französischen<br />
Kriegsgewinners vor den Toren der Stadt,<br />
um hier jedoch alles andere als einen triumphalen<br />
Empfang bereitet zu bekommen. Nur wenige<br />
Einheimische seien auf den Straßen gewesen, ein<br />
einziger habe es gewagt, Vive la France zu rufen<br />
– und der sei deshalb, so behauptete zumindest<br />
die vox populi später, verprügelt worden. Das<br />
Spiel um die Wahrung der nationalen Ehre, die es<br />
umso mehr aufrecht zu erhalten galt, als man um<br />
den militärischen Sieg scheinbar betrogen worden<br />
war, ging am nächsten Tag weiter. Der von<br />
den Franzosen geforderte Empfang von General<br />
Lecomte am Saarlouiser Stadttor durch Bürgermeister<br />
und Stadtverordnete wurde jedenfalls<br />
verweigert, mit der bauernschlauen Begründung,<br />
dass man auch preußischen Militärs niemals derart<br />
entgegen gekommen sei. Im Gobelinsaal des<br />
Rathauses standen Bürgermeister Dr. Peter Gilles,<br />
der an diesem Tag in sein Amt eingeführt worden<br />
war (nachdem tags zuvor die Amtszeit von<br />
Dr. Karl-August Kohlen abgelaufen war) sowie<br />
die Beigeordneten später aber doch zum Rencontre<br />
mit dem General bereit. Der sprach zwar<br />
demonstrativ von den ungezählten »Schandtaten<br />
der Deutschen« im vergangenen Krieg,<br />
[6] Saarlouis in Wahrheit – nicht Dichtung, in: Saar-Zeitung<br />
Nr. 83 v. 12. April 20, S.1.
saargeschichte|n 21<br />
zeigte ansonsten aber viel Entgegenkommen,<br />
das die Saarlouiser Stadtväter mit der Versicherung<br />
des loyalen Verhaltens ihrer Kommune<br />
erwiderten. Der friedliche Neuanfang lief also gar<br />
nicht so schlecht, wenngleich die Saarlouiser Bürger<br />
auf den Straßen der Stadt den neuen Machthabern<br />
eher die kalte Schulter zeigten. [7]<br />
Um die Jahreswende 1918/19 wurden verschiedene<br />
Sollbruchstellen in der vermeintlich<br />
festgefügten »deutschen Front« des Saarlouiser<br />
Landes immer deutlicher. Das hatte<br />
zum einen seine historischen beziehungsweise<br />
grenzüberschreitenden Gründe, wenn zum Beispiel<br />
einige Familien sich ihrer französischen<br />
Herkunft beziehungsweise des französischen<br />
Ursprungs der Stadt Saarlouis erinnerten oder<br />
auch deutsche Bewohner mit ehemals lothringischem<br />
Wohnsitz und guten (wirtschaftlichen)<br />
Beziehungen zur Grande Nation die Nähe der<br />
Militärverwaltung suchten. Das hatte zum anderen<br />
damit zu tun, dass diese Militärverwaltung<br />
nun auf offiziellen und inoffiziellen Wegen, mal<br />
mit Zuckerbrot, mal mit Peitsche, versuchte, die<br />
Saarlouiser Bevölkerung auf einen Kurs heim ins<br />
Frank-Reich zu bringen. Ob das kurzfristig auf<br />
dem Weg der Annexion oder mittelfristig durch<br />
das Votum der Saarländer selbst geschehen<br />
sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch offen, war<br />
außerdem eine Frage, deren international und<br />
friedensvertraglich geregelte Sanktionierung<br />
ja noch ausstand. Und so lange noch nicht klar<br />
war, in welche nationale Zukunft das Land gehen<br />
würde, war vieles möglich, sowohl bei den französischen<br />
Machthabern wie bei den Bürgern von<br />
Saarlouis.<br />
Es ist schwer zu sagen, ob und inwieweit die<br />
profranzösischen Aktivitäten dieser Übergangszeit<br />
von oben gesteuert wurden oder auf die<br />
persönlichen Initiativen frankophiler Persönlich-<br />
[7] Das Saargebiet unter der Herrschaft des Waffenstillstandsabkommens<br />
und des Vertrags von Versailles. Als<br />
Weißbuch von der deutschen Regierung dem Reichstag<br />
vorgelegt, Berlin 1921, hier die Nr. 3, S. 19–21. Die Amtseinführung<br />
von Gilles nach StA SLS, Beschlussbuch der<br />
Stadtverordnetenversammlung 1913–1920, S. 483ff.<br />
keiten vor Ort zurückgingen.<br />
Nicht selten wird beides<br />
zusammen gewirkt haben,<br />
wie es sich besonders bei<br />
der Familie Fabvier nachvollziehen<br />
lässt, deren Name<br />
uns im Zusammenhang<br />
mit der frankophilen Agitation<br />
der ersten Nachkriegsjahre<br />
immer wieder begegnet. Das sogenannte<br />
schwarze Schloss, ein ursprünglich den Villeroys<br />
gehörendes Wallerfanger Rittergut, bewohnten<br />
die Fabviers seit dem 19. Jahrhundert, sie waren<br />
im Saarlouiser Land von gewissem Einfluss und<br />
griffen seit 1918 in Person des Leutnants Fabvier<br />
als französische Militärverwalter aktiv ins<br />
Geschehen ein. Das war auch im Rahmen jener<br />
konzertierten Aktionen der Fall, mit denen man<br />
Saarlouis und Umgebung Anfang 1919 auf einen<br />
antipreußischen und profranzösischen Kurs zu<br />
bringen gedachte. Aufrufe zum Boykott der Wahlen<br />
zur Nationalversammlung, Unterschriftenlisten<br />
für den Anschluss des Kreises Saarlouis an<br />
Frankreich, Anträge auf Erhalt der französischen<br />
Staatsbürgerschaft, diese allgemeinen und viele<br />
individuellen Maßnahmen gehörten ins Portfolio<br />
der aktiven Frankreichstrategie der Jahre<br />
nach 1918. Argumentativ unterfüttert wurden<br />
diese Initiativen stets mit historischen, rechtlichen,<br />
politischen und ökonomischen Gründen:<br />
mit dem französischen Ursprung Saarlouis’, mit<br />
dem »widerrechtlichen Raub« von 1815, mit der<br />
preußischen Unterdrückung des katholisch-französischen<br />
Landkreises, nicht zuletzt mit den düsteren<br />
wirtschaftlichen Perspektiven, die im Fall<br />
eines Verbleibs im Deutschen Reich drohten.<br />
Quantitativ betrachtet fand die französische<br />
Werbung im Saarlouiser Landkreis nur einen<br />
ziemlich bescheidenen Widerhall. Gleichwohl<br />
stieg die Unruhe mit der Ungewissheit<br />
über die eigene Zukunft; sie wurde zudem<br />
befeuert von der dramatischen Zuspitzung bei<br />
den Saarverhandlungen von Versailles. Frankreichs<br />
Annexionsansprüche und Wilsons Selbstbestimmungsvision<br />
waren hier ziemlich schroff<br />
aufeinandergeprallt und konnten erst nach harten<br />
Kontroversen in eine Kompromisslösung<br />
gegossen werden.<br />
Clemenceaus Diktum von den angeblich 150.000<br />
im Saargebiet lebenden Franzosen hallte lange<br />
nach, bot vor allem in den ersten Monaten des Jahres<br />
1919 den Hintergrund für die gesteigerten Agitationen<br />
im französischen Saarlouis. Ob sie nun<br />
als gesamtsaarländische Nachkommenschaft<br />
der »ursprünglichen« Saarfranzosen gedacht<br />
Im »Schwarzen<br />
Schloss« in Wallerfangen<br />
lebte die<br />
franz. Familie Fabvier<br />
seit dem 19.<br />
Jahrhundert. Das<br />
Bild aus den 1920er<br />
Jahren zeigt das<br />
Anwesen in marodem<br />
Zustand.<br />
(LA SB, Bildersammlung)
Im Mittelpunkt des<br />
Großen Marktes, der<br />
seinerseits das Zentrum<br />
der Stadt des<br />
Sonnenkönigs war,<br />
stand die französische<br />
Militärkommandatur.<br />
Der Stich aus dem 19.<br />
Jahrhundert zeigt den<br />
alten Paradeplatz zu<br />
einem Zeitpunkt, als<br />
er bereits in preußische<br />
Herrschaft übergegangen<br />
war. (LA SB,<br />
Bildersammlung)<br />
wurden oder ob man sie mit den Bewohnern<br />
des Landkreises identifizierte, jedenfalls ergab es<br />
durchaus einen Sinn, wenn man entsprechende<br />
Bekenntnisse für die Pariser Politik ausgerechnet<br />
in Saarlouis suchte. Denn hier konnte man auf<br />
gewisse historische Fakten verweisen, hier konnte<br />
der Wunsch nach Angliederung an Frankreich<br />
zumindest einigermaßen glaubhaft als Ausübung<br />
des Selbstbestimmungsrechtes interpretiert<br />
werden. [8]<br />
Von März bis Mai 1919, während in Versailles<br />
die kontroversen Verhandlungen und die<br />
schwierigen Entscheidungen über die Saarfrage<br />
anstanden, spitzte sich die Lage in Saarlouis<br />
dramatisch zu. Auf der einen Seite erhöhte<br />
die Militärkommandantur erheblich den Druck,<br />
forderte Loyalitätsbekundungen ein, nahm<br />
Einfluss auf die Berichterstattung der Presse,<br />
behauptete öffentlich, dass die Entscheidung<br />
für eine französische Zukunft Saarlouis’ bereits<br />
gefallen sei, wollte einen vorgesehenen Empfang<br />
für Marschall Foch so gestaltet wissen, dass<br />
Saarlouiser Kinder Blumen überbrächten und<br />
Gedichte aufsagten, während ein Chor von Einheimischen<br />
die Marseillaise singen sollte. Auf<br />
der anderen Seite begegneten Parteien, Verbände<br />
und Verwaltungen den französischen<br />
Herausforderungen mit Bekenntnissen ihres<br />
[8] Zu den Saarverhandlungen auf der Friedenskonferenz<br />
vgl. Helmut Hirsch, Die Saar in Versailles. Die Saarfrage<br />
auf der Friedenskonferenz von 1919, Bonn 1952; jetzt<br />
auch die Einordnung im Rahmen des gesamten Friedensprozesses:<br />
Saarland und Fiume, Schantung und<br />
Kleinasien. Die Krise der Konferenz im April 1919, in: Jörn<br />
Leonhard, Der überforderte Frieden. Versailles und die<br />
Welt 1918–1923, München 2018, S. 819–837.<br />
Deutschtums. So etwa in einer Kundgebung am<br />
7. März, in dem der »unabänderliche Willen der<br />
Bevölkerung, am deutschen Vaterland festzuhalten«<br />
artikuliert wurde. »Weder die zwangsweise<br />
Einführung des französischen Unterrichts<br />
in allen Schulen, weder die Zusicherung finanzieller<br />
und wirtschaftlicher Vorteile, weder die<br />
französischerseits veranstalteten Propagandaversammlungen<br />
und Werbungen, weder die<br />
gewaltsame Unterdrückung von Äußerungen<br />
deutscher Gesinnung, noch die Knebelung<br />
unserer Presse (…) werden uns in unserer<br />
Anhänglichkeit und Treue gegen das Deutsche<br />
Reich wankend und zum Anschluß an Frankreich<br />
zu bewegen vermögen.« Ein Bekenntnis, das der<br />
Kreistag von Saarlouis gut drei Wochen später<br />
»in der jetzigen Schicksalsstunde« mit ähnlichen<br />
Worten bekräftigte. [9]<br />
Der spektakuläre Höhepunkt der Kontroverse<br />
um die nationale Frage von Saarlouis hatte allerdings<br />
bereits zwei Wochen zuvor in und um das<br />
Rathaus der Kreisstadt stattgefunden. Am 14.<br />
März war Major Delévaque, Adjutant des Stadtkommandanten<br />
Poulet, bei Bürgermeister Gilles<br />
erschienen. Er behauptete, dass Saarlouis faktisch<br />
bereits französisch sei, dass Marschall Foch kommen<br />
würde, um die entsprechende Proklamation<br />
zu vollziehen, und fragte das Stadtoberhaupt,<br />
was die Stadt in diesem Fall zu tun gedenke. Gilles<br />
erwiderte, dass er diese Frage nur nach Konsultation<br />
mit dem Stadtrat beantworten könne,<br />
der Adjutant stimmte zu und sagte sein persönliches<br />
Kommen zur Entgegennahme dieser Antwort<br />
in der Stadtverordnetenversammlung am<br />
[9] Weißbuch (wie Anm. 7), Nr. 9, S.31f.; die Kundgebung des<br />
Kreistages vom 31. März in Nr. 16, S. 40.
saargeschichte|n 23<br />
17. März zu. In den Tagen dazwischen<br />
tagte das städtische Kollegium drei<br />
Mal, um eine entsprechende Resolution<br />
zu verabschieden. Keine leichte<br />
Aufgabe, zumal es auch innerhalb des<br />
Rates disparate Meinungen dazu gab.<br />
Nachdem ein diplomatisch ziemlich<br />
geschickter Entwurf gefunden war,<br />
der sowohl der Größe der französischen<br />
Nation huldigte als auch, daraus<br />
abgeleitet, eine Lanze für das<br />
(deutsche) Selbstbestimmungsrecht<br />
der Saarlouiser brach, fiel der Showdown<br />
im letzten Moment doch aus. Oberst<br />
Poulet verbot die von ihm nicht genehmigte<br />
Stadtverordnetenversammlung und rügte das<br />
eigenmächtige Vorgehen seines Adjutanten.<br />
Hunderte Saarlouiser Bürger, die sich auf dem<br />
Markt vor dem Rathaus versammelt hatten, ließen<br />
daraufhin vielfache Hurra-Rufe hören und<br />
sangen Deutschland, Deutschland über alles. [10]<br />
Der nur knapp verhinderte Eklat und die eindeutige<br />
Positionierung der Saarlouiser Stadtväter<br />
hatten Konsequenzen politischer und<br />
persönlicher Art. General Andlauer, seit dem 24.<br />
Januar Chef der französischen Militärverwaltung<br />
im Saargebiet, erschien an mehreren Tagen in der<br />
Stadt, um sich in persönlichen Gesprächen ein<br />
Bild von der Lage zu machen. Adjutant Delévaque<br />
und sein Helfer, Leutnant Collong, wurden sofort<br />
von ihren Aufgaben entbunden, später auch der<br />
Stadtkommandant Poulet. Bürgermeister und<br />
Landrat von Saarlouis, die beiden ranghöchsten<br />
Saarlouiser in diesem Drama, sollten zwei Monate<br />
später ebenfalls ihr Amt verlieren: Wiewohl bis<br />
zum Mai noch einige schwerwiegende Konflikte<br />
gefolgt waren, dürfte seit dem neuralgischen<br />
Märztag ihr Weg ins politische Abseits vor-<br />
[10] A.a.O., S. 32.<br />
gezeichnet gewesen sein. Auf<br />
der anderen Seite begann an diesem Tag vermutlich<br />
der politische Aufstieg jenes Mannes,<br />
der mit der Resolution seiner deutschen Stadtratskollegen<br />
vom 17. März nicht so ganz einverstanden<br />
gewesen war.<br />
Dr. Hector oder: wie er gelernt haben könnte,<br />
den Erbfeind zu lieben<br />
Wann und wo ist der Funke übergesprungen?<br />
Wie kam es, dass Jakob Hector nach einer eindeutig<br />
preußischen Sozialisation und in einem<br />
Nachkriegsklima, das im Saarlouiser Land ein<br />
kerndeutsches Bekenntnis fast gebieterisch verlangte,<br />
mit französischen Stellen zu kooperieren<br />
begann? Waren es persönliche Erlebnisse als Arzt<br />
während des Weltkrieges gewesen, die ihn frankreichfreundlich<br />
stimmten? Brachte ihn, ähnlich<br />
wie den aus Saarlouis stammenden Geheimrat<br />
Muth zur gleichen Zeit, sein tiefer Katholizismus<br />
dazu, im Vergleich mit dem protestantischen<br />
Preußen die Vorzüge des katholischen Frankreich<br />
zu entdecken? Immerhin stammte Jakob<br />
aus einer strenggläubigen Familie, immerhin war<br />
er selbst Präsident katholischer Studentenverbindungen<br />
gewesen, immerhin hatten sich einige<br />
Kreise im katholischen Saarlouis schon lange<br />
General Andlauer,<br />
Chef<br />
der französischen<br />
Militärregierung<br />
an<br />
der Saar seit Januar<br />
1919, war ursprünglich<br />
als Präsident<br />
der Regierungskommission<br />
im<br />
Gespräch und blieb<br />
dem Saarland lange<br />
verbunden. Die Aufnahme<br />
zeigt Andlauer<br />
zusammen<br />
mit dem französischen<br />
Außenminister<br />
Bidault bei einem<br />
Festakt auf Schloss<br />
Halberg am 20.<br />
Dezember 1952. (LA<br />
SB, Sammlung NPress<br />
Act)<br />
Gedruckte Proklamation<br />
General<br />
Andlauers vom 20.<br />
April 1919 (LA SB,<br />
Plakatsammlung)
Das »neue« Landratsamt<br />
am Kaiser-<br />
Friedrich-Ring war<br />
ein Epizentrum<br />
preußisch-deutscher<br />
Nationalkultur – auch<br />
während der Auseinandersetzungen<br />
um die Zukunft<br />
Saarlouis‘ nach dem<br />
Ersten Weltkrieg.<br />
(StA SLS, Postkartensammlung)<br />
gegen die Bevormundung durch das protestantische<br />
Saarbrücken gewehrt. Hatte der bestens<br />
vernetzte »Stadtarzt« Hector im Laufe seiner (bis<br />
dahin) fast zwanzig Saarlouiser Jahre besondere<br />
Beziehungen zu französischen und frankophilen<br />
Familien der Region aufgebaut? Oder nutzte er<br />
einfach »nur« die Gunst der Stunde, um einen<br />
ihm notwendig erscheinenden Politikwechsel<br />
einleiten zu können und dabei selbst an die Spitze<br />
der Stadt vorzurücken? [11]<br />
Dass »die Ursachen des Falles Hector (…) nichts als<br />
die verständlich menschliche Schwäche des biederen<br />
praktischen Landarztes (waren), einmal aus<br />
der Enge des täglichen ärztlichen Einerlei herauszukommen,<br />
ins Rampenlicht der Öffentlichkeit<br />
zu rücken und eine politische Rolle zu spielen«,<br />
das scheint aber dann doch viel zu kurz und zu<br />
pejorativ gegriffen. Namentlich dokumentiert<br />
tritt Hector erstmals im Zusammenhang mit<br />
der eben zitierten Note der Stadtverordneten<br />
vom 17. März 1919 als »frankophiler« Politiker in<br />
Erscheinung. Neben dem jüdischen Kaufmann<br />
Henry Cahn, so wird es im »amtlichen Bericht«<br />
[11] Tatsächlich könnte der Katholizismus bei frankophilen<br />
Bestrebungen der Nachkriegszeit eine größere Rolle<br />
gespielt haben, als das meist gesehen wird. Geheimrat<br />
Johann Peter Muth hatte im Frühsommer 1919 bereits<br />
ein entsprechendes Schreiben nach Paris gesandt,<br />
in dem die Segnungen französischer Politik seit der<br />
Zeit Ludwig XIV. aufgezählt und den »Unterdrückungen«<br />
durch das protestantische Preußen gegenübergestellt<br />
wurden. Muth war als Bürger von Saarlouis im<br />
August 1870 aus seiner Heimatstadt ausgewiesen worden,<br />
weil er mit seiner Verwandtschaft zuvor an einer<br />
Marschall-Ney-Feier teilgenommen hatte. Im Juni 1919<br />
unterzeichneten die führenden Zentrumsfunktionäre<br />
von der Saar ein Schreiben, in dem dafür plädiert wurde,<br />
Muth zum saarländischen Mitglied der künftigen<br />
Regierungskommission zu küren. Vgl. dazu: Dokumente<br />
zur Zeitgeschichte des Saarreviers, in: SZ v. 18. April<br />
1920 sowie als Replik darauf : Veröffentlichung von Dokumenten,<br />
in: Saarzeitung v. 20. April 1920.<br />
festgehalten, sei er der einzige aus dem Kreis von<br />
25 Ratsherren gewesen, der zunächst gegen das<br />
Papier gestimmt hatte, bei der Endfassung dann<br />
aber doch zur einstimmigen Geschlossenheit des<br />
Stadtrates beitrug. [12]<br />
In den Wochen danach wurde das Klima der<br />
nationalen Konfrontation noch rauer, trotz der<br />
bereits erwähnten Ablösung der Saarlouiser<br />
Militärkommandanten. Während in Versailles<br />
die Saarfrage auf des Messers Schneide stand,<br />
begann auf den Saargruben eine weitere große<br />
Streikwelle, es ging um Lohnfragen und Arbeitszeit.<br />
Die Militärverwaltung ließ die Bergleute<br />
requirieren, erklärte den Belagerungszustand,<br />
wies schließlich Anfang April über 400 Streikende<br />
aus, darunter etwa 100 aus dem Landkreis<br />
Saarlouis. Und in der Kreisstadt selbst ging<br />
es weiter mit einer Politik der Nadelstiche, diesmal<br />
mit überaus symbolträchtigen Angriffen auf<br />
das Kulturgut der Stadt. Die 18 Gobelinstühle<br />
aus der Zeit Ludwigs XIV. ließ der neue Kommandant<br />
de Job requirieren, einige Tage später<br />
sogar die Wandbehänge aus Gobelin im Rathaus<br />
abmontieren, außerdem sollten ein Schrein<br />
mit Medaillons sowie das Stadtarchiv mit alten<br />
Bildern und Urkunden in die Hände der Franzosen<br />
übergehen. Mit Gobelinstühlen und Wandbehängen<br />
war das beschlagnahmt worden,<br />
was die Stadt »1/4 Jahrtausend als ihren wertvollsten<br />
Schatz gehütet und geschätzt« hatte. [13]<br />
So jedenfalls bezeichnete es Bürgermeister Gilles,<br />
der die Wegnahme nur unter scharfem Protest<br />
zuließ, die die Deutsche Waffenstillstandskommission<br />
darüber benachrichtigte, worauf<br />
diese eine offizielle Protestnote bei der interalliierten<br />
Kommission einreichte.<br />
[12] Undatiertes und unbenamtes Schreiben, in: LA SB, NL<br />
Schneider 239; Weißbuch Nr. 14, S.38. Interessanterweise<br />
sind die entsprechenden Passagen über diese Dissonanz<br />
in der Stadtversammlung nicht in den Beschlussbüchern<br />
festgehalten.<br />
[13] Weißbuch Nr. 17, S. 42.
saargeschichte|n 25<br />
Sechs der damals insgesamt<br />
18 Gobelinsessel<br />
aus dem<br />
Saarlouiser Rathaus,<br />
die als eine Folge<br />
der gescheiterten<br />
Frankreichpolitik der<br />
Besatzungszeit für<br />
eine Weile aus der<br />
Stadt verschwanden<br />
waren. Die Aufnahme<br />
stammt aus der Zeit<br />
vor dem Ersten Weltkrieg.<br />
(LA SB, Bildersammlung<br />
HV)<br />
Die Beschlagnahmung der kostbaren Kulturgüter<br />
aus der französischen Gründungszeit von<br />
Saarlouis war eine in ihrer Deutlichkeit kaum zu<br />
überhörende politische Botschaft. Nachdem sich<br />
Bewohner und Offizielle der Stadt zuvor mit vielen<br />
kerndeutschen Worten stets gegen die französischen<br />
Werbungen gewehrt hatten, nachdem<br />
in Versailles über die nationale Zukunft des Landkreises<br />
de facto bereits entschieden war, zeigten<br />
die Militärs vor Ort, dass die Saarlouiser dann<br />
künftig auch nicht mehr mit der besonderen<br />
Unterstützung aus Paris zu rechnen hatten. Das<br />
war genau der Zeitpunkt, zu dem sich der Stadtverordnete<br />
Hector offenbar genötigt sah, aktiv zu<br />
werden und für eine neue Stadtpolitik einzutreten.<br />
Am 16. April, einen Tag nach der Konfiszierung der<br />
Gobelinstühle, erschien er bei Bürgermeister Gilles<br />
»und erklärte ihm, es sei an der Zeit, die von<br />
der Stadt zu vertretende Politik endlich anders<br />
zu orientieren. Er habe den Eindruck, daß nach<br />
den Vorgängen vom 17. März das Verhältnis zwischen<br />
Besatzung und Stadt getrübt sei.« Da Hector<br />
die unmittelbare Zukunft seiner Stadt noch<br />
für offen hielt, meinte er sogar, dass im deutschen<br />
Saarlouis noch starke Erinnerungen an die<br />
französische Zeit herrschten und dass, falls die<br />
Stadt an Frankreich fallen sollte, in 10 bis 15 Jahren<br />
niemand mehr merken würde, dass die Kommune<br />
einmal deutsch gewesen sei. Schließlich<br />
verlautbarte er gegenüber Bürgermeister Gilles<br />
sogar »die Überzeugung, daß Sie zum Nachteil<br />
von Saarlouis die Stadt regieren«. [14]<br />
Solche Worte waren im April 1919 natürlich ziemlich<br />
starker Tobak – sowohl, was den Frontalangriff<br />
gegen das Stadtoberhaupt betraf, als auch<br />
und vor allem hinsichtlich der Gewissheit, die<br />
preußisch-deutschen Nationalfarben von Saarlouis<br />
problemlos wieder gegen die blau-weißroten<br />
zurücktauschen zu können. In den darauffolgenden<br />
Tagen forcierte Hector sogar noch<br />
seinen politischen »Borderline«-Kurs, wollte bei<br />
Gilles die Einrichtung einer städtischen Kommission<br />
erreichen, die in Versailles antichambrieren<br />
sollte, um für alle der drei möglichen Zukunftsfälle<br />
von Saarlouis gewappnet zu sein. Im Fall<br />
der Rückkehr zu Frankreich sollte die Saarlouiser<br />
Abordnung die größtmögliche Unterstützung für<br />
die Stadt in Paris erwirken, im Falle der Neutralität<br />
für einen Anschluss an Frankreich werben (weil<br />
sonst Saarlouis binnen 15 Jahren wirtschaftlich<br />
ruiniert sei), im Falle des Verbleibs bei Deutschland<br />
gar nichts tun müssen. Die Beigeordneten<br />
der Stadt und ihr Bürgermeister waren, wie nicht<br />
anders zu erwarten, gegen die politische Strategie<br />
des Jakob Hector. Der sich daraufhin, so<br />
erzählt es der amtliche Bericht, »frostig« aus dem<br />
Rathaus entfernt habe. [15]<br />
Die plötzliche Vorliebe des Dr. Hector scheint<br />
ungeachtet aller zeitgenössischen und historischen<br />
Unkenrufe eher einer pragmatischen Einsicht<br />
in Notwendigkeiten und Möglichkeiten<br />
der Stadtpolitik als einem quasi libertären<br />
Umgang mit nationalen Gefühlen geschuldet<br />
gewesen zu sein. Trotz aller auch unter französischer<br />
Militärherrschaft riskant bleibender<br />
Exponierung in der nationalen Frage respektierte<br />
Hector in letzter Konsequenz eben doch<br />
die deutsche Staatsräson von Saarlouis, wollte<br />
sich ebenso selbstverständlich dem schicksalshaften<br />
Urteil von Versailles fügen, suchte nicht<br />
bedingungslos den Anschluss an Frankreich,<br />
trat auch bei den vielen Bemühungen franko-<br />
[14] Weißbuch Nr. 18, S. 44.<br />
[15] ebda.
Die Karte vom Cours<br />
de la Sarre von 1703<br />
zeigt die französische<br />
Saarprovinz mit ihrer<br />
»Hauptstadt«, der<br />
Festungsstadt Saarlouis<br />
(LA SB, Kartensammlung<br />
Hellwig)<br />
philer Kräfte bis zum Frühjahr 1919 nie namentlich<br />
in Erscheinung. Nicht einmal nach der<br />
Abfuhr, die er sich bei Bürgermeister Gilles und<br />
den Beigeordneten geholt hatte: Die Saarlouiser<br />
Abordnung, die am 19. April für eine Woche mit<br />
Unterstützung der Militärregierung nach Paris<br />
reiste, tat dies ohne den sich immer deutlicher<br />
Frankreich nähernden Arzt vom Großen Markt. [16]<br />
Dass diese Annäherung in einem reziproken Verhältnis<br />
zur Distanzierung von Gilles’ »deutschem«<br />
Konfrontationskurs (so dürfte ihn jedenfalls Hector<br />
gedeutet haben) geschah, ist mehr als wahrscheinlich.<br />
Ebenso wie die nicht durch Quellen zu<br />
stützende Vermutung, dass Hector bei der zweiten<br />
Saarlouiser Delegationsreise nach Paris, die<br />
nur wenige Tage nach der ersten stattfand, mit<br />
an Bord gewesen sein könnte.<br />
Jedenfalls kam es genau nach diesem zweiten<br />
Saarlouiser Bittgang gen Süden zu einem von<br />
Frankreich gewünschten Machtwechsel im Rathaus.<br />
Am 28. April hatte Dr. Gilles noch seine<br />
Protestnote gegen die Requierierung der Wandbehänge<br />
und eine entsprechende Eingabe an die<br />
deutsche Delegation in Versailles unterschrieben,<br />
wenige Tage später war er bereits abgesetzt und<br />
durch Dr. Hector kommissarisch ersetzt worden.<br />
Am 12. Mai wurde er gar gemeinsam mit<br />
dem Saarlouiser Landrat ins Rechtsrheinische<br />
ausgewiesen, folgte damit einigen unbeliebt<br />
[16] Weißbuch Nr. 19, S. 45f. Allerdings wird ebda., Anm. 2,<br />
auch erläutert, dass man sich bei einer Vorbesprechung<br />
dieser Reise darauf geeinigt hatte, dass nach den Vorkommnissen<br />
des 17. März kein Stadtverordneter unter<br />
den Delegierten sein solle.<br />
gewordenen Mitbürgern, die schon eine Woche<br />
zuvor die Reise ins unfreiwillige Exil hatten<br />
antreten müssen. Wie sehr der neue Bürgermeister<br />
Hector die Unterstützung Frankreichs<br />
besaß, wurde spätestens am nächsten Tag ganz<br />
klar. Am 13. Mai nämlich wurde er auch offiziell<br />
vom Stadtrat zum neuen Stadtoberhaupt<br />
gewählt, nachdem der in der Sitzung anwesende<br />
Leutnant Fabvier zuvor erklärt hatte, dass General<br />
Andlauer wünsche, dass Hector in dieses Amt<br />
gewählt würde. 20 von 22 anwesenden Stadtverordneten<br />
folgten diesem »Wunsch« und der<br />
gebürtige Saarlouiser Fabvier sprach danach<br />
seine Hoffnung aus, dass nun in der Stadt wieder<br />
mehr Ruhe einkehren möge. Jakob Hector nahm<br />
das Ergebnis der geheimen Abstimmung dankbar<br />
an. [17]<br />
Das gute Jahr, das Hector als Saarlouiser Bürgermeister<br />
verbrachte, war nicht gerade eines, in<br />
dem man die Stadt vom Ruhekissen aus regieren<br />
konnte. Erst recht nicht dann, wenn man wie Hector<br />
weiterhin auch seinem bürgerlichen Beruf als<br />
praktischer Arzt nachging. Da waren zum einen,<br />
wie die überlieferten Protokolle und Berichte<br />
von den Stadtverordnetenversammlungen ausweisen,<br />
die vielen elementaren Probleme, die die<br />
Kommune nach dem langen Krieg zu bewältigen<br />
hatte. Lebensmittelknappheit, Wohnungsnot,<br />
die mangelhaften Verhältnisse von Straßen und<br />
Infrastruktur, die Not der Gewerbetreibenden,<br />
verschärft durch die Folgen von Streiks und<br />
[17] Weißbuch Nr. 24, S.49. Dieser Bericht entspricht dem<br />
Protokoll der Stadtverordnetenversammlung vom 13.<br />
Mai 19, vgl. Beschlussbuch 1913–1920, S. 540ff.
saargeschichte|n 27<br />
Teuerungskrise, schließlich auch noch ein Hochwasser<br />
im Januar 1920, das Teile der Stadt regelrecht<br />
absaufen ließ. Nicht zu vergessen die<br />
Umstellung auf Friedenswirtschaft und -politik,<br />
was erst im Frühjahr 1920 erreicht wurde,<br />
nachdem die Militärregierung auf Kreis- und<br />
Kommunalebene ihre Verwaltung aufgegeben<br />
hatte. Über all dem schwebte die große nationale<br />
Frage, die Hector offenbar stets in sozio-ökonomischer,<br />
in landes- und kommunalpolitischer<br />
Perspektive begriff. Und von der er daher glaubte,<br />
dass sie zum Wohle seiner Stadt am besten gelöst<br />
wäre, wenn sie im engen Schulterschluss mit<br />
dem französischen »Heimatland« von Saarlouis<br />
realisiert würde. In diesem Fall, so dachte Hector<br />
wohl tatsächlich, könnte es sogar gelingen, die<br />
Vorherrschaft des preußisch-protestantischen<br />
Saarbrücken zu beenden und Saarlouis von der<br />
heimlichen zur wirklichen Hauptstadt der neuen<br />
Saar-Lande zu machen.<br />
In Saarlouiser Optik ergab ein nationaler Salto<br />
rückwärts in die französische Vergangenheit<br />
genau deshalb einen Sinn, weil die erhoffte kapitale<br />
Zukunft so in der Geschichte ihre Legitimation<br />
erhielt: Schließlich war Saarlouis ja schon<br />
zwischen 1680 und 1815 die »Hauptstadt« eines<br />
französisch dominierten Saarraumes gewesen.<br />
Exakt auf dieser Basis argumentierte auch eine<br />
Denkschrift sowie ein Begleitschreiben, die Hector<br />
wenige Wochen nach seinem Amtsantritt auf<br />
den Weg nach Paris bringen ließ. »Diese Stadt«,<br />
so heißt es in dem Schreiben vom 24. Juli 1919,<br />
»die nach Absicht ihres Gründers die gegebene<br />
Hauptstadt der Saarprovinz war, steht Gefahr,<br />
durch die unbestreitbar preußische Stadt Saarbrücken<br />
aus ihren Rechten verdrängt zu werden.«<br />
Deswegen baten Bürgermeister und Stadtverordnete<br />
in der Denkschrift die »hohe Regierung«<br />
– Adressat war die damals erst noch zu schaffende<br />
Regierungskommission – »Saarlouis zum<br />
Sitz des Regierungsausschusses und des obersten<br />
Gerichtshofes des neuen Saarstaates zu<br />
machen.« Außerdem wünschten die Saarlouiser,<br />
auch Bischofssitz, (französische) Garnisonsstadt,<br />
Verkehrsknotenpunkt und schließlich Sitz einer<br />
neu zu errichtenden technischen Fach(hoch)<br />
schule zu werden. Wäre all dies wie von Hector<br />
1920 gewünscht Realität geworden,<br />
würde wahrscheinlich auch das Saarland<br />
von heute ein anderes Gesicht<br />
haben. [18]<br />
Es war also nicht gerade wenig, was<br />
man sich da an der mittleren Saar für<br />
die staatliche Zukunft mit der wohlwollenden<br />
Unterstützung aus Paris<br />
erhoffte. Um der Sache den nötigen Nachdruck<br />
zu verleihen, wurde deshalb auch die Übergabe<br />
der Denkschrift in Versailles beziehungsweise<br />
Paris zur Chefsache erklärt. Hector stand selbst<br />
an der Spitze einer kleinen Saarlouiser Delegation,<br />
um Premierminister Clemenceau und seinem<br />
engsten Mitarbeiter auf der Friedenskonferenz,<br />
André Tardieu, am 1. August 1919 persönlich die<br />
Wünsche der Stadt Louis’ XIV. darzulegen. [19]<br />
Die Eisenbahnfrage, die auf der Saarlouiser Agenda<br />
nicht zuletzt wegen der gewünschten Direkt-<br />
[18] Das Begleitschreiben zitiert nach: N.N., Prozeß Dr. Hector<br />
gegen die »Saarbrücker Zeitung«, in: SZ v. 23. März<br />
23; ein gedrucktes Exemplar der Saarlouiser Denkschrift<br />
(»Die Zukunft der Stadt Saarlouis«) in: LA SB, NL<br />
Schneider 239.<br />
[19] Nach Schu, Chronik (wie Anm. 1) , S. 109, verweigerten<br />
die (meisten) Stadtverordneten dem Bürgermeister die<br />
Begleitung anlässlich der Übergabe in Paris. Das deutet<br />
bereits auf das Zerwürfnis zwischen Versammlung<br />
und Hector hin, das im Prozess von 1923 dann in aller<br />
Öffentlichkeit dargelegt wurde.<br />
Ausweisung von Saarländern<br />
durch die<br />
französische Militärverwaltung,<br />
hier in<br />
Sulzbach im Sommer<br />
1919. (LA SB, BSlg HV)<br />
Der französische<br />
Premier- und Kriegsministers<br />
Georges<br />
Clemenceaus, Widerpart<br />
des amerikanischen<br />
Präsidenten<br />
Wilson auf der Versailler<br />
Konferenz, ist<br />
mit seinem Diktum<br />
von den »150.00<br />
Saarfranzosen« auch<br />
in die saarländische<br />
Geschichte eingegangen.<br />
(wiki commons)
verbindung nach Paris einen besonderen Platz<br />
einnahm, wurde auf einen entsprechenden französischen<br />
Vorschlag hin sogar mit einer eigenen<br />
Denkschrift kommuniziert; auch das ein sicheres<br />
Indiz für den kurzen Draht, der damals zwischen<br />
der saarländischen Möchtegern- und der französischen<br />
Hauptstadt existierte. Um das große Ziel<br />
zu erreichen, hängte sich die Stadtführung unter<br />
Hector ziemlich weit aus dem nationalen Fenster,<br />
betonte nicht nur ständig die historische Verbindung<br />
zwischen Paris und Saarlouis, sondern<br />
ließ in der französischen Version der Denkschrift<br />
auch Sätze fallen, die so in der Urschrift nie zu<br />
lesen waren und die ganz klar eine viel weitergehende<br />
Liaison für die Zukunft assoziierten. Zu<br />
klar wurden damit die damals gültigen nationalen<br />
»Grenzwerte« überschritten, mit Folgen, die<br />
Jakob Hector schon bald zu spüren bekommen<br />
sollte.<br />
Hectors Jahr als Bürgermeister war das Jahr, in<br />
dem sich die Zukunft des Saargebietes und diejenige<br />
von Saarlouis konkretisierten. Und in beiden<br />
Fällen geschah das in einer Richtung, die<br />
der Pachtener nicht unbedingt gewünscht hatte,<br />
gegen die sich seine grenzüberschreitenden<br />
politischen Aktivitäten eigentlich gerichtet hatten.<br />
Im Sommer 1919 war es das Saarstatut des<br />
Versailler Vertrages, das ihn zur Intervention in<br />
Paris motiviert hatte, im Januar 1920 das Inkrafttreten<br />
des Statuts und der Regierungsantritt der<br />
Mandatsverwaltung, die ihn noch einmal zur<br />
Grenzüberschreitung animierten. Fast schon ein<br />
wenig verzweifelt klang es am 15. Januar 1920 –<br />
zu einem Zeitpunkt, da die Würfel längst gefallen<br />
waren –, wenn in einem handschriftlichen Brief<br />
Hectors, den vorgeblich alle Saarlouiser Stadtväter<br />
an den »Herrn Ministerpräsidenten und<br />
Kriegsminister« Clemenceau richteten, wenn<br />
also scheinbar alle Saarlouiser Ratsherren ihrer<br />
»sicheren Hoffnung Ausdruck (gaben), daß Frankreich<br />
ihrer Stadt, die über ein Jahrhundert lang<br />
wegen ihres Ursprungs und ihrer Zuneigung zu<br />
Frankreich von Preußen boykottiert wurde, helfen<br />
wird, wieder in ihre historischen Rechte eingesetzt<br />
zu werden.« Wenn in einem an die französische<br />
Regierung adressierten Brief darum<br />
gebeten wird, Saarlouis dabei zu helfen, wieder<br />
in seine historischen Rechte eingesetzt zu werden,<br />
dann war das zweifelsohne mehr als eine<br />
geschichtliche Reminiszenz, und entsprechend<br />
eindeutig wurde dieser Hilferuf später auch von<br />
jener Seite verstanden, die alles andere als eine<br />
Annäherung an Frankreich wünschte. [20]<br />
[20] Zitat nach »Prozeß Dr. Hector«, a.a.O. (wie Anm.18).<br />
Immerhin hat die Regierungskommission unter<br />
ihrem französischen Präsidenten Victor Rault<br />
das Saarlouiser Flehen insoweit erhört, als der<br />
im Versailler Vertrag für das Saargebiet vorgesehene<br />
Oberste Gerichtshof tatsächlich in die<br />
alte Festungsstadt kam. Einen Tag nach ihrem<br />
Amtsantritt, am 27. Februar 1920, wurde diese<br />
Entscheidung der Reko publiziert, und natürlich<br />
wurde das in der Saarlouiser Öffentlichkeit<br />
auch als Punktsieg gegen den preußischen Rivalen<br />
aus Saarbrücken gefeiert.[21] Gleichwohl war<br />
das höchstens ein Trostpflaster im Vergleich zu<br />
dem Programm, das in Hectors Denkschrift für<br />
die Zukunft der Stadt des Sonnenkönigs entworfen<br />
worden war. Von einem Regierungs- oder<br />
Bischofssitz blieb Saarlouis weit entfernt, und<br />
auch eine spürbare Verbesserung der wirtschaftlichen<br />
Situation war durch französische Protektion<br />
nicht zu erwarten. Vielleicht hat dieses<br />
magere Ergebnis mit dazu beigetragen, dass sich<br />
der lokale Widerstand gegen Hectors riskanten<br />
Kurs just seit diesem Zeitpunkt formieren und<br />
bald lautstark artikulieren konnte. Allerdings<br />
konnte sich die volle Wucht des kerndeutschen<br />
Nationalgefühls erst gegen den Bürgermeister<br />
und späteren Minister entladen, als die französische<br />
Militärmacht langsam an Bedeutung verlor<br />
– und Stück für Stück bekannt wurde, wie sehr Dr.<br />
Hector mit den Franzosen 1919/20 geflirtet hatte.<br />
Rücktritt kommt vor dem Fall<br />
Der politische Fall des Dr. Hector nahm bereits Formen<br />
an, als sein politischer Aufstieg noch bevorstand.<br />
Nur durch die Gerichtsverhandlungen von<br />
1923 wissen wir überhaupt, was da wie zu Beginn<br />
des Jahres 1920 seinen Lauf nahm und warum es<br />
schließlich nicht mehr zu stoppen war. Das Verhängnis<br />
begann mit den beiden Begleitschreiben<br />
zu den Pariser Eingaben, die Hector ohne Wissen<br />
und Wollen der gewählten Stadtverordneten<br />
schrieb oder verfassen ließ. Letztlich fatal waren<br />
für ihn außerdem seine mangelhaften, eigentlich<br />
kaum existenten Französischkenntnisse, die<br />
ihn zum einen von kompetenten Übersetzern<br />
abhängig, zum anderen die persönliche Kontrolle<br />
über das Ergebnis der Übersetzung unmöglich<br />
machten. Schon von daher gab es zu viele Mitwisser<br />
von einem Unternehmen, das zumindest<br />
im Saargebiet eigentlich als undercover-Aktion<br />
angelegt war. Wenigstens zwei Übersetzerinnen<br />
waren allein für das zweite Schreiben im Spiel, und<br />
außerdem gab es da auch noch die Stenotypistin<br />
[21] Vgl. den Leitartikel »Saarlouis – Saarbrücken« in der<br />
Saarzeitung vom. 13. März 20.
saargeschichte|n 29<br />
Auch die Sozialisten<br />
im Reich protestierten<br />
energisch gegen<br />
den »Raub des deutschen<br />
Saargebiets«,<br />
hier auf einem Plakat<br />
des »Werbedienstes<br />
der sozialistischen<br />
Republik« von 1919.<br />
(Sammlung Gerhard<br />
Paul)<br />
Frau Jost, die im Prozess 1923 aussagte, dass es<br />
»empörend für eine deutsche Frau (gewesen<br />
sei), solche Briefe schreiben zu müssen«. [22]<br />
Die Empörung über »solche Briefe«, die sich für<br />
einen »deutschen Saarlouiser« nicht gehörten,<br />
teilten wohl noch so einige Mitbürger der Stadt.<br />
Sogar vor der unmittelbaren Umgebung des<br />
Bürgermeisters machte sie nicht halt, schuf<br />
undichte Stellen im Zentrum der städtischen<br />
Macht. Aus dem Schreibtisch des Bürgermeisters<br />
wurden jedenfalls irgendwann zwischen Januar<br />
und März 1920 einige delikate Briefe gestohlen,<br />
darunter auch die beiden hier angezeigten<br />
Begleitschreiben, das eine sogar in Hectors<br />
[22] Der Hectorprozeß. Fünfter Verhandlungstag, in: SZ v. 6.<br />
März 23.<br />
Originalhandschrift. Und diese beiden »Briefbomben«<br />
landeten dann auf unbekanntem Wege<br />
ausgerechnet in den Händen des jungen Joseph<br />
Goergen, damals Jurastudent und Mitarbeiter<br />
eines juvenilen Redaktionsteams der Saarzeitung,<br />
die ebenso forsch die Sache des katholischen<br />
Zentrums wie die eines kerndeutschen<br />
Saargebiets vertrat.<br />
Der ältere Bruder von Joseph Goergen, auch er<br />
Jurist, war als Justitiar von Saarlouis pikanter<br />
Weise die rechte Hand von Dr. Hector und Autor<br />
der deutschen Fassung jener Denkschrift, die<br />
im Sommer 1919 zwar an die kommende Saarregierung<br />
adressiert war, recht eigentlich aber<br />
Augen und Ohren der französischen Regierung<br />
erreichen sollte. Honi soit qui mal y pense, aber<br />
in diesem Fall lag das Schlechte einfach zu nahe,
Kleinanzeigen<br />
und redaktionelle<br />
Erklärung aus der<br />
Saarlouiser Saar-Zeitung<br />
vom April 1920.<br />
weswegen der ältere Goergen quasi selbstverständlich<br />
in Verdacht geriet, die kompromittierenden<br />
Briefe gestohlen und seinem jüngeren<br />
Bruder zugespielt zu haben. Er mochte sich gegen<br />
diesen Verdacht noch so sehr wehren (und später<br />
im Prozess auch unter Eid beschwören, dass er die<br />
Schriften nicht geleakt hatte), der Bürgermeister<br />
und die französische Militärregierung glaubten<br />
ihm offenbar nicht, und so wurde der ältere<br />
Goergen nicht nur seinen Job, sondern für sieben<br />
Monate auch seine Aufenthaltsgenehmigung<br />
im Saargebiet los. Eine Ausweisung, die die Zahl<br />
von Hectors Gegenspielern aber im Endeffekt<br />
erhöhte – statt sie wie beabsichtigt zu reduzieren.<br />
Vielleicht war auch die politische Naivität<br />
eines Nebenberufspolitikers dafür verantwortlich,<br />
wenn Hector nicht bedacht hatte, dass die<br />
gefährlichsten Gegner oft die werden, die man<br />
aus dem gemeinsamen Haus vertrieben hat.<br />
Außer Frage steht jedenfalls, dass Hectors politische<br />
Demontage in der medialen Öffentlichkeit<br />
stattfand, ausgetragen vor allem als Zeitungskrieg<br />
zwischen dem frankophilen Saarlouiser<br />
Journal und der deutschen Saarzeitung von<br />
Redakteur Goergen. Im März oder April 1920, so<br />
gab es Hector im Prozess zu Protokoll, habe Goergen<br />
in zwei Artikeln die Pariser Briefe herangezogen<br />
und ihm damit – will wohl sagen: mit<br />
deren Veröffentlichung – gedroht. Der Redakteur<br />
meinte hingegen, er habe keineswegs gedroht,<br />
sei vielmehr von Hector als »alldeutscher Hetzer«<br />
beschimpft worden und habe lediglich am<br />
Ende des zweiten Artikels konstatiert, dass er im<br />
Gegensatz zum Bürgermeister eine weiße Weste<br />
habe, die nicht durch zwei nach Paris geschickte<br />
Briefe befleckt sei. [23] Es ist nicht ganz einfach,<br />
die einzelnen Stationen einer langsam eskalierenden<br />
Auseinandersetzung zu benennen. Oft<br />
wurden die Artikel in der damaligen Zeit nicht<br />
namentlich gekennzeichnet, wurden Argumente<br />
literarisch-metaphorisch sublimiert oder Stellvertreterkriege<br />
geführt, indem man einen anonymen<br />
Leserbrief (nach dem Muster: Eingesandt –<br />
Ein Rodener) zum Ausgangspunkt für die jeweils<br />
[23] Prozeß Dr. Hector gegen »Saarbrücker Zeitung«, wie<br />
Anm. 18.<br />
nächste Eskalationsstufe nutzte. Deutlich nachvollziehbar<br />
ist jedoch, dass die nationale Tonlage<br />
auf der »deutschen« Presse-Seite seit Ende der<br />
Militärherrschaft insgesamt strammer wurde<br />
und nationale Abweichungen jetzt offen attackiert<br />
werden. Man positioniert sich nun eindeutig,<br />
vor allem in Saarlouis, das wegen seiner<br />
französischen Geschichte im Reich in den Ruf der<br />
»Unzuverlässigkeit« gekommen sei. In dem allerdings<br />
nur einige »Dunkelmänner« und »räudige<br />
Schafe« innerhalb der »Herde« guter Deutscher<br />
für Unruhe oder gar für die »Anstiftung zum<br />
Landesverrat« gesorgt hätten, wie er namentlich<br />
in den erschlichenen Anträgen zur Naturalisierung<br />
von Saarlouisern greifbar geworden sei.<br />
»Die Elemente aber«, so urteilt die Saarzeitung<br />
am 19. April 1920, »die zum Landesverrat verleitet<br />
haben, verdienen die größte Verachtung<br />
aller anständigen Deutschen. Sie müßten aus der<br />
deutschen Volksgemeinschaft ausgeschlossen<br />
werden, wenn sie sich nicht schon selbst ausgeschlossen<br />
haben. An alle gutgesinnten deutschen<br />
Saarlouiser aus Stadt und Land richten wir<br />
die dringende und herzliche Bitte: Schließt euch<br />
zusammen zu einer heiligen Gemeinschaft, um<br />
Euer edelstes Gut, die deutsche Nationalität … zu<br />
schützen. Ihr, die Ihr Deutsche seid und bleiben<br />
wollt, pflanzt die Liebe zum Vaterland in die Herzen<br />
Eurer Kinder …« [24]<br />
Im Klima dieser nationalen Polarisierung von<br />
Saarlouis wurde auch die Kritik am Bürgermeister,<br />
die zuvor in der Regel nur »mitgedacht« worden<br />
war, mehr oder weniger konkret. Abermals<br />
war der Auslöser ein Eingesandt, eine Zuschrift,<br />
für deren Form und Inhalt die Redaktion nur<br />
die »preßgesetzliche Verantwortung« zu über-<br />
[24] Der Tiefstand des nationalen Geistes, in: Saarzeitung Nr.<br />
90 v. 19. April 20; die »Dunkelmänner« und »räudigen<br />
Schafe« sowie die »nationale Unzuverlässigkeit« nach<br />
einer am 31. März 20 abgedruckten Zuschrift: »Saarlouis‘<br />
Ruf in Wahrheit und Dichtung«. Die vom Autor<br />
über sich selbst in dem Text gemachten Angaben könnten<br />
darauf hindeuten, dass hinter ihm der ehemalige,<br />
ausgewiesene Saarlouiser Bürgermeister Dr. Gilles<br />
steckte – und dass seine implizite Kritik an den »Dunkelmännern«<br />
(auch) seinem Nachfolger Hector galt.
saargeschichte|n 31<br />
Die erste und einzige<br />
Meldung vom Rücktritt<br />
Jacob Hectors als<br />
Saarlouiser Bürgermeister<br />
in der Saar-<br />
Zeitung vom 29. Mai<br />
1920.<br />
nehmen hatte. Der Briefeschreiber kritisiert darin<br />
zunächst lediglich den etwas despektierlichen<br />
Ton gegenüber den Rodener Stadtverordneten in<br />
der Ratsversammlung und die »Tatsache«, dass<br />
der Stadtteil gegenüber der Stadtmitte in der<br />
Kommunalpolitik stets vernachlässigt werde.<br />
Bei der Gelegenheit glaubt er aber auch darauf<br />
hinweisen zu müssen, dass es Zeit werde, »daß<br />
die Stadt wieder einen Berufsbürgermeister<br />
bekommt, der mehr Zeit hat, um nach dem<br />
Rechten zu sehen.« Und der überhaupt als Verwaltungsfachmann<br />
professioneller im Bürgermeisteramt<br />
arbeiten könne, als es der gelernte<br />
Arzt Hector tue. Im Übrigen habe Bürgermeister<br />
Hector »doch bestimmt erklärt, am 1. April sein<br />
Amt niederzulegen«. [25]<br />
Tatsächlich warfen die ersten Kommunalwahlen<br />
im Saargebiet Ende Mai 1920 bereits ihre Schatten<br />
voraus, tatsächlich unterschrieb Hector oft<br />
als »kommissarischer Bürgermeister«, war also<br />
das Statement des offenkundig eingeweihten<br />
»Rodeners« zum angekündigten Rücktritt Hectors<br />
sicher nicht aus der Luft gegriffen. Gleichwohl<br />
wurde aus der Normalität eines kommunalen<br />
Amtswechsels im Furor des nationalen<br />
Bekenntniseifers ein lokales Politikum. Hector<br />
habe in der Stadtverordnetenversammlung das<br />
Rodener Eingesandt zur Debatte gestellt, habe<br />
sich über die »Haß und Zwietracht« verbreitende<br />
Zentrumspresse, namentlich die Redaktion der<br />
Saarzeitung beklagt, habe schließlich die Vertrauensfrage<br />
gestellt, die nach namentlicher<br />
Abstimmung einstimmig für ihn ausfiel. Ein deutlicher<br />
Hinweis, wie prekär die Situation im Saarlouiser<br />
Rathaus mittlerweile war. Und die Saarzeitung,<br />
höchstwahrscheinlich in Person Joseph<br />
Goergens, goss weiter Öl ins Feuer. Eine öffentliche<br />
Stellungnahme erwarte die Zeitung nach den<br />
Anschuldigungen des Bürgermeisters, sie fahre<br />
im Gegensatz zu diesem nicht auf einem Karren<br />
»der je nach der politischen Konjunktur Berliner<br />
oder Pariser Richtung« einschlage, habe »Zeit<br />
und Nerven und vor allem keine Veranlassung<br />
unsere schwer belastenden Karten vorzeitig aus-<br />
zuspielen«. Der bedrohlichen Anspielung auf die<br />
gelakten Paris-Papers folgte ein verbales Finale,<br />
das man aus heutiger Perspektive fast wie eine<br />
finstere Prophezeiung auf das Jahr 1935 lesen<br />
kann. Der Geist der nationalen Unzuverlässigkeit,<br />
so heißt es da, »wird eines Tages, wenn der<br />
Gerechtigkeit und vor allem dem Recht, das der<br />
Welt innewohnt und sich letzten Endes doch<br />
Bahn brechen muß, zur Rechenschaft gezogen<br />
werden; er wird, wenn einmal das sogenannte<br />
Selbstbestimmungsrecht zur Wirksamkeit werden<br />
sollte, seinen Verrat am Volkstum bitter zu<br />
büßen haben.« [26]<br />
Wenige Tage nach der Veröffentlichung dieser<br />
Zeilen war Jacob Hector als Bürgermeister<br />
zurückgetreten. In wenigen, allerdings sehr fett<br />
gedruckten Buchstaben verkündete die Saarzeitung<br />
am 29. Mai in ihrem Lokalteil: »Herr<br />
k. Bürgermeister Dr. Hector hat, wie uns mitgeteilt<br />
wird, sein Amt mit dem 28. Mai niedergelegt.«<br />
Danach herrschte erst einmal langes<br />
Schweigen in Saarlouis: in der Saarzeitung, über<br />
Dr. Hector und über die frankophilen Affären, die<br />
man mit ihm in Verbindung brachte. Zum nächsten<br />
Bürgermeister von Saarlouis wurde nach<br />
den Kommunalwahlen vom 11. August 1920 Dr.<br />
Johann Josef Latz gekürt. Er bekleidete dieses<br />
Amt bis in das Jahr 1936 und war danach noch<br />
neun Jahre lang Stadtoberhaupt in Sulzbach. An<br />
nationaler Zuverlässigkeit, wie man sie in den<br />
saarländischen 1920ern verstand, hat es ihm<br />
bestimmt nicht gefehlt.<br />
Plötzlich Minister<br />
Als Jacob Hector nach den Turbulenzen im Frühjahr<br />
1920 seinen Platz im Saarlouiser Rathaus<br />
räumte und in den einstweiligen politischen<br />
Ruhestand trat, hätte er wohl selbst nicht vermutet,<br />
schon wenige Monate später noch viel<br />
stärker im Rampenlicht des jungen »Saarstaats«<br />
zu stehen. Denn der Posten des saarländischen<br />
Ministers in der Regierungskommission, den<br />
Hector am 20. September 1920 übernehmen sollte,<br />
war Ende Mai gerade einmal seit vier Mona-<br />
[25] Eingesandt, in: Saarzeitung v. 20. Mai 20.<br />
[26] Zu dem Angriff des Bürgermeisters Dr. Hector, in: Saarzeitung<br />
v. 23. Mai 20.
Dieses Entree<br />
im Gebäude des<br />
heutigen Saarbrücker<br />
Landgerichtes<br />
passierten<br />
Minister, Beamte<br />
und Mitarbeiter<br />
der Regierungskommission<br />
auf<br />
dem Weg zu ihren<br />
Amtsstuben. (LA SB,<br />
Bildersammlung)<br />
ten besetzt von Alfred von Boch. Einem alten<br />
Bekannten aus Saarlouis also, der bis zum Jahresbeginn<br />
noch als Landrat des Kreises amtiert<br />
hatte und dort, wenn die Nachrichten von seiner<br />
Verabschiedung zutreffen, durchaus beliebt<br />
war. Es war wohl alles andere als ein Zufall, dass<br />
die ersten drei saarländischen Minister in der<br />
Reko aus Saarlouis stammten. Zwar wurden die<br />
Kommissare offiziell vom Völkerbundrat ernannt.<br />
Aber gerade in den frühen Zwanzigern war man<br />
dort offenkundig bereit, den französischen Wünschen<br />
nach Hegemonie in diesem Gremium zu<br />
entsprechen. Ein Kandidat aus der französischsten<br />
Stadt des Saarlandes passt jedenfalls sehr<br />
gut in diese Konstellation, die mit dem mächtigen<br />
Präsidenten Rault, dem seit Jahrzehnten in<br />
Paris lebenden Dänen Moltke-Huitfeld und dem<br />
Belgier Jaques Lambert ohnehin mehr als frankophil<br />
eingefärbt war. [27]<br />
Aber schon bei dem Wohlfahrts- und Landwirtschaftsminister<br />
von Boch wurde, wie bei seinen<br />
Nachfolgern dann auch, deutlich, dass die<br />
saarländischen Vertreter in der Reko keineswegs<br />
willfährige Mitspieler in einer von französischen<br />
Interessen gelenkten Saarpolitik sein<br />
wollten. Zum frühen Bruch der ersten Kommission<br />
kam es anlässlich der Beschlüsse über das<br />
saarländische Beamtenstatut, die erste große<br />
Bewährungsprobe der Reko seit ihrem Amtsantritt<br />
im Februar. Es ging bei dem Streit zwi-<br />
[27] Zur französischen Reko-Macht der ersten Jahre vgl.<br />
Zenner, Parteien und Politik (wie Anm. 1), S. 40f..<br />
schen Regierung und (deutschen) Beamten um<br />
soziale, um Prestige- und nicht zuletzt um politisch-nationale<br />
Fragen, ein Paket, über das man<br />
sich bis August 1920 nicht einig werden konnte,<br />
so dass am 6. August ein großer Streik fast<br />
aller saarländischer Beamten begann. Rault verhängte<br />
den Ausnahmezustand, ließ das Militär<br />
aufmarschieren, es folgte eine Woche mit den<br />
bis dahin schlimmsten Zusammenstößen im<br />
Saargebiet, mit Verhaftungen, Ausweisungen,<br />
Entlassungen. Am Tag des Streikbeginns reichte<br />
von Boch seine Demission beim Generalsekretär<br />
des Völkerbundes ein. Schon in der an diesem<br />
6. August 1920 stattfindenden Sitzung der<br />
Regierungskommission fehlte von Boch, sogar<br />
ohne Angabe von Gründen. Der saarländische<br />
Stuhl am Regierungstisch sollte damit für mehrere<br />
Wochen leer bleiben, ausgerechnet in dieser<br />
sehr turbulenten Zeit. [28]<br />
Zu viert und ohne Saarländer musste also die<br />
Reko die erste große Staatskrise durchfechten,<br />
aber vielleicht war die lange Vakanz der französischen<br />
Kommissionsführung gar nicht so unrecht.<br />
Da erst in der dritten Septemberwoche im Völkerbundrat<br />
über die Akzeptanz von Bochs Demission<br />
entschieden werden konnte und dieser wiederum<br />
nur dann selbst einen Ersatzmann benennen<br />
durfte, wenn die Gründe für sein Fernbleiben von<br />
seinen vier Kollegen akzeptiert wurden, blieben<br />
die »Internationalen« bis zur Sitzung vom 11. September<br />
unter sich. Am 25. August endlich einigte<br />
sich das Gremium darauf, dass von Bochs Fernbleiben<br />
wegen »Krankheit und aus persönlichen<br />
Gründen« akzeptabel sei und man deshalb bis zur<br />
Entscheidung des Völkerbunds mit dem von ihm<br />
benannten »Übergangsminister« arbeiten könne.<br />
Die Wahl des ehemaligen Landrats fiel nicht etwa<br />
auf einen Saarlouiser Landsmann, sondern auf<br />
den Eppelborner Bartholomäus Koßmann, ehemaliger<br />
Reichstagsabgeordneter, ehemaliges<br />
Mitglied der Weimarer National- und der preußischen<br />
Verfassungsgebenden Versammlung, einflussreicher<br />
Politiker des Zentrums. [29]<br />
[28] Zum Beamtenstreik Zenner, a.a.O., S. 50f. und den Quellentext<br />
in: Weißbuch, Nr. 143, S.213–215. Exemplarisch<br />
die Denkschrift über die ungünstige finanzielle Lage<br />
der vom Deutschen Reich, Preußen und Bayern in die<br />
Dienste der Saarregierung beurlaubten Beamten, in: LA<br />
SB, EBD 550.<br />
[29] Vgl. zu den entscheidenden Sitzungen der Reko: Commission<br />
de Gouvernement de la Sarre, Procès-verbeaux<br />
vom 6., 7., 17. und 25. August sowie vom 11. September<br />
1920, in: LA SB, NL Koßmann 1, S. 99; 112; 116; 119; 195.
saargeschichte|n 33<br />
Die zweite<br />
Regierungskommission<br />
des Saargebiets<br />
mit Hectors Nachfolger<br />
Julius Land<br />
(o.l.) sowie sitzend<br />
Präsident Victor Rault<br />
(links) und George<br />
Washington Stephens<br />
(r.); stehend<br />
neben Land Graf von<br />
Moltke-Huitfeldt und<br />
Jacques Lambert. (LA<br />
SB, BSlg)<br />
Obwohl Koßmann schon 1920 ein, wenn nicht das<br />
politische Schwergewicht des Saargebiets war<br />
und er gerade für das Wohlfahrtsministerium der<br />
geradezu prädestinierte Ressortchef gewesen<br />
wäre, blieb er in der Regierungskommission<br />
zunächst eine politische Eintagsfliege. Historiker<br />
Koßmanns haben sich bis heute immer wieder<br />
gefragt, warum der ausgewiesen erfahrene<br />
Sozialpolitiker 1920 aus den Höhen der Berliner<br />
Luft freiwillig in die verräucherten Niederungen<br />
des Saargebiets zurückgekehrt ist, um dort als<br />
Oberregierungsrat in eine Ministerialverwaltung<br />
einzutreten, deren Chef er eigentlich sein konnte.<br />
Vielleicht war das zumindest aus saarländischdeutscher<br />
Perspektive aber ganz anders geplant<br />
gewesen, stand der im Juni aus der Nationalversammlung<br />
ausgeschiedene Koßmann im August<br />
1920 bereits Gewehr bei Fuß, um von Boch dauerhaft<br />
zu beerben. Immerhin sollte es beim Ausscheiden<br />
Hectors drei Jahre später ja dann genau<br />
so kommen, dass der vom demissionierten Minister<br />
benannte Ersatzmann zum echten Nachfolger<br />
aufstieg. Auch Koßmanns biographische Daten<br />
sprechen dafür, dass er nicht unbedingt freiwillig<br />
als Subalterner ins Wohlfahrtsressort einzog.<br />
Exakt drei Tage, nachdem seine Nominierung<br />
zum Ersatzmann Bochs von der Reko abgenickt<br />
worden war, verlegte er seinen langjährigen<br />
Wohnsitz von Neunkirchen nach Saarbrücken. Im<br />
Übrigen soll das Verhältnis zwischen Koßmann<br />
und seinem Minister Hector später ziemlich frostig<br />
gewesen sein, am Ende sei der Eppelborner<br />
sogar regelrecht kalt gestellt gewesen. Und als<br />
1922 Koßmanns Wahl zum ersten Präsidenten des<br />
Landesrats anstand, war Hector der einzige in der<br />
Reko, der nicht für seinen Ex-Mitarbeiter votierte:<br />
Auch das könnte nicht nur im politischen Dissens,<br />
sondern ebenso in der Konkurrenzsituation von<br />
1920 begründet gewesen sein. [30]<br />
[30] Sitzung der Reko mit dem Ersatzmann Koßmann am 11.<br />
September 20, in NL Koßmann 1, S. 119–124; zum »kaltgestellten«<br />
Koßmann vgl. Philipp W. Fabry, Bartholomäus<br />
Koßmann. Treuhänder der Saar 1924–1935, Merzig<br />
2011, S.67; Reinhold Bost, Bartholomäus Koßmann.<br />
Christ – Gewerkschaftler – Politiker 1883–1952, Blieskastel<br />
2002, S. 178. Nach den Erkenntnissen aus den<br />
Reko-Akten müsste über die Umstände des Wechsels<br />
von Koßmann aus Berlin nach Saarbrücken neu nachgedacht<br />
werden. Vgl. auch meinen Beitrag in den saargeschichten<br />
3/19, hier v.a. S. 19. – Zur Designation Koßmanns<br />
zum Landesratspräsidenten am 11. Juli 22, vgl. NL<br />
Koßmann 25, S. 192f.
Paris gegangen war. Mit machiavellistischem<br />
Auge betrachtet konnte es sogar von Nutzen<br />
sein, mit Hector einen Saarländer im Kabinett<br />
zu haben, der wegen seiner heiklen Aktionen als<br />
Bürgermeister in seiner Heimat auf unsicherem<br />
Terrain stand. Jedenfalls lobte Präsident Rault<br />
bei Hectors Amtseinführung am 23. September<br />
1920, dass »les circonstances de ce choix …<br />
des plus favorables« seien und dass »sa désignation<br />
répondait à leur désir«, also der Wunsch<br />
aller Minister der Reko gewesen sei – soweit sie<br />
die französischen Interessen im Gremium unterstützten,<br />
möchte man hinzufügen. [31]<br />
Die zweieinhalb Jahre, die Jacob Hector als<br />
Minister für Wohlfahrt und Landwirtschaft in<br />
der Regierungskommission verbrachte, waren<br />
zweifelsohne der Höhepunkt seiner politischen<br />
Karriere. Sie umfassen aber auch die Zeit zwischen<br />
Beamten- und Hunderttagestreik, die oft<br />
konfliktreiche Phase also, in der das Saargebiet<br />
und seine internationale Mandatsregierung<br />
»das Laufen« lernten, eine Zeit also, aus der man<br />
viel darüber erfahren könnte, wie die Implementierung<br />
des neuen Systems funktionierte – und<br />
inwiefern der Saarländer in diesem System die<br />
Das Schreiben aus<br />
Hectors Ressort zum<br />
Übergang der Heilanstalt<br />
Homburg in<br />
staatliche Verwaltung<br />
markiert den Beginn<br />
des Universitätsklinikums.<br />
(LA SB, LRA<br />
IGB).<br />
Neun Tage nach Koßmanns erstem und für einige<br />
Jahre letzten Auftritt am Saarbrücker Regierungstisch<br />
fand in Paris eine Sitzung des Völkerbundrates<br />
statt. Monsieur Caclamanos, der Vertreter<br />
Griechenlands, legte dabei den Bericht über die<br />
Regierungskommission des Saargebietes vor, in<br />
dem er die Demission von Bochs und die Nachfolgerfrage<br />
thematisierte. Letztbezüglich habe er<br />
»Erkundungen eingezogen und einige mögliche<br />
Kandidaten erwogen. Ich bin stehen geblieben<br />
bei dem Namen des Dr. Hector, ehemals Bürgermeister<br />
von Saarlouis, wo er seinen Beruf als<br />
Arzt ausübt.« Caclamanos’ Statement zu Hector<br />
klang nicht unbedingt wie ein unwiderstehliches<br />
Plädoyer für den fraglos besten Kandidaten –<br />
zumal mit Koßmann ein unzweifelhaft höher<br />
qualifizierter Saarländer schon auf der Matte<br />
stand. Man kann sich also sehr leicht vorstellen,<br />
dass Harr Calcamanos bei seiner Kandidatensuche<br />
tatkräftige Unterstützung vor allem in<br />
eine gewünschte Richtung erhielt. Und dass die<br />
französischen Protektoren dieser Richtung sich<br />
noch lebhaft daran erinnerten, wie sehr Dr. Hector<br />
in den Nachkriegsjahren auf Tuchfühlung mit<br />
[31] Bericht über die Sitzung des Völkerbundrates v. 20. September<br />
20 nach SDN, Journal Officiel 1, 7, S. 44ff, hier zitiert<br />
nach der deutschen Übersetzung in Weißbuch Nr.<br />
156, S. 234; Sitzung v. 23. September 20, NL Koßmann 25,<br />
S. 125.
saargeschichte|n 35<br />
ihm zugedachte Rolle ausfüllte. In der landesgeschichtlichen<br />
Literatur erfährt man darüber<br />
erstaunlich wenig, zu sehr scheint diese frühe<br />
Phase im Schatten der großen (nationalen) Nachkriegskrisen<br />
zu stehen oder wie selbstverständlich<br />
als die Zeit der autokratischen Herrschaft<br />
Victor Raults abgehandelt zu werden. Von der<br />
Arbeit Hectors als Ressortminister erfährt man<br />
allenfalls den auch in seinen Nekrologen stets<br />
hervorgehobene Aufbau der Homburger Heilund<br />
Pflegeanstalt zum Landeskrankenhaus, die<br />
Fundamentierung der heutigen Universitätskliniken<br />
also (was ja per se durchaus als großes<br />
Verdienst zu belobigen ist). Praktisch nichts<br />
wurde hingegen zu seiner Rolle im Kollegium der<br />
Regierungskommission verlautbart, zu selbstverständlich<br />
ging man wohl davon aus, dass Hector<br />
stets am Pariser Tropf hing und sich dementsprechend<br />
passiv verhalten habe. [32]<br />
Schon eine flüchtige Durchsicht der Protokollbände<br />
der Reko vermittelt jedoch ein anderes<br />
Bild – das den Saarlouiser nicht nur immer mit<br />
einer durchaus eigenständigen Stimme im internationalen<br />
Diskurs agierend zeigt, sondern auch<br />
deutlich macht, dass er vor der sachlichen Konfrontation<br />
mit dem scheinbar übermächtigen<br />
Präsidenten Rault nicht zurückschreckte. Selbst<br />
der Vorwurf eines Verstoßes gegen den Geist des<br />
Versailler Vertrages steht da mal gegen den Präsidenten<br />
im Raum und eine scharfe Replik, die sich<br />
Hector deshalb vom Regierungschef einhandelt.<br />
Auch »saarländische« Minderheitenvoten, später<br />
eine »Spezialität« von Bartholomäus Koßmanns<br />
Reko-Politik, tauchen da auf, Voten, mit denen er<br />
sich einsam gegen die Mehrheit seiner Kollegen<br />
aus den Völkerbundstaaten stellte, um seine Mission<br />
im Sinne des »Saarvolkes« zu erfüllen. Als es<br />
seit 1922 um die konfliktreiche Zusammenarbeit<br />
mit dem Landesrat und die Einsetzung eines<br />
Studienausschusses ging, meinte Rault gar, dass<br />
sich Hector nicht über die diesbezüglichen Probleme<br />
wundern müsse, da er es ja gewesen sei<br />
»qui a toujours defendu le principe de la collaboration<br />
avec la population«. Überhaupt könnte<br />
sich das, in Parallelität zur Zeit im Bürgermeisteramt,<br />
als Maßstab für das politische Handeln<br />
[32] Vgl. zum Beispiel: den Nachruf »Zum Gedächtnis von Dr.<br />
med Jakob Hector« in der SZ v. 6. Februar 54. – Der Übergang<br />
der Klinik aus dem Provinzialverband der Rheinprovinz<br />
und der Pfalz in saarländische Obhut erfolgte<br />
nach Verhandlungen mit der Reko unter Hectors Verantwortung<br />
zum 1. November 1921. Vgl. das in Saarlouis<br />
(!) datierte Schreiben vom 20. September 21 in LA SB,<br />
LRA IGB 6030.<br />
Hectors herauskristallisieren: das Bestmögliche<br />
für die Menschen seiner Heimat, seines »Wahlbezirks«<br />
zu erreichen, ob es sich dabei um die<br />
Bürger_innen seiner Stadt oder die seines neuen<br />
»Landes« handelte. Die Sache hatte freilich einen<br />
Haken: Dass er im Einsatz für die Heimat sogar<br />
bereit war, nationale Schranken zu überspringen,<br />
mag für uns heute sympathisch wirken, war<br />
damals für die meisten Menschen jedoch genau<br />
das Gegenteil davon. [33]<br />
Weil die nationale Selbstvergewisserung in<br />
der Folge von Versailles für die vom Reich<br />
abgetrennten Saarländer eine überragende<br />
Bedeutung quer durch alle Parteien bekam, ist es<br />
fast erstaunlich, wenn Hector seine ersten beiden<br />
Amtsjahre als Regierungskommissar relativ<br />
unbeschadet überstand. Zwar soll es, wie es spätere<br />
Aussagen im Prozess belegen, immer wieder<br />
belastende Anschuldigungen gegeben haben, die<br />
nicht nur gerüchteweise durchs Land zogen, sondern<br />
auch in der Öffentlichkeit ausgesprochen<br />
wurden. Aber richtigen Gegenwind bekam der<br />
Wohlfahrtsminister erst, als die saarländischen<br />
Parteien mit dem Landesrat ein institutionelles<br />
Gehäuse für die Artikulation ihres Protestes<br />
erhalten hatten, der nun auch in Genf legitimer<br />
Weise vorgetragen werden konnte. Dann aber<br />
kam die Kritik umso heftiger. Nur wenige Tage<br />
nach der konstituierenden Sitzung am 19. Juli<br />
1922 richteten die saarländischen Parteien und<br />
26 von 30 Landesratsmitgliedern an den Völkerbundsrat<br />
die Bitte, Hectors Amtszeit nicht mehr<br />
zu verlängern und den nächsten Saarländer am<br />
Regierungstisch entweder nach allgemeinen<br />
Wahlen oder auf Vorschlag des Landesrats zu<br />
ernennen. Demokratische Teilhabe und nationale<br />
Selbstbestimmung: Das war der offizielle Rahmen,<br />
in dem die deutsche Opposition gegen den<br />
Minister mit »anrüchig« frankophiler Vergangenheit<br />
Fahrt aufnehmen konnte. [34]<br />
Nachdem weder Genf noch die Reko in Saarbrücken<br />
auf die Eingabe reagiert hatten, legten<br />
die Saarländer nach. Als die turnusgemäße Ver-<br />
[33] Hector als engagierter Wortführer schon in den ersten<br />
Verhandlungen am Reko Tisch, zum Beispiel in der<br />
Sitzung vom 13. Oktober 20, NL Koßmann 1, S.140. Der<br />
Streit mit Rault – es ging hier um die Frage der Renten<br />
für die Beamten der Zentralverwaltung in der Sitzung<br />
vom 24. Juni 22, NL Koßmann 25, S. 179ff., hier v.a. S.180;<br />
die Bemerkung Raults zu Hectors Bedürfnis nach ‚demokratischer<br />
Rückbindung’ in der Sitzung vom 11. Juli<br />
22, a.a.O., S.203.<br />
[34] Der Fall Hector und seine Konsequenzen. Die Fraktionen<br />
des Saargebietes, Saarbrücken 1922.
Im »neuen« Landgericht<br />
(dem Vorgängerbau<br />
des<br />
heutigen) an der<br />
damaligen Saarbrücker<br />
Alleestraße<br />
(heute: Franz-Josef-<br />
Röder-Straße) fand<br />
der Prozess gegen SZ-<br />
Redakteur Adolf Franke<br />
wegen Beleidigung<br />
von Minister Hector<br />
statt. (LA SB, BSlg)<br />
längerung von Hectors Mandat im September<br />
1922 anstand, erschien ein Artikel in der Saarbrücker<br />
Zeitung, der diesmal wirklich ganz großes<br />
Geschütz auffuhr. Redakteur Adolf Franke<br />
bezog sich in seinen Ausführungen über den<br />
»Fall Hector« explizit auf die Eingabe der saarländischen<br />
Parteien, die diese »dieser Tage dem<br />
Völkerbundsrat auf dem vorschriftsmäßigen Weg<br />
über die Saarregierung übersandt« hätten. Und<br />
er übte sich in der Beurteilung von Hectors Politik<br />
der Jahre 1919/20 nicht gerade in Zurückhaltung:<br />
»Herr Dr. Hector hat schmachvollen Landesverrat<br />
verübt durch einen gemeinen Betrug«. Noch<br />
bevor Franke diese seine Anklage überhaupt<br />
ausgesprochen oder gar begründet hatte, hatte<br />
er bereits das Urteil über seinen »Angeklagten«<br />
gesprochen: »Herr Dr. Hector mag seine Sachen<br />
packen und das Saargebiet im Eiltempo und für<br />
immer verlassen. Ob er vielleicht nun noch in<br />
Frankreich irgendwo ein Dankasyl findet, das zu<br />
erwägen ist nicht unsere Sache. Vielleicht heißt<br />
es auch: der Mohr hat seine Schuldigkeit getan<br />
...« Unüberhörbar war da bereits der Ton der spöttischen<br />
Ausgrenzung, der den (nationalen) Diskurs<br />
der 1920er Jahre von allen Seiten dominierte.<br />
Die Nazis haben ihn später aufgenommen und<br />
bis zur mörderischen Konsequenz perfektioniert.<br />
[35]<br />
Unmittelbar unter dem Artikel Frankes erschien<br />
die Meldung, dass Hector abermals vom Völkerbund<br />
für ein weiteres Jahr in seinem Amt bestätigt<br />
worden sei. Die saar-deutsche Öffentlichkeit wird<br />
es als weitere Provokation verstanden und deshalb<br />
mit Genugtuung zur Kenntnis genommen<br />
haben, dass die Saarparteien drei Wochen nach<br />
dem Angriff in der Saarbrücker Zeitung ein zweites<br />
Mal beim Völkerbundsrat antichambrierten,<br />
diesmal auch, um Redakteur Franke dezidiert den<br />
Rücken zu stärken. Spätestens jetzt war der Zeitpunkt<br />
gekommen, dass der schwer beschuldigte<br />
[35] Adolf Franke, Der Fall Hector, in: SZ v. 4. September 1922.<br />
Dr. Hector reagieren musste. Nachdem<br />
er die vorausgegangenen Verbalattacken<br />
offenkundig ignoriert hatte,<br />
war der jetzt im Raum stehende Vorwurf<br />
so schwerwiegend, dass ihm<br />
nichts anderes übrig blieb, als Anzeige<br />
gegen Adolf Franke zu erstatten. Gerade<br />
die nationale Frage war, wie bereits<br />
erwähnt, eine Ehrenfrage, die anders<br />
als im 19. Jahrhundert nun nicht mehr<br />
im Duell, sondern in dessen domestizierter<br />
Form vor Gericht ausgetragen<br />
wurde. Der politische Beleidigungsprozess<br />
gegen den Redakteur Adolf Franke wurde<br />
am 23. Februar 1923 vor der Strafkammer des<br />
Landgerichts Saarbrücken eröffnet. [36]<br />
Verkehrte Welt: der Kläger als Angeklagter<br />
Eigentlich hätte der Prozess gegen Franke und<br />
die Saarbrücker Zeitung schon vier Wochen vorher<br />
stattfinden sollen. Ein Termin war sogar<br />
bereits festgelegt, wurde dann aber wieder aufgehoben.<br />
Die ungewöhnliche Verlegung hatte<br />
einen gewichtigen Grund: Nach einem vorangegangen<br />
politischen Verfahren, deren es so<br />
viele in der Völkerbundszeit gab, musste vom<br />
Obersten Gerichtshof die Frage der Unabhängigkeit<br />
des Gerichts in solchen Fällen geklärt werden.<br />
Erst nachdem die im rechtsstaatlichen Sinne<br />
gewünschte Stärkung der richterlichen Autorität<br />
höchstinstanzlich fixiert worden war, Richter also<br />
nicht mehr durch die Intervention der Regierung<br />
bei politischen Verfahren ausgetauscht werden<br />
konnten, wurde der Franke-Prozess eröffnet.<br />
Schon am ersten Verhandlungstag sollte er de<br />
facto zu einem Hector-Prozess werden.<br />
[36] Zur Logik der Politischen Strafprozesse in den 1920er<br />
Jahren vgl. Linsmayer, Politische Kultur (wie Anm. 1), S.<br />
205–208. Die Prozessakten zum Fall Hector sind wie<br />
die meisten frühen Unterlagen des Saarbrücker Landgerichtes<br />
bedauerlicher Weise durch Kriegseinwirkung<br />
oder Hochwasser verloren gegangen. Zum Glück (und<br />
in dem Fall natürlich auch aus Eigeninteresse) hat die<br />
Saarbrücker Zeitung den Fall damals sehr intensiv begleitet;<br />
dass sie als Betroffene oft auch in eigener Sache<br />
interpretierte, schmälert den insgesamt objektiven<br />
Gesamtbestand der damit erhaltenen Dokumentation<br />
kaum. Die folgenden Seiten beziehen ihre Informationen<br />
aus der ausführlichen Berichterstattung über<br />
die sechs Verhandlungstage in: SZ v. 23./27. Februar 23;<br />
1./4./6./9. März 23 sowie der medialen Würdigung des<br />
Prozesses im Leitartikel: »Ein Sieg der Wahrheit« am 9.<br />
März 1923.
saargeschichte|n 37<br />
Es begann alles wie gewöhnlich vor den Schranken<br />
eines Gerichts: Die Feststellung der Prozessbeteiligten<br />
des Verfahrens unter der Leitung<br />
von Landgerichtsdirektor Dr. Messinger, die<br />
Benennung und Frage der Zulässigkeit der Zeugen,<br />
die Verlesung der Anklageschrift. Hector,<br />
der als Zeuge und Nebenkläger auftrat, wurde<br />
von Rechtsanwalt Donnevert aus Saarlouis vertreten,<br />
der als Stadtverordneter aber auch als<br />
Zeuge geladen war und daher Dr. Schmidt in<br />
seiner Vertretung ins Rennen schicken musste.<br />
Der Beklagte Franke erschien mit den Rechtsanwälten<br />
Dr. Steegmann und Dr. Lehmann vor<br />
Gericht, beide waren auch politische Schwergewichte,<br />
der eine als Vorsitzender des Saar-Zentrums,<br />
der andere im Vorstand der Saar-SPD. Und<br />
beide waren, um das gleich vorwegzuschicken,<br />
keine deutschnationalen Hard liner, das Gegenteil<br />
war der Fall, Lehmann musste als Jude später<br />
sogar vor den Nazis fliehen. [37] Hectors Anwalt<br />
bemühte sich vergeblich darum, Joseph Goergen<br />
als Zeugen der Gegenseite nicht vor Gericht<br />
zuzulassen, aus formalen Gründen, wahrscheinlich<br />
ahnte man bereits, dass von ihm besonderes<br />
Ungemach drohte. Die zur Verhandlung stehende<br />
öffentliche Beleidigung Hectors gründete sich<br />
vor allem, so hielt es das Gericht fest, auf Frankes<br />
Diktum vom schmachvollen Landesverrat verübt<br />
durch einen gemeinen Betrug. Der Angeklagte<br />
begründete dies, wie in seinem Beitrag für die<br />
SZ, mit dem Hinweis auf die Denkschrift der Parteien<br />
und die darin festgehaltene Tatsache, dass<br />
aus einer ökonomisch motivierten Bittschrift<br />
der Stadt Saarlouis durch absichtlich gefälschte<br />
Übersetzung eine Ergebenheitsadresse der Verwaltung<br />
einer deutschen Stadt entstanden sei<br />
– womit sowohl die französische Seite als auch<br />
die Stadtverordneten betrogen worden sein. Zu<br />
seiner Anschuldigung gegenüber Hector, so gab<br />
es Franke zum Abschluss seines einführenden<br />
Statements zu Protokoll, habe er sich demnach<br />
»als Vertreter der Öffentlichkeit und als Deutscher<br />
verpflichtet gefühlt.«<br />
Die Zeugenbefragungen des ersten Verhandlungstages<br />
drehten sich vor allem um die<br />
Entstehung der Saarlouiser Denkschrift, um die<br />
Modalitäten der Übersetzung, die Verhandlungen<br />
darüber in der Stadtverordnetenversammlung<br />
[37] Zu den Viten kurz: Peter Wettmann-Jungblut, Rechtsanwälte<br />
an der Saar 1800–1960. Geschichte eines bürgerlichen<br />
Berufsstandes, Blieskastel 2004, S. 512 u. 537<br />
sowie in LA SB, MJ-PA 308 (Lehmann); LG SB 218 (Steegmann).<br />
Zu Landesgerichtsdirektor Messinger die umfängliche<br />
Personalakte MJ-PA 3<strong>59</strong>.<br />
und schließlich die Überbringung der Schriften<br />
zur Saarabteilung der Friedenskommission in<br />
Versailles sowie den hohen Politikern und Militärs<br />
in Paris. Es lässt sich bereits in dieser Phase<br />
der Verhandlungen erkennen, dass es von Anfang<br />
an Widerstände gegen die Diktion der französischen<br />
Fassung seitens der Stadtverordneten<br />
gegeben hatte – und dass an mehr als einer Stelle<br />
getrickst worden war, um eine Version nach Paris<br />
bringen zu können, die deutlich frankophiler ausfiel<br />
als das Original. Vor allem jene Stelle in der<br />
zweiten, bedeutend kürzeren französischen Version<br />
(die vom Wallerfanger Urban Fabvier besorgt<br />
worden war), in der »Le Maire et le conseil de Sarrelouis<br />
(…) vous assurer en meme temps de sa<br />
fidèlité et de sa loyauté« erregte stark die deutschen<br />
Gemüter. Es klingt schon nach ziemlichen<br />
Taschenspielertricks, wenn man die Stadtverordneten<br />
wechselweise dadurch zu beruhigen<br />
suchte, dass man fidèlité und loyauté als Rechtschaffenheit<br />
und Wahrheit übersetzte, dass man<br />
Glauben machen wollte, diese Bekundungen<br />
gälten der neuen Saarregierung (die formal<br />
der Adressat der Denkschrift war) oder schlicht<br />
die Verordneten in dem Glauben ließ, dass die<br />
Begriffe vor der Übergabe in Paris entfernt würden.<br />
Auch viele andere, neuen Sinn stiftende<br />
Abweichungen brachten deutlich mehr französischen<br />
Esprit in die Übersetzung, als er im Original<br />
jemals erwünscht gewesen wäre. So zum<br />
Beispiel die besonders heikle Konzedierung einer<br />
l’annexion de la Lorraine im Bezug auf die Grenzziehung<br />
von 1871, ein Verständnis der Geschichte,<br />
das in Deutschland selbst in den Weimarer Parteien<br />
verpönt war. Kurzum, das Gericht konnte<br />
im Grunde schon in diesem frühen Stadium bei<br />
einer objektiven Würdigung der gehörten Dinge<br />
eigentlich nur zu der Auffassung kommen, dass<br />
da einiges faul gewesen sein musste in der von<br />
Dr. Hector verantworteten Stadtpolitik. Und dass<br />
die französische Botschaft, die 1919 den Pariser<br />
Machthabern übermittelt wurde, so zumindest<br />
nicht von den Saarlouiser Stadtverordneten<br />
abgesegnet worden sein konnte. [38]<br />
Die Verteidigung des Ministers und ehemaligen<br />
Bürgermeisters stand bei kritischen Fragen von<br />
[38] Die Parteien des Landesrats hatten ihrer Eingabe von<br />
1923 Hectors Denkschrift zur »Zukunft der Stadt Saarlouis«<br />
angefügt, in einer synoptischen Druckform, die<br />
die Unterschiede zwischen deutscher und französischer<br />
Fassung schon bildlich klarmachte, in dem besonders<br />
anzufechtende Passagen der französischen<br />
Übersetzung zudem gesperrt gedruckt waren. Vgl dazu<br />
das Druckexemplar in: NL Schneider (wie Anm. 18).
André Tardieu, Berater<br />
Clemenceaus auf der<br />
Versailler Konferenz<br />
und später mehrfach<br />
französischer Minister<br />
und Ministerpräsident,<br />
war ein<br />
wichtiger Ansprechpartner<br />
für die Saarlouiser<br />
Delegationen<br />
in den Jahren 1919/20.<br />
(wiki commons)<br />
Anfang an auf schwachen Füßen. So erklärte er<br />
beispielsweise zur eklatanten Diskrepanz zwischen<br />
deutscher und französischer Denkschrift,<br />
dass sein Französisch »damals« - also drei Jahre<br />
vor dem Prozess – so schlecht gewesen sei, dass<br />
»er nicht in der Lage gewesen sei, die Unterschiede<br />
zwischen dem deutschen und französischen<br />
Texte zu erkennen.« Ungeachtet der Tatsache,<br />
dass eine solche Uneinsichtigkeit schon<br />
wegen der quantitativ gravierend voneinander<br />
abweichenden Textcorpora schwer nachvollziehbar<br />
ist, enthob das Hector natürlich nicht der<br />
politischen Verantwortung für die schlechterdings<br />
kaum übersehbaren Differenzen. Ebenso<br />
kurios war Hectors Replik auf die Frage von<br />
Frankes Verteidigern, warum er die Denkschrift<br />
nicht – wie eigentlich verabredet – auch in französischer<br />
Fassung zur Kontrolle an die Stadtverordneten<br />
gegeben hätte? Weil, so Hector, er nach<br />
seiner Parisreise, auf der er sehr vielen maßgeblichen<br />
Franzosen das Druckwerk überreicht habe,<br />
keine Exemplare mehr zur Verfügung gehabt<br />
hätte. Vielleicht hatte Hector tatsächlich gar<br />
nicht damit gerechnet, vor einem Tribunal, das ja<br />
eigentlich einen anderen anklagte, in die Defensive<br />
zu geraten. Eine Einstellung, die freilich für<br />
einen Minister auch reichlich naiv gewesen wäre.<br />
Jedenfalls war und blieb die Verteidigungslinie<br />
Hectors so brüchig, dass ihr Zusammenbruch<br />
absehbar war.<br />
Der kam dann tatsächlich bereits mit der Vernehmung<br />
des zwölften und letzten Zeugen am<br />
ersten Verhandlungstag. Das war eben jener<br />
junge Joseph Goergen, der ehemalige Redakteur<br />
der Saarzeitung, mit dem Hector schon<br />
1920 im Clinch gelegen hatte und der bereits<br />
in den Artikeln jener Monate vor dem Rücktritt<br />
des Bürgermeisters hatte ahnen lassen, dass er<br />
schwergewichtiges Beweismaterial in Händen<br />
hatte. An diesem 23. Februar 1923 wurde es von<br />
Goergen der Öffentlichkeit präsentiert, mit dreijähriger<br />
Verspätung, ganz so, als habe Hectors<br />
Gegenspieler nur auf diesen Moment gewartet.<br />
Zwei Schreiben aus dem Bürgermeisteramt, so<br />
der Zeuge, seien ihm aus dritter Hand zugespielt<br />
worden. Es handelte es sich dabei um jene beiden<br />
bereits oben erwähnten Briefe vom 23. Juli<br />
1919 und vom 15. Januar 1920, die als Begleit- und<br />
Bittschreiben nach Paris gebracht worden waren<br />
und bis zum Zeitpunkt des Prozesses in der saarländischen<br />
Öffentlichkeit offenkundig noch<br />
völlig unbekannt waren. Als Rechtsanwalt Dr.<br />
Steegmann sie nun vor Gericht in ihrer französischen<br />
Übersetzung verlas, gab es im Saal »eine<br />
ungeheure Erregung«, die sich noch steigerte,<br />
nachdem die deutsche Fassung gefolgt war.<br />
Die Bombe, die da gerade geplatzt war, hatte<br />
verheerende Wirkungen. In der hochgradig<br />
emotionalisierten und nationalisierten<br />
Öffentlichkeit, weil hier erstmals ein handfester<br />
Beweis dafür auftauchte, dass die kerndeutsche<br />
Identität der Saarländer tatsächlich von Frankreich<br />
bedroht sein könnte, und zwar durch die<br />
»Untergrundtätigkeit« von Kollaborateuren aus<br />
den eigenen Reihen. Anders als bei den allermeisten<br />
sonstigen Injurienfällen, in denen sich<br />
fast immer zeigte, dass da etwas konstruiert worden<br />
war, um dem Ruf des politisch missliebigen<br />
Kontrahenten zu schaden. Entsprechend hochgradig<br />
erregt zeigte sich zum Ende des ersten<br />
Verhandlungstages vor allem der unversehens<br />
zum Hauptbeschuldigten gewordene Dr. Hector.<br />
Unter Eid könne er beschwören, so der Doktor<br />
mehrfach, dass er das erste Schreiben nicht<br />
kenne, nicht verfasst und nicht dem französischen<br />
Premierminister Clemenceau überreicht<br />
habe. An das zweite Schreiben, dessen deutsches<br />
Original seine Handschrift tragen solle, könne er<br />
sich nicht erinnern. Um den Dingen möglichst<br />
zügig auf den Grund gehen zu können, ordnete<br />
das Gericht an, dass sich sofort eine dreiköpfige<br />
Delegation mit einem Auto der Regierungskommission<br />
auf den Weg nach Saarlouis machen<br />
solle, um das Stadtarchiv nach den Originalschriften<br />
und allen Hinweisen auf die Entstehung<br />
der Denkschrift zu untersuchen und gegebenenfalls<br />
zu beschlagnahmen.<br />
Die Vorlage für den Brief vom 15. Januar 1920<br />
mit der Handschrift Hectors wurde tatsächlich<br />
gefunden. Anhand des Ausgangsjournals für<br />
1920 ließ sich sogar nachvollziehen, wann er unter
saargeschichte|n 39<br />
Der Landesrat war der<br />
wichtigste institutionelle<br />
Gegenspieler<br />
des frankophilen Kurses<br />
von Jacob Hector.<br />
Hier ein Bild aus der<br />
letzten Sitzung des<br />
Landesrats im Saarbrücker<br />
Rathaus,<br />
Dezember 1934. (LA<br />
SB, BSlg.)<br />
welcher Nummer an den Ministre de La Guerre<br />
nach Paris geschickt worden war. Dieser Fund ließ<br />
die letzten Dämme brechen. Als am Montag nach<br />
der samstäglichen Durchsuchung in Saarbrücken<br />
wieder verhandelt wurde, überschlugen sich die<br />
Ereignisse. Hector war nicht mehr vor Gericht<br />
erschienen, hatte ein ärztliches Attest vorlegen<br />
lassen, nach dem er aufgrund von Grippe, nervösen<br />
Beschwerden und Herzleiden für eine Woche<br />
krankgeschrieben war. Auch Hectors Anwalt Donnevert<br />
erschien nicht mehr, hatte nach der neuen<br />
Erkenntnislage sein Mandat niedergelegt, da er<br />
in Kenntnis der ihm bisher vorenthaltenen Informationen<br />
nichts mehr verteidigen könne. Frankes<br />
Anwälte hingegen gingen in die Offensive. Lehmann<br />
erklärte, dass ihn der physische und psychische<br />
Zusammenbruch Hectors angesichts der<br />
erdrückenden Beweislast nicht wundere. Steegmann<br />
hatte bereits am ersten Verhandlungstag<br />
betont, dass er die von Hector reklamierte<br />
Erinnerungslücke für unmöglich halte: Wer<br />
einen solchen Brief an Clémenceau geschrieben<br />
habe, erinnere sich sein ganzes Leben daran. Es<br />
bestünde, so die quasi zu Staatsanwälten mutierten<br />
Verteidiger Frankes, der starke Verdacht, dass<br />
Hector einen Meineid geschworen habe. Sie legten<br />
daher vor Gericht seine Verhaftung nahe, da<br />
Fluchtgefahr bestünde. Außerdem solle sein Haus<br />
durchsucht, seine Privatkorrespondenz beschlagnahmt<br />
und weitere Zeugen gehört werden. Viele<br />
Indizien sprächen dafür, dass Hector auch der Initiator<br />
des ersten, des Begleitschreibens der Denkschrift<br />
gewesen sei.<br />
Mit jedem weiteren Verhandlungstag wuchs der<br />
von ihm selbst initiierte Prozess zu einem völligen<br />
Alptraum für Hector, in politischer wie in<br />
persönlicher Hinsicht. Nur seine, am zweiten Verhandlungstag<br />
durch Gerichtsbeschluss erst sanktionierte<br />
Immunität als quasi »exterritorialer«<br />
Beamter des Völkerbundes, verhinderte seine<br />
sofortige Strafverfolgung. Eine amtsärztliche<br />
Untersuchung Hectors sollte nun feststellen, ob<br />
er weiter verhandlungsfähig sei – und eventuell<br />
am Krankenbett befragt werden könne. Dass<br />
der buchstäbliche Fall eines Ministers auch das<br />
Gericht zunehmend nervös machte, zeigte sich<br />
am dritten Prozesstag. Als der Noch-Angeklagte<br />
Franke angeblich wenige Minuten zu spät vor<br />
Gericht erschien, erhielt er eine scharfe Rüge des<br />
Vorsitzenden. Und an Verteidiger Lehmann richtete<br />
Dr. Messinger die hier vollkommen unangemessen<br />
ironische Frage, ob er deshalb nun<br />
auch die Verhaftung Frankes beantragen wolle.<br />
Der derart aus der Rolle gefallene Richter dokumentierte,<br />
dass der Fall Hector längst zum Politikum<br />
geworden war, dessen Auswachsen zur<br />
Staatskrise man befürchten konnte. Als die Verteidigung<br />
Frankes immer weitere Zeugen vor<br />
Gericht bestellen wollte, um das ganze Ausmaß<br />
der Saarlouiser »Frankreichpolitik« der Jahre<br />
1919/20 zu beleuchten, schob der Regierungschef<br />
persönlich einen Riegel vor: Seinen höchsten<br />
Beamten, die vor die Saarbrücker Schwurkammer<br />
geladen werden sollten – darunter auch der<br />
Generalsekretär und nachmalige Reko-Minister<br />
Morize –, erteilte er Aussageverbot. Da zeitgleich<br />
jener große Bergarbeiterstreik begonnen hatte,<br />
der hundert Tage währen sollte und zur »nationalen«<br />
Kraftprobe wurde, wollte Rault offenbar<br />
nicht noch eine zweite offene Flanke haben.<br />
Sein bisheriger Wohlfahrtsminister hatte da<br />
allerdings schon die Konsequenzen gezogen<br />
und endgültig das Handtuch geworfen. In einer<br />
Erklärung, die sein neuer Rechtsanwalt Flesch am<br />
vierten Verhandlungstag verlesen ließ, gab Hector<br />
an, sich nun doch erinnern zu können, den<br />
ersten Brief seinem Oberstadtsekretär diktiert<br />
und den zweiten selbst geschrieben zu haben.<br />
Die Zeitungslektüre der Namen seiner städtischen<br />
Angestellten, die an der Aktion damals<br />
beteiligt waren, habe seiner Erinnerung auf die<br />
Sprünge geholfen. Im Fall des zweiten Briefes
Mitglieder der<br />
Regierungskommission<br />
unter Präsident<br />
Rault (m.) und französische<br />
Militärs<br />
besuchen das Festgelände<br />
auf dem Großen<br />
Exerzierplatz in<br />
Saarbrücken anlässlich<br />
des französischen<br />
Nationalfeiertages.<br />
(LA SB, BSlg.)<br />
revidierte er ebenfalls seine erste eidliche Aussage,<br />
begründete die fehlende Erinnerung am<br />
ersten Verhandlungstag mit dem Stress einer<br />
zehnstündigen Gerichtsverhandlung und der Tatsache,<br />
dass ihm, einem Menschen, der sich ständig<br />
mit geistigen Materien zu befassen habe, die<br />
Erinnerung an das ein oder andere Detail schnell<br />
eingetrübt werden könne. Im Übrigen habe er<br />
aber beide Aussagen in dem subjektiven Bewusstsein<br />
getätigt, die Wahrheit zu sagen. So wackelig<br />
– oder eher: vorgeschoben – diese Aussagen auch<br />
wirken mochten, sie kamen doch noch gerade<br />
rechtzeitig, um den juristisch begründeten Vorwurf<br />
eines vollzogenen Meineids loszuwerden. [39]<br />
Noch am gleichen Tag erklärte Hector in einem<br />
Schreiben an die Regierungskommission, dass er<br />
sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht<br />
mehr wahrnehmen könne. Als seinen Stellver-<br />
treter benannte er Julius Land, ehemaliger Landrat<br />
des Kreises Saarlouis. [40]<br />
Nur das Ende des Prozesses in Saarbrücken verhinderte,<br />
dass noch viel mehr Details über die<br />
Beziehungen zwischen Saarlouis und Paris in<br />
Hectors Amtszeit als Bürgermeister ans Licht<br />
kamen. Und die Liste der Zeugen, die noch aufgeboten<br />
worden waren, sprach dafür, dass da<br />
noch so einiges zu sagen gewesen wäre. Am<br />
sechsten und letzten Verhandlungstag erschien<br />
aber kein einziger der Zeugen mehr vor Gericht,<br />
ob sie nun krank gemeldet waren oder ein Aussageverbot<br />
von höchster Stelle hatten. Außerdem<br />
erklärte Dr. Flesch, der Anwalt des ursprünglichen<br />
Nebenklägers Hector, dass der Strafantrag<br />
seines Mandanten gegen Franke zurückgezogen<br />
worden sei. So gab es nichts mehr zu verhandeln.<br />
Damit fehlte allerdings nun auch das Forum für<br />
die weitere öffentliche Aufarbeitung. Immerhin<br />
sorgten die Verteidiger Frankes noch für einen<br />
unüberhörbaren Schlussakkord. Steegmann<br />
taxierte Frankes mediale Enthüllung im Nachhinein<br />
als »eine höchst verdienstvolle Tat, (…) die<br />
[39] Hectors Revision seiner ersten Aussagen und sein dazu<br />
gemachter Kommentar zielte v. a. auf die §§ 1<strong>58</strong> und 163<br />
StGB, nach denen die Strafe bei Meineid auf die Hälfte<br />
bis ein Viertel reduziert wurde beziehungsweise Straflosigkeit<br />
zur Folge hatte, wenn eine gegenläufige Aussage<br />
vor der Anzeige wegen Meineids erfolgte, wenn<br />
der »Meineid« niemand geschadet hatte und er aus<br />
Fahrlässigkeit erfolgt war.<br />
[40] In seinem Schreiben an die Regierungskommission<br />
heißt es, dass Hecors Krankheit ihn hindere, »pour<br />
plusieurs semaines« an der Arbeit der Reko teilzunehmen,<br />
und dass er daher Julius Land, »ancien Landrate<br />
de Sarrelouis«, als seinen Stellvertreter benenne. Hector<br />
kannte Land auch als Stadtverordneten, er gehörte<br />
dem Rat bereits vor Hector an. Vgl. Procès-verbal du<br />
Conseil de Gouvernement vom 3. März 23 (LA SB, NL<br />
Koßmann 35, S.73) sowie: StA SLS das Beschlussbuch<br />
Stadtverordnetenversammlung 1913–1920.
saargeschichte|n 41<br />
der ganzen Saarbevölkerung zum Wohle<br />
gereicht und für die sie ihm immer dankbar<br />
sein wird«. Und Kollege Lehmann plädierte<br />
entgegen der ursprünglichen Vorstellung<br />
des Gerichts, dass der Staat die Kosten des<br />
Verfahrens trage, dafür, dass alle Kosten<br />
von Hector übernommen werden müssten,<br />
einschließlich jener Unkosten, die dem<br />
Angeklagten entstanden waren. Genau so<br />
beschloss es dann das Gericht. [41]<br />
Vollständiger als Hector konnte man ein<br />
Gerichtsverfahren eigentlich kaum verlieren.<br />
Der Prozess hatte als Beleidigungsklage<br />
gegen einen Redakteur begonnen<br />
und endete als völliges Debakel für einen<br />
Minister. Der Nachhall dieses spektakulären<br />
Verfahrens war noch lange zu hören,<br />
weit über das Prozessende, ja über das<br />
Ende der Völkerbundszeit hinaus.<br />
Ein asiatisches<br />
Gesicht in blau-weißrot,<br />
die Kokarde auf<br />
dem Kopf und eine<br />
(falsche) Schlange,<br />
die das Saargebiet<br />
vergiftet: Die Attribuierung<br />
des frankophilen<br />
Saarbundes<br />
auf einem »deutschen«<br />
Plakat anlässlich<br />
der Landesratswahlen<br />
von 1932 war<br />
eindeutig. (Sammlung<br />
Gerhard Paul)<br />
Vom Nachbeben zum Nachleben<br />
Vor einigen Jahren hat Alexis Andres, französischer<br />
Diplomat und Enkel des früheren saarländischen<br />
Innenministers Edgar Hector, einen<br />
Artikel über die politische Vorstellungswelt seines<br />
Großvaters publiziert. Auf der Suche nach<br />
den frankophilen Wurzeln von Hectors saarländischer<br />
Politik im teilautonomen Saarstaat<br />
kommt Andres zu Beginn auch kurz auf das Wirken<br />
seines Urgroßvaters Jakob Hector zu sprechen.<br />
Ein Grund für dessen Rücktritt aus der<br />
Reko im März 1923 sei die Sorge des Urgroßvaters<br />
gewesen, sein Familienleben vor den politischen<br />
Spannungen schützen zu müssen. Spannungen,<br />
die vor allem auf die »scharfen Angriffe« der<br />
»prodeutschen Opposition« im Saarland gegen<br />
die »frankophilen Neigungen« Jakobs zurückzuführen<br />
gewesen seien. [42]<br />
Nach dem bisher zum Fall Hector Dargelegten<br />
möchte man den einen oder anderen Widerspruch<br />
gegen diese etwas einseitige Begründung<br />
erheben. Im unmittelbaren Handlungszusammenhang<br />
der frühen 1920er Jahre waren<br />
es vorderhand und zuallererst natürlich nicht<br />
familiäre Gründe, die den Rücktritt verursachten,<br />
[41] Infos und Zitat nach: Der Hectorprozeß. Der sechste<br />
Verhandlungstag, in: SZ v. 9. März 23.<br />
[42] Alexis Andres, Edgar Hector und die Saarfrage 1920-<br />
1960, in: Rainer Hudemann u.a. (Hgg.), Grenz-Fall. Das<br />
Saarland zwischen Frankreich und Deutschland 1945–<br />
1960, St. Ingbert 1997, S. 163–176, hier S. 164. Vgl auch die<br />
Straßburger Maîtrise d’histoire des gleichen Autors:Edgar<br />
Hector et la question sarroise 1920–1957.<br />
sondern die in einem einwandfrei rechtsstaatlichen<br />
Verfahren nachgewiesenen ‚Grenzüberschreitungen’<br />
während Hectors Amtszeit als<br />
Bürgermeister von Saarlouis und sein haarscharf<br />
am juristisch sanktionierten Meineid vorbeischrammendes<br />
Verhalten vor Gericht. Als Minister<br />
einer Regierungskommission, die ohnehin<br />
ständig im Kreuzfeuer der (inter)nationalen Kritik<br />
stand, war er so schlechterdings nicht mehr<br />
haltbar, sein Rücktritt kam also quasi zwangsläufig.<br />
Dennoch wäre es nicht gerechtfertigt,<br />
Andres’ Darstellung einfach als pure Apologetik<br />
im Dienst einer möglichst ungetrübten Familienbiografie<br />
zu qualifizieren. Das Narrativ der Familie<br />
Hector hat in diesem Punkt nämlich durchaus<br />
auch seine historisch berechtigten Seiten. Zum<br />
einen, weil völlig überzogene Anfeindungen der<br />
Hectors durch eine »deutsche Opposition« tatsächlich<br />
stattfanden – diese ihre aggressiv-ausgrenzenden<br />
Wirkungen aber erst später und in<br />
anderem Kontext entfalteten. Zum anderen, weil<br />
die öffentliche (Selbst-)Demontage einer politischen<br />
Führungsfigur wie Jakob Hector auch ein<br />
unmittelbares Nachbeben in der Völkerbundszeit<br />
verursachte. Dass davon er und seine Familie<br />
persönlich betroffen sein würden, war kaum<br />
anders zu erwarten, gerade bei nationalen Fragen,<br />
die in den 1920ern stets in unmittelbarer<br />
Verbindung mit denen der Ehre verhandelt wurden.<br />
Mit welcher Hypothek Hector den Neustart in<br />
Privat- und Berufsleben schaffen musste, machte<br />
schon die Eingabe der Saarparteien an den<br />
Völkerbund vom 13. März 1923 klar. »In den Augen
An einem Umzug<br />
frankophiler Organisationen<br />
des Saargebietes<br />
durch Paris<br />
nahm Anfang der<br />
1930er Jahre der<br />
junge Edgar Hector,<br />
Sohn Jakob Hectors<br />
und nachmaliger<br />
saarländischer Innenminister,<br />
als Gallionsfigur<br />
der »Sarre« in<br />
tragender Funktion<br />
teil.<br />
der gesamten Saarbevölkerung«, heißt es da, »ist<br />
und bleibt Dr. Hector allzeit ein Meineidiger und<br />
ein Verräter. Jedermann ist empört, dass ein derartiger<br />
Mann eine so lange Zeit der Vertreter der<br />
Saarbevölkerung in der Regierungskommission<br />
des Saargebietes sein konnte.« Da wir keinen<br />
unmittelbaren Einblick in die Familiengeschichte<br />
jener Zeit besitzen, können wir nur ahnen, was<br />
eine solche Belastung für das Leben in und um<br />
den Großen Markt 16 in Saarlouis bedeutete.<br />
Fest steht zunächst einmal nur, dass Jakob Hector<br />
nach seinem knapp dreijährigen Intermezzo<br />
als Berufspolitiker wieder in seine Arztpraxis<br />
zurückkehrte. Und wenn die Taxierungen späterer<br />
Jahre über diese Zeit zutreffen, dann hatte<br />
Hector nach 1923 wieder eine gut gehende Praxis,<br />
die ein ordentliches Familieneinkommen garantierte.<br />
Eine solche erfolgreiche Reintegration war<br />
keineswegs selbstverständlich nach dem öffentlichen<br />
Absturz, bringt in solchen Fällen der politische<br />
Niedergang doch oft einen harten Einschnitt<br />
in der sozialen Reputation mit sich. Aber vielleicht<br />
war es auch genau umgekehrt. Nach verschiedenen<br />
Erzählungen war Jakob ein guter und<br />
beliebter Arzt, und es könnte genau diese Positionierung<br />
in der lokalen Gesellschaft gewesen sein,<br />
die ihn die Demontage als politische Führungsfigur<br />
relativ schadlos überstehen ließ. [43]<br />
Eine andere Frage ist, wie die dramatischen Ereignisse<br />
von 1923 auf die Kinder der Hectors wirkten.<br />
Die drei ältesten waren Jungen, Arno, Kurt<br />
und Edgar, zum Zeitpunkt des Prozesses knapp<br />
17, 15 und 12 Jahre alt, in einem Alter also, da die<br />
Vaterfigur eine doppelt wichtige Rolle spielt.<br />
Zumal in einer Zeit wie damals, als die Welt der<br />
männlichen Sozialisation von lauter (nationalen)<br />
Heroen bevölkert war. Es braucht nicht viel<br />
Phantasie, um sich vorzustellen, welches Echo die<br />
öffentliche Brandmarkung des Vaters als nationaler<br />
»Verräter« und »Meineidiger« in dieser<br />
[43] Die Eingabe vom 13. März 23 zitiert nach LA SB, NL<br />
Schneider 239; die Einschätzung der Einnahmen aus<br />
dem Praxisbetrieb von Hector in der Völkerbundszeit<br />
nach: einer Taxierung der Ärztekammer in den Entschädigungsakten<br />
der Hectors: LA SB, LEA 14216, Bl. 24.<br />
pubertären Welt ausgelöst hat. Und dass der tägliche<br />
Gang zur deutschen Schule zu einem Spießrutenlauf<br />
werden konnte. Was wiederum ein<br />
Grund dafür gewesen sein mag, dass der Vater<br />
den jüngsten Sohn Edgar für seine letzten Schuljahre<br />
aufs Kolleg der Jesuiten nach Metz schickte.<br />
Die Fürsorge für die Kinder, sie spielte im Hause<br />
Hector sicher eine besonders große Rolle, nicht<br />
zuletzt seit den Erfahrungen aus der ›Gründerzeit‹<br />
der Familie, als dem jungen Paar 1905 binnen<br />
drei Wochen die ersten drei Kinder im Alter von<br />
wenigen Monaten bis zwei Jahren verstarben. [44]<br />
Obwohl man Anfang des 20. Jahrhunderts mit<br />
einem solchen ›schnellen Kindstod‹ viel häufiger<br />
rechnen musste als heute, war das für einen<br />
Arzt und tiefgläubigen Katholiken fraglos eine<br />
traumatische Erfahrung. Umso mehr wird sich<br />
der Vater nach den Ereignissen der frühen 20er<br />
bemüht haben, Schaden von seinen verbliebenen<br />
Kindern abzuhalten. Gemeinsam mit seinem in<br />
Paris auf das Jurastudium wartenden Sohn Edgar<br />
erwarb er 1930 sogar die französische Staatsbürgerschaft.<br />
Vermutlich deshalb, weil das sonst<br />
für den noch minderjährigen Edgar nicht so ohne<br />
weiteres möglich gewesen wäre.<br />
Was von außen – und das heißt: in der historischen<br />
Rückschau wie in der Perspektive von<br />
Hectors Gegenspielern – wie die konsequente<br />
Fortführung eines frankophilen Lebensweges<br />
aussah, das könnte also auch hier noch in eine<br />
andere Richtung weisen. Ähnlich wie bei seinen<br />
profranzösischen Entscheidungen der Nachkriegsjahre<br />
könnte der Weg zur französischen<br />
Staatsbürgerschaft vor allem pragmatischen<br />
Gründen geschuldet gewesen sein, Einsicht in<br />
jene Notwendigkeiten dokumentieren, die man<br />
zu beachten hatte, wenn man die beste Lösung<br />
für seine »Schutzbefohlenen« finden wollte.<br />
Umgekehrt bedeutete dies allerdings auch, dass<br />
Hector nicht die gleichen unverrückbaren Vorstellungen<br />
von Nation und Nationalgefühl teilte<br />
wie die allermeisten seiner (deutschen) Zeitgenossen.<br />
Dass alles Nationale bei ihm nicht jenes<br />
zunehmend ethnisch-völkisch grundierte Fundament<br />
besaß, das die Volksgemeinschaft gerade<br />
nach den Fronterlebnissen des Ersten Weltkriegs<br />
entwickelt hatte. Dass ihm seine Nation<br />
mithin nicht in Fleisch und Blut übergegangen,<br />
nicht untrennbar mit seiner physischen Existenz<br />
verbunden, sondern im Notfall eben auch<br />
austauschbar war. Wäre Hectors Leben einfach<br />
einem frankophilen Muster gefolgt – und zwar in<br />
[44] Vgl.: Klauck, Einwohner Saarlouis (wie Anm.2), Nr. 22270,<br />
S. 553.
saargeschichte|n 43<br />
unserem heutigen, eher positiv konnotierten Verständnis<br />
ebenso wie im durchweg negativen seiner<br />
Zeitgenossen – dann hätte diese Biographie<br />
in vielen Dingen sicher anders ausgesehen. Dann<br />
wäre er bestimmt nach dem GAU von 1923 und<br />
erst recht nach dem Super-GAU von 1935–45<br />
nicht in Saarlouis geblieben beziehungsweise<br />
dorthin zurückgekehrt. Dann hätte er ohne Zweifel<br />
auch sprachlich schon viel früher eine größere<br />
Annäherung an Frankreich gesucht (Hector, so<br />
wird berichtet, hatte hingegen noch in der Exilzeit<br />
aus sprachlichen Gründen Schwierigkeiten,<br />
seinen Arztberuf in Frankreich auszuüben) und<br />
wäre nach den schlimmen Erfahrungen mit großer<br />
Wahrscheinlichkeit dauerhaft in der Grande<br />
Nation geblieben. [45]<br />
Das Beispiel der Frankophilie deutet an, dass<br />
wir sehr viel intensiver über die Kategorien des<br />
Nationalen nachdenken müssen, wenn wir all<br />
das verstehen wollen, was mit dem Fall Hector<br />
verbunden ist. Wir müssen diese Kategorien historisieren,<br />
kontextualisieren, anthropologisieren,<br />
quasi verflüssigen, um nicht durch ein statisches<br />
Begriffsverständnis die Geschichte der 1920er<br />
Jahre zu vernebeln, anstatt sie aufzuklären. Das<br />
gilt für das Selbstverständnis der historischen<br />
Akteure von einst ebenso wie für die wechselnden<br />
Bilder, die wir Nachgeborenen uns von ihnen<br />
machen. Dass das Verdikt vom frankophilen Dr.<br />
Hector, mit dem die Saardeutschen in den Zwanzigern<br />
ihren Zeitgenossen belegten, etwas ganz<br />
anderes konnotierte, als wenn wir heute – aus<br />
der Sicht eines Deutschen – von einem frankophilen<br />
Saarländer sprechen, ist unmittelbar<br />
nachvollziehbar. Der Unterschied von gestern zu<br />
[45] Zur Entwicklung des Nationalismus in Deutschland vgl.<br />
Otto Dann, Nation und Nationalismus in Deutschland<br />
1790–1990, München 1993, S. 173; Erich Hobsbawm, Nation<br />
und Nationalismus, S. 212ff. Die Informationen zu<br />
Hectors Berufstätigkeit in Frankreich und den mangelnden<br />
Französischkenntnissen nach seiner Entschädigungsakte<br />
in: LA SB, LEA 14216, Bl. 18ff.<br />
heute liegt vor allem darin,<br />
dass bei buchstäblichem<br />
Gleichklang die Frankreichliebe<br />
heute nicht nur denkbar,<br />
sondern möglich, gar<br />
wünschenswert geworden<br />
ist.<br />
Insofern hat die Frankophilie<br />
eine verblüffend ähnliche<br />
Karriere gemacht wie<br />
jene Diskurse über Leib und<br />
Körper, die mit den Vorstellungen<br />
von Nation – wie bereits angedeutet<br />
– so eng verbunden waren. Nichts hat den Körper<br />
in seinen möglichen und verbotenen Äußerungsformen<br />
so eindeutig definiert wie eine scheinbar<br />
ewig festgefügte Ordnung der Geschlechter.<br />
Alles, was von dieser sexuell codierten Ordnung<br />
abwich, wurde als Perversion empfunden, als<br />
widernatürliche Abweichung von jener selbstevidenten<br />
Norm, die die Welt zusammenhielt.<br />
Auf dieser gedanklichen Metaebene betrachtet,<br />
funktionierten Norm und Abweichung in der<br />
Geschlechterordnung ebenso wie in der Ordnung<br />
nationaler Identitäten. Und so nimmt es<br />
kaum Wunder, dass man die Frankophilie lange,<br />
zum Teil noch immer, sprachlich ebenso kategorisierte<br />
wie Homosexualität: Von Neigungen<br />
ist in dem einen wie in dem anderen Fall bis<br />
heute die Rede. Wobei es diese Neigungen früher<br />
zu unterdrücken, gar auszumerzen galt, während<br />
sie mittlerweile als eine von vielen Möglichkeitsformen<br />
gelebt werden wollen. Überspitzt<br />
formuliert entspricht heutige Diversität der<br />
Lebensstile der Internationalisierung, Europäisierung,<br />
Globalisierung politischer Identitätsvorstellungen.<br />
Der Vergleich von nationalen Fragen und Körperbildern<br />
lässt ahnen, wie schwer es ist, eine adäquate<br />
Beurteilung des Falles Hector, seiner Folgen<br />
und der mit ihm verbundenen Erinnerung zu finden.<br />
Weil hier gerade das, was scheinbar ewig gültigen<br />
Naturgesetzen unterliegt, sich in Wirklichkeit<br />
als den Gesetzen der Relativität gehorchend<br />
offenbart. Tatsächlich ergibt sich je nach Standpunkt<br />
ein ganz anderes Bild, einschließlich<br />
jener Ausblendungen und Verfälschungen, die<br />
Perspektivwechsel eben mit sich bringen. So war<br />
bereits die zeitgenössische Auseinandersetzung<br />
von vielen kognitiven Dissonanzen begleitet. Die<br />
saardeutschen Gegenspieler Hectors, infiziert<br />
von der Sozialisation im Kaiserreich und befeuert<br />
von den Erfahrungen des Weltkriegs, konnten<br />
des Doktors Aktivitäten kaum anders deuten<br />
denn als schändlichen Verrat und Betrug – wie<br />
Ein beredtes Zeugnis<br />
für den Wandel der<br />
saarländischen Vorstellung<br />
von Frankophilie<br />
stellte der<br />
erfolgreiche Wahlkampf<br />
des nachmaligen<br />
Ministerpräsidenten<br />
Oskar<br />
Lafontaine im Jahr<br />
1985 dar: Das »savoir<br />
vivre« war staatstragend<br />
geworden.<br />
(LA SB, Plakatsammlung)
Edgar Hector bei<br />
einem Empfang<br />
des saarländischen<br />
Ministerpräsidenten<br />
im Ministerpräsidium<br />
in der Saarbrücker<br />
Schillerstraße 1949.<br />
Neben Hector Josef<br />
Kurtz (l.) und Emil<br />
Weiten (r.)<br />
sonst hätte man eine Politik erklären können, sie<br />
so offenkundig der natürlichen Ordnung widersprach?<br />
Sie übersahen dabei ganz (und vermutlich<br />
auch gerne), dass Hector sehr wohl im Interesse<br />
des (lokalen) Gemeinwohls handelte, dass<br />
er diese Gemeinschaft aber ganz offenkundig<br />
nicht als vom nationalen Blut schicksalhaft<br />
zusammengehaltenen Volkskörper begriff. Dass<br />
gerade er als Arzt dem engen Konnex von Körper<br />
und Nation skeptisch gegenüberstand, ist vielleicht<br />
kein Zufall, zumal solche transzendenten<br />
Gemeinschaftsvorstellungen in einem unmittelbaren<br />
Konkurrenzverhältnis zu denen »seiner«<br />
heiligen katholischen Kirche standen.<br />
Ob man Hectors Politik der Jahre 1919/20 im<br />
juristischen Sinne überhaupt als »Landesverrat«<br />
hätte sanktionieren können, ist eine andere<br />
Frage. Immerhin befand sich die Saar damals in<br />
so etwas wie einem nationalen Schwebezustand,<br />
schufen das Besatzungsregime, die Möglichkeiten<br />
einer friedensvertraglichen Neuregelung<br />
und schließlich der internationale Status der<br />
Völkerbundsregierung ganz andere Voraussetzungen<br />
als es vor 1919 oder nach 1935 der Fall<br />
gewesen wäre. Selbst wenn aber Hector in diesem<br />
Punkt einen Freispruch vor einem virtuellen<br />
Gericht und der realen Geschichte erreichen<br />
könnte, so war doch sein Verhalten nicht frei von<br />
Schuld, von Fehlern und Fehlwahrnehmungen.<br />
Denn so sehr er sich mit seiner Frankreichpolitik<br />
eigentlich für das Wohl seiner Stadt einsetzen<br />
wollte, so sehr übersah er dabei gut und gerne,<br />
dass er sich über die nationalen Gedanken und<br />
Gefühle der allermeisten Mitbürger_innen in seiner<br />
Kommune recht eigenmächtig hinwegsetzte.<br />
Dass er damit die demokratischen Spielregeln im<br />
Saarlouiser Rathaus missachtete. Dass er sogar<br />
bereit war, den großen Mehrheitswillen mit<br />
einem Doppelspiel zu delegitimieren. Ob er dabei<br />
wissentlich trickste oder nur in wohlmeinender<br />
Absicht Dinge zuließ, von denen er selbst lieber<br />
nichts wissen wollte, ist letztlich nur ein gradueller<br />
Unterschied. Vermutlich glaubte er einfach,<br />
auch da ganz Arzt, die einzig richtige Medizin für<br />
seine politischen »Patienten« zu haben.<br />
Die kollektive Erinnerung des Saarlandes an den<br />
Fall Hector hat sich sehr lange gehalten, teils<br />
namentlich, noch viel mehr aber als Metapher für<br />
jenes Feld der deutsch-französischen Wechsellagen,<br />
in dem das Land seine nationale, staatliche<br />
und kulturelle Identität gesucht und gefunden<br />
hat. Die langlebige Erinnerung hat sicher damit<br />
zu tun, dass der Fall Hector den Anfang unseres<br />
»Saarhunderts« beschreibt, dass er genau an jener<br />
Schnittstelle stattfand, an dem staatliche Identitäten<br />
– erstmals einschließlich einer solchen des<br />
Saarlandes selbst – neu verhandelt und nationale<br />
Gefühlslagen neu befeuert wurden. Im Fall Hector<br />
steckte damit bereits die gesamte Potenzialität<br />
des saarländischen »Sonderwegs«, der im<br />
deutsch-französischen Antagonismus begann<br />
und im Zeichen deutsch-französischer Freundschaft<br />
bis heute fortlebt. Die unterschiedliche<br />
Perspektivierung der nationalen Frage, die schon<br />
den Hectorprozess so explosiv gemacht hatte,<br />
bestimmt auch die historische Rückschau auf den<br />
Fall. Die einen, deren nationales Blut die Frankophilie<br />
bereits in den 1920ern in Wallung gebracht<br />
hatte, sahen in ihm so etwas wie die Erbsünde<br />
des Separatismus’ und der patriotischen Unzuverlässigkeit.<br />
Der Fall Hector stand deswegen<br />
ganz folgerichtig stets am Anfang jenes deutschnationalen<br />
Narrativs vom Saarland, das nach<br />
den nationalsozialistischen Monstrositäten zwar<br />
modifiziert, aber nicht grundsätzlich in Frage<br />
gestellt werden musste. Mit dem Innenminister<br />
Edgar Hector hatte die »deutsche« Opposition<br />
auch im frankophilen Nachkriegssaarland einen<br />
glänzend funktionierenden Gegenspieler aus der<br />
gleichen Familie gefunden, der damit die alten<br />
Vorstellungen vom Zusammenhang von Blut und<br />
Nation quasi ex negativo spiegelte.
saargeschichte|n 45<br />
Der seit 1930 französische<br />
Saarländer Jacob<br />
Hector (3.v.l.) unter<br />
Franzosen: Hoher<br />
Kommissar Gilbert<br />
Grandval, General<br />
Joseph Louis Marie<br />
Andlauer, Madame<br />
Christine Grandval<br />
(erste Reihe, v.l.n.r.).<br />
(LA SB, NPressPhA)<br />
Auf der anderen Seite der saarländischen Sonderwegsgeschichte<br />
stand die Fraktion derer,<br />
deren nationale Identitätsvorstellungen entweder<br />
bereits nach dem Ersten Weltkrieg Flexibilitäten<br />
zuließen (eine winzige Minderheit)<br />
oder nach den schlimmen Erfahrungen der<br />
Nazizeit einem leiblich-völkisch begründeten<br />
Nationalismus endgültig abgeschworen hatten.<br />
In dieser bis heute lebendigen Tradition hat die<br />
Erinnerung an Jakob Hector einen neuen Platz<br />
erhalten. Seine frankophile Politik wurde nicht<br />
nur vom Ruch des Vaterlandsverrats befreit, sondern<br />
retrospektiv geadelt: durch Hectors Beitrag<br />
zum Widerstand gegen Hitler (der 1933 mit<br />
der Gründung der von Frankreich unterstützten<br />
Saarländischen Wirtschaftsvereinigung begann),<br />
durch seine Emigration nach Frankreich, durch<br />
seinen Status als Verfolgter des Nationalsozialismus.<br />
Dass auch die Umstände des Falles Hector<br />
vor diesem Hintergrund unter eine Art Generalamnestie<br />
gestellt wurden, ist moralisch absolut<br />
verständlich, historiographisch aber fragwürdig.<br />
Nicht nur, weil der Prozess bereits zehn Jahre<br />
vor der nationalsozialistischen Machtergreifung<br />
stattgefunden hatte, sondern auch, weil diese<br />
Überblendung nicht unbedingt zu einer intensiveren<br />
Beschäftigung mit diesem wichtigen Kapitel<br />
saarländischer Geschichte beigetragen hat.<br />
Und heute, was ist geblieben in der saarländischen<br />
Erinnerung an Jakob Hector und seinen Fall?<br />
Man hat auch nach längerer Beschäftigung das<br />
Gefühl, dass es abgesehen von der bereits eingangs<br />
benannten Fanalwirkung seines Namens<br />
wenige Fakten aber viele moralische Grautöne<br />
gibt. Weil die »deutsche« Tradition ihn nicht<br />
gänzlich zur Antifigur aufbauen konnte (dagegen<br />
stand sein antinazistisches Engagement) und<br />
die antinazistische Tradition ihn nicht rundweg<br />
positiv vereinnahmen konnte (dagegen stand<br />
sein undemokratisches Verhalten am Beginn des<br />
»Saarhunderts«), wurde er in eine Ecke des saarländischen<br />
Geschichtsraumes gestellt, die man<br />
am besten nur wenig, ganz diskret beleuchtet.<br />
Selbst in Saarlouis, jener Stadt, in der er sein halbes<br />
Leben gewohnt und gearbeitet und für die<br />
er riskante Reisen nach Paris unternommen hat,<br />
selbst in dieser »seiner« Stadt stammt die heutige<br />
Erinnerungskultur eigentlich von gestern.<br />
Wäre der frankophile Saarstaat nicht gewesen,<br />
würde man Hectors Namen in der Saarlouiser<br />
Öffentlichkeit vermutlich vergeblich suchen.<br />
Denn nur damals gab es für ihn eine öffentliche<br />
Rehabilitation, er erhielt die Ehrenbürgerschaft<br />
der Stadt und schon ein Jahr später (1951), noch<br />
zu seinen Lebzeiten, wurde eine Straße nach<br />
ihm benannt. An der vielleicht deswegen wiederum<br />
das Erstaunlichste ist, dass sie die »Kulturrevolution«<br />
von 1956/57 überlebt hat.<br />
Aber wer weiß, vielleicht gibt es in Saarlouis<br />
ja irgendwann ein Hector-Revival. In Zeiten, in<br />
denen Kulturmanagement und Stadtmarketing<br />
den Reiz der Frankophilie neu entdeckt haben,<br />
in denen man mit strahlenden Augen und ohne<br />
nationale Störfeuer seine französische Festungsgeschichte<br />
präsentieren kann (natürlich auf<br />
Deutsch), in denen man savoir vivre zu Füßen<br />
eines saarlouis-französischen Generals zelebriert,<br />
der nicht nur zu leben, sondern natürlich auch zu<br />
töten verstand – in diesen verrückten, schönen,<br />
modernen Zeiten könnte man sich doch eigentlich<br />
auch wieder mehr an jenen frankophilen<br />
Mann erinnern, der vor hundert Jahren ganz<br />
heimlich große Pläne für seine Stadt entwickelt<br />
hatte. Wären sie aufgegangen, die Saarlouiser<br />
müssten heute nicht mehr nur von der heimlichen<br />
Hauptstadt des Saarlandes schwärmen.<br />
Sie könnten sogar auf das Adjektiv verzichten.
mit dem rütlischwur heim ins reich!<br />
Der Abstimmungskampf von 1935 und seine eidgenössischen Vorbilder<br />
von florian bührer<br />
Toni Zepf, Saarkundgebung<br />
am Niederwalddenkmal<br />
27.<br />
August 1933, Farblithographie,<br />
100 x<br />
155 cm, Auftraggeber:<br />
Saarvereine. (Institut<br />
für Zeitungsforschung<br />
Dortmund)<br />
An der Saar kam es 1935 zu regelrechten Plakatschlachten.<br />
Der Grund: Wie im Versailler Vertrag<br />
vorgesehen, fand am 13. Januar 1935 unter Aufsicht<br />
des Völkerbunds eine Volksabstimmung<br />
statt. Die Saarländer und Saarländerinnen sollten<br />
über ihre Zukunft entscheiden. Vor allem von<br />
deutscher Seite ging der Abstimmung eine massive<br />
Propagandakampagne voraus. Unter Führung<br />
der NSDAP hatten sich 1933 im Saarland<br />
rechte Parteien zur »Deutschen Front« formiert,<br />
die vom Deutschen Reich auch finanziell unterstützt<br />
wurde. Egal ob Befürworter oder Gegner<br />
eines Anschlusses an das Dritte Reich – ihre visuellen<br />
Argumente ähnelten sich stark. Blickt man<br />
aus der Schweiz auf die eingesetzten Bildmotive<br />
ist man überrascht. Denn die sind auch im eidgenössischen<br />
Bildgedächtnis omnipräsent.<br />
An der Saar sei es bei der Saarabstimmung 1935<br />
zu »regelrechten Plakatschlachten« [1] gekommen,<br />
schreiben die Historiker und Autoren Gerhard<br />
Paul und Ralph Schock. Das verwundert insofern,<br />
da in Deutschland Volksabstimmungen nur selten<br />
stattfinden und folglich das Abstimmungsplakat<br />
hier ein Nischendasein fristet. Anders<br />
in der Schweiz. Flaniert man dort vor einem<br />
Abstimmungssonntag durch den öffentlichen<br />
Raum, wird man von der Vielzahl an Plakaten<br />
förmlich erschlagen. Mit Beginn des<br />
Schweizer Bundesstaates und der ersten eidgenössischen<br />
Volksabstimmung 1848 tauchten<br />
allmählich immer mehr Plakate an Häuserund<br />
Plakatwänden auf. Nicht so in Deutschland.<br />
Denn zur gleichen Zeit wurde hier das politische<br />
Plakat verboten. Das Zensurgesetz blieb<br />
bis 1918 in Kraft, politische Plakate waren in<br />
Deutschland bis 1914 in Gänze verboten. [2]<br />
Es dauerte beinahe 20 Jahre, bis im Saarland der<br />
besondere Plakattypus des Abstimmungsplakats<br />
auf deutschem Bode eine kurze Blütezeit erfuhr.<br />
Die beiden Abstimmungskämpfe von 1935 und<br />
1955 zeigen die wechselvolle Geschichte des Saar-<br />
[1] Gerhard Paul; Ralph Schock, Saargeschichte im Plakat<br />
1918–1957, Saarbrücken 1987, S. 7.<br />
[2] Kai Artinger, Das politische Plakat – Einige Bemerkungen<br />
zur Funktion und Geschichte. In: ders (Hg.), Die Grundrechte<br />
im Spiegel des Plakats von 1919 bis 1999, Berlin<br />
2000, S. 15–22, hier S. 19.<br />
landes zwischen Deutschland und Frankreich,<br />
zwischen Demokratie und diktatorischer Herrschaft<br />
und zwischen militärischer Besatzung und<br />
vermeintlicher Befreiung. Jeder dieser Punkte<br />
würde meterweise historische Bücherregale füllen.<br />
Die Bildwissenschaft interessiert sich jedoch<br />
mehr für die eingesetzten Bildmotive. Denn sie<br />
sind es, die die stummen Plakate zum Sprechen<br />
bringen. Wie sich zeigt, waren vor allem bei der<br />
ersten Abstimmung 1935 an der Saar Bildmotive<br />
beliebt, die in ihrer ästhetischen Gestaltung<br />
und in ihrer ikonographischen Aussage im kollektiven<br />
schweizerischen Bildgedächtnis einen<br />
festen Platz haben, und die auch in den eidgenössischen<br />
Abstimmungskämpfen seit mehr
saargeschichte|n 47<br />
als hundert Jahren eine große Rolle spielen. Nämlich<br />
die Gründermythen Wilhelm Tell oder der<br />
Rütlischwur. Sie sind so genannte »Schlagbilder«,<br />
die der Hamburger Kunst- und Bildhistoriker<br />
Aby Warburg während des Ersten Weltkriegs<br />
als Reaktion auf die gestiegene Bildproduktion<br />
prägte. Er meinte damit den gesteigerten affektiven<br />
Gehalt von Bildern, die besonders in politischen<br />
Streitfragen mit Kalkül eingesetzt wurden.<br />
[3]<br />
Durch sie werden politische Vorstellungs- und<br />
Erscheinungsbilder geformt und propagiert. Die<br />
saarländischen Plakate zeigen, dass diese Schlagbilder<br />
länderübergreifend ihre Wirkung in der<br />
politischen Propaganda entfalten. Egal bei welch<br />
politischer Couleur. Egal ob an der Saar, an der<br />
Prims oder eben an der Limmat.Der Duft der Freiheit<br />
weht nur wenige Jahre an der Saar Nach<br />
der Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten<br />
Weltkrieg trat am 10. Januar 1920 der Versailler<br />
Vertrag in Kraft. Da sich Frankreich mit der Annexion<br />
des Saarreviers nicht durchsetzten konnte,<br />
einigten sich alle Parteien auf den Kompromiss,<br />
dass das Saargebiet fünfzehn Jahre lang vom<br />
Völkerbund verwaltet werden sollte. Der französische<br />
Staat übernahm als Ersatz für die im<br />
Ersten Weltkrieg zerstörten nordfranzösischen<br />
Kohlengruben und als Reparationsleistungen<br />
die Kontrolle über die Gruben an der Saar. Unter<br />
dem Vorsitz des Franzosen Victor Rault nahm die<br />
Regierungskommission am 26. Februar 1920 ihre<br />
Amtsgeschäfte auf. Rault drang darauf, die französischen<br />
Rechte an der Saar auszubauen und<br />
kritische Stimmen zu unterdrücken. Erst 1922<br />
wurde auf Drängen der Bevölkerung ein Länderrat<br />
eingerichtet, der politisch aber nur eine<br />
beratende Funktion hatte. Nach fünfzehn Jahren<br />
musste also die saarländische Bevölkerung<br />
darüber entscheiden, ob sie zu Frankreich oder<br />
Deutschland gehören wollte, oder ob der Status<br />
Quo, das Mandat des Völkerbundes, aufrechterhalten<br />
werden sollte. Der überwiegende Teil<br />
der Saarbevölkerung neigte der Rückgliederung<br />
an Deutschland zu. Am Tag der Abstimmung war<br />
dann die vaterländische Gesinnung des Volkes<br />
stärker als alle wirtschaftlichen Erwägungen, die<br />
gegen den Anschluss sprachen. Über 90 Prozent<br />
der Wähler stimmten für die Wiedervereinigung<br />
mit dem Deutschen Reich. [4]<br />
Im Herbst 1933 setzte in den saarländischen<br />
Städten und Dörfern ein regelrechter »Plakat-,<br />
Transparenten- und Fahnenkrieg« [5] ein. Zwischen<br />
Befürwortern und Gegnern einer »Heimkehr ins<br />
Reich« entbrannte ein heftiger Kampf auf den<br />
Plakatwänden. Die »Deutsche Front« stand an<br />
der Spitze jener politischen Kräfte, die für die<br />
Rückkehr des Saargebiets in ein diktatorisch<br />
regiertes, faschistisches Deutsches Reich eintraten.<br />
Sie war eine Sammelbewegung aus konservativen,<br />
rechtsgerichteten und bürgerlichen<br />
Parteien und setzte auf die Zugkraft nationaler<br />
Parolen. [6] Auch Gebrauchsgraphiker wie der<br />
Saarbrücker Toni Zepf stellten ihre Arbeit in den<br />
nationalen Dienst. Sein 1933 entworfenes Plakat<br />
»Saar Kundgebung am Niederwald-Denkmal«<br />
wirbt mit einer gewaltig senkrecht in den Himmel<br />
ragenden, schwarz-weiß-rot eingefärbten<br />
Schwurhand, hinter der aufrecht und herrschaftlich<br />
auftretenden Germania für die Rückkehr<br />
des Saarlands nach Deutschland. Inmitten einer<br />
heimisch anmutenden, grau schattierten Landschaft<br />
steigt jene Schwurhand empor, die in der<br />
Schweiz eine wohl Bekannte ist. Als Insigne der<br />
Qualität ziert sie seit vielen Jahren Lebensmittelverpackungen<br />
und der Legende nach sollen<br />
drei freiheitsliebende Eidgenossen sie auf einer<br />
Anonym, Wählt Liste<br />
3 zu den Grossratsund<br />
Regierungsratswahlen<br />
im Kanton<br />
Bern vom 5./6. Mai<br />
1934, Auftraggeber:<br />
Nationale Front, Farblithographie,<br />
100 x 71<br />
cm. (Plakatsammlung<br />
Bern, SNL_POL_333)<br />
[3] Aby Warburg, Heidnisch-antike Weissagungen in Wort<br />
und Bild zu Luthers Zeiten (1920). In: Horst Bredekamp;<br />
Michael Diers; Kurt W. Forster; Nicholas Mann; Salvatore<br />
Settis; Martin Warnke (Hg.): Aby Warburg. Gesammelte<br />
Schriften. Erste Abteilung, Band I.2. Die Erneuerung der<br />
heidnischen Antike. Kulturwissenschaftliche Beiträge<br />
der europäischen Renaissance, Berlin 1998, S. 487–5<strong>58</strong>,<br />
hier S. 513.<br />
[4] Peter Rütters, Landesparlamentarismus – Saarland, In:<br />
Siegfried Mielke; Werner Reuter (Hg.): Landesparlamentarismus.<br />
Geschichte – Struktur – Funktionen, 2. durchgesehene<br />
und aktualisierte Auflage, Wiesbaden, S. 471–<br />
508, hier S. 472.<br />
[5] Paul; Schock, 1987, S. 61.<br />
[6] Wolfgang Behringer; Gabriele Clemens, Geschichte des<br />
Saarlandes, München 2009, S. 101.
Anonym, Nur Status<br />
Quo schützt unsere<br />
Heimat, Auftraggeber:<br />
Status-quo-<br />
Bündnis 1934, Farblithographie<br />
50 x 66<br />
cm. (Deutsche Bibliothek<br />
Frankfurt am<br />
Main)<br />
Wiese am Vierwaldstättersee im ausgehenden<br />
15. Jahrhundert gen Himmel gereckt haben. Die<br />
Hand rekrutiert auf den Rütlischwur – jener<br />
Gründungsmythos der Schweiz, mit dem sich die<br />
Eidgenossen gegen die Habsburger Tyrannei zur<br />
Wehr gesetzt haben. [7] Im populären Geschichtsbild<br />
der Schweizer Bürger ist der Schwur Symbol<br />
der Unabhängigkeit und der Selbstbestimmung.<br />
Im »Weissen Buch von Sarnen«, einer Sammlung<br />
eidgenössischer Urkunden, hieß es 1470:<br />
»und swüren einandern truw und wahrheit und<br />
ir lib und güt ze wagen und sich der herren zu<br />
[7] Ausführlich zum Rütlischwur und den historischen Begebenheiten:<br />
Jean-François Bergier, Wilhelm Tel – Realität<br />
und Mythos, Zürich 2012.<br />
werren.« [8] Hunderte Jahre später aktualisierte<br />
Zepf den Schwur vor einem Hakenkreuz, wahrlich<br />
dem Symbol schlechthin für Unfreiheit und<br />
Unterdrückung: »Schwört und sprecht: Recht<br />
bleibt Recht, Wahr bleibt wahr: Deutsch die Saar.«<br />
Zepf hat den Treueschwur nationalsozialistisch<br />
aufgeladen und macht das nicht zuletzt durch<br />
die Farbkombination schwarz-weiß-rot deutlich.<br />
In seiner Darstellung schwört das Volk nicht der<br />
Freiheit, sondern der nationalsozialistisch Tyrannei<br />
die Treue. Diese faschistische Umdeutung des<br />
[8] Zit. in: Georg Kreis; Josef Wiget, Mythos Rütli: Geschichte<br />
eines Erinnerungsortes, Zürich 2001, S. 77. Sinngemäße<br />
Übersetzung: und schwören gegenseitige Treue und<br />
Wahrheit, Leib und Leben zu wagen und sich gegen die<br />
Herren zu wehren.
saargeschichte|n 49<br />
Schwurs hat das Saarland aber nicht exklusiv. In<br />
der politischen Agitation der Schweiz erlebte der<br />
Rütlischwur vor allem während der Geistigen<br />
Landesverteidigung einen Höhepunkt. Die Geistigen<br />
Landesverteidigung war eine politisch-kulturelle<br />
Bewegung von den 1930er bis in die 60er<br />
Jahre, die »schweizerische« Werte stärken und<br />
das Land gegen die Bedrohung von Nationalsozialismus,<br />
Faschismus und später Kommunismus<br />
schützen sollte. Freilich war die Bewegung<br />
nicht vor faschistischen Tendenzen sicher. Beinahe<br />
zeitgleich warb die »Nationale Front« im<br />
Kanton Bern zu den Grossrats- und Regierungsratswahlen<br />
mit der Schwurhand. Beide<br />
Bewegungen waren in ihrer politischen Haltung<br />
identisch. Auch die »Nationale Front« lehnte sich<br />
an die NSDAP an und machte aus ihrer Liebe<br />
zum Nationalsozialismus keinen Hehl. [9] Statt<br />
schwarz-weiß-rot sollte auf dem Plakat eine rote<br />
Schwurhand samt weißem Kreuz die patriotischem<br />
Gefühle ansprechen. In beiden Plakatbeispielen<br />
ging der freiheitsstrebende Schwur und<br />
der Nationalsozialismus eine unheilvolle Symbiose<br />
ein.<br />
Die Gegner der Rückgliederung des Saarlandes<br />
traten für den Staus Quo ein. Sie mussten im<br />
Abstimmungskampf gegen eine Welle des<br />
[9] Jakob Tanner, Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert,<br />
München 2015, S. 234.<br />
Nationalgefühls ankämpfen. Da die<br />
Befürworter einer Rückkehr zum Großdeutschen<br />
Reich die nationale Unzuverlässigkeit<br />
der Linken betonten,<br />
mussten die Anhänger des Status Quo<br />
ihre Liebe für die Heimat und ihr nationales<br />
Bekenntnis unter Beweis stellen.<br />
»Nur Status Quo schützt unsere<br />
Heimat« verkündet das bekannteste<br />
Plakat der Einheitsfront aus Sozialisten,<br />
Antifaschisten und Kommunisten.<br />
Wie auch ihre politische Kontrahenten<br />
vertrauten sie der Wirkmacht der<br />
Schwurhand. Mit ihr in tiefer Nacht<br />
über einem stilisierten Saargebiet<br />
voller Kirchtürme und Fördergerüste<br />
wollten sie die Propaganda der Gegner<br />
vereinnahmen und das Nationalgefühl<br />
von links instrumentalisieren.<br />
In der Schweizer Plakatgeschichte ist<br />
es keine Seltenheit, dass dasselbe Plakatsujet<br />
während einer Abstimmung<br />
von rechts, wie auch von links vereinnahmt<br />
wird. [10] Der Rütlischwur<br />
hat viele Zungen. Er ist länderübergreifend<br />
offen für unterschiedliche, mitunter<br />
divergierende Interpretationen. Auch an der<br />
Saar.Auch auf ihrem Plakat »Volksfront für Status<br />
Quo« stellte die Einheitsfront den schweizerischen<br />
Gründungsmythos in ihre Sache. Die<br />
drei Eidgenossen wurden ab dem 18. Jahrhundert<br />
zu einem beliebten Motiv im eidgenössischen<br />
Kunstschaffen. Eine der prominentesten Visualisierungen<br />
der freiheitsgewillten Eidgenossen<br />
ist sicherlich Johann Heinrich Füsslis Gemälde<br />
»Die drei Eidgenossen beim Schwur auf dem<br />
Rütli« von 1781. Anfang des 20. Jahrhunderts vollzog<br />
sich die schrittweise Ablösung vom konkreten<br />
Ort und die Ausdrucksfähigkeit der Gruppe<br />
wurde für einen allgemeinen politischen Kontext<br />
vereinnahmt. [11] Auf dem Plakat des Status-Quo-<br />
Bündnisses haben die drei Schwörenden ihre historische<br />
Kleidung zugunsten des »Dresscodes«<br />
der vorkriegszeitlichen Drei-Klassen-Gesellschaft<br />
eingetauscht. Sie verkörpern die Vereinigung des<br />
Bürgertums, der Arbeiter- und der Bauernschaft.<br />
In ähnlicher Tonlage hat Friedrich Schiller in sei-<br />
[10] Siehe hierzu etwa: Bruno Margadant, Das Schweizer Plakat:<br />
1900–1983, Basel 1983 oder auch Bruno Margadant,<br />
»Für das Volk – gegen das Kapital«: Plakate der schweizerischen<br />
Arbeiterbewegung von 1919 bis 1973: 99 Plakate,<br />
Zürich 1973.<br />
[11] Florian Bührer, Die Ikonographie Schweizer Abstimmungsplakate,<br />
Berlin 2015, S. 49.<br />
Anonym, Volksfront<br />
für Status<br />
Quo, Auftraggeber:<br />
Status-quo-Bündnis,<br />
1934, Schwarzer<br />
Druck auf weißem<br />
Grund, 91 x 61 cm.<br />
(Hoover Institution<br />
Library & Archives,<br />
Stanford University,<br />
XX343.8994)
Hans Schweitzer<br />
(Mjölnir), Deutsche<br />
Mutter - heim zu Dir!,<br />
Auftraggeber: Deutscher<br />
Front 1934, Farblithographie,<br />
84 x 119<br />
cm. (Bundesarchiv<br />
Koblenz, Plak 003-<br />
004-019)<br />
nem Drama Wilhelm Tell den Rütlischwur formuliert:<br />
Dort versprechen sich die drei Eidgenossen:<br />
»Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,<br />
in keiner Not uns trennen und Gefahr.« [12] Der<br />
Gefahr des Nationalsozialismus begegneten die<br />
Anhänger des Statue Quo allerdings ganz und gar<br />
nicht geeint. In ihrem Plakatschaffen ignorierten<br />
sie ganze Bevölkerungsgruppen wie Anhänger<br />
der katholischen Kirche oder Frauen. So ist die<br />
Selbstbeschreibung »Volksfront« mit Vorsicht zu<br />
[12] Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, Tübingen 1804, S. 147.<br />
genießen, wie Gerhard Paul und Ralph Schock<br />
anmerken. [13] Immerhin: Frauen durften bei der<br />
Abstimmung ihre Stimme abgeben. Dieses »Privileg«<br />
war den Schweizer Frauen noch jahrelang<br />
vergönnt. Die Mutter der Nation Ein »optischer<br />
Schrei« [14] , der Aufmerksamkeit erzeugt, ist Hans<br />
Schweitzers Plakat »Deutsche Mutter – heim<br />
[13] Paul; Schock, 1987, S. 67.<br />
[14] So beschreibt der Kunsthistoriker Kai Artinger die wesentliche<br />
Aufgabe eines Plakats. Sieht hierzu: Artinger,<br />
2000, S. 19.
saargeschichte|n 51<br />
zu dir«. Es erfüllt im besten Sinne ein wesentliches<br />
Merkmal politischer Plakate, wie es in der<br />
Schweiz von Plakatkennern vor vielen Jahren<br />
formuliert wurde: »Es wird an unterschwellige<br />
Regungen appelliert, und es werden Emotionen,<br />
manchmal Aggressionen ausgelöst.« [15]<br />
Die »Nationale Front« zielte mit ihrem Plakat<br />
auf die »Ausschaltung des kalt rechnenden Verstandes«<br />
und die »Eroberung des Herzens«. [16] Für<br />
Schweitzer, der unter dem Pseudonym Mjölnir<br />
gestaltete, ist die Rückkehr des Saarlandes zum<br />
Dritten Reich etwas sehr persönliches. Es ist, als<br />
komme der Sohn heim und falle in die Arme der<br />
Mutter. Mjölnir, einer der bekanntesten nationalsozialistischen<br />
Plakatkünstler, proklamierte<br />
unmissverständlich: Deutscher Sohn, komm<br />
heim ins Reich! Der Sohn hat auf dem Plakat die<br />
französische Fabrikkulisse hinter sich gelassen<br />
und überquert die saarländisch-französsiche<br />
Grenze. Erschöpft fällt er in seiner deutschen Heimat<br />
seiner Mutter vor dem Trier Dom in die Arme.<br />
In einer Zeit voller Ungewissheit greift Mjölnir<br />
die latenten Bedürfnisse der saarländischen<br />
Bevölkerung nach Geborgenheit und Sicherheit<br />
auf. Das großdeutsche Reich als hilfsbereite Mutter<br />
versprach in Zeiten der großen Wirtschaftskrise<br />
den Menschen an der Saar vermeintlich<br />
Arbeit und Brot. Die enge Koppelung der Begriffe<br />
Mutter und Heimat bot, wie die beiden Publizis-<br />
[15] Willy Rotzler; Fritz Schärer; Karl Wobmann, Das Plakat<br />
In der Schweiz, Zürich 1991, S. 11.<br />
[16] Paul; Schock, 1987, S. 61.<br />
tinnen Maruta Schmidt und Gabi Dietz<br />
aufzeigen, den Nationalsozialisten<br />
eine entsprechende Projektionsfläche,<br />
um die Begeisterung und Bindung<br />
der Volksgemeinschaft an die eigene<br />
Nation und deren vermeintliche<br />
Größe anzufachen. [17] Die gesellschaftliche<br />
Überhöhung des Mutterbildes<br />
und vor allem der Bildtypus der liebevoll<br />
und schützenden Mutter, die<br />
sich dem Kind zuneigt und es schützend<br />
umfaßt, ist in der politischen<br />
Ikonographie wohlbekannt. In der<br />
Schweiz ging die »Matrona Helvetia«<br />
als mütterliche Personifikation in der<br />
Ikonographie des 19. Jahrhunderts ein.<br />
Im Konflikt mit Preußen um den Kanton<br />
Neuenburg 1856 und zur Zeit der<br />
ersten Gesamtrevision der Verfassung<br />
1874 trat die Helvetia als gerüstete<br />
Mutter wehrhafter Söhne mit Speer,<br />
Schild und Panzer auf. [18] Dieses Bild<br />
der angriffslustigen Helvetia hat sich während<br />
des Ersten Weltkriegs gewandelt. Von nun an<br />
hat sich die Helvetia Schild und Speer abgelegt.<br />
Ganz im Sinne des Zeitgeists zeigt eine Postkarte<br />
des Roten Kreuz zur Bundesfeier 1917 sie in<br />
ihrer mütterlichen Rolle. Nach einem Gemälde<br />
von Eugène Burnand gibt sie sich als einfache<br />
Bürgersfrau, gekleidet in einen groben Mantel,<br />
und hilft den Schwachen und Verfolgten. Barmherzig<br />
nimmt sie ihre Landeskinder unter den<br />
Mantel. Die häufige Darstellung der Helvetia als<br />
Mutter für bedrängte Kinder, Alte und Flüchtende<br />
in der Not ist ein typisches Schlagbild der Schweizer<br />
Ikonographie. Jedoch tritt sie immer jung<br />
und aufrecht auf. Mjölnirs Darstellung der älteren<br />
Frau in gebückter Haltung und grauem Haar<br />
zeugt von den Qualen, die der verlorene Weltkrieg<br />
und der Versailler Vertrag über sie – also über<br />
Deutschland – gebracht haben. Macht weit auf<br />
die Tore Ein besonderes Plakat ist Sepp Semars<br />
»Zu Deutschland«. Am oberen Rand prangt ein<br />
lichtdurchflutetes Hakenkreuz. Es ist eines der<br />
wenigen Plakate, das mit nationalsozialistischer<br />
Symbolik wirbt. Ansonsten verzichtete die »Deutsche<br />
Front« darauf, derart offen ihre politische<br />
Heimat zur Schau zu stellen. Die Plakate sollten<br />
den Eindruck erwecken, es handle sich bei der<br />
[17] Maruta Schmidt; Gabi Dietz, Frauen unterm Hakenkreuz.<br />
Eine Dokumentation, München 1985, S. 56–67.<br />
[18] Ted Stoll, Helvetia und ihre Schwestern: Trouvailles aus<br />
der Rumpelkammer der Geschichte: ein inoffizieller<br />
Beitrag zum Jubeljahr 1991, Bern 1990, S. 76.<br />
Sepp Semar, Zu<br />
Deutschland, Auftraggeber:<br />
Deutsche<br />
Front 1934, Zweifarbendruck,<br />
82 x 117<br />
cm. (Bundesarchiv<br />
Koblenz, Plak 003-<br />
004-020)
Rolf Gfeller, Wählt<br />
freisinnig, Für eine<br />
starke freie Demokratie,<br />
Auftraggeber:<br />
Freisinnig-<br />
Demokratische<br />
Partei der Schweiz,<br />
1951, Farblithographie<br />
127,5 x<br />
90,5cm. (Plakatsammlung<br />
Bern,<br />
SNL_POL_<strong>58</strong>6)<br />
Abstimmung um eine nationale Entscheidung<br />
unabhängig politischer Rahmenbedingungen. [19]<br />
Der Zweibrücker Gebrauchsgrafiker Semar stellte<br />
sein künstlerisches Talent regelmäßig in den<br />
Dienst des Nationalsozialismus. Sein Aushang<br />
»Zu Deutschland« strahlt eine enorme Entschlossenheit<br />
und Siegeszuversicht aus. Ein muskulöser,<br />
ganz in schwarz gekleideter Arbeiter in<br />
Rückansicht stößt mit einem mächtigen Kraftakt<br />
ein schweres Tor auf. Es ist das Tor zum Dritten<br />
Reich. Endlich tritt der junge Mann aus der französischen<br />
Unterdrückung heraus und in das wärmende<br />
Licht des Hakenkreuzes. Für Semar stand<br />
ohne Zweifel fest, wo die Zukunft des Saarlandes<br />
liegen sollte.<br />
In seiner ästhetischen Gestaltung erinnert das<br />
Plakat unweigerlich an ein Plakat des Berner<br />
Künstler Rolf Gfeller. Für die Freisinnig-Demokratische<br />
Partei der Schweiz gestaltete er in den<br />
Fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein<br />
[19] Franz Maier; Sylvain Chimello; Charles Hiegel, Krieg auf<br />
Plakaten – La Guerre par l‘Affiche, Koblenz 2000, S. 77.<br />
nahezu identisches Plakat. Zumindest<br />
aus formalen Gesichtspunkten. Ebenfalls<br />
in Rückansicht stößt ein hermsärmeliger<br />
junger Mann, nicht ganz<br />
so muskulös, in zeitgenössischer Kleidung<br />
kraftvoll zwei Türflügel auf und<br />
eröffnet sich und dem Betrachter den<br />
Weg in die Zukunft. Anders als bei<br />
Semar liegt die Zukunft aber nicht im<br />
nationalsozialistischen Terrorregime,<br />
sondern in einer starken und freien<br />
Demokratie. Es ist wohl gewiss, dass<br />
Gfeller nicht Semars Plakat zum Vorbild<br />
nahm. Vielmehr erinnern die beiden<br />
Plakate in ihren Kompositionen und<br />
der malerischen Stile an ein bekanntes<br />
Schweizer Gemälde. Wären statt<br />
der Türflügel schroffe Felsen und Wolken,<br />
würde man unweigerlich an den<br />
Hodlerschen Tell denken. Der Schweizer<br />
Nationalmaler Ferdinand Hodler<br />
erschuf um 1896 den überlebensgroßen<br />
»Wilhelm Tell«. Der Schweizer<br />
Freiheitskämpfer steht frontal auf<br />
einer Anhöhe, fixiert den Betrachter<br />
mit grimmigem Ausdruck, in der linken<br />
Hand trägt er die Armbrust als<br />
Zeichen der Kampfbereitschaft. Links<br />
und rechts sind die bekannten Wolken,<br />
aus denen er hervortritt. Durch<br />
die Kehrtwende der Figur verändern<br />
beide Künstler die Aussage. Sie sprechen<br />
den Betrachter nicht mehr direkt an, sondern<br />
zeigen ihm den künftigen Weg. Der könnte<br />
unterschiedlicher nicht sein. Bei Semar endet<br />
der Weg im Nationalsozialismus endet, Gfeller<br />
macht sich für eine freie Demokratie stark. Am<br />
18. Januar beschloss der Völkerbund die Wiedervereinigung<br />
des Saargebiets mit dem Deutschen<br />
Reich zum 1. März 1945. An jenem Tag fanden an<br />
der Saar große Feierlichkeiten statt und Adolf<br />
Hitler nahm vor dem Saarbrücker Rathaus den<br />
Vorbeimarsch der »Deutschen-Front«-Formation<br />
ab. »Getreu bis in den Tod« hatten sich die Saarländer<br />
dem nationalsozialistischen Deutschland<br />
verschworen und leisteten diesen Schwur noch<br />
einmal auf einem Plakat vom 1. März. Wie wir<br />
wissen, kam der Tod bereits wenige Jahre später.<br />
Was aber bis heute blieb sind die Bildmotive – die<br />
Schlagbilder – die ihre Kraft aus den Varianten<br />
langer Überlieferungen gewinnen und die an der<br />
Saar, weit weg der eidgenössischen Heimat, offen<br />
für unterschiedliche, mitunter divergierende<br />
Interpretationen sind.
seines zeichens ein dichter<br />
saargeschichte|n 53<br />
Der Kölner Expressionist Johannes Theodor Kuhlemann und Saarbrücken<br />
von ralph schock<br />
Unter dem Titel »Also heraus und weit weg!<br />
– Expressionismus, eine Epoche und die Saarregion«<br />
wird im Sommer <strong>2020</strong> im Conte-Verlag<br />
ein Lese- und Bilderbuch erscheinen, in dem<br />
Ralph Schock Spuren expressionistischer Schriftsteller<br />
und Künstler mit einem Bezug zur Saarregion<br />
dokumentiert.<br />
Zu ihnen gehört der am 4. November 1891 in Köln<br />
geborene und am 9. März 1939 dort gestorbene<br />
Lyriker, Kabarettist, Mundartautor und Musikkritiker<br />
Johannes Theodor Kuhlemann.<br />
Wir drucken einen Auszug aus dem Kapitel über<br />
ihn.<br />
Der 77-seitige Gedichtband »Consolamini«, 1919<br />
im Kairos-Verlag in Köln-Ehrenfeld erschienen,<br />
ist das Hauptwerk dieses rheinischen Expressionisten.<br />
Die Illustrationen des Bandes stammen<br />
von Max Ernst, der im gleichen Jahr zusammen<br />
mit Johannes Baargeld und Hans Arp die Kölner<br />
Dada-Gruppe gründete. Die fünf Zeichnungen<br />
waren die ersten Buchillustrationen des damals<br />
noch weitgehend unbekannten Künstlers. Kuhlemann<br />
und Ernst, gleichaltrig, waren befreundet.<br />
Als Max Ernst seine erste Frau Luise Straus heiratete,<br />
verfasste Kuhlemann ein dreiteiliges Hochzeitscarmen<br />
mit dem Titel »Hymne«. Mit folgender<br />
Nachschrift wurde es in »Consolamini«<br />
aufgenommen: »Gesprochen am 7. Oktober 1918<br />
auf der Hochzeit meiner Freunde Max Ernst und<br />
Lou Straus.« (S. 65).<br />
Schon 1915 hatte Max Ernst versucht, Kuhlemann<br />
an den »Sturm«-Herausgeber Herwarth Walden<br />
zu vermitteln, wo er selbst schon zahlreiche Illustrationen<br />
veröffentlicht hatte. Am 19. Dezember<br />
jenes Jahres übersandte er Walden ein Kuhlemann-Gedicht<br />
mit der Bitte um Publikation: »Ich<br />
schicke Ihnen ein sehr erhabenes Gedicht meines<br />
Freundes Joh. Th. Kuhlemann«. Doch Walden war<br />
der Text möglicherweise zu erhaben, zu einer Veröffentlichung<br />
kam es jedenfalls nicht.<br />
Zu dem Band »Consolamini« hatte Max Ernst<br />
Federzeichnungen beigesteuert, obwohl ihm<br />
der »symphonische, leicht hölderlinsche« Ton der<br />
Gedichte inzwischen »bereits fremd geworden«<br />
sei, wie Werner Spies weiß, der in den Zeichnungen<br />
Ernsts »Klee-Reminiszenzen« erkennt. Da der<br />
Lyrikband nahezu unverkäuflich blieb, wurde fast<br />
die gesamte Auflage 1920 eingestampft. Seine<br />
ersten Gedichte hatte Kuhlemann bereits 1913<br />
in der in Heidelberg erschienenen Anthologie<br />
»Fanale« veröffentlicht, in der auch Lyrik des in<br />
Saarlouis geborenen Expressionisten Richard<br />
Maximilian Cahén abgedruckt war.<br />
Der mehrfach unter dem Pseudonym »Ithaka«<br />
(abgeleitet aus den Anfangsbuchstaben seines<br />
Namens) veröffentlichende Autor verließ<br />
1919 Köln, um eine Stelle als Schriftleiter einer<br />
Saarbrücker Musikzeitschrift zu übernehmen.<br />
Er wohnte laut Eintrag im Saarbrücker Melderegister<br />
vom 11. Dezember 1919 bis zum 20.<br />
August 1920 in der Blumenstraße 33, danach, bis<br />
zu seiner Abmeldung aus Saarbrücken am 27. Mai<br />
1922, in der Lebacher Straße 17. Als Beruf ist auf<br />
der Meldekarte »Schriftsteller« angegeben.<br />
In Köln wurde Kuhlemann vor und nach seinem<br />
Aufenthalt an der Saar von dem Tabakgroßhändler<br />
Josef Feinhals (Collofino) gefördert, einem vermögenden<br />
Kunstsammler und Mäzen der Kölner<br />
und Rheinischen Kunst- und Kulturszene. Der<br />
Autor, der sieben Fremdsprachen beherrschte<br />
und sich exzellent in europäischer Geschichte,<br />
Kunst, Literatur und Musik auskannte, wurde von<br />
Feinhals als Sekretär angestellt und arbeitete als<br />
Kulturhistoriker in dessen Tabakmuseum. Der gut<br />
vernetzte Unternehmer Feinhals war auch mit<br />
Hermann Hesse befreundet, der ihn unter seiner<br />
latinisierten Namensform Collofino in mehreren<br />
Erzählungen und im »Glasperlenspiel« erwähnte.<br />
Leider ist über eine Beziehung zwischen Hesse<br />
und Kuhlemann nichts bekannt. Die umfangreiche<br />
Korrespondenz von Feinhals, die darüber
Saarbrücker Meldekarte<br />
des Johannes<br />
Kuhlemann. (StA SB)<br />
vielleicht hätte Auskunft geben können, wurde<br />
mit der Villa des Unternehmers Anfang Juli 1943<br />
bei einem Bombenangriff auf Köln zerstört. Feinhals-Collofino<br />
starb am 1. Mai 1947, und zwar auf<br />
Schloß Randegg, dem Wohnsitz seines Freundes,<br />
des in St. Avold geborenen expressionistischen<br />
Schriftstellers und Kunstsammlers Hans Koch.<br />
In einer biographischen Skizze, der Einleitung<br />
zu einer <strong>Ausgabe</strong> von Gedichten Kuhlemanns in<br />
Kölner Mundart, geht Otto Brües kurz auf dessen<br />
Saarbrücker Zeit ein: »Er wird dort Schriftleiter,<br />
und die Weite seiner Bildung ermöglicht<br />
ihm, sich auf vielerlei Gebieten zu tummeln, vor<br />
allem kann er seiner Neigung zur Musik nachgehen.<br />
Seine Musikkritiken gehören zum Besten,<br />
was er wertend hinterlassen hat.« Brües erwähnt<br />
auch dunkle Seiten Kuhlemanns: »Daß sein äußeres<br />
Leben nun gesichert scheint, bedeutet ihm<br />
wenig. In seinem Innern ist er, der leicht Verletzliche,<br />
zutiefst verwundet, auch die Freundschaft<br />
vieler junger Menschen, die sich um ihn<br />
scharen, bringt ihm keinen Trost. […] Er wird nun<br />
im Übermaß der Eindrücke leiblich und seelisch<br />
krank, und die Freunde finden ihn manchmal auf<br />
dem Bette wie tot.« (S. 11) Dies scheint auf eine<br />
depressive Veranlagung Kuhlemanns hinzudeuten,<br />
zudem war er offenbar dem Alkohol nicht<br />
gänzlich abgeneigt. Das legt ein seinem Gedicht<br />
»Der Botengänger« beigefügtes Motto des französischen<br />
Lyrikers Charles-Louis Philippe nahe: »Il<br />
y a un bon Dieu pour les ivrognes« (Gott sei auch<br />
den Trunkenbolden, den Säufern, gnädig …)<br />
Der Schriftsteller Karl Willy Straub (1880–1971),<br />
der nach dem Ersten Weltkrieg in Saarbrücken<br />
lebte, begegnete dort Kuhlemann. In einem drei<br />
Jahrzehnte später entstandenen Gedenkartikel<br />
erinnerte er sich recht herablassend an ihn: »Seines<br />
Zeichens ein Dichter. Ein schmächtiger, mit<br />
einer Hornbrille bewaffneter junger Mensch, der<br />
es nicht dabei bewenden ließ, selbst in die Saiten<br />
seiner etwas verstimmten Lyra zu greifen, sondern<br />
auch die vor ihm und neben ihm dichtenden<br />
Kollegen von Goethe bis Stefan George einer<br />
ihm lauschenden Gemeinde nahe zu bringen<br />
versuchte. Einen besonderen Kreis von Hörern<br />
bildete eine Anzahl junger Menschen beiderlei<br />
Geschlechts, meistens Pennäler und höhere<br />
Töchter der oberen Schülerklassen. Da es Kuhlemann,<br />
dem Vermittler besserer Literatur, an<br />
einem geeigneten Raum fehlte (in seine Mietbude<br />
konnte er wirklich niemanden einladen,<br />
ohne missverstanden zu werden), so verlegte er<br />
seine wöchentlich einmal abzuhaltenden Privatissima<br />
kurzerhand in das Schloßcafé. Hier in<br />
einer stillen Ecke versammelten sich die Adepten<br />
einer brotlosen Kunst und lauschten bei Kaffee<br />
und Kuchen den Ausführungen des vom Nymbus<br />
[!] der Dichtkunst umgebenen Meisters. War die<br />
Stunde abgelaufen, dann türmte sich das Honorar<br />
in Gestalt von Crèmeschnitten, Nußschiffchen<br />
und Mohrenköpfen auf Kuhlemanns Teller. Aber<br />
wohin mit dem Segen? Der Meister wußte sich<br />
zu helfen. Er verschwand geheimnisvoll im W.C.<br />
Wenn er wiederkam, entnahm er seiner Rocktasche<br />
mehrere Meter des bekannten schmalen<br />
grauen oder rosanen Kreppapiers und begann,<br />
dem Naturalien-Honorar einen Verband anzulegen,<br />
um dessen Kunstfertigkeit ihn mancher<br />
Sanitäter hätte beneiden können. Für die Speisekammer<br />
der nächsten Tage hatte Johannes Kuhlemann<br />
gesorgt.<br />
Zehn Jahre später schlug mir ein Teilnehmer der<br />
Rheinischen Dichtertagung in Freiburg [1931] auf<br />
die Schulter. Es war ein sehr korpulenter Mann<br />
mit dicker Hornbrille und Baskenmütze. Die Art<br />
der Begrüßung eines mir völlig Fremden ging<br />
mir auf die Nerven, weshalb ich wohl etwas<br />
zurückhaltend meinen Namen nannte. ›Sie kennen<br />
mich nicht mehr?‹, lachte der Dicke. ›Ja, ich<br />
habe mich ein bißchen verändert, das muß ich<br />
zugeben: Johannes Kuhlemann aus dem Schloßcafé<br />
in Saarbrücken.‹ ›Ach, Sie sind es‹, rief ich<br />
nun, versöhnt mit der burschikosen Begrüßung.
saargeschichte|n 55<br />
Inneres des Schlosscafés<br />
an der Viktoriabrücke<br />
in Saarbrücken<br />
1900.<br />
Urheber: Kunstanstalt<br />
Demetz, St. Ingbert.<br />
(LA SB; B 1686/8 C)<br />
›Da scheinen Sie ja der Währung des Schloßcafé-Honorars<br />
treu geblieben zu sein!‹ Wir feierten<br />
das unverhoffte Wiedersehen ausgiebig.«<br />
Zwanzig Jahre später wurde in der Zeitschrift<br />
»Saarheimat« ein weiterer Text Straubs<br />
abgedruckt, in dem er erneut etwas überheblich<br />
auf Kuhlemann zu sprechen kommt. Leider fehlt<br />
dem Beitrag eine Quellenangabe. Ich vermute,<br />
dass er im Auftrag von Karl-August Schleiden<br />
entstand, dem Herausgeber der »Saarheimat«,<br />
und dann in dessen Redaktionsschreibtisch lag,<br />
bis er zwei Jahre nach Straubs Tod schließlich<br />
gedruckt wurde. Straub schreibt:<br />
»Neben diesen mehr oder weniger ernst zu nehmenden<br />
Künstlern [Fritz Grewenig, Christoph<br />
Voll, Richard Wenzel] machten in diesen Jahren<br />
zwei junge Menschen den untauglichen Versuch,<br />
in Saarbrücken sogar so etwas wie eine Bohème<br />
heimisch werden zu lassen. Der eine kam aus dem<br />
Rheinland und hieß Johannes Taddäus [recte:<br />
Theodor] Kulemann [recte: Kuhlemann]; der<br />
andere hatte seiner tschechischen Heimat Valet<br />
gesagt und hörte auf den Namen Mischa Szenkar.<br />
Kuhlemann war der typische Kaffeehausliterat.<br />
Wo er nächtigte, war unbekannt. Tagsüber saß<br />
er im ›Schloßcafé‹ im Kreise literaturhungriger<br />
Gymnasiasten und las ihnen aus einem Bande<br />
George’scher Lyrik vor, die schon deshalb auf die<br />
Jünger Apolls ihren Eindruck nicht verfehlten,<br />
weil sie die Interpunktion und Orthographie auf<br />
den Kopf stellten und damit die Autorität ihres<br />
Deutschlehrers ad absurdum führte. Um mich zu<br />
Luisenbrücke mit<br />
Schloss-Café und<br />
gegenüberliegendem<br />
Gebäude<br />
frühe 1920er Jahre<br />
LA SB<br />
(B 1720/10 C)
amüsieren, setzte ich mich öfters in die Nähe dieses<br />
Kreises. War die Literaturstunde zu Ende, verschwand<br />
Kuhlemann in den Räumlichkeiten ›Für<br />
Herren‹. In das dort von der Rolle abgewickelte<br />
Papier verstaute er dann die von seinen Schülern<br />
gestifteten Kuchen, denn jene pflegten in Naturalien<br />
zu bezahlen! Aber Kuhlemanns Ambitionen<br />
beschränkten sich nicht auf diese Privatissima<br />
in Literatur. Dann und wann veranstaltete<br />
er auch ›Lesungen‹ für die große Öffentlichkeit.<br />
Als er aber in der Auswahl seiner literarischen<br />
Erzeugnisse einmal garzusehr den Takt<br />
gegenüber dem weiblichen Publikum vermissen<br />
ließ – nebenbei erschien er in kurzen Hosen und<br />
gepumptem Gehrock – hatte seine Stunde in<br />
Saarbrücken geschlagen. Das Gedicht von der<br />
›bleichen Wasserleiche‹ war für schwache Nerven<br />
zuviel. In Köln fand Kuhlemann den Mäzen,<br />
den er brauchte. Der Zigarrenfabrikant Feinhals<br />
machte ihn zu seinem Bibliothekar!«<br />
Die Rezitation besagten Gedichts dürfte jener<br />
»berufliche Eklat« gewesen sein, der in einer<br />
kurzen biografischen Notiz über Kuhlemann in<br />
den »Literarischen Nachlässen in Rheinischen<br />
Archiven« genannt wird als Grund für die Rückkehr<br />
nach Köln. Das Gedicht über die »bleiche<br />
Wasserleiche« mit dem Titel »Im Karpfenteich«<br />
verfasste Hanns Heinz Ewers. Viele Abende lang,<br />
so ein zeitgenössischer Bericht, habe er es vor<br />
einem begeisterten Berliner Publikum in Ernst<br />
von Wolzogens Kabarett »Überbrettl« vorgetragen,<br />
»schmatzend wie ein Karpfen«. Das<br />
Publikum in Saarbrücken mag von einer Lyriklesung<br />
möglicherweise Erbaulicheres erwartet<br />
haben als die Rezitation eines solchen Gedichts.<br />
Der Text über die drei Karpfen ist abgedruckt in<br />
dem gemeinsam von Hanns Heinz Ewers und<br />
Theodor Etzel verfassten und 1901 in München im<br />
Albert Langen Verlag erschienenen »Fabelbuch«<br />
(S. 23). Die beiden Autoren dieses Bandes, die<br />
befreundet waren, hatten etwa 20 Jahre vor Kuhlemann<br />
eine Zeitlang an der Saar gelebt. Der eine,<br />
Etzel, ab 1895 als Beamter in Merzig und später,<br />
von Januar bis August 1899, in Saarbrücken als<br />
Herausgeber der Zeitschrift »Der Kunstfreund«;<br />
der andere 1897 einige Monate als Referendar am<br />
Landgericht in Saarbrücken.<br />
Im Karpfenteich<br />
Im Karpfenteiche<br />
schwamm einmal eine bläulich bleiche<br />
und schleimig weiche Wasserleiche.<br />
Ein Karpfenjüngling kam heran<br />
und fing wie folgt zu reden an:<br />
»O Menschenlos! Gewiss die Flammen,<br />
die aus verschmähter Liebe stammen,<br />
verbrannten seinen armen Sinn<br />
und trieben ihn zum Wasser hin!«<br />
Ein anderer Karpfen hört sein Klagen<br />
und hub verächtlich an zu sagen:<br />
»Ach wat! Im Dusel hat er sich verloffen<br />
fiel in den Teich und ist darin versoffen!«<br />
- Jedoch ein alter, hundertjähriger Knabe<br />
erfreute sich der guten Gottesgabe.<br />
Er sprach kein Wort, er frass und frass,<br />
dass er die Welt darob vergass,<br />
und dacht: »Nicht immer gibts im Teiche<br />
solch eine schöne, schleimig weiche<br />
und bläulich bleiche Wasserleiche!«<br />
Der Schriftsteller und Jurist Hanns Heinz Ewers<br />
war von 1912 bis 1920 mit der französischen Lyrikerin<br />
und Malerin Marie Laurencin (1883–1956)<br />
liiert, die zuvor die Gefährtin von Apollinaire<br />
gewesen war. 1914 hatte sie den deutschen Maler<br />
Otto von Wätjen geheiratet und war mit ihm 1918<br />
nach Düsseldorf gezogen. Beide Künstler wurden<br />
von der Galerie Alfred Flechtheim vertreten. Da<br />
der Galerist in engem Kontakt zu dem Sammler<br />
Collofino-Feinhals stand, dürfte Kuhlemann auf<br />
diesem Wege die Französin kennengelernt haben.<br />
Jedenfalls war ihm Marie Laurencin ein Begriff,<br />
ist ihr doch eines jener Landschaftsgedichte des<br />
Bandes »Consolamini« gewidmet, die später<br />
von Erwin Schulhoff vertont wurden. Karl Otten<br />
schreibt in seinen Erinnerungen über Kuhlemann:<br />
»Unter den Besuchern der Ausstellung [Rheinische<br />
Expressionisten, 1914] war mir ein anderer<br />
Dichter aufgefallen, mit dem ich mich<br />
anfreundete, Johannes Theodor Kuhlemann,<br />
braunhäutig, schwarzhaarig, glich er einem Franzosen<br />
oder Spanier eher als einem echten Kölner.<br />
Er war Sekretär des großen Collofino-Feinhals,<br />
jenes reichen Zigarrenhändlers, der das Tabakbuch<br />
schrieb und moderne Bilder sammelte.«<br />
Das Saarbrücker Schloßcafé scheint in jener Zeit<br />
ein beliebter Treffpunkt von Schriftstellern und<br />
Künstlern gewesen zu sein. Auch Alfred Döblin,<br />
der von Januar 1915 bis Juni 1917 in Saargemünd<br />
als Militärarzt stationiert war, berichtet, dass er<br />
»oft herübergewandert« sei, um dieses Lokal zu<br />
besuchen: »Saarbrücken war mir doch damals
saargeschichte|n 57<br />
die ›Großstadt‹. Da war nicht nur das eine Kaffee,<br />
sondern das schöne Schloßkaffee am Wasser, wo<br />
man interessante durchreisende Menschen sah.«<br />
Vermutlich in diesem Szene-Café dürften sich<br />
der expressionistische Lyriker und der böhmische<br />
Komponist und Pianist Schulhoff begegnet<br />
sein. Dieser, damals ein Anhänger des Dadaismus,<br />
hatte am 15. Oktober 1920 eine Stelle als Klavierlehrer<br />
an einem privaten Saarbrücker Konservatorium<br />
angetreten; zwei Unangepasste, bis 1922<br />
in die Diaspora verbannt.<br />
Kennengelernt hatten sich die beiden schon früher.<br />
Denn der damals in Dresden lebende Schulhoff<br />
hatte gute Kontakte in die Künstlerszene<br />
Kölns und Düsseldorfs, etwa zu Otto Dix, der mit<br />
Schulhoffs Schwester Viola liiert war. Dix porträtierte<br />
Hans Koch sowie den Komponisten, der<br />
seinerseits von Dix das Gemälde »Billardspieler«<br />
erwarb .<br />
In der Erwin-Schulhoff-Sammlung im Archiv der<br />
Berliner Akademie der Künste ist die Partitur<br />
»Landschaften op. 26: Fünf Gedichte von Johannes<br />
Theodor Kuhlemann« archiviert mit der Datumsangabe<br />
»23. August 1918«. Schulhoff kannte also<br />
Kuhlemanns Lyrik, zumindest den Zyklus »Das<br />
Herz« und dessen Landschaftsgedichte, bereits<br />
ein Jahr vor der Veröffentlichung. Opus 26 ist eine<br />
Symphonie für Mezzosopranstimme und Orchester.<br />
Vermutlich waren sich die beiden Künstler sogar<br />
schon früher begegnet; denn in dem von Klaus<br />
Simon im Schott-Verlag herausgegebenen Schulhoff-Werk<br />
»Sämtliche Lieder, Bd. 2, Frühe Lieder<br />
II (1911–1915)« findet sich bereits eine Vertonung<br />
des Textes »Der Apfel« von Kuhlemann. Seine<br />
Geburtsstadt Köln ehrte den Schriftsteller mit<br />
einer Straßenbenennung in dem Stadtteil Altstadt-Süd.<br />
Landschaft<br />
Die Türen sind zugeweht<br />
lang. Aber die kalten Kissen<br />
schluchzen der Lust nach. Schräg<br />
rauscht der Vorhang<br />
herein, wie die Liebe kommt,<br />
tiefrot und zum Weinen.<br />
Schmücke mit Silber und Eis<br />
und brich ein Fenster<br />
der hoch andrängenden Welt.<br />
Landschaft<br />
(Marie Laurencin)<br />
Alle Frauen weinen. Der graue Prinz<br />
hat seinen Vater erschlagen. Er reitet<br />
durch der Frühe singende Schneedome<br />
der Lilie nach, die seine vollendeten<br />
Hände halten. Aber<br />
ein Haus ist, dessen bange Wölbung<br />
er nie verlassen wird. Bis in die Keller<br />
fällt Regen böse Jahre lang.<br />
Bitter starren die toten Adern<br />
der Erde. Doch in den höheren Lüften<br />
singt Ariel einsam.<br />
Landschaft<br />
Demut faltet den Raum. Wir müssen<br />
sterben. Aus nächtlichen Spiegeln<br />
zittert Unruh. O Woge<br />
des Monds! Es ruft<br />
über den Fluß. Und hoher,<br />
aller Tage gekrönter Stern<br />
ist unterwegs, hebt<br />
hinter der Wand der Meere sich auf.<br />
Ich kann den Tod nicht, wie<br />
den Abend lieben. Am Ende<br />
steht der Engel: mitten<br />
unter dem Tor. Ihm bergen<br />
lauschendes Haupt die Völker. Auch mir<br />
rauscht am Boden das Gras. Die Pfade<br />
enden im schaurigen Herzen mir.<br />
Junges Mädchen stirbt im Hospital<br />
In meinem Bette flieg ich durch den Raum.<br />
Schneewälder wiegen mich in neuen Düften.<br />
Noch sengen Erdenfeuer aus den Lüften<br />
der letzten Berge düster meinen Traum.<br />
Noch bin ich weich von Schmerz. Hier ist der Saum.<br />
Im Tale brechen leise meine Hüften<br />
und sehnen sich zu ruhn in jungen Grüften,<br />
gebadet und gesalbt. Ich weine kaum<br />
und sinke. Menschen stehn um mich gehäuft,<br />
verliebte, fremd, beladen mit Gerüchen,<br />
Tabak und Blumen aus der alten Welt.<br />
Und Dinge klirren wie verlornes Geld<br />
im Saal, aus dessen bunten Bibelsprüchen<br />
ein letztes Mal Gespräch und Liebe träuft.
von der industriebrache<br />
zum postmodernen ökopark<br />
Der Bürgerpark Hafeninsel in Saarbrücken-Malstatt<br />
von kristine marschall<br />
Bürgerpark<br />
Hafeninsel, Aquädukt,<br />
2018.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Innenstadt<br />
Saarbrückens zu etwa 80 Prozent in Trümmern.<br />
Der dichte Wiederaufbau auf historischen<br />
Quartiergrundrissen prägte das nachkriegszeitliche<br />
Stadtbild in weiten Bereichen. Die verkehrsgerechte<br />
Stadt der 1960er Jahre wurde<br />
durch den Bau der Stadtautobahn in der Flussaue<br />
der Saar Realität. Eine Folge davon war die<br />
Beseitigung der Luisenanlage in Alt-Saarbrücken.<br />
Dieser öffentliche Park erstreckte sich seit 1876<br />
links der Saar in Alt-Saarbrücken bis auf Höhe<br />
der gegenüberliegenden Hafeninsel in Malstatt-Burbach.<br />
Seit dem späten 17. Jahrhundert<br />
wurde hier im Hafenbecken am Altarm der Saar<br />
die in den umliegenden Gruben gewonnene<br />
Steinkohle gewogen, gelagert, von Lastkränen<br />
umgeladen und verschifft. Eigentümer waren<br />
die Saarbergwerke. In der Nachkriegszeit wurde<br />
das Hafenbecken mit Kriegstrümmern verfüllt.<br />
Das Areal wurde zum Schuttdepot. Über Jahrzehnte<br />
erfolgte auf weiten Teilen eine natürliche<br />
Renaturierung. 1967 entstand die Kongresshalle<br />
östlich des bachliegenden Bereichs der ehemaligen<br />
Hafeninsel und eine Teilfläche wurde als<br />
Parkplatz genutzt.<br />
Anfang der 1980er Jahre konkretisierte sich die<br />
Planung der Verkehrsanbindungen der A 1 (Trier,<br />
Köln) und der A 623 (Friedrichsthal, Zubringer zur<br />
A 8 Pirmasens) an die linksseitige A 620 (Stadtautobahn<br />
Saarbrücken-Saarlouis) über die neue<br />
Westspangenbrücke, die 1986 fertiggestellt<br />
wurde. In diesem Zusammenhang ließ die Stadt<br />
Saarbrücken in einem Gutachterverfahren ein<br />
Nutzungskonzept für die historische Industriebrache<br />
beziehungsweise die Kriegstrümmerlandschaft<br />
des ehemaligen Kohlehafens vom<br />
Büro Peter Latz und Partner, Gunter Bartholmai<br />
und Nicki Biegler erstellen, das 1981 in der großformatigen<br />
Publikation Hafeninsel. Alternativen<br />
zur Gestaltung eines citynahen Parks veröffentlicht<br />
wurde.<br />
Die Planer und Landschaftsarchitekten<br />
Dipl. Hort. Anneliese Latz, Prof.<br />
Dipl. Ing. Peter Latz und Paul von Pattay<br />
erarbeiteten dabei drei Konzepte,<br />
wobei die Variante eines geometrischbarocken<br />
Parks ebenso verworfen<br />
wurde wie die des klassischen englischen<br />
Landschaftsgartens. Beides<br />
erschien zu traditionell und hätte in<br />
keiner Weise Rücksicht auf die vorgefundenen<br />
Strukturen genommen.<br />
Diese bildeten jedoch die entscheidende<br />
Prämisse für die dritte,<br />
sowohl naturnah als auch geometrisch<br />
gestaltete Alternative, deren syntaktisches<br />
Konzept umgesetzt wurde. Entscheidend<br />
war die Akzeptanz der vorhandenen<br />
räumlichen Gegebenheiten.<br />
Dabei spielten die Integration differenzierter<br />
Nutzungsanforderungen
saargeschichte|n <strong>59</strong><br />
Bürgerpark Hafeninsel,<br />
gestutzte<br />
Heckenscheiben und<br />
hohe Pappelallee als<br />
Sicht- und Lärmschutz<br />
an der Westspange,<br />
2018.<br />
und entsprechende technische Lösungsansätze,<br />
zudem Ansprüche an die ästhetische Formensprache<br />
und eine moderne Anwendung von<br />
Vegetation eine entscheidende Rolle.<br />
Grundvoraussetzung für die Planung war die<br />
Analyse der architektonischen Hinterlassenschaften,<br />
der Topografie und des vegetativen<br />
Bestandes. Hinzu kam die Beschäftigung mit der<br />
ursprünglichen Nutzung dieses Industriestandortes<br />
und seiner Altlasten. Die Überprüfung der<br />
städtebaulichen Situation und die besonders<br />
von sozialen und wirtschaftlichen Erwägungen<br />
geprägte optimale Anbindung des neuen Parkareals<br />
an die Stadt waren erklärte Ziele von Peter<br />
Latz.<br />
Das Parkareal auf etwa 190 m über NHN erstreckte<br />
sich Anfang der 1980er Jahre auf etwa 9,5 Hektar<br />
entlang des rechten Saarufers und wurde von<br />
der neuen sechsspurigen Westspange mit ihren<br />
zwei Auf- und Abfahrten sowie dem darunter<br />
befindlichen Parkhaus in Nord-Süd-Richtung in<br />
zwei annähernd gleich große Hälften geteilt. Aktuell<br />
begrenzt eine große Niederlassung der Steag<br />
(technischer Service, Energieanlagen Süd) das<br />
Terrain im Westen. Die St. Johanner Straße mit<br />
dem 2000 implementierten Großkino Cinemax<br />
inklusive Parkplatz schirmen das Areal im<br />
Nordwesten von der Wohnbebauung des südlichen<br />
Malstatt ab. Im Nordosten entstand in<br />
den 1990er Jahren entlang der Hafenstraße<br />
die in zwei parallelen Gebäuderiegeln untergebrachte<br />
Agentur für Arbeit Saarland. Bereits<br />
1967 entstand die Con gresshalle im Osten nach<br />
Entwurf des renommierten Architekten Dieter<br />
Oesterlen. 1996/97 wurde die Parkfläche durch<br />
die Erweiterung der Congresshalle neu begrenzt<br />
und durch den vom Johannes-Hoffmann-Platz<br />
erreichbaren, langgestreckten fünfteiligen Parkhausriegel<br />
vermindert.<br />
Fußläufig zugänglich ist der Park über den<br />
von der St. Johanner Straße abzweigenden<br />
Schleusenweg im Westen, der zugleich das Areal<br />
auch begrenzt, und einen weiteren Stichweg,<br />
der als Verlängerung der von Norden auf die<br />
St. Johanner Straße treffenden Straße Auf der<br />
Werth westlich am Kino vorbei zum Park führt<br />
und dort auf die große diagonale Erschließung<br />
Richtung Saar und Westspange überleitet. Auch<br />
auf der östlichen Seite des Kinos kann man den<br />
Park betreten und gelangt auf einen Hauptweg<br />
in Nord-Süd-Verlauf, der, durch einen schmalen<br />
Grüngürtel (eng gestellte diagonale Heckenriegel<br />
und Alleebäume) von den Parkplätzen<br />
unter der Westspange getrennt, bis an den künstlichen<br />
Teich führt. Parallel dazu verläuft auch von<br />
der Hafenstraße aus ein vergleichbar gestalteter<br />
Weg auf die östliche Seite des Teichs. Auf Höhe<br />
der Abzweigungen der Westspange führen ausladende<br />
Betontreppenkonstruktionen sowohl<br />
links als auch rechts hinunter auf das Parkniveau.<br />
Man findet sich fast mittig in der Anlage zwischen<br />
hohen schmalseitig aufgereihten Heckensegmenten<br />
wieder. Des Weiteren sind zwei<br />
Zugänge von der Congresshalle angelegt, die<br />
zum einen auf den Freiplatz unterhalb des neuen<br />
Parkhauses führen beziehungsweise zur West-<br />
Ost-Querung des Bürgerparks. Der Uferweg entlang<br />
der Saar ist als Teil des Parkkonzeptes über<br />
mehrere Wege und dem zentralen Platz am Teich<br />
mit dem Park verbunden. Entlang der Saar werden<br />
die westlichen und östlichen Parkteile durch<br />
niedrige Stützmauern geschützt.
Bürgerpark Hafeninsel,<br />
Amphitheater,<br />
2018.<br />
Parallel zum Gutachterverfahren lobte die<br />
Saarbergwerke AG einen Wettbewerb für verdichteten<br />
Wohnungsbau als nördliche Randbebauung<br />
aus. Projektiert wurden viergeschossige<br />
Wohnbauten von gehobenem Standard, die<br />
jedoch nicht umgesetzt wurden. Vielmehr entstanden<br />
in den kommenden Jahren entlang der<br />
St. Johanner Straße und Hafenstraße in unmittelbarer<br />
Parknähe große Verwaltungs-, Veranstaltungs-<br />
und Parkhauskomplexe. Der Bürgerpark<br />
büßte die in den 1980er Jahren planerisch intendierte<br />
Bürgernähe mehr und mehr ein, da die<br />
Wohnquartiere durch verschiedene Neubauten<br />
städtebaulich in den Hintergrund rückten.<br />
Peter Latz erhielt den Auftrag, die inzwischen<br />
stark verwilderte Landschaft im Bereich der ehemaligen<br />
Hafeninsel als Bürgerpark zu gestalten.<br />
1983–1989 entstand ein innerstädtischer Landschaftspark,<br />
der die Geschichte des Industrieortes<br />
ebenso einbezieht wie das Trümmerfeld<br />
der Nachkriegszeit, und eine zeitgenössische, von<br />
ökologischen Gesichtspunkten geprägte Anlage<br />
in einem über Jahre hinweg aufgelassenen stadtnahen<br />
Bereich schafft. Diagonale Wege und Sichtachsen<br />
sowie ein dem Gauß-Krüger-Koordinatensystem<br />
folgendes Raster strukturieren den<br />
Park. Engagierte Bürger, Studentengruppen<br />
und Arbeitskräfte eines Arbeitsbeschaffungsprogramms,<br />
Lehrlinge und Handwerker konnten<br />
in Workshops Details nach eigenen Vorstellungen<br />
gestalten. Ziel war die identitätsstiftende Einbeziehung<br />
der Bevölkerung in den Schaffensprozess<br />
bei möglichst kostengünstigen Arbeitsleistungen.<br />
Den Auftakt der Parkanlage im Anschluss an<br />
die Congresshalle bildet eine begehbare türkisfarbene<br />
Stahlpergola mit großen segmentbogigen<br />
Öffnungen, die mit vergitterten<br />
Zwischenelementen alternieren. Sie wurde mit<br />
Glyzinien (Blauregen) bepflanzt. Durch diese<br />
begrünte Torwand gelangt man auf die mit Kopfsteinpflaster<br />
versehene große Freifläche, dem<br />
multifunktional nutzbaren Festplatz. Dieser wird<br />
im Norden durch zwei die Parkgrenze entlang<br />
des neuen Parkhauses säumende Mischhecken<br />
abgeschlossen.<br />
Auf dem Kopfsteinpflaster des Festplatzes wurde<br />
die einzige von insgesamt drei geplanten Skulpturen<br />
aufgestellt. Der Pariser Bildhauer Michel<br />
Gérard schuf die 1991 eingeweihte Installation<br />
Wanderung eines Caspar David. Sie besteht<br />
aus zwölf geschmiedeten Stahlelementen, die<br />
von Saarstahl in Völklingen produziert wurden.<br />
Das größte Element, ein Bogen von vier Metern<br />
Höhe und zwölf Metern Durchmesser, steht auf<br />
einer Fundamentplatte, ebenso sechs stehende<br />
Spitzen. Ein Spieß mit Spirale und eine überdimensionierte<br />
Garnrolle ruhen auf dem Pflaster.<br />
Anfang des 19. Jahrhunderts begann die industrielle<br />
Ausbeute der Erde. Gérard wählte Leitmotive<br />
aus den Gemälden Caspar David Friedrichs<br />
– Regenbogen und Bergspitzen. Romantische<br />
Naturvorstellung und industrielle Fertigung stehen<br />
eng beieinander. Übergroß erscheinen die<br />
Werkzeuge der Plünderung der natürlichen Ressourcen.<br />
Die begehbare Installation schafft ihren<br />
eigenen Bezug zum ehemaligen Kohlehafen und<br />
dem Umgang mit Natur im industriellen Zeitalter.<br />
Der Saaruferweg ist in ähnlicher Dichte wie in<br />
der Grünanlage des Stadens in Saarbrücken-<br />
St. Johann mit Platanen gesäumt, welche hier
saargeschichte|n 61<br />
als beidseitige Allee gepflanzt sind. Oberhalb<br />
des Uferwegs verläuft einer der Hauptwege<br />
des Parks parallel zur Saar von der Congresshalle<br />
zum Parkende am Schleusenweg. Flankierend<br />
bilden rechteckig gestutzte Mischheckensegmente<br />
Nischen aus, in denen weitere mit<br />
Beleuchtungskörpern ausgestattete Rankhilfen<br />
und Sitzgelegenheiten stehen. Die Bepflanzung<br />
verdichtet den Weg seitlich, so dass der Blick eng<br />
auf die Wasserwand fokussiert wird. Zwischen<br />
dem tunnelähnlichen, geschotterten Weg und<br />
dem offenen Festplatz wurden streng orthogonal<br />
Linden aufgestellt, die einen weitläufigen<br />
beschatteten Baumplatz bilden. Im Laufe der Zeit<br />
haben die Wurzeln die ehemals plane Kopfsteinpflasterung<br />
in sanfte Wellenformationen versetzt.<br />
Der künstliche Teich erstreckt sich beidseits<br />
und unter der Westspange und spiegelt deren<br />
Unterbau. Sein Saum ist teils mit feinem Sand<br />
aufgefüllt, teils mit einer Bambusanpflanzung<br />
begrünt, zu der sich im Laufe der Zeit noch Rohrkolben<br />
gesellt haben. Hier siedeln inzwischen<br />
verschiedene Enten- und Halbgansarten. Ein aufgeständerter<br />
Metallsteg führt nahe am Halbrund<br />
der hoch aufragenden Wasserwand aus<br />
Ziegelsteinen vorbei über den Teich hinweg und<br />
unter der Westspange hindurch. Dieser Steg<br />
war ursprünglich beleuchtet. Die Wasserwand,<br />
eines der Schlüsselelemente der Landschaftsgestaltung,<br />
erinnert an ein Segment aus einem<br />
römischen Aquädukt. Wie dort fließt das Wasser<br />
in einer offenen Rinne im oberen Abschluss. Eine<br />
Vielzahl kleiner Wasserspeier mit runden Öffnungen<br />
seitlich der Rinne ermöglichen Wasserergüsse<br />
aus höchster Höhe in den Teich. Auf diese<br />
Weise wird die urbane Geräuschkulisse durch das<br />
fallende Wasser überdeckt und zudem mit<br />
Sauerstoff angereichert bevor es wieder<br />
dem Teich zugeführt wird. Es handelt sich<br />
nicht allein um eine beeindruckende Konstruktion,<br />
sondern hier wird auch pragmatisch<br />
das Oberflächenwasser gesammelt<br />
und die Wasserzu- und -ableitung des<br />
Parks über das kleine unweit aufgestellte<br />
Pumpenhaus bewerkstelligt.<br />
Die aufgeständerte offene Parkhausebene<br />
beidseitig der darüber verlaufenden Westspange<br />
wird von einem breiten Band diagonal<br />
in enger Abfolge angeordneter Mischheckenreihen<br />
begleitet. Diese bestanden<br />
aus Weißdorn, Linden, Hainbuchen, Flieder<br />
und Liguster, der sich dem Formschnitt am<br />
besten anpasste und nun als dominantes<br />
Gehölz die mannshohen Hecken des Parks<br />
prägt. Geplant waren bis zu vier Meter Heckenhöhe,<br />
um die Hochstraße zu kaschieren. Die<br />
Formerziehung durch entsprechende Schnittmaßnahmen<br />
erwies sich jedoch als zu hoher<br />
gartentechnischer Aufwand, zumal in dem zur<br />
unteren Parkebene abschüssigen Gelände.<br />
Als weitere die Höhenstaffelung gen Hochstraße<br />
fortsetzende Elemente tragen die beiden Alleen<br />
hoch aufgeschossener Säulenpappeln auch zur<br />
Sichtabschirmung bei. Peter Latz verband mit<br />
ihnen die Assoziation an südländische, von Zypressen<br />
gesäumte Straßen.<br />
Wichtige Prämissen für die Parkgestaltung waren<br />
eine möglichst Verkehrslärm absorbierende Konzeption<br />
(Wasserwand, Heckenmauern), um neben<br />
der aktiven Nutzung, die vorwiegend im Ostteil<br />
des Parks verortet wurde (Festplatz, später Boulebahn,<br />
aktuell neue Skateranlage), Ruhezonen<br />
in Flussnähe und im Westteil zu erschaffen. Der<br />
Park bietet ein großes Spektrum im Umgang mit<br />
Pflanzkulturen, welches die historische Dimension<br />
der Entwicklung neuzeitlicher Grünanlagen<br />
vom Barock über die romantischen Landschaftsgärten<br />
des 19. Jahrhunderts mit ihren architekturhistorischen<br />
Zitaten widerspiegelt. Vom<br />
ausgeprägten Formwillen (Heckenerziehung,<br />
Buchsbaumformtrimmung) und linearer, geometrischer<br />
Anordnung (Betonung der diagonalen<br />
Wegeführung beziehungsweise Rasterung<br />
mittels Pflanzschemata, lange Blickachsen) reicht<br />
das Repertoire über pflegeintensive Teilbereiche<br />
(Kräuterkiste, Rosenanlage, Beetbepflanzung) zur<br />
Steinspirale mit differenzierten Bodensubstraten,<br />
die der Spontanvegetation zur Verfügung gestellt<br />
wurden, sowie zum weitgehend unangetasteten<br />
Trümmergrundstück mit ökologischem Eigenleben.<br />
Bürgerpark<br />
Hafeninsel,<br />
Spolienwand, 2018.
Aspektreich bieten die überaus zahleichen und<br />
vielfältigen überlieferten Materialien, aus denen<br />
Wegbeläge, Mauern, Treppen, Sitzgelegenheiten,<br />
Nischen, Einfassungen von Pflanzbereichen und<br />
Aussichtspunkte entwickelt wurden, unzählige<br />
optische und haptische Attraktionen. Latz<br />
entwickelte Klamottmauerwerk als Grundbestandteil<br />
der Mauertechnik im Park, für das<br />
die vorgefundenen riesigen Blöcke zusammenhängender<br />
Mauer- beziehungsweise Betonverbände<br />
umgenutzt wurden. Das Entdecken historischer<br />
Relikte und deren Umdeutung im neuen<br />
Parkkontext ist Programm. Neben dem Hauptzugang<br />
von Seiten der Congresshalle, wo durch<br />
die begrünte mehrbogige Pergola der Wechsel<br />
aus der urbanen Struktur in die Grünzone<br />
besonders akzentuiert wird, sind noch sechs<br />
weitere Zugänge vorhanden. Die leichte Erreichbarkeit<br />
des Bürgerparks war ein wichtiges planerisches<br />
Anliegen. Alle Zugänge sind Ausgangspunkte<br />
von Hauptwegen, die zugleich, durch<br />
architektonische und/oder vegetabile seitliche<br />
Wegbegleiter hervorgehoben, lange Blickachsen<br />
bilden. Zusammen mit der diagonalen Wegeführung<br />
sollte eine optische Erweiterung erzeugt<br />
werden.<br />
Gen Westen erschließt sich über die Teichachse<br />
zunächst ein klassisches Landschaftsparksegment<br />
– eine kleinhügelige, mit Buschund<br />
halbhohen Baumgruppen bestandene<br />
Schutttopografie, die vielfältige An- und Einblicke<br />
gewährt. Die syntaktische Durchdringung<br />
naturnaher Gestaltung und geometrischer Ordnung<br />
gelingt im Westteil des Parks am eindringlichsten.<br />
Neben Strauchrosenrabatten wurden<br />
vereinzelte Ölweiden und Traubenkirschen<br />
gepflanzt. Hauptwege bilden ein großes Dreieck<br />
aus, das in optimaler Sonnenlage eine Wildkrautflur<br />
in quadratisch gerasterten Flächen aufnahm.<br />
Eine dieser Fläche füllt eine große steinerne Spirale,<br />
deren unterschiedliche Bodensubstrate differenzierte<br />
Spontanvegetation befördern sollte.<br />
Ein weiteres Hauptanliegen bestand in der<br />
Auflassung verschiedener Parkareale, die ökologisch<br />
sich selbst überlassen blieben, wie das<br />
Trümmergrundstück im Süden und Osten des<br />
Rondells. Dieses entstand als architektonischer<br />
Schwerpunkt im Westen des Parks in Nachbarschaft<br />
zur ungebändigten Natur, in Anlehnung<br />
an römische und neuzeitliche Vorbilder, als Ort<br />
multipler kultureller Open-Air-Veranstaltungen.<br />
Das große in den Schutthügel eingetiefte, von<br />
hohen Stützmauern und einer mit Glyzinien<br />
berankten Pergola umgebene Kreisrund ist über<br />
drei in den Hügel eingeschnittene Zugänge und<br />
Treppen erreichbar. Die Brunnen- beziehungsweise<br />
Bühnenanlage liegt im Zentrum, umgeben<br />
von höhengestaffelten Sitzbänken. Klinker ist<br />
das vorherrschende Material. Von Buchsbaum<br />
gesäumte Blumenbeetsegmente lassen den Ort<br />
zum geordneten, intensiv gepflegten Garten im<br />
Park werden. Versenkt in den Schutthügel entsteht<br />
ein Ruheort abseits des Verkehrs- und<br />
Stadtlärms.<br />
In Richtung Schleusenweg und Unteres Malstatt<br />
waren im Bereich des Bauhofes Nachbarschaftsgärten<br />
geplant, die den Malstatter Anwohnern<br />
zur individuellen Bepflanzung und Nutzung zur<br />
Verfügung gestellt werden sollten. Die persönliche<br />
Gestaltung durch die Anwohner sollte dem<br />
Park zu besserer Akzeptanz durch die Bevölkerung<br />
verhelfen.<br />
Eine weitere Ruhezone bietet der zwischen Rondell<br />
und Westspange ebenfalls in Rundform<br />
angelegte Kastanienhain, ein leicht abgesenkter<br />
Platz mit gemauerten Sitzgelegenheiten, welcher<br />
den ursprünglichen Belag samt Kastanienbäumen<br />
in den Park integriert. Eine Hecke erhöht<br />
optisch den rückwärtigen Wandabschluss, so dass<br />
auch diese kleine Arena sich in den umgebenden<br />
Grünbereich einfügt. Nahe der Böschungsmauer<br />
am Uferweg im Südwesten erlaubt ein Pavillon<br />
den Ausblick über die Saar nach Alt-Saarbrücken.<br />
Die meisten Hauptwege haben begleitend architektonische<br />
Ausstattungen, wie zum Beispiel<br />
kniehohe Mäuerchen, Treppenwangen aus Spolien,<br />
mannshohe Stützmauern mit Pilastern,<br />
Segmentbögen und Nischen oder aufgesetzte<br />
Betonquader mit Schlackesplittoberfläche. Allein<br />
der lange, parallel zur St. Johanner Straße verlaufende<br />
nordwestliche Begrenzungsweg ist<br />
als Pflanzenwand ausgebildet. Das Besondere<br />
der fast zwei Meter hohen Wallhecke in Mischkultur<br />
ist ihr Schnittbild, das als pulsierende<br />
Welle hinter einer Reihe von Götterbäumen viel<br />
Raum einnimmt. Torähnliche Durchlässe, meist<br />
als Ziegelsteinkonstruktionen, wie hohe Pfeiler<br />
mit Übergängen oder Bogenkonstruktionen<br />
ergänzen das architektonische Inventar des Parks<br />
und dienen wiederum der Akzentuierung der<br />
Blickachsen.<br />
Straßenbäume kündigen in den Randbereichen<br />
des Parks bereits die Grünanlage an. Im Park kontrastieren<br />
ruhige Rückzugsräume mit offenen<br />
strapazierfähigen Flächen. Zur Benutzerfreundlichkeit<br />
gehörten eine konstante Beleuchtung<br />
des Hauptwegenetzes, eine Toilettenanlage und<br />
ein Funktionsgebäude für die Gartenpflege.<br />
Die historische Nutzung als Kohlehafen und<br />
die Zweitnutzung als Kriegsschuttdeponie ist
saargeschichte|n 63<br />
Bürgerpark Hafeninsel,<br />
Park- und<br />
Spolienlandschaft,<br />
2018.<br />
anhand diverser Relikte und Ruinen der ehemaligen<br />
Logistikanlage in situ im Park mannigfaltig<br />
ablesbar. Der nach syntaktischem Entwurfskonzept<br />
realisierte Landschaftspark Hafeninsel<br />
im Saarbrücker Stadtteil Malstatt zeichnet<br />
sich durch seine minimalistischen Eingriffe in<br />
die vorhandene Topografie aus. Die natürliche<br />
Pionierpflanzenwelt des Brachlandes wurde in<br />
bestimmten Segmenten bewahrt.<br />
Viele Spolien, überwiegend aus kriegszerstörten<br />
Architekturen des Stadtgebietes, als historische<br />
Relikte uminterpretiert, erhielten eine neue<br />
Funktion und wurden erkennbar teils durch<br />
neue Materialien ergänzt. Die vorgefundenen<br />
historischen Hinterlassenschaften dienen als<br />
Bedeutungsträger der Aufarbeitung des Vergangenen.<br />
Parallel werden die Geschichte und<br />
die Pflanzensukzession des Ortes in großen<br />
Bereichen des Parks thematisiert. Dabei spielt<br />
die vorgefundene Vielfalt der Pflanzen und der<br />
Bodensubstrate aus den verschiedensten geologischen<br />
Vorkommen des Saarlandes eine entscheidende<br />
Rolle. Angestrebt wird die existierende<br />
Flora weiter zu entwickeln, um artenreiche<br />
Biotope zu generieren. Diese stehen in Kontrast<br />
zu den pflegeintensiven Gartenarealen, die sich<br />
über die Hafeninsel verteilen.<br />
Der Rückgriff in die europäische Kunst- und Baugeschichte<br />
findet im Bereich der Landschaftsgartengeschichte<br />
statt. Das Label postmodern<br />
wird aussagekräftig in der hervorragenden syntaktischen<br />
Neuinterpretation barocker Gartenstrukturen<br />
und englischer Landschaftsgartenelemente<br />
dargelegt. Die Grundformen der<br />
beiden neuen Großbauwerke des Parks lösen<br />
Assoziationen an römische Aquädukte und Arenen<br />
aus. Einzelne Relikte werden aufgegriffen,<br />
in den neuen Park integriert (zum Beispiel eine<br />
Kellerruine im Westen, Schienen und Pflaster im<br />
Osten) und zum Teil neu interpretiert (zum Beispiel<br />
Kastanienhain oder Klammottmauern). Eine<br />
für die postmoderne Architekturströmung charakteristische<br />
Uminterpretation und Funktionsänderung<br />
einzelner, größerer historischer Bauelemente<br />
fehlt.<br />
Bedeutend erscheint der neuartige Ansatz im<br />
Umgang mit einer innerstädtischen Industriebrache.<br />
Die Landeshauptstadt hatte sich Anfang<br />
der 1980er Jahre für einen Wandel der städtebaulichen<br />
Leitbilder entschlossen. Zwischen<br />
den Saarbrücker Industriestandorten, den Verwaltungssitzen<br />
und den Nahtstellen der Stadtteile<br />
Malstatt-Burbach und St. Johann entstand<br />
vor dem Hintergrund der damals begeisterten<br />
und engagierten Umweltbewegung in Deutschland<br />
ein Nukleus ökologischer Stadterneuerung.<br />
Als Vorläufer von Parkanlagen mit industrieller<br />
Vorgeschichte kann der 1973 bis 1975 nach Entwurf<br />
von Richard Haag angelegte Gas Works<br />
Park in Seattle, Washington, angesehen werden.<br />
Die historische Kohlevergasungsanlage blieb im<br />
öffentlichen Park als Landmarke, als Zitat der<br />
ehemaligen industriellen Nutzung, erhalten,<br />
während das Gelände jedoch wegen starker Altlasten<br />
abgedichtet und planiert wurde.<br />
Die Saarbrücker Hafeninsel ist eines der frühesten<br />
europäischen Beispiele für die Konversion<br />
einer Industriebrache in einen innerstädtischen<br />
Landschaftspark und bleibt im Saarland singulär.<br />
Etwa zeitgleich entstand 1983 bis 1998 im Nordosten<br />
von Paris der Parc de la Villette auf dem ehemaligen<br />
Schlachthofareal. Die größte öffentliche
Pariser Parkanlage berücksichtigt die 1982 formulierte<br />
Wettbewerbsanforderung, die Geschichte<br />
des Ortes bei der Planung zu berücksichtigen.<br />
Der schweizer Architekt Bernhard Tschumi schuf<br />
den 35 ha großen Park mit knallroten Pavillons,<br />
den Folies, als Knotenpunkte auf einer orthogonal<br />
gerasterten Matrix. In Barcelona wurde<br />
1985 bis 1986 ein ehemaliges Werksgelände der<br />
spanischen Eisenbahngesellschaft in einen 2,7 ha<br />
großen innerstädtischen Quartierspark, dem Parc<br />
del Clot, umgewandelt. Die Landschaftsarchitekten<br />
Dani Feixes und Vincente Miranda nahmen<br />
Industrierelikte in die Parkgestaltung auf<br />
und interpretierten sie im neuen Umfeld um.<br />
Thema dieser landschaftsarchitektonischen<br />
Bestrebungen war die Reintegration von altindustriellen<br />
Standorten in urbane Funktionsräume<br />
in städtebaulich wertvoller Lage. Aus dem<br />
Industriestandort und der Kriegsschuttdeponie<br />
wurde ein vielseitig nutzbarer Freizeitbereich.<br />
Eine Revitalisierung im industriellen Architekturkontext<br />
erfolgte im Saarland erstmals in großem<br />
Maßstab im Zusammenhang mit der Umund<br />
Nachnutzung des baulichen Bestandes<br />
des ehemaligen Eisenwerkes in Völklingen, das<br />
1994 als erstes Industriedenkmal in die Weltkulturerbeliste<br />
der UNESCO aufgenommen und<br />
dann zum Großmuseum, Veranstaltungsort und<br />
multimedialem Wissenschaftszentrum weiterentwickelt<br />
wurde.<br />
Im 21. Jahrhundert wird das Thema Industriebrachenumgestaltung<br />
seit 2006 alljährlich im Rahmen<br />
der ibug künstlerisch vereinnahmt – ein<br />
sächsisches Festival für urbane Kunst, welches<br />
Oberflächen, Räume und Plätze der Industriebrachen<br />
künstlerisch recycelt.<br />
Im Werk des Landschaftsarchitekten Peter Latz<br />
nimmt das Saarbrücker Projekt Bürgerpark<br />
Hafeninsel sicherlich einen besonderen Stellenwert<br />
ein, da er dem Saarland über lange Jahre in<br />
Leben und Arbeit verbunden war. So wuchs er im<br />
Saarland auf und gründete nach dem Studium<br />
der Landschaftsarchitektur an der TH in München<br />
und der Weiterbildung im Städtebau an der<br />
RWTH Aachen 1968 mit seiner Frau Anneliese<br />
ein Landschaftsarchitekturbüro in Aachen und<br />
zusammen mit Herbert Kruske in Saarbrücken.<br />
Zusammen mit dem Dillinger Architekten Conny<br />
Schmitz führte er bis 1976 ein Büro für interdisziplinäre<br />
Stadtplanung in Saarlouis. 1974 wurde<br />
Kassel Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Ab 1983<br />
an der TU München-Weihenstephan als Lehrstuhlinhaber<br />
für Landschaftsarchitektur und<br />
Planung beschäftigt, zog das Büro 1991 nach<br />
Ampertshausen bei Kranzberg/Bayern. Peter Latz<br />
wurde vielfach international ausgezeichnet. 1989<br />
erhielt er für den Bürgerpark Hafeninsel den<br />
Landschaftsarchitekturpreis des Bundes Deutscher<br />
Landschaftsarchitekten (BDLA) und 2000<br />
für die Planung des Emscher Parks in Duisburg-<br />
Nord den Ersten Europäischen Preis für Landschaftsarchitektur<br />
in Barcelona. 2001 folgte die<br />
Grande Médaille d’Urbanisme der Académie<br />
royale d’architecture in Paris und 2016 verlieh<br />
ihm die International Federation of Landscape<br />
Architects in Turin den Sir Geoffrey Jellicoe Award.<br />
Die Belassung und Einbeziehung historischer<br />
Grundstrukturen folgt dem Motto function follows<br />
form, das vom Büro Latz und Partner erstmals<br />
bei der Parkgestaltung der Saarbrücker<br />
Hafeninsel realisiert wurde. Im Werkzusammenhang<br />
erscheint der Bürgerpark als Pionierprojekt.<br />
In kleinem Maßstab wurden prototypisch Fragestellungen<br />
und Analysemethoden bezüglich der<br />
historischen, vegetabilen und städtebaulichen<br />
Matrix angewandt. Die umfassende Nutzungssuche<br />
für vorstrukturierte Areale wurde später<br />
im Großformat im Emscher Park in Duisburg-<br />
Nord ausdifferenzierter umgesetzt. Die Industrieanlagen<br />
sind keine Zitate einer abgeschlossenen<br />
Epoche wie in Seattle, sondern bleiben im Kontext<br />
verbundene interagierende Elemente<br />
analog zu Biotopen oder Gelände- und Infrastrukturen<br />
des ehemaligen Industriestandorts.<br />
Die Parkkonzeption ermöglicht und fördert die<br />
Spontanbildung von Biotopen (Teich mit neuer<br />
Flora und Fauna, Ökokiste auf dem Schutthügel).<br />
Die Weiterentwicklung natürlicher Prozesse und<br />
die damit einhergehende langsame Veränderung<br />
der Parkanlage waren im Konzept vorgesehen.<br />
Für Peter Latz war die Realität offen und<br />
interpretierbar. Eine neue Gestalt konnte<br />
durch Anreicherung mit funktionalen und<br />
gestalterischen Elementen ohne Negation oder<br />
Zerstörung des Historischen entstehen. Wichtig<br />
sei ein Park mit offenem Ende, das heißt einer<br />
Entwicklungsfähigkeit innerhalb der Grundstruktur,<br />
da auch künftig Ansprüche und Konflikte<br />
den Park neu definieren werden.<br />
Den größten Eingriff in die Parksubstanz<br />
bedeutete der Verlust einer Teilfläche im Nordosten<br />
zugunsten des langestreckten mehrteiligen<br />
Parkhauses in den 1990er Jahren. Anlässlich<br />
des Neubaus der Landeszentralbank im<br />
Winkel zwischen Westspange und Hafenstraße<br />
1990 konnte Peter Latz das südlich anschließende<br />
Gelände mit einem Kiefernhain neu gestalten.<br />
Analog dazu wurden auch die drei Kiefern im<br />
Zugangsbereich auf der Nordwestseite der<br />
Congresshalle gepflanzt. Zwischenzeitlich erfolg-
saargeschichte|n 65<br />
te der Rückbau der Toilettenanlage. Ein Unterstand,<br />
eine reversible leichte Metallkonstruktion,<br />
wurde für die Mitglieder des ortsansässigen Bouleclubs<br />
genehmigt. Die Brunnenanlage in der<br />
Arena wurde 2018 provisorisch mit einer begehbaren<br />
Holzkonstruktion mit Metallbelag zerstörungssicher<br />
gegen Vandalismus abgedeckt.<br />
Aktuell (2018) wird ein Schutthügel nordöstlich<br />
der Wasserwand für eine Skaterbahn neu modelliert.<br />
Die bisherigen Veränderungen haben die<br />
wesentlichen Strukturen und Komponenten<br />
des Landschaftsparks nicht maßgeblich beeinträchtigt,<br />
vielmehr tragen die neuen Nutzungen<br />
durch Boulespieler und Skater vermehrt zu dessen<br />
Akzeptanz, positivem Gebrauch und somit<br />
zur Erhaltung bei.<br />
Der in vielerlei Hinsicht innovative Park ist ein<br />
signifikanter Bedeutungsträger für die Saarbrücker<br />
Stadtgeschichte und die saarländische<br />
Industriegeschichte sowie den in den 1970er<br />
Jahren in Deutschland aufkommenden ökologischen<br />
Wertewandel. Der Bürgerpark Hafeninsel<br />
stellt zugleich im internationalen Kontext<br />
der Landschaftsarchitekturgeschichte ein<br />
herausragendes Zeugnis dar. Der Landschaftspark<br />
besitzt aus stadt- und regionalgeschichtlichen,<br />
insbesondere aus architektur-, industrieund<br />
gartenhistorischen Gründen im öffentlichen<br />
Interesse eine besondere Bedeutung.<br />
Saarlandfarben von Georg Fox<br />
Über den Charme des Landes und vom Glück,<br />
im Saarland leben zu dürfen<br />
Georg Fox<br />
Neu aufgelegt und ab sofort<br />
wieder erhältlich im Buchhandel,<br />
bei Amazon oder bei<br />
www.edition-schaumberg.de<br />
saarlandfarben<br />
Über den Charme des Landes und vom Glück, im Saarland leben zu dürfen
»bei kameraden und<br />
vorgesetzten stets beliebt«<br />
Das Schicksal der Dillinger Ernst und Otto Schmeyer –<br />
nach ihren Feldbriefen erzählt<br />
von joachim conrad<br />
Peter Schmeyer<br />
(1889–1932) um 1914.<br />
(PA Schmeyer Homburg.<br />
NL Cäcila<br />
Schmeyer Best.7,1)<br />
»Media vita in morte sumus« – Mitten im Leben<br />
sind wir im Tod. Der Tod traf im Zweiten Weltkrieg<br />
unzählige Familien in Deutschland – aber<br />
manche mehr als andere. Das zeigen die Feldpostbriefe<br />
der Brüder Ernst und Otto Schmeyer<br />
aus Dillingen. Durch den Tod der beiden Söhne<br />
veranlasst, hütete die Mutter Cäcilia die Dokumente<br />
wie einen Schatz. Nach ihrem Tod blieben<br />
sie weitgehend unbeachtet in einem Ordner,<br />
bis sie der Urenkel von Cäcilia Schmeyer, Thomas<br />
Schmeyer, wiederentdeckte und zugänglich<br />
machte.<br />
Der Vater der Brüder Ernst und Otto, Hüttenarbeiter<br />
Peter Schmeyer [1] aus Dillingen, hatte<br />
noch im Ersten Weltkrieg für Kaiser und Reich<br />
gekämpft. Sein Militärpass hat sich erhalten. [2]<br />
In Friedenszeiten, am 13. Oktober 1909, trat er<br />
seinen Dienst in der 11. Kompanie des Oberrheinischen<br />
Infanterieregiment Nr. 97 an und<br />
wurde bis zum Gefreiten befördert. [3] Die Liste der<br />
Gefechte, an denen er im Ersten Weltkrieg teilnahm<br />
ist lang [4] , dazu gehören Verdun (3. November<br />
1917 bis 9. April 1918) und Flandern (5. Mai<br />
[1] Peter Schmeyer, geboren am 15. Mai 1889 in Dillingen,<br />
dort gestorben am 16. Juli 1932.<br />
[2] PA Schmeyer Homburg. NL Cäcila Schmeyer Best. 1,1 Militärpass<br />
von Peter Schmeyer.<br />
[3] Durch den Militärpass erfahren wir, dass Peter Schmeyer<br />
1,66 m groß war und – wie üblich – in der ersten Schießklasse<br />
ausgebildet wurde. Nach seiner Beförderung zum<br />
Gefreiten am 17. Dezember 1910 erfolgte die Beurlaubung<br />
zur Reserve am 25. September 1911. 1914 brach dann<br />
der Krieg aus.<br />
[4] Das waren: 21. bis 25. August 1914 Longwy, 1. September<br />
1914 Dannevoux, 29.November 1914 bis 5. Januar 1915<br />
Argonnenwald, 25. September bis 11. Oktober 1916 Verdun,<br />
24. Dezember 1916 bis 8. März 1917 Champagne, 3.<br />
November 1917 bis 9. April 1918 Verdun (mit Unterbrechung),<br />
5. Mai bis 11. September 1918 Flandern (mit Unterbrechung).<br />
bis 11. September 1918), wobei ausdrücklich festgehalten<br />
wurde, dass die Teilnahme an den<br />
Schlachten immer wieder unterbrochen wurde<br />
durch Heimaturlaube. Die Verwundungen [5] halten<br />
sich im Rahmen, die Auszeichnungen auch:<br />
am 1. August 1917 Eisernes Kreuz II. Klasse und am<br />
26. Juli 1918 das Verwundetenabzeichen.<br />
[5] Notiert sind für den 1. September 1914 ein Schuss in die<br />
rechte Hand und für den 5. Januar 1915 eine Gehirnerschütterung.
saargeschichte|n 67<br />
Peter Schmeyer hatte die standeslose Katharina<br />
Cäcilia Stein [6] geheiratet; sie gebar ihm drei<br />
Söhne: Ernst, Otto und Josef. Cäcilia Schmeyer<br />
muss eine starke Frau gewesen sein, denn sie<br />
kämpfte ein Leben lang. Am 16. Juli 1932 war Peter<br />
Schmeyer wohl an den Spätfolgen des Krieges<br />
gestorben, und seine Witwe Cäcilia focht (ihren<br />
ersten Kampf) um die Rente und den Unterhalt<br />
der Söhne aus. [7] Sie nahm dann am 30. November<br />
1935 eine Putzstelle bei der Dillinger Hütte an,<br />
die sie noch am 3. August 1944 innehatte. [8]<br />
Der älteste Sohn Ernst Peter war den Eheleuten<br />
am 16. Dezember 1920 in Dillingen geboren worden.<br />
Er besuchte die achtklassige katholische<br />
Volksschule am Ort, die er am 30. März 1935 verließ,<br />
[9] machte eine Ausbildung zum Technischen<br />
Zeichner und besuchte die Gewerbliche Berufsschule<br />
Bezirk Dillingen-Saar. [10] Mit Kriegsbeginn<br />
wurde er zum Heer eingezogen.<br />
[6] Katharina Cäcilia Schmeyer geb. Stein, Hausfrau, geboren<br />
am 29. April 1897 in Hülzweiler, gest. am 22. April 1972<br />
in Wallerfangen.<br />
[7] PA Schmeyer Homburg. NL Cäcila Schmeyer Best. 2,1<br />
Schreiben des Knappschaftsvereins der Dillinger Hüttenwerke<br />
zu Dillingen-Saar betr. Die Witwenpension<br />
nach dem Tod des Peter Schmeyer († 16. Juli 1932) vom<br />
26. Juli 1932.<br />
[8] Ebd. Best. 2,2 Arbeitsbuch als Putzfrau auf der Dillinger<br />
Hütte.<br />
[9] Ebd. Best. 3,2 Entlassungszeugnis der Katholischen<br />
Volksschule Dillingen vom 30. März 1935.<br />
[10] Ebd. Best. 3,3 Zeugnis der Gewerblichen Berufsschule Bezirk<br />
Dillingen-Saar vom 27. Oktober 1937.<br />
Der zweite Sohn Otto wurde am 23. März 1926<br />
in Dillingen geboren und besuchte ebenfalls die<br />
katholische Volksschule. [11] Am 3. Oktober 1940<br />
unterschrieb seine Mutter den Lehrvertrag bei der<br />
Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke; er<br />
wurde Modellschreiner und verließ die Gewerbliche<br />
Berufsschule Dillingen am 20. März 1943. [12]<br />
Bald danach zog er ins Feld. Beide Brüder sollten<br />
sterben. Nur der dritte, Josef Ambrosius, geboren<br />
am 3. Oktober 1929 in Dillingen, hatte die Gnade<br />
der späten Geburt und blieb am Leben. Von ihm<br />
sind im Nachlass der Mutter Cäcilia keine Dokumente<br />
erhalten. Das Gros des Nachlasses besteht<br />
aus Korrespondenz, besonders mit dem älteren<br />
[11] Ebd. Best. 4,1 Zeugnisheft der Katholischen Volksschule<br />
in Dillingen. Die Laufzeit des Heftes reicht aber nur vom<br />
7. April 1932 bis 20. März 1939.<br />
[12] Ebd. Best. 4,5 Beglaubigte Abschrift des Schulabgangszeugnisses<br />
vom 20. März 1943.<br />
Gruppenbild 1917.<br />
(PA Schmeyer Homburg.<br />
NL Cäcila<br />
Schmeyer Best. 7,11)<br />
Ernst Schmeyer als<br />
Säugling um 1921. (PA<br />
Schmeyer Homburg.<br />
NL Cäcila Schmeyer<br />
Best. 7,12)
Ernst Schmeyer<br />
(rechts) und Hans<br />
Ferner um 1939. (PA<br />
Schmeyer Homburg.<br />
NL Cäcila Schmeyer<br />
Best. 7,14)<br />
Die Hosen sind durchgescheuert.<br />
Album<br />
mit Bildern von Otto<br />
und Ernst Schmeyer<br />
im Zweiten Weltkrieg.<br />
(PA Schmeyer<br />
Homburg. NL Cäcila<br />
Schmeyer Best. 9,1<br />
Nr. 5)<br />
Sohn Josef. Diese Korrespondenz beleuchtet bei<br />
der ganzen tragischen Situation der Mutter die<br />
Verhältnisse dieser Zeit.<br />
»Ein fröhliches Treiben« – Reichsarbeitsdienst<br />
Während die Rote Zone und damit Dillingen evakuiert<br />
war, befand sich Ernst Schmeyer in Schönebeck<br />
an der Elbe im Reichsarbeitsdienst. Anlässlich<br />
eines Heimataufenthaltes wollte er die<br />
Mutter mit den jüngeren Brüdern besuchen und<br />
machte sich mit dem Fahrrad auf den Weg durch<br />
den Hunsrück. Vergeblich. Ihm wurde gesagt,<br />
man habe die Dillinger nach Bleicherode in den<br />
Harz gebracht. »Das erste, was wir dort hörten,<br />
war, das[s] wir arbeiten könnten. Dazu hatten wir<br />
aber keine Lust. Von Essen u. Quartier war hier<br />
überhaupt nichts zu sehen und noch viel weniger<br />
von den Dillingern. Wir hatten hier die Nase ziemlich<br />
voll und den Magen bedenklich leer. Wir fuhren<br />
anderntags auf eigene Gefahr nachmittags<br />
um V 8 Uhr los in Richtung Magdeburg […]. Es<br />
hieß, hinter Magdeburg sind die ganzen Dillinger.<br />
So kamen wir hier nach Schönebeck ziemlich ausgehungert.<br />
[…] Jetzt bin ich hier bei einem Apot[h]eker<br />
und habe es sehr gut, habe ein Zimmer u.<br />
ein Bad dabei. Bis jetzt brauchte ich noch nichts<br />
zu bezahlen; es sind sehr nette Leute.« [13]<br />
In Schönebeck arbeitete Ernst in der ortsansässigen<br />
Patronen- und Zündhütchenfabrik<br />
als Zeichner und verdiente 120 Reichsmark. Der<br />
Neunzehnjährige konnte seiner Mutter stolz vermelden,<br />
dass er 153 Pfund wog, beichtete aber<br />
auch, dass er in Dillingen zwei Tage »vergnügt<br />
mit den Soldaten verlebt [hat] zwischen Wein<br />
und Bier. Es wurde nämlich sämtlicher Alkohol<br />
von den Männern ausgetrunken; das war ein<br />
fröhliches Treiben.« [14]<br />
Nachdem Ernst Schmeyer nach Wiesbaden als<br />
Gefreiter gewechselt war, berichtet er vom Alltag<br />
in den Kasernen. An keiner Stelle hat man den<br />
Eindruck, dass ein grausamer Krieg tobte. »Unser<br />
Dienstplan ist folgender. Morgens um 6 Uhr ist<br />
Wecken. Um 6.50 Uhr haben wir Antreten zur<br />
Befehlsausgabe. In den 50 Min. müssen wir Betten<br />
bauen, etwas Kaffee trinken und waschen.<br />
Von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr haben wir Unterricht<br />
über das Gewehr; Rangordnungen von Offizieren<br />
usw. Von 9 bis V 10 haben wir Kaffeetrinken.<br />
Von V 10 bis 10 formale Ausbildung, also Exerzieren,<br />
Gewehrübungen, Gehen und Stehen. Das<br />
macht mir am meisten Spaß. Da geht es so richtig<br />
stramm zu. Von 12 bis 2.00 haben wir Mittagspause.<br />
Wenn wir raustreten, müssen wir die Finger<br />
vorzeigen. Das Essen ist tadellos. Wir erhalten<br />
ganz selten nur Eintopf, und die Woche hatten<br />
wir jeden Tag Fleisch. Von 2.00 Uhr bis 6.00 Uhr<br />
haben wir verschiedenen Dienst. Entweder theoretisch<br />
oder Luftschutzübung oder Gewehr oder<br />
Kleiderappell oder Sport. Um 10 Uhr müssen wir<br />
in den Betten sein. Vorher aber müssen wir die<br />
Stube blitzblank machen.« [15]<br />
»Alles halb so wild« – Durchhalteparolen<br />
Um Mutter und Brüder zu beruhigen, bemühte<br />
sich Ernst Schmeyer beständig darum, positive<br />
Nachricht zu übermitteln. Der Gefreite schrieb<br />
aus Wiesbaden: »Meine Uniform passt mir fabelhaft.<br />
Aber Stiefel haben wir noch nicht und neue<br />
Stiefelzieher brauche ich noch nicht. Eine Ausgangsuniform<br />
haben wir auch schon. Meine<br />
eigene Wäsche werde ich auch wieder schicken.<br />
Meine Militärwäsche bekommen wir gewaschen.<br />
[13] Ebd. Best 3,4. Brief von Ernst Schmeyer an die Mutter<br />
vom 24. September 1939, S. 1. Der Verf. schreibt fast<br />
ohne Satzzeichen; sie sind hier ergänzt.<br />
[14] Ebd., S. 2–3.<br />
[15] PA Schmeyer Homburg. NL Cäcila Schmeyer Best. 3,5.<br />
Brief von Ernst Schmeyer an die Mutterr vom 12. Oktober<br />
1940.
saargeschichte|n 69<br />
Wir brauchen nur die Taschentücher und Strümpfe<br />
zu waschen und die Halsbinden.« [16] Nur selten<br />
und knapp kommen klare Worte: »Es gefällt mir<br />
immer noch gut, wenn es auch manchmal scheisse<br />
ist« [17] , dann geht es positiv weiter: »Auf unserer<br />
Stube liegen alles Pfälzer oder Mannheimer,<br />
und wir haben eine Bombenkameradschaft.<br />
Einen Volksempfänger haben wir uns auch schon<br />
zugelegt.« [18]<br />
Also »bestens versorgt« hatten die Rekruten auch<br />
viele Vergnügungen, schenkt man den Briefen<br />
von Ernst Schmeyer Glauben. »Wir bekommen<br />
[…] am Freitag Geld und unser Soldbuch und<br />
dann können wir allein ausgehen. Hier in Wiesbaden<br />
ist ein schönes Treiben in den Lokalen und<br />
ganz tolle Mädels, und als Soldat hat mans ziemlich<br />
leicht, um mit Mädels weg zu gehen.« [19]<br />
Und weil die Mutter kritisch nachfragte, schrieb<br />
Ernst: »Du machst Dir bestimmt zu schlimme<br />
Vorstellungen, was wir alles aushalten müssen.<br />
Ich glaube, daran ist nichts anderes schuld als die<br />
Wochenschau und die Bilder in der Zeitung. Das<br />
ist doch klar, das[s] die nicht Bilder bringen können,<br />
wo wir in Ruhe liegen oder sonst was treiben.<br />
Das würde die, welche zu Hause sind, doch gar<br />
nicht interessieren und würde bestimmt langweilig<br />
werden.« [20]<br />
Der jüngere Bruder Otto scheint von seinem großen<br />
Bruder gelernt zu haben, denn im Dezember<br />
1944 schreibt er über die Westfront: »Wir sind<br />
immer noch da, wo wir von Landau aus hin sind,<br />
und das weißt Du ja. Wir sollten ja zuerst nach 4<br />
Wochen wieder von hier weg, aber nun hat sich<br />
die Lage so geändert, daß wir hier bleiben müssen.<br />
Du brauchst nun aber nicht zu erschrecken, und<br />
Dir unnötige Sorge zu machen. Das ist alles halb<br />
so wild. Der Westwall ist hier ziemlich stark, und<br />
der Amerikaner wird sich bei uns schon die Zähne<br />
ausbeißen. So einen kleinen Vorgeschmack hatte<br />
er schon heute Mittag bekommen. Er war nähmlich<br />
(!) mit ein paar Panzern etwas vor gekommen,<br />
und das hat ihn unsere Ari [21] im Nu wieder vertrieben.<br />
Die ersten Kugeln sind auch schon über<br />
uns weg, und das ganze ist halb so wild, wenn<br />
man die Nase rechtzeitig in den Dreck steckt. |<br />
Und Dreck ist hier im wahrsten Sinne genug.<br />
[16] Ebd.<br />
[17] Ebd.<br />
[18] Ebd.<br />
[19] Ebd.<br />
[20] PA Schmeyer Homburg. NL Cäcila Schmeyer Best. 3,10.<br />
Brief von Ernst Schmeyer an seine Mutter und seine<br />
Brüder vom 4. Dezember 1941.<br />
[21] Ari = Angehöriger der Artillerie.<br />
Du brauchst Dir also um mich keine Sorgen zu<br />
machen, ich passe schon von selbst auf.« [22]<br />
Am 7. Januar 1945 sollte Otto Schmeyer mit 19<br />
Jahren in Stundviller/Elsass fallen. Noch vier<br />
Tage zuvor schrieb er der Mutter: »Wir liegen hier<br />
immer noch in Ruhe, und führen ein ganz tadelloses<br />
Leben. Den ganzen Tag machen wir nichts<br />
anderes als schlafen und Essen. Das Essen ist ganz<br />
prima, und zu rauchen haben wir auch genug. Du<br />
brauchst Dir also um mich überhaupt keine Sorgen<br />
zu machen. Nun will ich schließen, denn ich<br />
muß mich noch rasieren. Ich hab einen Bart wie<br />
ein U-Boot-Fahrer. Denn an Weihnachten hab ich<br />
mich das letzte mal rasiert.« [23]<br />
»Wieder im Luftschutzkeller« –<br />
Luftkrieg und Mittagsschlaf<br />
Die Luftangriffe nahmen zu. Ernst Schmeyer<br />
betonte gegenüber der Mutter das Positive.<br />
»Wenn wir Alarm haben, dann haben wir von<br />
2-3 Mittags Schlafstunde.« [24] Und später genauer:<br />
»Wegen dem Fliegeralarm brauchst Du Dir<br />
keine Angst zu machen. Wir sind nämlich Mittags<br />
immer froh, wenn wir eine Stunde länger schlafen<br />
können. Und der Fliegeralarm dauert auch<br />
höchstens nur eine Stunde, und Bomben sind<br />
noch keine […] abgeworfen worden.« [25] Zu Weihnachten<br />
äußerte sich Ernst Schmeyer, inzwischen<br />
Funker, gegenüber dem kleinen Bruder Josef ganz<br />
ehrlich: »Ich habe Deine Karte in mein Spind aufgehängt<br />
und sieht schön aus. Es ist jetzt 9 Uhr<br />
[22] PA Schmeyer Homburg. NL Cäcila Schmeyer Best.4,9.<br />
Brief von Otto Schmeyer an seine Mutter und Bruder<br />
Josef vom 16. Dezember 1944.<br />
[23] Ebd. Best.4,11. Feldpostbrief von Otto Schmeyer an seine<br />
Mutter und Bruder Josef vom 3. Januar 1945.<br />
[24] Ebd. Best. 3,5. Brief von Ernst Schmeyer an die Mutter<br />
vom 12. Oktober 1940.<br />
[25] Ebd. Best.3,6. Brief von Ernst Schmeyer an die Mutter<br />
vom 30. Oktober 1940.<br />
Baden in einem russischen<br />
See.<br />
Album mit Bildern<br />
von Otto und Ernst<br />
Schmeyer im Zweiten<br />
Weltkrieg. (PA<br />
Schmeyer Homburg.<br />
NL Cäcila Schmeyer<br />
Best. 9,1 Nr. 7)
Friseurtag im Lager.<br />
Album mit Bildern<br />
von Otto und Ernst<br />
Schmeyer im Zweiten<br />
Weltkrieg. (PA<br />
Schmeyer Homburg.<br />
NL Cäcila Schmeyer<br />
Best. 9,1 Nr. 10)<br />
abends und ich sitze wieder im Luftschutzkeller.<br />
Ich lag gerade 5 Min. im Bett und mußte wieder<br />
heraus. Hier darf man nicht wie zu Hause im Bett<br />
liegen bleiben.« [26]<br />
Was der Luftkrieg aber aus einem jungen Mann<br />
von rund zwanzig Jahren machte, der – von seiner<br />
Familie getrennt – »den starken Mann« spielen<br />
musste, ist seinem kurzen Bericht über einen<br />
Alptraum zu entnehmen: »Die vorige Nacht<br />
hatte ich geträumt von Dillingen. […] Ich träume<br />
sonst nie, und da kann ich tagsüber noch so viel<br />
erlebt haben. Ich habe geträumt, ich hätte mit<br />
Otto beim Gratz am Geschäft gestanden und<br />
auf einmal wäre eine ganze Masse Flugzeuge<br />
angekommen. Alle Leute glaubten, es seien deutsche.<br />
Bis auf einmal rief ich zu Otto: ‚Die werfen<br />
Bomben‘, denn ich hörte das übliche Zischen in<br />
der Luft. Wir sprangen beide sofort in Deckung,<br />
und schon hagelte es an allen Ecken und Enden.<br />
Wie ich auch hier sah, waren es Engländer. Wir<br />
gingen dann noch seelenruhig Wurst und Brötchen<br />
kaufen, und dann wurde ich wach […]. Wieder<br />
war es nur ein Wünschen. Ich hätte ja lieber<br />
diesen Bombenangriff mitgemacht und wäre<br />
aber die Hauptsache zu Hause. Allerdings dürfte<br />
man bei einem solchen Bombenangriff kein Loch<br />
in den Kopf kriegen. War auch schwerer Quatsch,<br />
der Traum, was?« [27]<br />
»Seit langer Zeit wieder gebadet« –<br />
Der Frontalltag<br />
Ernst Schmeyer verdanken wir zahlreiche Bilder,<br />
denn er bat seine Mutter, ihm den Fotoapparat<br />
zu schicken. [28] Immer wieder erzählt er in seinen<br />
Briefen vom Alltag an der Ostfront. »Der ganze<br />
Nachschub, überhaupt sämtliche Verbindungen<br />
mit dem vorgesetzten Oberst [halten wir nur<br />
über das] Flugzeug. Wir waren die ersten 14 Tage<br />
eingeschlossen. Das geht Euch ja gar nichts an.<br />
Das ist ja Dienstsache. Mache dir keine Angst<br />
[26] Ebd. Best.3,7. Karte von Ernst Schmeyer an Josef Schmeyer<br />
vom 3. Dezember 1940. Auf derselben Karte zeigt er<br />
sich als großer und fürsorglicher Bruder: »Lieber Josef,<br />
wie gefällt es Dir denn noch in der Schule. Bekommst<br />
Du bald wieder Ferien. Hast Du Dich auch geschickt,<br />
daß Dir der Nikolaus was bringt und das Christkindchen.<br />
Ich bekomme für Weihnachten sehr wahrscheinlich<br />
kein Urlaub. Ich hoffe aber bald nach Neujahr.«<br />
[27] Ebd. Best.3,18. Brief von Ernst Schmeyer an seine Mutter<br />
und seine Brüder vom 11. Januar 1942.<br />
[28] Ebd. Best. 3,5. Brief von Ernst Schmeyer an Cäcila<br />
Schmeyer vom 12. Oktober 1940.<br />
deswegen, denn jetzt ist wieder alles in bester<br />
Ordnung.« [29]<br />
Die hygienischen Zustände waren grauenvoll,<br />
aber ein junger Mann wird seiner Mutter gegenüber<br />
nicht so deutlich, sondern sagt durch die<br />
Blume, wie ihn die Verhältnisse quälen. Ein gutes<br />
Beispiel liefert ein Brief vom 7. Dezember 1941:<br />
»Ich war gerade eben in meiner Farm. Wenn Du,<br />
liebe Mama, jetzt wüßtest, was das wäre. Jeder<br />
von uns hat eine Zucht von kleinen [Tierchen] […].<br />
Habe eben ein paar mit dem Lasso [gefangen].<br />
Jetzt merken die lieben Tierchen, daß ich von<br />
ihnen schreibe und jetzt marschieren dieselben<br />
im Takt des Pariser Einzugsmarsches auf meinem<br />
Rücken und Bauch auf und ab. Bei uns nennt man<br />
dieselben Schneiderläuse. Von Flöhen oder Wanzen<br />
merke ich nichts. Ich werde aber, wenn wir<br />
das nächste feste Quartier erhalten, dieselben<br />
vertreiben. Ich werde die ganze Wäsche mal<br />
Nachts in die Kälte legen und dann werden dieselben<br />
schon den Schnupfen bekommen.«[30]<br />
Und ein paar Wochen später: »Eben war ich wieder<br />
in meinem Jagdrevier und habe eine ganze<br />
Anzahl Abschüsse. Die Biester können einen aufregen.<br />
Wenn man in der Kälte ist, merkt man<br />
nichts. Wie man es aber warm bekommt, fangen<br />
die an zu laufen.« [31]<br />
Russland wäre nicht Russland, wenn der Junge<br />
aus Dillingen nicht die Sauna für sich entdeckt<br />
hätte. »Gestern habe ich seit langer Zeit wieder<br />
[29] Ebd. Best.3,10. Brief von Ernst Schmeyer an seine Mutter<br />
und seine Brüder vom 4. Dezember 1941.<br />
[30] Ebd. Best.3,11. Brief von Ernst Schmeyer an seine Mutter<br />
und seine Brüder vom 7. Dezember 1941.<br />
[31] Ebd. Best. 3,12. Brief von Ernst Schmeyer an seine Mutter<br />
und seine Brüder vom 16. Dezember 1941.
saargeschichte|n 71<br />
gebadet. Ach war das schön. Es war ein Dampfbad,<br />
da wurden Steine heiß gemacht und darauf<br />
Wasser geschüttet. Das Wasser verdampft<br />
und durch die Hitze kommt [man] dermaßen ans<br />
Schwitzen, daß das Wasser nur einem so runterläuft.<br />
Das Bad ist ziemlich gesund, nur bekommt<br />
man Hunger darauf.« [32]<br />
Der jüngere Bruder Otto erlebte den Umstand,<br />
an Weihnachten nicht zu Hause zu sein, als<br />
besondere Anfechtung, thematisierte aber nur<br />
den Schmerz der Familie, um selbst unangreifbarer<br />
zu sein: »Wie werdet Ihr den heiligen<br />
Abend da gesessen haben, und wieviele Tränen<br />
sind wieder geflossen. Hoffentlich wart Ihr nicht<br />
all zu traurig. Nun will ich Dir mal schreiben, wie<br />
ich hl. Abend erlebt habe. Zunächst mal wußten<br />
wir hier in unserer Einsamkeit garnicht richtig,<br />
wo wir mit dem Datum dran waren, und feierten<br />
darum hl. Abend einen Tag zu früh. Am anderen<br />
Tag erst erfuhren wir das richtige Datum. Na<br />
das macht auch nichts, sagten wir, dann feiern<br />
wir eben zweimal. Aber Scheibe (!): Am hl. Abend<br />
um 6 Uhr dann Alarm. Alles mußte in den Graben,<br />
weil der Amerikaner einen Angriff plante. Unsere<br />
Ari hat ihm aber den Spaß verdorben, und so<br />
wurde der Alarm um 12 Uhr beendet. Unser Chef<br />
ging um 11 Uhr durch den Graben, und wünschte<br />
jedem frohe Weihnachten und ließ Zigaretten<br />
verteilen. Von 12 Uhr ab habe ich dann 2 Stunden<br />
geschlafen, und um 2 Uhr mußte ich dann<br />
raus mit auf Spähtrupp. Das waren meine Weihnachten<br />
1944. Die werde ich nie im Leben vergessen.<br />
Aber es kommen auch wieder andere<br />
Zeiten, und dann wird alles nachgeholt.« [33] Otto<br />
Schmeyer ist im Januar darauf gefallen; es war<br />
sein letztes Weihnachtsfest.<br />
»Erfroren habe ich mir noch nichts« –<br />
Wetter und Arbeit im Osten<br />
Der Funker Ernst Schmeyer lernte an der Ostfront<br />
den russischen Winter fürchten. »Wir haben<br />
hier jetzt richtigen Winter. Heute morgen hatten<br />
wir 35° kalt. Der Schnee liegt aber noch nicht<br />
so hoch. Wir haben 25 cm Schnee vielleicht […].<br />
Da war aber so ein Wind. An dem Weg mußten<br />
wir gerade ein ganz kurzes Stück Leitung schalten.<br />
Der Wind hat einen bald vom Mast herunter<br />
geschmissen. Und kalte Füsse (!) und Finger gibt<br />
es, wenn man so auf dem Mast hängt. Aber das ist<br />
alles nicht so schlimm. Die Infanterie ist wohl viel<br />
beschissener dran. Wir haben wenigstens Ruhe,<br />
wenn wir unsere Leitung gebaut haben.« [34] Die<br />
Mutter reagierte prompt: »Hoffentlich hast Du<br />
die Hände und Füße noch nicht erfroren. Wenn<br />
Du doch so auf die Masten klettern mußt, kannst<br />
Du doch keine Handschuhe anlaßen, und im<br />
Auto werden Dir die Füße steif werden, oder habt<br />
Ihr auch von den neuen heizbaren Einlegesohlen,<br />
wie sie hier erzählen und im Radio?« [35] Ernst antwortete<br />
wahrheitsgemäß: »Erfroren habe ich mir<br />
noch nichts. Dabei hatte ich schon oft zum Weinen<br />
kalte Füsse (!) und Finger. Aber es ging wieder<br />
vorbei. Wir hatten auch schon ganz schön kalte<br />
Tage. Augenblicklich geht es wieder. Wir haben<br />
heute vielleicht 10° Kälte oder auch nicht soviel.<br />
Ein Silvester und Neujahr habe ich verbracht […].<br />
Wir lagen im Bett und hörten etwas Musik. Um<br />
12 Uhr wurde ich wach gemacht. Wir gratulierten<br />
uns gegenseitig, und ich schlief, nachdem das<br />
Glockengeläut im Radio wieder vorbei war, ruhig<br />
ein. Wenn Du auf warst, wirst Du auch die Musik<br />
gehört haben, welche nach dem Glockengeläut<br />
gespielt wurde. Die hat mir prima gefallen. Es war<br />
Auf dem Telegrafenmast.<br />
Album mit<br />
Bildern von Otto und<br />
Ernst Schmeyer im<br />
Zweiten Weltkrieg.<br />
(PA Schmeyer Homburg.<br />
NL Cäcila<br />
Schmeyer Best. 9,1<br />
Nr. 12)<br />
[32] Ebd. Best.3,11. Brief von Ernst Schmeyer an seine Mutter<br />
und seine Brüder vom 7. Dezember 1941.<br />
[33] Ebd. Best.4,10. Brief von Otto Schmeyer an seine Mutter<br />
und Bruder Josef vom 25. Dezember 1944.<br />
[34] Ebd. Best. 3,12. Brief von Ernst Schmeyer an seine Mutter<br />
und seine Brüder vom 16. Dezember 1941.<br />
[35] Ebd. Best. 3,19. Brief von Cäcilia, Otto und Josef Schmeyer<br />
an Ernst Schmeyer vom 22. Januar 1942.
die ‚Götterdämmerung‘ von Wagner.«[36] Wenige<br />
Tage später geriet der junge Mann in russische<br />
Kriegsgefangenschaft und galt ab 22. Januar 1942<br />
als verschollen.<br />
»Ohne besonders großen Widerstand« –<br />
Der Vormarsch<br />
Von den eigentlichen Kriegshandlungen<br />
berichten die Brüder Ernst und Otto eher selten;<br />
die Zensur wird ihnen die Möglichkeit<br />
genommen haben. In einer Karte an den jüngsten<br />
Bruder Josef – er setzt nach dessen Namen<br />
den Begriff »Kaninchenzüchter« ins Adressfeld,<br />
um dem Jungen eine Freude zu machen – schreibt<br />
Ernst Schmeyer über das Leben auf dem Russlandfeldzug:<br />
»Ich bin heute in guter Laune und<br />
habe Bauchweh vor lauter Lachen. Hier sind wir<br />
in einem kleinen Dorf und in dem Hause machen<br />
die Mädchen ein paar russische Volkstänze. So<br />
etwas mußt Du mal sehen. Der eine spielt auf der<br />
Ballalaika (!) und die anderen singen gegenseitig<br />
und trampeln mit den Füßen und tanzen im Kreis<br />
herum.« [37]<br />
Im Dezember 1941 wird Ernst deutlicher und<br />
berichtet einer Familie Eggert vom Verlauf des<br />
Russlandfeldzuges, wie er ihn mitgemacht und<br />
erlebt hat. »Ich bin jetzt schon seit Kriegsbeginn<br />
in Rußland, und ich wäre froh, wenn wir bald aus<br />
dem Arbeiterparadies heraus können. […]. Denn<br />
hier in Rußland lebt man wie vor hundert Jahren,<br />
und das noch nicht ein mal. […] Am 22. Juni<br />
sind wir als motorisierte Division bei Tilsit über<br />
die Deutsch-Litauische Grenze, ohne besonders<br />
großen Widerstand. Durch ganz Litauen ging es<br />
schnell, und hier hieß es, nichts als fahren und<br />
am Feinde bleiben. Am Tage haben wir 100 – 150<br />
km zurückgelegt, und das auf Wegen, welche<br />
nur aus Sand und Schlaglöchern bestanden. […]<br />
Unser Vormarsch ging immer noch in dem gleichen<br />
Tempo weiter durch Lettland über die russische<br />
Grenze bis nach Pleskau [heute Pskow]. Hier<br />
wurde die Stalin-Linie durchbrochen und weiter<br />
ging es den Peizus-See bis an die Luga. Hier<br />
blieben wir 4 Wochen liegen, denn der Russe<br />
verteidigte den Fluss. Aber dieses war nicht der<br />
Grund zu unserem Stillstand. Der ganze Nachschub<br />
mußte wieder herangebracht werden.<br />
Während diese[r] 4 Wochen lag unsere Kompanie<br />
am Samra-See, und hier konnten wir es gut<br />
aushalten und unsere Wäsche wieder in die Reihe<br />
[36] Ebd. Best. 3,17. Brief von Ernst Schmeyer an seine Mutter<br />
und seine Brüder vom 9. Januar 1942.<br />
[37] Ebd. Best. 3,9. Karte von Ernst Schmeyer an Josef<br />
Schmeyer vom 27. November 1941.<br />
bringen. Das schlimmste Übel bis jetzt war der<br />
Staub und die unendlich vielen Stechmücken.<br />
Die konnten einen verrückt machen. Abends war<br />
man müde, und die Biester stachen sogar durch<br />
die Wolldecken, die man über das Gesicht zog.<br />
Wir sind dann weiter gezogen und haben die<br />
starke Verteidigungslinie bei Petersburg durchbrochen.<br />
Wir waren bis auf Sichtweite an die<br />
Stadt herangekommen. Hier wurden wir dann<br />
herausgezogen und kamen an die Mittelfront.<br />
Hier haben wir die Umfassungsschlacht bei<br />
Wjasma mitgemacht und haben dann in schnellem<br />
Vorstoß Kalinin genommen. Hier sah ich zum<br />
ersten Mal in Rußland mehrstöckige Steinhäuser,<br />
in dem aber nur Kommissare wohnten. Der Winter<br />
hat jetzt die Operationen still gelegt. An 2<br />
Tagen hatten wir schon 35° unter Null.« [38]<br />
»Mit seinem Leben bezahlt« –<br />
Mütterliche Suche nach dem Sohn<br />
Cäcilia Schmeyer sollte innerhalb von weniger als<br />
drei Jahren zwei von drei Söhnen verlieren. Ernst<br />
starb mit 21 Jahren, Otto mit 19. Als Ernst am 3. Mai<br />
1942 in russischer Kriegsgefangenschaft starb,<br />
wusste niemand von seinem Schicksal, nachdem<br />
er seit dem 22. Januar vermisst war. Ein Offizier<br />
schrieb der Mutter: »Ihr Sohn war mit einem Bautrupp,<br />
dem er seit längerer Zeit angehörte, in der<br />
Nacht vom 21. zum 22.1.42 bei einem Bataillonsstab<br />
in Krassny-Cholm, einem kleinen russischen<br />
Dorf an der Moskauer Front. Der Trupp<br />
hatte die Aufgabe, die zum Regiment führenden<br />
Fernsprechleitungen zu unterhalten. In den frühen<br />
Morgenstunden gelang es russischen Spähtrupps,<br />
unsere Posten an einer Seite des Dorfes<br />
zu überrennen und mit stärkeren Kräften in das<br />
Dorf einzudringen. Der Bataillonskommandeur<br />
mußte auf Grund dieser Lage das Absetzen vom<br />
Ort befehlen. Ihr Sohn lag nun mit seinem Trupp<br />
und mehreren Leuten des Bataillons in einem<br />
Hause an der Dorfstraße, in die die Russen mit<br />
Maschinengewehren hineinschossen. Keiner der<br />
Leute des Bataillons und auch der Kommandeur<br />
selbst nicht hat in der Hitze des entbrannten<br />
Gefechtes beobachtet, daß irgendeiner der<br />
Kameraden aus dem betreffenden Hause herausgekommen<br />
wäre. Es besteht nun – ich will es<br />
Ihnen ganz offen schreiben – die Möglichkeit, daß<br />
Ihr Junge, der ja immer zu den Tapfersten gehörte,<br />
mit den fünf Kameraden im Kampf gefallen ist,<br />
es ist jedoch auch möglich, daß er in Gefangenschaft<br />
geraten ist. Das Dorf wurde später von uns<br />
[38] Ebd. Best.3,13. Brief von Ernst Schmeyer an Familie Eggert<br />
vom 16. Dezember 1941.
saargeschichte|n 73<br />
aus taktischen Gründen nicht wieder genommen,<br />
so daß mir leider weitere Nachforschungen nicht<br />
möglich sind.« [39] Und dann folgten die üblichen<br />
Floskeln: »Der Verlust Ihres Sohnes trifft die Kompagnie<br />
deswegen besonders hart, weil er zu den<br />
zuverlässigsten Fernsprechern gehörte, und weil<br />
er bei Kameraden und Vorgesetzten stets beliebt<br />
war. Er hat seinen freudigen Einsatz für die Kompanie<br />
und damit für unser aller großes Ziel nun<br />
wahrscheinlich mit seinem Leben bezahlt.« [40]<br />
Nun begann ein Kampf für die Mutter. Nachdem<br />
auch der Kompaniechef, Oberleutnant Köhlhofer,<br />
einen Bericht abgegeben und weitere Vermisste<br />
benannte hatte [41] , wollte Cäcilia Schmeyer nichts<br />
unversucht lassen, das Schicksal ihres Erstgeborenen<br />
zu erforschen. So schrieb das Bischöfliche<br />
Offizialat Trier 1951 an die Mutter über Nachforschungen,<br />
die angestellt worden waren. [42]<br />
Es folgte ein Brief des Deutschen Caritasverbandes.<br />
[43] Cäcilia Schmeyer versuchte, den<br />
Verlust für sich zu verarbeiten und fügte ihren<br />
Papieren eine eigene Darstellung hinzu: »[…] in<br />
der Nacht vom 21.–22. Januar kam er verwundet<br />
in Gefangenschaft. Das habe ich durch einen<br />
Heimkehrer erfahren, kam in ein Sammellager<br />
bei Moskau, Lager 3 […]. Dort war er für zwei<br />
Monate. Von dort kam er in ein Lazarett wegen<br />
Wundfieber. Von der Zeit fehlt jede Spur.« [44] 1955<br />
wurde amtlich der Tod festgestellt und auf den 31.<br />
Januar 1942 datiert. [45] Vierzehn Jahre danach gab<br />
es Klarheit, dass Ernst Schmeyer am 3. Mai 1942<br />
in Gefangenschaft verstorben war. [46] Der traurige<br />
Kampf war für die Mutter zu Ende.<br />
Was Otto Schmeyer angeht, den zweiten<br />
Sohn, der sich an der Westfront befand, so war<br />
die Botschaft klar. Otto schrieb am 6. Januar<br />
1945 aus der Nähe von Wissembourg an<br />
seine Mutter – und er hatte nahezu eine Vorahnung:<br />
»Heute mittag geht es wieder weiter,<br />
und zwar gehen wir zum Angriff über. Hoffentlich<br />
geht alles gut. Es ist ja doch ein komisches<br />
Gefühl. Ihr braucht Euch aber keine Sorgen zu<br />
machen, es wird schon schief gehen. Behüt Euch<br />
alle Gott, auf Wiedersehen.« [47] Am Tag darauf<br />
war er tot, gefallen im Gefecht bei Stundviller.<br />
[48]<br />
Der Totenzettel berichtet über den Heldentod<br />
des Panzer-Grenadiers Otto Schmeyer. [49]<br />
Zwei Söhne einem unmenschlichen Regime<br />
opfern zu müssen, wird auch für eine fromme<br />
Katholikin aus Dillingen eine Anfechtung<br />
gewesen sein; aber der Glaube gab der Mutter<br />
den einzigen Halt. Der drittgeborene Sohn Josef<br />
sollte erwachsen werden und Kinder und Enkel<br />
erleben.<br />
[39] Ebd. Best. 3,20. Schreiben des Kompaniechefs, Adler (?),<br />
der 1. Kompagnie Nachrichtenabteilung 36 (Original<br />
und zwei hektografierte Fassungen) an Cäcilia Schmeyer<br />
vom 10. Februar 1942.<br />
[40] Ebd.<br />
[41] PA Schmeyer Homburg. NL Cäcila Schmeyer Best. 3,21.<br />
Schreiben des Oberleutnants und Kompaniechefs<br />
Köhlhofer, Einheit 18007, an Cäcilia Schmeyer vom 5.<br />
April 1942.<br />
[42] Ebd. Best. 3,22. Schreiben des Bischöflichen Offizialates<br />
Trier an Cäcilia Schmeyer vom 4. Oktober 1951.<br />
[43] Ebd. Best. 3,23. Schreiben des Deutschen Caritasverbandes<br />
an Cäcilia Schmeyer vom 6. Oktober 1951.<br />
[44] Ebd. Best. 3,25. Handschriftliche Notiz von Cäcilia<br />
Schmeyer zum Tod ihres Sohnes Ernst Peter.<br />
[45] Ebd. Best. 3,31. Urkunde des Standesamtes Saarbrücken<br />
Nr. 11/ 1955 über die amtliche Feststellung des Todes<br />
von Ernst Peter Schmeyer, festgelegt auf den 31. Januar<br />
1942, ausgestellt am 12. Januar 1955.<br />
[46] Ebd. Best. 3,33. Schreiben der Deutschen Dienststelle<br />
für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen<br />
von Gefallen der ehemaligen deutschen Wehrmacht,<br />
Berlin-Wittenau, an Cäcilia Schmeyer vom 3. Februar<br />
1969 und Mitteilung über den Tod von Ernst Peter<br />
Schmeyer am 3. Mai 1942 in russischer Kriegsgefangenschaft<br />
[Korrektur des Todestages!]<br />
[47] Ebd. Best.4,12. Feldpostbrief von Otto Schmeyer an seine<br />
Mutter und Bruder Josef vom 6. Januar 1945.<br />
[48] Ebd. Best.4,13. Brief des Feldwebels Robert Katthaus<br />
vom 11. Januar 1945 an Cäcilia Schmeyer betr. den Tod<br />
von Otto Schmeyer am 7. Januar 1945 im Gefecht bei<br />
Stundviller.<br />
[49] Ebd. Best.4,14. Totenzettel (stark beschädigt) über den<br />
Heldentod des Panzer-Grenadiers Otto Schmeyer sowie<br />
Fotokopie des Totenzettels.
der lange schatten<br />
des abstimmungskampfes<br />
Ein schwieriges Erbe: Zur Entstehungsgeschichte des Deutsch-Französischen Gartens<br />
von hans-christian herrmann<br />
Vor der offiziellen<br />
Eröffnung der<br />
Deutsch-Französischen<br />
Gartenschau<br />
im Deutschmühlental<br />
fand am Ehrenmal<br />
auf den Spicherer<br />
Höhen eine Gedenkfeier<br />
statt – als<br />
Zeichen der neuen<br />
Freundschaft zwischen<br />
Frankreich und<br />
Deutschland.<br />
(Stadtarchiv SB, Nl M<br />
1142/11)<br />
Eröffnung ohne den Kanzler<br />
Samstag, der 23. April 1960 in Saarbrücken. Um<br />
13.00 Uhr öffnete die Deutsch-Französische<br />
Gartenschau ihre Tore für das Publikum. Ein wichtiger<br />
Tag in der Saarbrücker Stadtgeschichte. Ein<br />
paar Stunden vorher hatten sich fast 3000 Menschen<br />
bei trübem Wetter mit Temperaturen von<br />
wenig frühlingshaften 10° C zu einer, wie die<br />
Saarbrücker Zeitung schrieb, »ergreifenden Feierstunde«<br />
auf den Spicherer Höhen versammelt. Es<br />
sprachen der Bischof von Lourdes Pierre-Marie<br />
Théas (1894–1977) und der Ratsvorsitzende der<br />
Evangelischen Kirchen in Deutschland, Bischof Dr.<br />
Otto Dibelius.« [1]<br />
Am Ehrenmal auf den Spicherer Höhen legten<br />
die Landwirtschaftsminister Frankreichs und<br />
Deutschlands sowie der saarländische Minister-<br />
[1] Saarbrücker Zeitung vom 25. April 1960.<br />
präsident einen Lorbeerkranz nieder – so der<br />
Bericht. Diese Feierstunde stand ganz im Zeichen<br />
der Völkerverständigung und wollte ein Zeichen<br />
für eine deutsche-französische Freundschaft<br />
setzen. Und so lautete auch die Schlagzeile der<br />
Saarbrücker Zeitung für die Deutsch-Französische<br />
Gartenschau »Symbol der Freundschaft«.<br />
Einen symbolträchtigeren Ort wie die Spicherer<br />
Höhen konnte es für die Überwindung der<br />
deutsch-französischen Feindschaft nicht geben.<br />
Zugleich fand damit die Eröffnung der Deutsch-<br />
Französischen Gartenschau sowohl auf französischem<br />
wie auch auf deutschem Territorium statt.<br />
Die im Planungsstadium entwickelte Idee einer<br />
grenzüberschreitenden Seilbahnverbindung<br />
von der Gartenschau im Deutschmühlental bis<br />
zu den Spicherer Höhen wurde allerdings auf<br />
eine im Deutschmühlental verbleibende Variante<br />
reduziert. Monsignore Théas hob die völker-
saargeschichte|n 75<br />
verbindende Idee der Gartenschau hervor und<br />
Bischof Dibelius erinnerte an das unsägliche<br />
Leid der Vergangenheit. Mit ihm verbunden die<br />
Gefallenen bei der Schlacht von Spichern, die<br />
Saarbrücker Zeitung zitierte seine bewegenden<br />
Ausführungen: »An diesem Tage aber, da die Vertreter<br />
ehemals feindlicher Völker zu gemeinsamer<br />
Feier zusammengekommen seien, könne man<br />
sagen: Hier hat der Friede begonnen«. Die Landwirtschaftsminister<br />
beider Länder, Henri Rocherau<br />
(1908–1999) und Werner Schwarz (1900–<br />
1982) bekräftigten die Ausführungen der Bischöfe.<br />
Der Saarbrücker Oberbürgermeister Fritz Schuster<br />
(1916–1988) beschrieb in blumigen Worten,<br />
»das Schussfeld zwischen zwei Völkern sei in<br />
einen blühenden Garten verwandelt worden, an<br />
dem Gärtner aus dem Raum zwischen Berlin und<br />
der Riviera in friedlichem Wettbewerb und seltener<br />
Eintracht zusammengearbeitet hätten«.<br />
Damit sprach Schuster den symbolträchtigen Ort<br />
an. Am 16. Oktober 1870 war hier ein neuer Friedhof<br />
für die Gefallenen der Schlacht von Spichern<br />
unter dem Namen Ehrental eingeweiht worden.<br />
Und in der NS-Zeit verliefen nicht weit entfernt<br />
Teile des Westwalls. Auch wenn das Ehrental der<br />
erste Soldatenfriedhof für Deutsche und Franzosen<br />
war, so entwickelte sich der Ort bis 1945 zu<br />
einer nationalen Weihestätte. Ministerpräsident<br />
Dr. Franz-Josef Röder (1909–1979) zugleich<br />
seinerzeit Bundesratspräsident, dankte bei der<br />
Gedenkstunde in Spichern Bundeskanzler Konrad<br />
Adenauer (1876–1967) und dem französischen<br />
Ministerpräsidenten Michel Debré (1912–1996)<br />
für die Schirmherrschaft. Beide waren aber nicht<br />
nach Saarbrücken gekommen – warum eigentlich<br />
nicht? [2]<br />
Das weiße Kreuz, das als Mahnmal den Spicherer<br />
Berg überragte, schenkte der Veranstaltung eine<br />
besondere Würde und machte ihn zum zentralen<br />
Ort der Veranstaltung. [3]<br />
Ein Tag zuvor war übrigens die Französische Woche<br />
im Saarland eröffnet worden und zeitgleich lief<br />
die Saarmesse. Dazu war Frankreichs Botschafter<br />
in der Bundesrepublik, François Seydoux de<br />
[2] Ebda.<br />
[3] Bernd Loch, Der Deutsch-Französische Garten in Saarbrücken.<br />
Geschichte und Führer, Saarbrücken 2000, S. 21.<br />
Clausonne, nach Saarbrücken gekommen, der<br />
zugleich das neu errichtete Centre Culturel in der<br />
Saarbücker Cecilienstraße eröffnete. Saarbrücken<br />
und das Saarland standen im Zeichen der Tricolore<br />
und überall warben Michel und Marianne<br />
für die neue Zeit friedlicher Nachbarschaft. [4]<br />
Beide Figuren spielten die Hauptrolle bei der<br />
Deutsch-Französischen Gartenschau. Die Tochter<br />
von Philippe Koenig, damals Leiter der Kulturabteilung<br />
beim französischen Generalkonsulat<br />
in Saarbrücken, spielte die Marianne und der von<br />
den Städtischen Bühnen Köln kommende Joachim<br />
Liman den Michel. [5]<br />
Deutsch-Französische Freundschaft war kein<br />
Gründungsmotiv<br />
Wenn man auf die Spurensuche in die Archive<br />
geht, stellt man aber fest, dass die deutsch-französische<br />
Freundschaft nicht das Gründungsmotiv<br />
der Gartenschau gewesen ist. Am Anfang, im Juni<br />
1956, stand der Wunsch, die Bundesgartenschau<br />
nach Saarbrücken zu holen. Sie sollte der Stadt<br />
wie dem Saarland, das zum 1. Januar 1957 dem<br />
Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten<br />
würde, ein attraktives Forum bilden. Das junge<br />
Bundesland wollte sich der deutschen Öffentlichkeit<br />
präsentieren und Gäste aus der ganzen<br />
Bundesrepublik an die Saar locken. So wandte<br />
sich die Stadtverwaltung am 25. Juni 1956 an den<br />
Zentralverband des Deutschen Gemüse-, Obstund<br />
Gartenbaus in Bonn. Leider musste man<br />
erfahren, dass die Termine für die Bundesgartenschau<br />
schon verplant seien und Saarbrücken<br />
könne vor 1965 nicht berücksichtigt werden. In<br />
dieser Situation sattelte die Stadt um, und es entstand<br />
die Idee, die Saarmesse mit einer deutschfranzösischen<br />
Gartenschau zu verbinden. Das bot<br />
sich auch geradezu an, da das Deutschmühlental<br />
als Ort der Gartenschau im Norden an den Standort<br />
der Saarmesse angrenzte. Die in der Autonomiezeit<br />
gegründete Saarmesse präsentierte<br />
sich nach der Saarabstimmung als deutsch-französische<br />
Austauschmesse. Eine deutsch-französische<br />
Gartenschau konnte da reibungslos integriert<br />
und zugleich die Saarmesse aufgewertet<br />
[4] Saarbrücker Zeitung vom 23. und 25. April 1960.<br />
[5] Saarbrücker Zeitung vom 15./16. Mai 1980.<br />
An den Eröffnungsfeierlichkeiten<br />
nahmen neben den<br />
französischen und<br />
deutschen Landwirtschaftsministern<br />
Henri Rocherau und<br />
Werner Schwarz<br />
u.a. der französische<br />
Bischof Pierre-<br />
Marie Théas sowie<br />
der Ratsvorsitzende<br />
der evangelischen<br />
Kirche in Deutschland,<br />
Bischof Otto<br />
Dibelius, teil, ebenso<br />
der saarländische<br />
Ministerpräsident Dr.<br />
Franz-Josef Röder, der<br />
Saarbrücker Oberbürgermeister<br />
Fritz<br />
Schuster, Kurt Conrad,<br />
Vorsitzender der SPD-<br />
Landtagsfraktion,<br />
sowie Bundeswirtschaftsminister<br />
Werner<br />
Schwarz.<br />
(Stadtarchiv SB, Nl M<br />
1142/36; Nl M 1142/26)
Die Delegation auf<br />
ihrem Weg durch die<br />
Deutsch-Französische<br />
Gartenschau.<br />
Bischof Pierre-Marie<br />
Théas und der SPD-<br />
Vorsitzende Curt<br />
Conrad bei ihrem<br />
Spaziergang am<br />
Eröffnungstag auf<br />
dem Gelände der<br />
Deutsch-Französischen<br />
Gartenschau.<br />
(Stadtarchiv SB,<br />
Nl M1143/8)<br />
werden. Sie war ab 19<strong>59</strong> mehr denn je darum<br />
bemüht, den deutsch-französischen beziehungsweise<br />
saarländisch-französischen Handel zu<br />
stärken. Mit Blick auf den zollfreien Warenverkehr,<br />
der auch nach der wirtschaftlichen Rückgliederung<br />
des Saarlandes zum Tag X (6. Juli<br />
Jungfernfahrt der<br />
Kleinbahn am<br />
Eröffnungstag der<br />
Deutsch-Französischen<br />
Gartenschau.<br />
(Stadtarchiv SB, Nl M<br />
1143/7)<br />
19<strong>59</strong>) weiterbestand, war dies für das Saarland<br />
von existenziellem Interesse zur Stärkung seiner<br />
Wirtschaft. Die Stadt fand für ihre Idee der<br />
Deutsch-Französischen Gartenschau die Unterstützung<br />
der Landesregierung und der Landwirtschaftskammer.<br />
Ein solches Projekt erleichterte<br />
es zudem, Bonn und Paris finanziell in die Pflicht<br />
zu nehmen. Die Chancen auf französische Förderung<br />
standen gut, nachdem Tanguy de Courson<br />
de la Villeneuve, der Chef der französischen<br />
diplomatischen Vertretung im Saarland, seine<br />
Unterstützung zusagte. Richard Näcke als Zeitzeuge<br />
und ehemaliger städtischer Mitarbeiter<br />
behauptete im Rückblick 1985: »In der französischen<br />
Botschaft [Pingusson-Bau] in Saarbrücken<br />
ließ man die städtische Abordnung, die ihren<br />
Gedanken vortragen wollte, stundenlang warten.<br />
Im folgenden Gespräch wurde aber das Eis<br />
gebrochen – die Deutschen fanden ihren ersten<br />
französischen Alliierten.« Anlässlich der<br />
Eröffnung der Saarmesse 1957 fühlten die Saarbrücker<br />
dann auch bei Staatssekretär Masson vor<br />
und fanden ihren zweiten »französischen Alliierten«.<br />
[6]<br />
Die Stadt warb bei Courson de Villneuve insbesondere<br />
für eine Förderung der wirtschaftlichen<br />
Kontakte, eine kulturelle Präsentation<br />
Frankreichs bei der Gartenschau war nicht<br />
geplant, OB Schuster formulierte dies ganz diplomatisch<br />
gegenüber Courson de la Villneuve:<br />
»Mit Hilfe des französischen Pavillons könnten<br />
während des ganzen Jahres im Rahmen der<br />
Gartenbauausstellung Veranstaltungen durchgeführt<br />
werden, die zweifellos rein wirtschaftlichen<br />
Bestrebungen sehr dienlich sein würden.«<br />
Der deutsche Pavillon würde sich »auf den rein<br />
kulturellen Sektor beschränken«. [7]<br />
Nicht nur die Umwidmung des ursprünglichen<br />
Bundesgartenschauprojektes stützt die These,<br />
dass es am Anfang gar nicht um die deutschfranzösische<br />
Freundschaft ging, sondern um die<br />
[6] Stadtarchiv Saarbrücken, Bestand Dezernat II, Nr. 35.2.<br />
Saarbrücker Zeitung vom 14. Februar 1985.<br />
[7] StASB., Bestand Dezernat II, Nr. 35.2., Schuster an Courson<br />
de Villneuve vom 19. Juli 1957.
saargeschichte|n 77<br />
sich auch nach dem Ende der Gartenschau am 25.<br />
Oktober 1960 stellende Frage, wie die nun entstandene<br />
prächtige Grünanlage benannt werden<br />
sollte. Die Diskussion darüber steht für die politische<br />
Befindlichkeit jener Zeit, die aus der Retrospektive<br />
von heute vielen sehr fern ist.<br />
Um die Namensgebung stritt der Stadtrat in seiner<br />
Sitzung am 28. Februar 1961. Der DPS-Fraktionsvorsitzende<br />
Ludwig Bruch hielt »den Zeitpunkt<br />
für gekommen, den neugeschaffenen<br />
Anlagen im Deutschmühlen- und Mockenthal<br />
ihren endgültigen Namen zu geben«. Mit einem<br />
gewissen Pathos forderte der gelernte Journalist<br />
Bruch: »In Übereinstimmung mit der großen<br />
Mehrheit, vor allem der eingesessenen<br />
Bevölkerung unserer Stadt, ist die Fraktion der<br />
Auffassung, dass bei dieser Namensgebung<br />
die heimische Überlieferung nicht außer acht<br />
gelassen werden darf (…)«. Und so lautete der<br />
DPS-Vorschlag »Deutschmühlenpark«. Bruchs<br />
Position bekräftigte sein DPS-Kollege Dr. Keuth.<br />
Der Name »Deutschmühlenpark« besitze zudem<br />
»den Vorzug der Prägnanz und Kürze«. Im Gegensatz<br />
zu seiner eigenen Partei gab Oberbürgermeister<br />
Schuster zu bedenken, Saarbrücken<br />
habe erhebliche Mittel in die Bewerbung der<br />
Deutsch-Französischen Gartenschau investiert.<br />
Er deutete damit die Entwertung des Symbols<br />
von Michel und Marianne an, das die Gartenschau<br />
so prägend begleitet hatte. Auch der neue<br />
französische Generalkonsul im Saarland Philippe<br />
Koenig habe mit aller Zurückhaltung die Beibehaltung<br />
des Symbols und der Begrifflichkeit<br />
empfohlen. Hier sei daran erinnert, dass seine<br />
Tochter die Marianne spielte. Die DPS-Fraktion<br />
scherte die Linie ihres Parteifreundes und Oberbürgermeisters<br />
wenig. Dagegen stellte SPD-<br />
Stadtratsmitglied Roth verwundert fest: »(…) wir<br />
hatten keine Bundesgartenschau (…), sondern<br />
eine Deutsch-Französische Gartenschau (…), bei<br />
deren Zustandekommen wir eine Verpflichtung<br />
eingegangen sind«. Ebenso votierte die Saarländische<br />
Volkspartei (SVP) für die Bezeichnung<br />
»Deutsch-Französischer Garten«. Die SVP versammelte<br />
eine überschaubare Gruppe von früheren<br />
Anhängern der CVP, die 19<strong>59</strong> nicht der CDU<br />
beitreten wollten. Die DPS hielt dagegen und<br />
Fraktionschef Bruch berief sich auf Gespräche<br />
mit vielen Saarbrücker Bürgern: »Niemand habe<br />
sich für die Bezeichnung Deutsch-Französischer<br />
Garten ausgesprochen. Man solle bei dieser<br />
Namensgebung nicht alle Tradition über Bord<br />
werfen, sondern Saarbrücken geben, was Saarbrücken<br />
sei«. Die CDU-Fraktion bemühte sich<br />
Werbeschilder und<br />
Werbefahrten für die<br />
Deutsch-Französische<br />
Gartenschau.<br />
(Stadtarchiv SB, Nl M<br />
1126/1; StA 67; Fotoalbum<br />
Klasen)<br />
Zu einem beliebten<br />
Markenzeichen der<br />
Gartenschau entwickelte<br />
sich die Seilbahn<br />
mit ihren Gondeln,<br />
in denen man<br />
den Park bis heute<br />
von oben betrachten<br />
kann. (Stadtarchiv SB,<br />
Nl M1154/6)
Zeitgenössischer Blick<br />
auf das Deutschmühlental.<br />
(Stadtarchiv SB, StA<br />
67; C 716-64)<br />
um Schadensbegrenzung und beantragte, die<br />
Ausschüsse sollten sich mit dieser Sache weiter<br />
befassen. Der Block Saarbrücker Bürger mit<br />
Brauereibesitzer Dr. Neufang unterstützte diesen<br />
Vorschlag ebenfalls, so dass die DPS dies akzeptieren<br />
musste. Die Ausschüsse einigten sich<br />
dann auf den Kompromiss »Deutsch-Französischer<br />
Garten im Deutschmühlental«. Darauf verständigte<br />
sich der Stadtrat in seiner Sitzung am<br />
21. März 1961. Auch die DPS-Fraktion stimmte zu,<br />
Fraktionschef Bruch gab aber zu Protokoll: »Sie<br />
[DPS] sei nach wie vor der Auffassung, dass die<br />
traditionsverbundene Bezeichnung ›Deutschmühlenpark‹<br />
der gegebene Name gewesen<br />
wäre«. [8]<br />
Die Menschen in Saarbrücken und im Saarland<br />
wählten aber schnell den Begriff »Deutsch-Französischer<br />
Garten«. Das Saarland entwickelte<br />
in den 1960er Jahren eine konstruktive Rolle<br />
in der Ausgestaltung der freundschaftlichen<br />
Beziehungen zwischen Bonn und Paris. Grundlage<br />
dafür war der Elysée-Vertrag von 1963,<br />
die Magna Charta der deutsch-französischen<br />
Freundschaft. Sie nahm ihren Anfang im Spätsommer<br />
19<strong>58</strong>. Am 14. September 19<strong>58</strong>, einem<br />
Samstag, folgte Bundeskanzler Adenauer der<br />
Einladung Charles de Gaulles, dem Präsidenten<br />
der neuen beziehungsweise V.Republik. De<br />
Gaulle hatte den Kanzler auf seinen Landsitz<br />
nach Colombey-les deux Eglises eingeladen. Auf<br />
der Autofahrt dorthin dachte Adenauer möglicherweise<br />
an einen Präsidenten, der ein Mann<br />
des Militärs war, den Ersten und Zweiten Weltkrieg<br />
erlebt hatte und von deutsch-französischer<br />
Feindschaft geprägt war. In Lothringen, im<br />
[8] StASB, Bestand V 18, Nr.21, Niederschrift zur Stadtratssitzung<br />
vom 28. Februar 1961 und 21. März 1961.<br />
Departement Haute Marne angekommen, dürfte<br />
sich die Stimmungslage rasch gewandelt haben.<br />
Beide Staatsmänner entwickelten ein Verständnis<br />
und eine Wertschätzung füreinander und<br />
wurden zu den Architekten freundschaftlicher<br />
Beziehungen und des Aufbaus einer Achse zwischen<br />
Bonn und Paris. Aber bis zum 22. Januar<br />
1963, der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages,<br />
war es noch ein langer Weg. Die Gründungsgeschichte<br />
der Deutsch-Französischen Gartenschau<br />
fällt in diese Phase Geschichte schreibender<br />
Veränderungen zwischen Deutschland und<br />
Frankreich. Interessant ist es zu sehen, wie Bonn<br />
und Paris das Saarbrücker Projekt begleiteten. [9]<br />
Poker um die Gartenschau zwischen Bonn und<br />
Saarbrücken<br />
Die Idee zur Bundesgartenschau soll im Juni 1956<br />
von Amtsrat Richard Näcke und Willy Reinkober<br />
geboren worden sein, engster Mitarbeiter von<br />
OB Schuster.10 Nachdem die Bundesgartenschau<br />
gescheitert war, folgte der Stadtrat am 18. Juni 1957<br />
der Vorlage der Verwaltung, eine deutsch-französische<br />
Gartenschau auszurichten. Schon am 9.<br />
Juli wurden eine Projektleitung und Arbeitsausschüsse<br />
gebildet. Innerhalb der Landesregierung<br />
war das Wirtschaftsministerium für die Gartenbauausstellung<br />
anzusprechen. Für die DPS-Hochburg<br />
Saarbrücken eine günstige Konstellation,<br />
denn DPS-Chef Heinrich Schneider (1907–1974)<br />
war seit 4. Juni 1957 Wirtschaftsminister, bis zum<br />
26. Februar 19<strong>59</strong> sollte er im Amt bleiben. Schneiders<br />
Präsenz im Kabinett brachte zwar Hilfe vom<br />
[9] Corine Defrance u. Ulrich Pfeil (Hg.), Der Elysée-Vertrag<br />
1945 – 1963 – 2003, Berlin 2016.<br />
[10] Heinrich Schneider, Das Wunder an der Saar, Stuttgart<br />
1974, S. 535.
saargeschichte|n 79<br />
Die 30 Meter lange<br />
Wasserorgel faszinierte<br />
die Besucher.<br />
Stündlich tanzten die<br />
Wasserfontänen zu<br />
einem Musikstück.<br />
(Stadtarchiv SB, Nl M<br />
1156/8)<br />
Land, aber die Stadtverwaltung brauchte auch<br />
die Unterstützung der Bundesregierung. Schneider<br />
kam erst gar nicht auf die Idee im Kanzleramt<br />
anzufragen, sondern nutzte seine Kontakte zu<br />
Bundeslandwirtschaftsminister Heinrich Lübke,<br />
den er in seinen Memoiren als »warmherzigen<br />
Freund« beschreibt. [11] Angeblich soll Schneider<br />
bei einem gemeinsamen Flug zur Grünen Woche<br />
nach Berlin Lübke dafür gewonnen haben. [12]<br />
Auffällig ist die ausgesprochen zurückhaltende<br />
Reaktion der Bundesregierung, das Saarbrücker<br />
Projekt zu fördern. Im Januar 19<strong>58</strong> stellte<br />
Oberregierungsrat Klitscher als der zuständige<br />
Ministerialbeamte im saarländischen Wirtschaftsministerium<br />
fest, die Bonner Ministerien<br />
ließen »wenig Neigung« für eine finanzielle<br />
Unterstützung erkennen. Klitschers Hoffnung<br />
auf einen Bundeszuschuss war gering. Schneiders<br />
Ministerium und auch die Stadt Saarbrücken<br />
fanden Unterstützung nur bei den Bündnispartnern<br />
aus den Saarkampf-Zeiten. Das von<br />
Lübke geführte Landwirtschaftsministerium war<br />
durch das Bundeswirtschaftsministerium zur<br />
Förderung des Projektes angesprochen worden.<br />
Zusammen mit dem Gesamtdeutschen Ministerium<br />
und dem Auswärtigen Amt beabsichtigte<br />
das Landwirtschaftsministerium im November<br />
1957 Sonderzuschüsse im Kabinett durchzusetzen.<br />
Weitergekommen war diese Gruppe aber<br />
nicht, denn im Juni 19<strong>58</strong> gab es immer noch keine<br />
Zusage des Kabinetts. Die saarländische Landesregierung<br />
hatte bereits 150 Mio Franken bereit-<br />
gestellt, ohne Bundeszuschuss war das Projekt<br />
aber nicht realisierbar. [13]<br />
Schneider versuchte die Bundeshilfe direkt über<br />
seine Kontakte aus den Zeiten des Saarkampfes<br />
zu organisieren. Erst als sich der erhoffte Erfolg<br />
nicht einstellte, schrieb Egon Reinert (1908–<br />
19<strong>59</strong>), der im Juni 1957 Hubert Ney (1892–1984)<br />
als Ministerpräsident ablöste, am 25. Juni 19<strong>58</strong> an<br />
Adenauer. Reinert erläuterte die Sinnhaftigkeit<br />
eines gemeinsamen Protektorates der Bundesrepublik<br />
und Frankreichs, beide Staaten »könnten<br />
auf diese Weise in wirksamer Form zum Ausdruck<br />
bringen, dass die Erledigung der Saarfrage bei<br />
keinem Partner Verstimmung und Unbehagen<br />
hinterlassen hat, sondern dass die deutsch-französischen<br />
Beziehungen in eine neue Phase gutnachbarlicher<br />
Zusammenarbeit getreten sind.«<br />
Reinerts Hinweis, dass bereits mit dem Ministerium<br />
für Landwirtschaft und Ernährung, dem<br />
Gesamtdeutschen Ministerium und dem Auswärtigen<br />
Amt auf Referentenebene das Vorhaben<br />
erörtert worden sei, dürfte den Kanzler<br />
nicht gerade gewogen gestimmt haben, Reinerts<br />
Bitte zu entsprechen und zusammen mit dem<br />
französischen Ministerpräsidenten die Schirmherrschaft<br />
zu übernehmen. [14]<br />
Die Langzeitfolgen des Saarkampfes der 1950er<br />
Jahre<br />
Und dafür gab es nachvollziehbare Gründe. Für<br />
Heinrich Schneider und die DPS wie auch für Teile<br />
der Saar-CDU und SPD war Konrad Adenauer<br />
nach seiner sogenannten Bochumer Rede vom<br />
[11] Ebda.<br />
[12] Saarbrücker Zeitung vom 19. April 1960.<br />
[13] StASB, V 18, Nr, 19, Niederschrift der Stadtratssitzung<br />
vom 9. Juni 19<strong>58</strong>, gef. 11. Juni 19<strong>58</strong>.<br />
[14] Bundesarchiv, Bestand Bundeskanzleramt (B 136), Nr.<br />
8643, Reinert an Adenauer vom 20. Juni 19<strong>58</strong>.
Auch die Amerikaner<br />
präsentierten sich mit<br />
einem Ausstellungspavillon<br />
in der spektakulären<br />
Architektur<br />
eines »Fuller<br />
Domes«, benannt<br />
nach dem amerikanischen<br />
Architekten<br />
und Designer Richard<br />
Buckminster Fuller.<br />
(Stadtarchiv SB, StA<br />
67)<br />
Bei den Besuchern<br />
seit dem Tag der<br />
Eröffnung äußerst<br />
beliebt: eine Fahrt mit<br />
der Kleinbahn.<br />
(Stadtarchiv SB, Nl M<br />
1141/16)<br />
2. September 1955 zum politischen Gegner, ja in<br />
der Emotion des Abstimmungskampfes, zum<br />
Feind geworden. Der Kanzler hatte seinerzeit die<br />
Annahme des Saarstatuts empfohlen. Für ihn<br />
war das eine Frage der Glaubwürdigkeit, hatte<br />
er sich doch zusammen mit Ministerpräsident<br />
Pierre Mendès-France seinerzeit auf das Statut<br />
verständigt und damit den letzten Bremsklotz<br />
für den Aufbau freundschaftlicher Beziehungen<br />
zwischen Bonn und Paris beseitigt. Außerdem<br />
hoffte Adenauer auf Frankreichs Zustimmung<br />
zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft.<br />
Adenauer hatte am 2. September 1955 die Saarländer<br />
direkt angesprochen: »An die Bevölkerung<br />
der Saar habe ich die herzliche Bitte zu richten:<br />
Ich verstehe, dass sie die Regierung Hoffmann<br />
nicht mehr will (…). Aber der Weg, zu einer<br />
anderen Regierung zu kommen, ist gerade, dieses<br />
Statut anzunehmen und dann in der darauf<br />
stattfindenden Landtagswahl einen Landtag zu<br />
wählen, der in seiner Mehrheit gegen die Regierung<br />
Hoffmann gerichtet ist. Wenn man das<br />
tut, dann wahrt man gleichzeitig auch die europäischen<br />
Interessen, die es nicht vertragen, daß<br />
(…) in Europa zwischen Deutschland und Frankreich<br />
wieder ein Unruheherd geschaffen wird.« [15]<br />
Damit konterkarierte er die Strategie der Statutgegner<br />
mit ihrem Slogan »Der Dicke muss weg«<br />
mit dem sie auf die Leibesfülle von Ministerpräsident<br />
Hoffmann anspielten. Nach Bochum<br />
schlossen sich DPS, SPD und CDU zum Deutschen<br />
Heimatbund zusammen. Schneider sprach<br />
mit Blick auf Adenauers Haltung noch in seinen<br />
Memoiren von einem »Dolchstoß in den Rücken<br />
der prodeutschen Parteien«. Und als Adenauer<br />
(1876–1967) am 1. Januar 1957 anlässlich des Beitrittes<br />
des Saarlandes Saarbrücken besuchte,<br />
wurde er mit Pfiffen empfangen. [16]<br />
Überhaupt war das Verhältnis zwischen der<br />
Bundesregierung und dem neuen Bundesland<br />
schwierig. Einen aus Bonner Sicht eher schlechten<br />
Eindruck hatten die Saarländer bei den Verhandlungen<br />
mit Paris über die Bedingungen der<br />
Rückkehr der Saar zur Bundesrepublik hinterlassen.<br />
Das Verhandlungsergebnis bildete der<br />
Luxemburger Vertrag vom 27. Oktober 1956, dem<br />
die DPS ihre Zustimmung mit Stimmenthaltung<br />
verweigerte und der zum Rücktritt der DPS-<br />
Minister führte.<br />
Der Kampf zwischen den Ja- und Nein-Sagern<br />
schwel te weiter. Die Landtagswahlen am 18.<br />
Dezember 1955 und die Kommunalwahlen am<br />
13. Mai 1956 zeigen die Spaltung des christlichen<br />
Lagers an der Saar und ein von der Bonner Republik<br />
noch weit entferntes Parteiensystem. So<br />
wurde bei den Landtagswahlen die CDU zwar<br />
stärk ste Partei mit 25,4 Prozent, aber nur 1,2 Prozent<br />
trennten die Union von Heinrich Schneiders<br />
DPS. Die von Johannes Hoffmann (1890–1967)<br />
begründete CVP erreichte beachtliche 21,8 Prozent,<br />
angeschlagen waren die Sozialdemokraten<br />
mit etwa 15 Prozent. Für die DPS bot sich die Perspektive,<br />
stärkste Partei zu werden und den frisch<br />
gewählten CDU-Ministerpräsidenten Ney abzulösen,<br />
der mit markigen Worten die christliche<br />
Spaltung zum Leidwesen der Bonner CDU und<br />
Teilen der Saar-CDU verfestigte. Das schwächte<br />
die CDU auf Bundesebene und damit den<br />
Kanzler. Hochburg der DPS war die Stadt Saarbrücken.<br />
Die Partei erzielte hier deutlich über<br />
40 Prozent und bildete mit großem Vorsprung<br />
die stärkste politische Kraft. Sie war hier sozusagen<br />
eine Volkspartei, denn neben dem protestantischen<br />
Bürgertum mit Kaufmannschaft und<br />
Handwerkern wählten auch viele Arbeiter und<br />
[15] https://www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/kalender/kalender-detail/-/content/eingliederung-dessaarlands-in-die-bundesrepublik.<br />
[16] Schneider, Wunder an der Saar, S. 456 ff.
saargeschichte|n 81<br />
Am Ufer des Deutschmühlenweihers.<br />
(Stadtarchiv SB, Nl M<br />
1141/15)<br />
Angestellte DPS und sie stellte mit Fritz Schuster<br />
seit 1956 den Oberbürgermeister.<br />
Die Autonomiegegner genossen ihren Triumpf<br />
vom 23. Oktober 1955. Ja- und Nein-Sager<br />
beschimpften sich weiter. Offene Rechnungen<br />
wurden nun beglichen und die Übergangsregierung<br />
unter Heinrich Welsch (1888–1976)<br />
entließ einige Beamte der Hoffmann-Regierung.<br />
Aus Perspektive der Autonomisten eine Hexenjagd<br />
und die französische Regierung mahnte zur<br />
Zurückhaltung. Um weiteren Auswüchen entgegenzuwirken<br />
veranlasste die Westeuropäische<br />
Union (WEU), die Einrichtung eines Internationalen<br />
Gerichtshofes in Saarbrücken. Am 27.<br />
Juni 1956 nahm dieser seine Arbeit auf und war<br />
bis 19<strong>59</strong> tätig. [17]<br />
Die Regierung Hoffmann hatte Gegner der Autonomie<br />
durch Zensur unterdrückt, einige auch<br />
ausgewiesen. Für die DPS war dies Anlass, im Februar<br />
1957 einen Gesetzentwurf ȟber die Wiedergutmachung<br />
der von Personen deutscher Staatsangehörigkeit<br />
im Saargebiet erlittenen Schäden«<br />
einzubringen. Im Juli 19<strong>59</strong> wurde das Gesetz<br />
dann in dritter Lesung verabschiedet, ganz<br />
bewusst wählten die Parlamentarier den Begriff<br />
»Wiedergutmachung« und wählten damit eine<br />
fragwürdige Analogie zur Entschädigung und<br />
Wiedergutmachung der singulären Verbrechen<br />
der NS-Diktatur wie dem Holocaust, dem sechs<br />
Millionen Juden zum Opfer fielen. Das autonome<br />
Saarland war aber keine Diktatur, gleichwohl<br />
aber angesichts einer fehlenden unabhängigen<br />
Verfassungsgerichtsbarkeit und Eingriffen in die<br />
[17] Alexis Andres, Edgar Hector und die Saarfrage 1920–<br />
1960, in: Rainer Hudemann, Burkhard Jellonnek, Bernd<br />
Rauls (Hg.), Grenz-Fall. Das Saarland zwischen Frankreich<br />
und Deutschland 1945–1960, St. Ingbert 1997, S.<br />
172.<br />
Meinungsfreiheit allenfalls eine Demokratie mit<br />
Vorbehalt. [18]<br />
Zum Triumphgefühl trug auch eine Straßenumbenennungsaktion<br />
bei. Akteur in Saarbrücken war<br />
die DPS. In der Zeit der Abtrennung sei »mit einer<br />
wahren Idiosynkrasie gegen alles Preußische«<br />
vorgegangen worden. Rund 120 Namen aus vornationalsozialistischer<br />
Zeit seien zwischen 1945<br />
und 1950 geändert worden. Verantwortlich dafür<br />
seien gar nicht allein die Franzosen gewesen,<br />
sondern der CVP-Stadtverordnete Dr. von Brochowski.<br />
Er habe den damaligen Bürgermeister<br />
Dr. Singer entsprechend instruiert. Sie hätten<br />
»alle traditionellen Bindungen einer urdeutschen<br />
Stadt durchschneiden wollen«. Die DPS konnte<br />
sich weitgehend durchsetzen, Widerstand leistete<br />
die CVP mit ihrem Stadtverordneten Kessler,<br />
aber in einigen Fällen auch CDU und SPD. [19]<br />
Neben den Straßenumbenennungen setzte die<br />
DPS die Wiederrichtung von Erinnerungsstätten<br />
durch. Neben dem Denkmal der 138er in den<br />
Hindenburg-Anlagen und dem Ulanen-Denkmal<br />
in der Stadenanlage wurde die Gedenktafel an<br />
der Wartburg zur Saarabstimmung am 13. Januar<br />
1935 wieder angebracht. [20]<br />
Nach der Begegnung Adenauers und De Gaulles<br />
im September 19<strong>58</strong> kam Bewegung in die<br />
deutsch-französischen Beziehungen. Als Bundeskanzler<br />
die Deutsch-Französische Gartenschau<br />
gemeinsam mit dem französischen Ministerpräsidenten<br />
zu eröffnen, an sich eine gute Perspektive,<br />
aber einen Heinrich Schneider dabei<br />
[18] Rainer Möhler, Bevölkerungspolitik und Ausweisungen<br />
nach 1945 an der Saar, in: Ebda., S. 399.<br />
[19] StA SB, V 18, Nr. 19, Sitzung vom 25. September 1956, S.<br />
113–115.<br />
[20] Ebda., Niederschrift zur Stadtratssitzung vom 30. Oktober<br />
1956, S. 139.
im Vordergrund zu haben und dessen Polemik<br />
und Nationalismus zu riskieren – dieses Risiko<br />
brauchte Bonn nicht einzugehen. In der sich<br />
nun abzeichnenden Etappe, enge und freundschaftliche<br />
Beziehungen zwischen Bonn und<br />
Paris aufzubauen, konnte man keine Kakophonie<br />
von der Saar gebrauchen. Und die gab es aus<br />
Bonner Sicht seit 1955. Knapp vier Wochen nach<br />
Adenauers Treffen mit De Gaulle im September<br />
war im Bundestag am 16. Oktober 19<strong>58</strong> die<br />
wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Saarland<br />
großes Thema. Die Saarländer wollten ihre<br />
höheren sozialpolitischen Leistungen bewahren,<br />
Schneider führte auch hier das große Wort. Im<br />
Verlauf dieser Kontroverse griff Schneider auch<br />
den Kanzler persönlich an, in Analogie an den<br />
Schlachtruf gegen Johannes Hoffmann hieß es<br />
nun nicht mehr »Der Dicke muss weg«, sondern<br />
»Der Alte muss weg«. [21]<br />
Die Bonner Ministerialbürokratie sprach von der<br />
»Rosinentheorie« der Saarländer. Sie wollten<br />
einerseits Angleichung an bundesdeutsche Standards,<br />
aber die günstigeren saarländischen Sozialstandards<br />
aus der Autonomiezeit behalten. [22]<br />
Wenn von Schneider im Kanzleramt die Rede war,<br />
sprach Adenauer nur vom »Nationalsozialisten«<br />
und den bis Juni 1957 amtierenden saarländischen<br />
Ministerpräsident Ney bezeichnete er<br />
als »Dummkopf und Nationalisten«. [23]<br />
Schneiders unangemessene Rhetorik des nationalen<br />
Pathos und des Nationalismus sowie<br />
sein populistisch kalkulierter Umgang mit seiner<br />
NSDAP-Vergangenheit – das konnte das<br />
Klima zwischen Bonn und Paris belasten, wenn<br />
im Kontext einer offiziellen Veranstaltung entsprechende<br />
Töne für Schlagzeilen sorgten. Nicht<br />
nur für den Kanzler, auch für die Franzosen war<br />
Schneider eine Reizfigur – bezeichnend die Aussage<br />
von Jean François Poncet: »(…) Heinrich<br />
Schneider, ein alter Nazi, der auf seine hitlerische<br />
Vergangenheit stolz ist. Er handelt entsprechend<br />
den Methoden des Dritten Reiches. Er ist ein Extremist,<br />
der schamlos das Nationalgefühl ausbeutet.«,<br />
so äußerte sich Frankreichs ehemaliger<br />
[21] Schneider, Wunder an der Saar, S. 289.<br />
[22] Hans-Christian Herrmann, Sozialer Besitzstand und<br />
gescheiterte Sozialpartnerschaft. Sozialpolitik und<br />
Gewerkschaften im Saarland 1945–1955, Saarbrücken<br />
1995. Ders., Eine Bilanz der kleinen Wiedervereinigung:<br />
40 Jahre nach der wirtschaftlichen Rückgliederung des<br />
Saarlandes, in: Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend<br />
48/2000, S. 309–328.<br />
[23] Hans-Peter Schwarz, Adenauer Bd. 2: Der Staatsmann<br />
1952–1957, Stuttgart 1991, S. 132–134.<br />
Hochkommissar und Botschafter in Bonn 1955 in<br />
der Zeitung »Le Figaro«. [24] Schneider prahlte mit<br />
seiner NSDAP-Mitgliedschaft und konnte sich<br />
damit in der bundesdeutschen Öffentlichkeit<br />
der 1950er und 1960er Jahre angesichts von 11,5<br />
Millionen ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und<br />
NSDAP-Anwärtern gewisser Sympathien sicher<br />
sein. Er hatte auch keine Skrupel, im Oktober 19<strong>59</strong><br />
auf einer Veranstaltung der »Hilfsgemeinschaft<br />
auf Gegenseitigkeit der Soldaten der ehemaligen<br />
Waffen-SS e. V.« (HIAG) als Redner aufzutreten. [25]<br />
Und so verwundert es auch nicht, dass im Oktober<br />
19<strong>58</strong> immer noch keine Finanzzusage der<br />
Bundesregierung für das Gartenschauprojekt<br />
vorlag. Heinrich Schneiders rechte Hand im Saarbrücker<br />
Rathaus, Willy Reinkober, setzte selbstbewusst<br />
auf Risiko: »Es sei daher notwendig, die<br />
Arbeiten so zu betreiben, als ob die Zusage des<br />
Bundes vorliegen würde, in den vorzubereitenden<br />
Verträgen müsse lediglich der Zusatz gemacht<br />
werden, dass die Rechtswirksamkeit erst mit der<br />
Zustimmung der Bundesregierung in Kraft trete«<br />
– im Nachhinein ein mutiger Schachzug, denn<br />
damit hätte der Bund ein Scheitern des Projektes<br />
verantworten müssen. [26]<br />
Im Lauf des Jahres 19<strong>59</strong> kam es dann zu verbindlichen<br />
finanziellen Zusagen der Bundesregierung.<br />
Strippenzieher war Lübke, der mehrfach bei<br />
Kanzleramtschef Hans Globke (1898–1973) für<br />
das Projekt warb und dabei behauptete, die<br />
finanzielle Beteiligung der französischen Regierung<br />
sei sichergestellt. Tatsächlich war dies<br />
aber noch unklar, ebenso wie die Frage einer<br />
Schirmherrschaft auch durch Frankreich. Darum<br />
bemühte sich der Bonner Botschafter in Paris<br />
Herbert Blankenhorn in Verhandlungen mit<br />
Pierre Joxe, dem Generalsekretär des französischen<br />
Außenministers. Teile der saarländischen<br />
Administration hofften auf das Ende von Adenauers<br />
Kanzlerschaft und damit auf mehr Förderung<br />
aus Bonn und Eröffnung der Garten-<br />
[24] Schneider, Wunder an der Saar, S. 470.<br />
[25] Schneider kokettierte mit ihr geradezu, betonte aber<br />
gelegentlich auch, als Anwalt Verfolgte des Nationalsozialismus<br />
verteidigt zu haben und deshalb Opfer eines<br />
Parteiverfahrens geworden zu sein. Wie wir durch<br />
Rainer Möhlers Studien wissen, scheiterte seine Parteikarriere<br />
aber an Gauleiter Bürckel, vgl. Rainer Möhler,<br />
Rechtsanwalt Dr. Heinrich Schneider: Trommler oder<br />
Mitläufer?, in: Peter Wettmann-Jungblut (Hg.), Rechtsanwälte<br />
an der Saar 1800–1960: Geschichte eines bürgerlichen<br />
Berufsstandes, Blieskastel 2003, S. 312.<br />
[26] StA SB, Dez II, Nr. 35.2, Niederschrift der Sitzung vom 9.<br />
Oktober 19<strong>58</strong>, gef. 25. Oktober 19<strong>58</strong>.
saargeschichte|n 83<br />
schau durch den neuen Kanzler, so äußerte sich<br />
Oberregierungsrat Marwede gegenüber Beamten<br />
des Kanzleramtes im Mai 19<strong>59</strong>. Hintergrund<br />
waren Adenauers damalige Ambitionen auf<br />
das Amt des Bundespräsidenten, so wird Marwede<br />
wie folgt zitiert: »Inzwischen könne man<br />
nach der Wahl des neuen Bundeskanzlers auch<br />
bezüglich der gemeinsamen deutsch-französischen<br />
Schirmherrschaft klarer sehen. Nach seiner<br />
Meinung komme eine Schirmherrschaft deutscher<br />
Bundespräsident/französischer Staatspräsident<br />
nicht in Betracht. Damit würde man<br />
die Ausstellung überbewerten, vielleicht sollte<br />
der neue deutsche Bundeskanzler zusammen<br />
mit dem französischen Premierminister die<br />
gemeinsame Schirmherrschaft antreten (…)«. [27]<br />
Hier deutet sich an, dass Teile der saarländischen<br />
Administration Adenauer auf keinen Fall in Saarbrücken<br />
sehen wollten.<br />
Adenauer blieb aber Kanzler und Lübke (1894–<br />
1972) wurde Bundespräsident. Im Saarland<br />
zeichneten sich aus Adenauers Sicht positive<br />
Entwicklungen ab. Durch die Vermittlung der<br />
bayerischen CSU war die CVP bereit, in der CDU<br />
Saar aufzugehen. Am 19. April 19<strong>59</strong> setzten sich<br />
auf einem Parteitag die innerhalb der CVP vermittelnden<br />
Kräfte durch und beschlossen mehrheitlich<br />
den Beitritt zur CDU. Einer der Gegner dieses<br />
Kurses, Hubert Ney, hatte die Partei schon im<br />
Februar 19<strong>59</strong> verlassen, ebenso der sogenannte<br />
Blutrichter von Prag und gesuchte Kriegsverbrecher<br />
Erwin Albrecht. Die Spaltung des christlichen<br />
Lagers war damit überwunden. Wie würde<br />
sie sich in der Praxis bewähren? Immerhin gab es<br />
einige Verweigerer in Reihen der CVP wie etwa<br />
Erwin Müller, er gründete die SVP. Für Heinrich<br />
Schneider war die Vereinigung eine erste Niederlage,<br />
schmolzen doch seine Chancen dahin, die<br />
DPS zur stärksten politischen Kraft nicht nur in<br />
Saarbrücken zu machen. Ende des Jahres 19<strong>59</strong><br />
verbesserte sich für das Saarland das Klima im<br />
Kanzleramt. Auf den tödlich verunglückten Reinert<br />
folgte Franz-Josef Röder (1909–1979) am<br />
30. April 19<strong>59</strong> als Ministerpräsident. Möglicherweise<br />
half Bundesaußenminister Heinrich von<br />
Brentano, der am 12. Oktober 19<strong>59</strong> an Adenauer<br />
schrieb, um das Kanzleramt zur aktiven Unterstützung<br />
zu bewegen. Brentano war zuvor in<br />
Saarbrücken gewesen: »Ich kann nur sagen, dass<br />
ich sowohl von dem Ministerpräsidenten [Röder]<br />
wie auch von seinem Kabinettskollegen [Schneider<br />
gehörte dem Kabinett nicht mehr an] einen<br />
[27] BA, B 136, Nr. 8643, Vermerk vom 5. Mai 1956 über Gespräch<br />
mit Marwede am 3. Mai 19<strong>59</strong>.<br />
sehr guten Eindruck gewonnen habe«. Weiter<br />
empfahl von Brentano, wohl auf Wunsch der<br />
saarländischen Landesregierung, das Patronat<br />
des Kanzlers und des französischen Ministerpräsidenten:<br />
»Ich halte diesen Vorschlag für einen<br />
glücklichen Gedanken,. Wir sollten gerade im<br />
Saarland die deutsch-französische Zusammenarbeit<br />
propagieren. (…) Die Übergangsschwierigkeiten,<br />
die notwendigerweise eintreten mussten<br />
und auch noch nicht behoben sind, werden<br />
dann an Bedeutung verlieren«. Am 19. Oktober<br />
19<strong>59</strong> vermerkte Globke, Adenauer übernehme<br />
die Schirmherrschaft, wenn auch der französische<br />
Ministerpräsident dies tue. Nun schien die<br />
Sache in trockenen Tüchern, da kam aus Paris im<br />
Dezember 19<strong>59</strong> die Nachricht, Ministerpräsident<br />
Debré verzichte auf die Schirmherrschaft. Er<br />
begründete dies mit Terminzwängen und teilte<br />
mit, der französische Landwirtschaftsminister<br />
werde die französische Regierung vertreten.<br />
Das Bundeskanzleramt teilte dies der Landesregierung<br />
am 16. Dezember 19<strong>59</strong> mit. Röder intervenierte<br />
wohl und als er Adenauer zu dessen<br />
Geburtstag am 5. Januar 1960 persönlich gratulierte,<br />
wurde vereinbart, Adenauer und Debré<br />
übernehmen die Schirmherrschaft. Röder sollte<br />
Debré nochmals persönlich darum bitten. Debré<br />
erklärte sich nun dazu bereit. Wegen eines wohl<br />
wirklich wichtigen anderen Termins vertrat ihn<br />
der französische Landwirtschaftsminister und<br />
sein deutscher Kollege den Kanzler. Die Saarbrücker<br />
Zeitung behauptete 1980 fälschlicherweise,<br />
Lübke sei der Schirmherr gewesen. Zur<br />
Freude der Saarbrücker Verwaltung besuchte er<br />
die Deutsch-Französische Gartenschau am 8. Juli<br />
1960. [28]<br />
Auch wenn es ursprünglich gar nicht beabsichtigt<br />
war, setzte die Deutsch-Französische Gartenschau<br />
ein Zeichen für eine neue Zeit deutschfranzösischer<br />
Beziehungen. Gut zwei Jahre<br />
nach der Eröffnung der Deutsch-Französischen<br />
Gartenschau besuchte Adenauer vom 2. bis 8.<br />
Juli 1962 Frankreich. De Gaulle (1890–1970) reiste<br />
im September 1962 in die Bundesrepublik. De<br />
Gaulles Staatsbesuch war eine historische Zäsur<br />
für die Deutschen, ein mediales Ereignis, das die<br />
bundesdeutsche Öffentlichkeit tief bewegte, ein<br />
Aufbruch in eine neue Zeit. Der Präsident eines<br />
Landes, das die Deutschen 1940 überfallen und<br />
besetzt hatten, reiste durch die Bonner Republik<br />
und sprach in deutscher Sprache zu den Menschen.<br />
Der von Deutschen zu verantwortende<br />
Zweite Weltkrieg mit mindestens 50 Millionen<br />
[28] Saarbrücker Zeitung vom 15./16. Mai 1980.
Strahlende Besucher<br />
bei der Eröffnung der<br />
Deutsch-Französischen<br />
Gartenschau<br />
am 23. April 1960.<br />
(Stadtarchiv SB, Nl M<br />
1143/6)<br />
Toten war noch keine 20 Jahre vorbei, da würdigte<br />
der Staatsmann eines überfallenen Landes<br />
die deutsche Kultur und appellierte, ein neues<br />
Kapitel in den Beziehungen beider Länder aufzuschlagen,<br />
ihre Erbfeindschaft zu überwinden<br />
und eine deutsch-französische Freundschaft aufzubauen.<br />
De Gaulles Auftritt gab den Deutschen<br />
ihre Würde zurück, Kritiker sahen De Gaulles<br />
Rede als eine Bestätigung all derer, die die deutsche<br />
Schuld zu verdrängen neigten. Diese Sichtweise<br />
ist nachvollziehbar, andererseits war es<br />
für den Aufbau der westdeutschen Demokratie<br />
wie auch für die angestrebte Freundschaft nicht<br />
förderlich, NSDAP-Mitglieder auf Dauer auszuschließen,<br />
diese Gruppe war mit mindestens 11,5<br />
Millionen Mitgliedern viel zu groß, da zu ihr Millionen<br />
von Mitläufern noch hinzuzurechnen sind.<br />
So hatte auch der Vorsitzende des Preisgerichts,<br />
das über die zur deutsch-französischen Gartenschau<br />
eingereichten Beiträge zu entscheiden<br />
hatte, eine belastete Vergangenheit. Alwin Seifert<br />
(1890–1972) war seinerzeit einer der führenden<br />
deutschen Landschaftsarchitekten, und galt<br />
als einer der Gründerväter der Ingenieurbiologie<br />
und einer der ersten Verfechter der Ökologiebewegung<br />
seit ihren Anfängen in den 1920er Jahren.<br />
Während der Zeit des Nationalsozialismus<br />
gehörte er zum Beraterstab Fritz Todts und war<br />
als Reichslandschaftsanwalt für die landschaftliche<br />
Eingliederung und den Streckenverlauf der<br />
Reichsautobahn sowie die landschaftliche Tarnung<br />
des Westwalls zuständig. Seifert hatte seit<br />
den 1920er Jahren engen Kontakt zu Rudolf Heß,<br />
Martin Bormann, Heinrich Himmler, Richard Walther<br />
Darré, Albert Speer und anderen NS-Granden.<br />
1938 verlieh ihm Adolf Hitler den Ehrentitel<br />
»Professor«. 1940 war er zum »Reichslandschaftsanwalt«<br />
ernannt worden.<br />
[29]<br />
Das Fernsehen begleitete De Gaulle bei<br />
seinen Besuchen in Bonn, Düsseldorf,<br />
Duisburg, Hamburg, München, Stuttgart<br />
und Ludwigsburg. Der Besuch<br />
des französischen Präsidenten zählt<br />
zu den Ereignissen der jungen Bonner<br />
Republik, das Tausende von Menschen<br />
voller Begeisterung auf die Straßen<br />
trieb. Im Garten des Ludwigsburger<br />
Schlosses sprach der französische Präsident<br />
vor über 10.000 jungen Menschen<br />
in deutscher Sprache. Die Begeisterung<br />
war zu spüren, als er vor allem die Jugend aufforderte,<br />
die Freundschaft zwischen beiden Völkern<br />
in die Hand zu nehmen.<br />
Das Saarland sollte ab den 1960er Jahren in<br />
der Entwicklung der deutsch-französischen<br />
Beziehungen eine führende und konstruktive<br />
Rolle spielen. Röder genoss hohes Ansehen in<br />
Frankreich und wurde als Ministerpräsident 1974<br />
zu einem Staatsbesuch nach Paris eingeladen<br />
– eine ungewöhnliche und zugleich wertschätzende<br />
Geste. Bei den Landtagswahlen 1965<br />
war die starke Stellung der DPS passé. Heinrich<br />
Schneider hatte keine Zugkraft mehr, wohl aber<br />
der neue Landesvater Franz-Josef Röder, der über<br />
20 Jahre regierte und bis heute der dienstälteste<br />
saarländische Ministerpräsident ist. Auch er war<br />
wie Schneider NSDAP-Mitglied, zog aber aus dieser<br />
Erfahrung für sein weiteres politisches Leben<br />
andere Konsequenzen.<br />
[29] Im Entnazifizierungsverfahren gelang es Seifert zunächst<br />
als Mitläufer und später als unbelastet eingestuft<br />
zu werden. 1950 nahm er seinen Lehrauftrag an<br />
der TH München wieder auf, 1954 erhielt er einen Lehrstuhl<br />
für Landschaftspflege, Landschaftsgestaltung<br />
sowie Straßen- und Wasserbau. Seifert hatte maßgeblichen<br />
Anteil an der Professionalisierung des Berufsstandes<br />
des Landschaftsarchitekten. Er war Berater<br />
bei großen Wasserbauprojekten und von 19<strong>58</strong> bis<br />
1963 Leiter des Naturschutzbundes in Bayern. 1961 war<br />
er einer der 16 Unterzeichner der »Grünen Charta von<br />
der Mainau«. Sein 1971 erschienenes Buch »Gärtnern,<br />
Ackern ohne Gift« avancierte zu einer Bibel der ökologischen<br />
Bewegung. Der Vf. dankt Ruth Bauer für diesen<br />
Hinweis. https://www.deutsche-biographie.de/<br />
sfz120993.html (Stand 18. Februar 2019).
europadämm(er)ung in saarbrücken<br />
saargeschichte|n 85<br />
Zwei Teppiche und ein Bildprogramm<br />
von sabine graf<br />
In der Empfangshalle des als Französische Botschaft<br />
im Saarland geplanten Gebäudes hängen<br />
zwei Wandteppiche. Sie gelten als Inventar, ohne<br />
dass bislang ihre Bedeutung genauer betrachtet<br />
wurde. Genau besehen bezeugen sie einen Wechsel<br />
in der Funktion des Gebäudes. Im November<br />
1954 bot Botschafter Gilbert Grandval das<br />
noch nicht komplett fertiggestellte Gebäude als<br />
einem möglichen Sitz für die Institutionen der<br />
Montanunion an. Seit 1952 hatte Saarbrücken für<br />
sich als Hauptstadt der Montanunion geworben.<br />
Der 23. Oktober 1955 beendete die französischen<br />
wie auch die europäischen Pläne für das Saarland.<br />
»Die Botschaft der Botschaft« (Barbara<br />
Renno, SR2 Kulturradio) lautete daher: Zu vermieten<br />
als Raum für Illusionen. Das galt 1954 und<br />
gilt auch heute noch. Die Indizien dafür liegen<br />
auf der Hand, Pardon: hängen an der Wand.<br />
Die Bildteppiche in der Empfangshalle der Residenz<br />
des französischen Botschafters im Saarland<br />
Die beiden Wandteppiche im Foyer der ehemaligen<br />
französischen Botschaft werden wie<br />
folgt beschrieben: Auf gewebtem Untergrund<br />
finden sich »abstrakte Formen«, »Hell-Dunkel<br />
Kontraste«, die den »unregelmäßigen Rhythmus<br />
der Komposition« bestimmen und ein »in<br />
sich unruhige(s) Muster« darstelle, das in der<br />
großzügigen Weite des Foyers gut zur Geltung<br />
(komme) und »dessen puristisch gestaltete<br />
Architektur mit Leben (erfülle). Das gelte auch für<br />
den zweiten der beiden Teppiche, der ein Ȋhnlich<br />
abstraktes Muster« zeige. [1]<br />
Das ist eine zutreffende Darstellung des Sachverhalts,<br />
sofern es sich ausschließlich auf den architektonischen<br />
Entwurf von Georges-Henri Pingusson<br />
bezieht. Jedoch darf bei diesem Gebäude der<br />
zeitliche Kontext nicht außer Acht gelassen werden.<br />
Vor allem dann nicht, wenn ihm eine neue<br />
Funktion zugewiesen wurde, wie es im November<br />
1954 der Fall war. Am 24. Juli 1952 stellten<br />
die Außenminister der sechs der zur Montanunion<br />
zusammengeschlossenen Länder Belgien,<br />
[1] Kunst im öffentlichen Raum. Saarland. Band 1: Saarbrücken,<br />
Bezirk Mitte. Herausgegeben von Jo Enzweiler. Institut<br />
für aktuelle Kunst an der Hochschule der Bildenden<br />
Künste Saar Saarlouis. Saarbrücken 1997, S. 137.<br />
Der größere Wandteppich<br />
von François<br />
Arnal an der Ostseite<br />
der Empfangshalle<br />
der Französischen<br />
Botschaft in Saarbrücken.(Foto:<br />
Mechthild<br />
Schneider, LPM)
Das Botschaftsensemble<br />
von Henri<br />
Georges Pingusson<br />
mit Verwaltungshochhaus<br />
und<br />
Botschafterresidenz,<br />
mit der Tricolore<br />
beflaggt, um 1957.<br />
(Foto: Joachim Lischke,<br />
Landesbildstelle)<br />
Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Italien und<br />
Deutschland in Aussicht, dass Saarbrücken zum<br />
Sitz der europäischen Institutionen der Montanunion<br />
werden könnte. In Saarbrücken reagierte<br />
man sofort und begann, nach Unterbringungsmöglichkeiten<br />
für Arbeiten und Wohnen der im<br />
Dienst der europäischen Institutionen stehenden<br />
Mitarbeitenden und deren Familien zu suchen.<br />
Der Entwurf der im Oktober 1952 erschienenen<br />
Broschüre »Warum nicht Saarbrücken«, die das<br />
Informationsamt der Stadt Saarbrücken herausgab,<br />
verzeichnet unter »IV: Unterbringungsmöglichkeiten,<br />
Punkt 3: das in den Saaranlagen<br />
gelegene, nur noch bis 1952 von der französischen<br />
diplomatischen Mission benutzte Bürogebäude<br />
mit über 200 Büroräumen.« [2] Dabei<br />
handelte es sich um die ehemalige Oberfinanzdirektion<br />
in der Alleestraße 21–23, dem heutigen<br />
Sitz des Sozialministeriums, in der das Hohe<br />
Kommissariat damals untergebracht war. Bereits<br />
im Juni 1952 hatte man in Saarbrücken, wie aus<br />
einem Schreiben an das Amt für Auswärtige und<br />
Europäische Angelegenheiten hervorgeht, die<br />
Errichtung der Schuman-Behörde in Saarbrücken<br />
gefordert. [3] Damals rechnete man damit, dass<br />
das seit 1951 im Bau befindliche neue Botschaftsgebäude<br />
an der Saaruferstraße im »Spätherbst<br />
1952« bezugsfertig sei und daher das bisherige<br />
Gebäude für die Montanunion genutzt werden<br />
könne. Das war ebenso eine Fehleinschätzung<br />
wie die Zuversicht, dass die Voraussetzung erfüllt<br />
werde, die Saarbrücken zur Hauptstadt der<br />
Montanunion machen sollte: Dafür musste es zu<br />
[2] LASB, AA 567: Typoskript Broschüre »Warum nicht Saarbrücken?«<br />
Herausgegeben vom Informationsamt der<br />
Stadt Saarbrücken, ohne Seitenangabe.<br />
[3] LASB, AA 565: Schreiben Generalsekretär Dr. Adams an<br />
Direktor Lorscheider, Amt für Auswärtige und Europäische<br />
Angelegenheiten, 13. Juni 1952.<br />
einer Verständigung über die Saarfrage zwischen<br />
Deutschland und Frankreich kommen. In beiden<br />
Fällen dauerte es jedoch länger als anfangs<br />
angenommen.<br />
Die Verhandlungen zwischen Deutschland und<br />
Frankreich zogen sich hin. Am 23. Oktober 1954<br />
unterzeichneten Bundeskanzler Adenauer und<br />
der französische Ministerpräsident Mendès-France<br />
die Pariser Verträge und damit das europäische<br />
Saarstatut für das Saarland, über das nach exakt<br />
einem Jahr die Saarländerinnen und Saarländer<br />
abzustimmen hatten. Die neue Botschaft harrte<br />
zu diesem Zeitpunkt noch ihrer Fertigstellung. Im<br />
August war das Verwaltungsgebäude bezogen<br />
worden, während an der Botschafterresidenz<br />
noch gearbeitet wurde, wie aus der erhaltenen<br />
Korrespondenz zwischen dem Ministerium für<br />
öffentliche Arbeiten und Wiederaufbau des Saarlandes<br />
und dem französischen Botschafter Gilbert<br />
Grandval hervorgeht. [4] Ungeachtet dessen<br />
stellte Grandval die noch nicht fertiggestellte<br />
Botschaft in einem Schreiben vom 8. November<br />
1954 an Ministerpräsident Hoffmann als ersten<br />
Verwaltungssitz für die Montanunion zur Verfügung.<br />
[5] Stattdessen wollte er mit seiner Landes-<br />
[4] LASB, AA 1375: Schreiben Oberregierungsrat Metzger, Ministerium<br />
für öffentliche Arbeiten und Wiederaufbau an<br />
Botschafter Gilbert Grandval, 29. November 1954: Darin<br />
ist von dem Wunsch des Botschafters die Rede, der die<br />
Fertigstellung der Residenz zwischen dem 8.und 10. Januar<br />
1955 wünsche. Siehe auch LASB, AA 543: Schreiben<br />
Oberregierungsrat Metzger, Ministerium für öffentliche<br />
Arbeiten und Wiederaufbau an Botschafter Gilbert<br />
Grandval, 1. Dezember 1954: Darin ist von Elektro- und<br />
Glaserarbeiten die Rede, die noch in der Botschafterresidenz<br />
auf Wunsch von Grandval vorgenommen wurden.<br />
[5] LASB, AA 544: Schreiben des französischen Botschafters<br />
Gilbert Grandval an Ministerpräsident Johannes Hoffmann,<br />
8. November 1954.
saargeschichte|n 87<br />
vertretung in die noch zu errichtende »Maison de<br />
France« einziehen. Diese sollte auf einem Grundstück<br />
neben dem Union-Filmtheater (dem heutigen<br />
Saarcenter mit den UT-Kinos und dem Saarufer<br />
an der Ecke Dudweilerstraße (heute: Höhe<br />
Rabbiner-Rülf-Platz) entstehen und das in Höhe<br />
der Bahnhofstraße 55–<strong>59</strong> geplante Bauprojekt<br />
»Europahaus« ersetzen. [6]<br />
Bereits am folgenden Tag schlug der im Februar<br />
1953 installierte »Aktionsausschuss Montanunionstadt<br />
Saarbrücken« unter dem Rubrum<br />
»Sofortmaßnahmen des Aktionsausschusses<br />
Montan unionstadt Saarbrücken« mit Bezug<br />
auf Artikel 13 des deutsch-französischen Saarabkommens<br />
vom 23. Oktober 1954 dieses ihm<br />
bei seiner Sitzung am 5. November bereits –<br />
offenkundig noch vor dem Ministerpräsidenten<br />
– vorliegende Angebot als »Sofortmaßnahme«<br />
vor. Derart, dass nun »die Notwendigkeiten bei<br />
einer sofortigen Übersiedlung der Europäischen<br />
Gemeinschaft für Kohle und Stahl von<br />
Luxemburg nach Saarbrücken, zum anderen die<br />
Erfordernisse bei einer Sitzverlegung nach hier<br />
nach Fertigstellung der Verwaltungs- und Wohngebäude<br />
– ausgerichtet nach den Wünschen dieser<br />
Behörde« in die Tat umzusetzen sind. [7] Mit<br />
dem vom Botschafter »spontanement à votre<br />
disposition« [8] dem Projekt »Hauptstadt der<br />
Montanunion« überlassenen Gebäude glaubte<br />
man, nun endlich einen großen Schritt auf das<br />
angestrebte Ziel hin getan zu haben.<br />
Aufgrund dieser Entwicklung und des damit eingeläuteten<br />
Funktionswandels erscheinen die<br />
beiden Wandteppiche im Foyer der Botschafter-<br />
[6] Ebd., dazu auch LASB AA 544, Schreiben Regierung<br />
des Saarlandes, der Direktor der Präsidialkanzlei, 17.<br />
Dezember 1954.<br />
[7] LASB, StK 2747: Schreiben Aktionsausschuss Montanunionstadt<br />
Saarbrücken an Ministerpräsident Johannes<br />
Hoffmann, 9. November 1954.<br />
[8] Siehe Anm. 5.<br />
residenz alles andere als rein dekorativ und ohne<br />
Bezug zum Ort. Sie abstrahieren die neue Funktion<br />
des Gebäudes. Ihr Urheber war der »Maler<br />
und Entwurfszeichner für Wandteppiche« [9] François<br />
Arnal (1924–2012). Der studierte Jurist und<br />
Literaturwissenschaftler hatte sich im Zweiten<br />
Weltkrieg der Résistance angeschlossen und<br />
hatte dort den niederländischen Maler und Galeristen<br />
Conrad Kickert kennengelernt. Durch ihn<br />
fand er zur Kunst, der er sich nach seiner Übersiedlung<br />
nach Paris im Jahr 1948 mit großem<br />
Erfolg zuwandte. 1949 erhielt er den Prix de la<br />
Jeune Peinture, nahm in den Folgejahren an den<br />
Kunstbiennalen in Sao Paolo und Venedig teil. In<br />
Deutschland vertrat ihn die in den Nachkriegsjahren<br />
bis in die 1960er Jahre für die Kunst der<br />
Bundesrepublik wichtigen Galerie Parnass in<br />
Wuppertal. Galerist Rudolf Jährling gab nicht nur<br />
den Malern Richter, Polke, Baselitz sowie Joseph<br />
Beuys oder dem Videokünstler Nam June Paik<br />
Raum, sondern richtete Werkschauen für Le Corbusier<br />
aus und holte aus Amerika den für seine<br />
Metallmobiles berühmten Alexander Calder erstmals<br />
nach Europa.<br />
1950 zeigte Parnass bereits Arbeiten von François<br />
Arnal. Dieser war ein Mann seiner Zeit und vertrat<br />
eine Bildsprache zwischen Informel, abstraktem<br />
Expressionismus und dem fröhlichen Eklektizismus<br />
Fernand Légers. Das war aktuell und ent-<br />
[9] Kunst im öffentlichen Raum. Band 1, a.a.O., S. 368.<br />
Der kleinere der beiden<br />
Wandteppiche<br />
von François Arnal<br />
an der Westseite<br />
der Empfangshalle<br />
des Pingusson-Baus<br />
entstand in einer<br />
künstlerischen Auseinandersetzung<br />
mit<br />
Impressionen aus der<br />
Stahlindustrie.(Foto:<br />
Mechthild Schneider,<br />
LPM)<br />
Das sogenannte<br />
Behördenhaus, später<br />
Finanzamt, am St.<br />
Johanner Saarufer im<br />
Bau, um 1949. (Foto:<br />
Landesarchiv Saarbrücken,<br />
Sammlung<br />
PhotoPressAct)
Anzeige in der Saarbrücker<br />
Zeitung zur<br />
geplanten Europäisiserung<br />
der Saar<br />
kurz vor den Landtagswahlen,<br />
am 25.<br />
November 1952.<br />
sprach den Sehgewohnheiten und Erwartungen<br />
der Nachkriegsmoderne in Frankreich. Demgemäß<br />
beschrieb Arnal seine Bildsprache: Informel<br />
mit Anklängen an Figuren und Landschaften. [10]<br />
Das trifft, so allgemein es auch vom Künstler formuliert<br />
ist, auf die beiden Teppiche zu. Der größere<br />
Teppich an der Ostseite zeigt Motive aus<br />
dem Bereich »Kohle«. Mächtige Flöze lagern in<br />
Schwarz, Weiß, Blau und Rot kreuz und quer im<br />
Bildraum, flankiert von wuchernden pflanzenartigen<br />
Organismen, den Urstoffen der Kohle.<br />
Ebenso lassen sich Strebe oder die kreisrunde<br />
Walze eines abstrahierten Walzenschrämladers<br />
erkennen, also die Technik, mittels der Kohle<br />
abgebaut wird. Der kleinere Teppich an der Westseite<br />
des Foyers beschäftigt sich mit der Eisenund<br />
Stahlerzeugung. Kreisformen erinnern an<br />
glühendes Eisen, das zudem an mehreren Stellen<br />
durch den Bildraum läuft. Abstrahierte Figuren<br />
halten Coquillen und andere Formen, in denen<br />
Roheisen gefangen und zur Stahlerzeugung<br />
transportiert wird. Im Zusammenhang mit der<br />
neuen Funktion des Gebäudes ist diese abstrahiert-assoziative<br />
Darstellung von Kohle und<br />
Stahl naheliegend. Sie entspricht zudem der<br />
Darstellung der Eisen- und Stahlindustrie und<br />
des Bergbaus in der Industriemalerei der 1950er<br />
Jahre, die sich durch eine »stärkere Abstraktion«<br />
auszeichnete, »um dem unverändert ästhetischen<br />
Reiz vor allem der Eisenerzeugung nachzugeben.«<br />
[11] Es zeigte sich eine »formale Abstraktion,<br />
ohne die Gegenständlichkeit aufzugeben.« [12]<br />
Der Soziologe Klaus Türk stellt in einer Untersuchung<br />
»Bilder der Arbeit« für die Industriemalerei<br />
der 1950er Jahre fest: »Das Industriebild<br />
der fünfziger Jahre war regional orientiert. Nicht<br />
Industrie an sich ist das Thema, sondern konkrete<br />
empirische Einzelobjekte oder -ereignisse. Dieser<br />
Sachverhalt ist vielleicht als ein mehr oder weniger<br />
bewusster Beitrag zu den Bemühungen um<br />
eine neue Identifikation mit den Leistungen und<br />
Ereignissen des Wiederaufbaus einzuordnen. Das<br />
Saarland und das Ruhrgebiet treten dabei quantitativ<br />
hervor.« [13] Das trifft auf die beiden Bild-<br />
[10] Pascale Thorel: Dans l’atelier de François Arnal. In: Le<br />
Magazine. La Gazette de l‘hotel Drouot, Nr. 16, 23. April<br />
2010 zit. in Pressereader über das Schaffen von François<br />
Arnal der Galerie E.G.P., Paris: http://artegp.com/<br />
dev/wp-content/uploads/2012/11/Arnal-press-Gazette-<br />
Drouot.pdf (gelesen am 31. Dezember 2019).<br />
[11] Klaus Türk: Bilder der Arbeit. Eine ikonografische Anthologie.<br />
Wiesbaden 2000, S. 329.<br />
[12] Ebd., S. 331.<br />
[13] Ebd., S. 330.<br />
teppiche zu. Sie geben in der Tat ein Bild ihrer Zeit<br />
ab.<br />
Als ihr Entstehungsjahr wird das Jahr 1954<br />
angegeben. Da es sich um großformatige Teppiche<br />
handelte, die aufwändig bestickt und gewebt<br />
wurden, war das nicht in ein paar Tagen getan.<br />
Die Maße mögen dafür sprechen: Der Teppich auf<br />
der Ostseite der Empfangshalle misst 5,00 Meter<br />
mal 8,10 Meter. Der an der Westseite, neben<br />
dem Treppenaufgang zum Büro des Botschafters<br />
(dem späteren Ministerbüro) hat die Maße 5,00<br />
Meter auf 4,70 Meter. Das könnte heißen, dass<br />
die Wandteppiche offenkundig schon geraume<br />
Zeit vor dem Angebot des Botschafters in Voraussicht<br />
darauf in Auftrag gegeben worden waren.<br />
Die Teppiche wären somit ein Geschenk Grandvals<br />
für das sich in Richtung Europa orientierende<br />
Saarland. Das wäre zu einer Zeit gewesen,<br />
als die französische Botschaft noch im Bau war,<br />
und er, ließe sich daraus folgern, dort nicht mehr<br />
einziehen wollte. Oder decken die Teppiche am<br />
Ende die These, dass »die eigentlich viel zu große<br />
Ambassade im kleinen Saarland von Anfang an<br />
mit ihrer möglichen europäischen Zukunft zu tun<br />
hatte.« [14]<br />
1952 – Das Jahr, in dem man Kontakt aufnahm?<br />
Der Plan, Saarbrücken zur Hauptstadt der<br />
Montanunion zu machen, reifte in Saarbrücken<br />
bereits vor dem 26. Juli 1952, als die Außenminister<br />
der Europäischen Gemeinschaft für<br />
Kohle und Stahl einen entsprechenden Vorschlag<br />
formulierten. Bereits am 9. Juni 1951 richtete der<br />
Saarbrücker Bürgermeister Peter Zimmer ein entsprechendes<br />
Ansinnen an den damaligen Außenminister<br />
Robert Schuman. [15] Diese Forderung<br />
wurde ein Jahr später in einem Schreiben an Gotthard<br />
Lorscheider, Direktor des Amtes für europäi-<br />
[14] Paul Burgard: Die Botschaft aus einer anderen Welt.<br />
Die Schlösser des Monsieur Grandval (Teil 2). In: <strong>Saargeschichten</strong><br />
Heft 1, 2017, S. 20–34; S. 33 .<br />
[15] LASB AA 527: Schreiben Peter Zimmer, Bürgermeister<br />
der Landeshauptstadt Saarbrücken an Robert Schuman,<br />
9. Juni 1951.
saargeschichte|n 89<br />
sche und auswärtige Angelegenheiten erneuert<br />
und bereits entsprechende Räumlichkeiten aquiriert:<br />
Darunter waren der Neubau der Landesversicherungsanstalt,<br />
das Behördenhaus Am Stadtgraben,<br />
das spätere Finanzamt und das Hohe<br />
Kommissariat in der Alleestraße, das wegen des<br />
geplanten Neubaus frei werde. [16] Auch der von<br />
dem Saarbrücker Architekten Otto Renner am 21.<br />
Juli 1952 im »Bau-Anzeiger«, Nr. 13/14 vorgelegte<br />
Entwurf für »die Unterbringungsmöglichkeiten«<br />
der Montanunion in Saarbrücken – wie die Hohe<br />
Behörde, der Gerichtshof, der Ministerrat und das<br />
Plenum – siedelte diese links und rechts des Neubaus<br />
der französischen Botschaft an. In einem<br />
Beitrag des »Bau-Anzeigers«, einer Sonderseite<br />
in der »Saarbrücker Zeitung« vom 29. November<br />
1952, die sich mit der Eignung Saarbrückens<br />
als Sitz der Montanunion befasste, legte Renner<br />
nach und prognostizierte: Dass die Botschaft<br />
»nach entsprechenden Begründungen und Verhandlungen<br />
wohl mit in den Gebäudekomplex<br />
des endgültigen Sitzes der Montanunion eingegliedert<br />
werden könnte.«<br />
Der Druck, das Projekt Hauptstadt der Montanunion<br />
voranzutreiben, hatte sich seit Juni 1952 stetig<br />
aufgebaut, befeuert unter anderem von einer<br />
AFP-Meldung vom 28. Juni 1952. Darin war von<br />
einem Treffen von Außenminister Schuman und<br />
Ministerpräsident Pinay die Rede, die gegenüber<br />
einer Delegation von Bas-Rhin sich für Straßburg<br />
als Sitz der Montanunion ausgesprochen hätten.<br />
Darüber informierte das Amt für auswärtige<br />
und europäische Angelegenheiten Botschafter<br />
Grandval. Umso entschlossener ging man in<br />
Saarbrücken ans Werk. So hieß es in einer Anzeige<br />
der Saarbrücker Zeitung vom 25. November 1952:<br />
»Wenn das Saarland europäisiert wird, dann wird<br />
Saarbrücken die Hauptstadt der Montanunion.<br />
Das ist schon jetzt beschlossen. Die Europäisierung<br />
kommt nur, wenn alle Saarländer einverstanden<br />
sind.« Um sicher zu gehen, dass dies der<br />
Fall ist, ließ die saarländische Regierung einen<br />
Tag vor der Landtagswahl am 30. November 1952<br />
aus einem Flugzeug Flugblätter abwerfen. Sie<br />
zeigten den Rohbau des Botschaftsgebäudes.<br />
Dabei war die Bezeichnung »Französische Botschaft«<br />
durchgestrichen und mit einem »Nein!«<br />
bekräftigt und zugleich die eigentliche Funktion<br />
des Gebäudes genannt: »Sitz der Montan-Union«.<br />
Damit war auch eine Begründung dafür gegeben,<br />
dass das für das Saarland im Grunde zu große<br />
Botschaftsgebäude von vorneherein für ganz<br />
[16] LASB AA 565: Schreiben Dr. Adams an Direktor Lorscheider,<br />
13. Juni 1952.<br />
andere Aufgaben vorgesehen war. Paul Burgard,<br />
der die Baugeschichte der französischen Botschaft<br />
vollumfänglich aufgearbeitet hat, ordnet<br />
diese Behauptung als »nachgeschobene Sinnstiftung<br />
aus »JoHos Wahlkampfmaschine« [17] ein.<br />
Längst hatte der Plan, aus Saarbrücken die Hauptstadt<br />
der Montanunion zu machen, eine Eigendynamik<br />
entwickelt. Am 25. Februar 1953 konstituierte<br />
sich unter dem Vorsitz des Saarbrücker<br />
Bürgermeisters Peter Zimmer der Aktionsausschuss<br />
»Montanunionstadt Saarbrücken«. Dieser<br />
kanalisierte den Aktionismus in einer Stadt,<br />
in der die Wohnungsnot groß war und gleichzeitig<br />
unablässig Neubauten für die erhofften<br />
europäischen Institutionen zur Verfügung stellte.<br />
Ungeachtet dessen schuf Luxemburg Fakten<br />
und hielt einen Neubau für die Hohe Behörde<br />
bereit, die die »Saarländische Volkszeitung« am 5.<br />
Januar 1953 vermeldete. Zudem habe Luxemburg<br />
den Auftrag für den Bau einer »Schumanplan-<br />
Gartenstadt« erteilt und dafür 100 Millionen<br />
Franc bereitgestellt. Die ersten Gebäude sollten<br />
im November des gleichen Jahres bezugsfertig<br />
sein. Schon am nächsten Tag sandte die Landesregierung<br />
ein Schreiben an Robert Schuman mit<br />
der Erinnerung daran, dass die Entscheidung<br />
über den Sitz der Hauptstadt der Montanunion<br />
noch offen sei. [18]<br />
Die Antwort an Ministerpräsident Johannes<br />
Hoffmann kam am 3. Februar 1953 vom französischen<br />
Außenminister Bidault und erinnerte<br />
diesen daran, dass die Entscheidung für Saarbrücken<br />
abhängig sei von den deutsch-französischen<br />
Verhandlungen über das Saarstatut.<br />
Da dies noch offen sei, so ließe sich der weitere<br />
Inhalt des Schreibens übersetzen, habe<br />
man in Luxemburg schon mal angefangen. [19]<br />
Dem wollte man in Saarbrücken nicht nachstehen,<br />
ungeachtet der Fakten, die bereits<br />
durch Gebäude in Luxemburg und Straßburg<br />
geschaffen worden waren. Das Protokoll der 3.<br />
Sitzung des Aktionsausschusses Montanunionstadt<br />
Saarbrücken vom 18. Mai 1953 bewertet<br />
daher die Chance für Saarbrücken, Hauptstadt<br />
der Montanunion zu werden, als »sehr groß« [20] .<br />
[17] Siehe Anm. 14.<br />
[18] LASB AA 565: Schreiben des Ministerpräsidenten an Außenminister<br />
Robert Schuman, 6. Januar 1953.<br />
[19] LASB AA 565: Schreiben Außenminister Bidault an Ministerpräsident<br />
Johannes Hoffmann, 3. Februar 1953.<br />
[20] St A, Bestand Großstadt Saarbrücken, Nr. 4276, Akte<br />
»Aktionsausschuss Montanunionstadt Saarbrücken«, 3.<br />
Sitzung vom 18. Mai 1953.
Brief von Le Corbusier<br />
mit einer<br />
abschlägigen Antwort<br />
auf die Anfrage<br />
der Landesregierung,<br />
ob Corbusier Mitglied<br />
einer Jury für<br />
den bevorstehenden<br />
Architekturwettbewerb<br />
sein könne.<br />
(LA SB, InfA)<br />
Doch begleiteten den Aktionismus und die Euphorie<br />
auch Zweifel, wie das Rücktrittsschreiben Peter<br />
Zimmers vom Vorsitz des Aktionsausschusses am<br />
23. September 1953 belegt. Darin bemängelt er<br />
die Unentschiedenheit im Vorgehen und bei der<br />
Bereitstellung eines entsprechenden Etats. Es<br />
gebe nur »ein paar schöne Fotos von besetzten<br />
Hochhäusern, die wir »evtl.« frei machen könnten.<br />
(…), dass wir mit dem gleichen Recht und der<br />
gleichen Wurstigkeit mit ein paar schönen Fotos<br />
von unseren Kasernen im Saarland den Nachweis<br />
führen könnten, dass bei uns im Saarland<br />
alle Voraussetzungen zur Abwehr einer russischen<br />
Invasion bestehen könnten.« [21] Auch der<br />
Vertreter des Wirtschaftsministeriums, Dr. Krause-Wichmann<br />
gab in einem Vermerk für den<br />
Direktor des Amtes für auswärtige und europäische<br />
Angelegenheiten vom 1. Dezember 1953 zu<br />
Protokoll, dass Saarbrücken wenig Chancen als<br />
Hauptstadt der Montanunion habe, »da es nicht<br />
den Ruf einer schönen Stadt genießt« [22] Offenbar<br />
hatte er sich in der immer noch vom Krieg<br />
gezeichneten Stadt umgesehen und geahnt,<br />
dass es noch andere Herausforderungen als die,<br />
Hauptstadt der Montanunion zu werden, zu<br />
meistern galt. Er riet daher dazu, die Trümmer<br />
[21] LASB AA 570: Schreiben Peter Zimmer, 23. September<br />
1953.<br />
[22] LASB AA 544: Vermerk Dr. W. Krause-Wichmann für Direktor<br />
Lorscheider, 1. Dezember 1953.<br />
aus der Stadt zu entfernen und die Infrastruktur<br />
zu verbessern. Das sollte ein paar Monate später<br />
auch einem weiteren Minister auffallen. Doch zur<br />
selben Zeit entstand der Entwurf eines Schreibens<br />
an Jean Monnet, Präsident der Europäischen<br />
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der für die<br />
Bestimmung Saarbrückens »zum endgültigen<br />
Sitz der Behörden der Gemeinschaft« warb, weil<br />
dies »ein maßgeblicher Schritt und eine wesentliche<br />
Förderung des Zustandekommens einer<br />
europäischen Saarlösung darstellen würde.« [23]<br />
Das Schreiben bekundet den Willen und ein großes<br />
Entgegenkommen, das die von Zimmer kritisierten<br />
wortreichen Versprechungen formuliert.<br />
So wolle man »in allen Punkten den Wünschen<br />
der EGKS entgegen (…) kommen und sowohl<br />
den Bau von Verwaltungsgebäuden als auch<br />
der Wohnsiedlungen nach den Wünschen Ihrer<br />
Behörde (…) unternehmen. Es stehen uns verschiedene<br />
Gebäude am Rande und in der Stadt<br />
Saarbrücken zur Verfügung, auf denen das Saarland<br />
gerne bereit ist, auch eine eigene »europäische<br />
Stadt« zu errichten.« [24] Entsprechendes<br />
hatte der Saar-Landtag bereits am 1. Oktober<br />
1953 beschlossen, vor der endgültigen Entscheidung<br />
für Saarbrücken, dort mit dem Bau<br />
von Gebäuden zu beginnen. Dazu wurde am 1.<br />
Juni 1954 ein Ideenwettbewerb ausgelobt. Die<br />
Begründung »für diese Umkehr der zeitlichen<br />
Reihenfolge« lieferte eine Pressemeldung im<br />
Auftrag des Ministerpräsidenten vom 19. Januar<br />
1954. Das sei im »Geist der Verständigung zwischen<br />
Deutschland und Frankreich« geschehen<br />
und finde seinen Ausdruck im Bau einer »kleinen<br />
europäischen Stadt« am südlichen Stadtrand. [25]<br />
Bereits am nächsten Tag vermeldete die »Saarbrücker<br />
Zeitung«: »Saarland zur Aufnahme der<br />
Montanunion bereit«. [26] Ob es die Montanunion<br />
auch war, war eine andere Frage.<br />
Das Saarland ging unverdrossen in Vorlage,<br />
um der Konkurrenz in Luxemburg und Straßburg<br />
zuvorzukommen. Der Ideenwettbewerb<br />
wurde am 1. Juni 1954 ausgerufen. Die Jury, der<br />
anstelle des zuerst genannten Le Corbusier dann<br />
auch Georges-Henri Pingusson angehörte, kam<br />
Anfang Mai 1955 zusammen, um über die 34 Ein-<br />
[23] LASB AA 570: Undatierter Entwurf eines Schreibens an<br />
[24] Ebd.<br />
Jean Monnet, der zwischen Schreiben aus dem November/Dezember<br />
1953 abgelegt wurde.<br />
[25] LASB Bestand Informationsamt (Infa) Nr. 146: Pressemeldung<br />
vom 19. Januar 1954.<br />
[26] Saarbrücker Zeitung, 20. Januar 1954: »Saarland zur<br />
Aufnahme der Montanunion bereit«.
saargeschichte|n 91<br />
reichungen aus Deutschland und Frankreich zu<br />
beraten. Derweil war auch mit Brüssel ein weiterer<br />
Mitbewerber erwachsen, worauf ein Telex<br />
mit der Überschrift »Brüssel will die Hauptstadt<br />
Europas werden« vom 29. Juli 1954 verweist, das<br />
sich in Akten des Amtes für auswärtige und europäische<br />
Angelegenheiten erhalten hat. [27] In Saarbrücken<br />
war man sich mittlerweile im Klaren,<br />
dass die Verkehrsverbindungen von und nach<br />
Saarbrücken aus Richtung Brüssel oder Den Haag<br />
nicht ideal waren und wenig für Saarbrücken als<br />
künftigen Standort sprachen. [28] Derweil nahm<br />
der Ideenwettbewerb für ein Verwaltungszentrum<br />
mit Hoher Behörde und Gerichtshof<br />
der Montanunion sowie Verwaltungsgebäude<br />
für zehn weitere europäische Institutionen seinen<br />
Lauf. Dabei gab es allenfalls »vage Absichtserklärungen«<br />
[29] in Bezug auf die Etablierung<br />
europäischer Institutionen in Saarbrücken, die<br />
jedoch als solche nicht wahrgenommen wurden.<br />
Auch gab es von Seiten des französischen Botschafters<br />
vor seinem Angebot vom 8. November<br />
1954 »keinerlei Anzeichen«, worauf Paul Burgard<br />
bereits verwiesen hat. [30]<br />
Das Gegenteil war der Fall, betrachtet man die<br />
Aktenlage. In einem Schreiben vom 29. Juli 1952<br />
empfahl Grandval, der seit dem 25. Januar 1952<br />
als Botschafter Frankreichs an der Saar fungierte,<br />
Ministerpräsident Johannes Hoffmann<br />
wegen des Neubaus der Botschaft, den Kohlehafen<br />
der gegenüber dem Neubau gelegenen<br />
Hafeninsel zu verlegen. Das diene zum einen<br />
der Entlastung des Bahnhofsviertels und sorge<br />
vor allem dafür, dass »der geographische Mittelpunkt<br />
der Stadt Saarbrücken mehr zur Geltung«<br />
komme, da die geplante Nord-Südachse mitten<br />
durch die Hafeninsel verlaufen sollte. Zur Amortisierung<br />
der dafür anfallenden Kosten solle das<br />
Saarland die Pachtgelder für die Saargruben nutzen,<br />
schlug der Botschafter vor. [31] Dabei sei ihm<br />
wohl bewusst, so Grandval, dass er sich in saarländische<br />
Angelegenheiten einmische. Aber das<br />
seien solche, »die mich nur insoweit angehen,<br />
als sie die Nachbarschaft der französischen Botschaft<br />
betreffen.« [32] Von Europa war nicht die<br />
Rede, sondern von der Repräsentanz Frankreichs,<br />
die möglichst frei von störenden, die Aussicht<br />
trübenden Industrieerzeugnissen des Landes<br />
gehalten werden sollte. Überflüssig zu erwähnen,<br />
dass es die Kohle war, welche die Aussicht des<br />
Botschafters aus seiner Residenz verschandelte.<br />
Der Rohstoff, der nur wenige Jahre später zur<br />
Rechtfertigung der Stadt als Sitz der Hauptstadt<br />
der Montanunion hinreichen sollte.<br />
Die Kohleninsel als Sitz des Verwaltungszentrums<br />
[33] und die Botschaft als unübersehbarer<br />
Mittelpunkt, an der Kreuzung der Nord-<br />
Südachse sowie der Ost-Westachse des Verkehrs<br />
entsprachen den zu diesem Zeitpunkt längst ad<br />
acta gelegten Planungen Georges-Henri Pingusson<br />
für das Nachkriegssaarbrücken . Der Neubau<br />
der Botschaft als deren Restbestand bilde »das<br />
Rückgrat des Saartals« [34] hieß es in der »Saarbrücker<br />
Zeitung« aus Anlass der Fertigstellung<br />
und des Bezugs des Verwaltungsteils der französischen<br />
Botschaft.<br />
Daher war die Botschaft von Anfang an groß<br />
gedacht und daher von ihrem Hausherrn, »der<br />
Schlechte Aussichten<br />
für Seine Exzellenz:<br />
Der Saarbrücker<br />
Kohlehafen prägte<br />
das Stadtbild auf der<br />
anderen Seite der<br />
Saar, gegenüber von<br />
Pingussons Botschaft.<br />
(LA SB, PhotoPressAct)<br />
[27] LASB AA 570, Telex vom 29. Juli 1954: »Brüssel will die<br />
Hauptstadt Europas werden«.<br />
[28] LASB AA 570: Schreiben Erwin Müller, Minister für Finanzen<br />
und Forsten an Oberregierungsrat Ganster, Aktionsausschuss<br />
Montanunionstadt Saarbrücken, 2. Juli<br />
1954.<br />
[29] Paul Burgard: Die Botschaft aus einer anderen Welt,<br />
a.a.O., S. 33.<br />
[30] Ebd.<br />
[31] LASB AA 1747, Schreiben Botschafter Gilbert Grandval<br />
an Ministerpräsident Johannes Hoffmann, 29. Juli 1952.<br />
[32] Ebd.<br />
[33] Siehe dazu: Ulrich Höhns: Saarbrücken – Verzögerte<br />
Moderne einer kleinen Großstadt. In: Neue Städte aus<br />
Ruinen. Deutscher Städtebau der Nachkriegszeit. München<br />
1992, S. 283–299; S. 294.<br />
[34] N.W.: »Eine schmale, hochgestellte Scheibe«. In: Saarbrücker<br />
Zeitung, August 1954.
Empfang des Ständigen<br />
Vertreters Frankreichs<br />
im Saarland<br />
am französischen<br />
Nationalfeiertag 19<strong>58</strong>.<br />
Im Hintergrund sind<br />
ein kleiner Ausschnitt<br />
des kleineren Arnal-<br />
Teppichs sowie der<br />
Aufgang zum Zimmer<br />
des Botschafters zu<br />
sehen. (Foto: Landesarchiv<br />
Saarbrücken,<br />
Sammlung Photo-<br />
PressAct)<br />
Inkarnation Frankreichs an der Saar« [35] auch groß<br />
geplant. Saarbrücken als »europäische Metropole«<br />
[36] kam erst in Gespräch, als man sich dort<br />
anschickte, sich um den Sitz der Montanunion<br />
zu bewerben. Gilbert Grandval schwenkte dazu<br />
erst Anfang November 1954 über, nachdem er am<br />
25. Oktober 1954 bei einem Treffen am Quai d‘Orsay<br />
das Angebot erhielt, eine andere Stellung zu<br />
übernehmen, die ebenfalls der eines Botschafters<br />
entspräche. [37] Grandval wusste daher im<br />
November 1954, dass er das Saarland verlassen<br />
würde. [38] Am 30. Juni 1955 verließ er Saarbrücken,<br />
um in Marokko das Amt des Generalresidenten<br />
zu übernehmen. Daher konnte er großzügig das<br />
noch nicht ganz fertiggestellte Gebäude dem<br />
Aktionsausschuss Montanunionstadt Saarbrücken<br />
anbieten. Er wolle daher mit der Botschaft<br />
in die geplante »Maison de France« einziehen.<br />
Auch dieses Gebäude hatte bereits eine<br />
Vorgeschichte. Bereits 1952 reifte der Plan ein<br />
Gebäude auf der freien Fläche zwischen der Saarufer-<br />
und der Bahnhofstraße zu errichten. [39] Dort<br />
sollte zuerst die »Maison de France« entstehen.<br />
Die Regierung des Saarlandes zeigte sich damit<br />
einverstanden, jedoch schlug<br />
Ministerpräsident Hoffmann<br />
dem Botschafter Grandval<br />
vor, man möge das Gebäude<br />
»Europa-Haus« nennen. [40]<br />
Auch dieses Bauprojekt ging<br />
auf Kosten des Saarlandes,<br />
weswegen Ministerpräsident<br />
Hoffmann in einem Schreiben<br />
vom 12. März 1954 avisierte,<br />
dass es keine weiteren<br />
Extras für den Bau der Botschaft<br />
geben sollte und das<br />
geplante Europa-Haus nicht<br />
mehr als 300 Millionen Franc kosten dürfe. [41] Das<br />
war bereits im November in Folge des Angebot<br />
Grandvals hinfällig, so dass das Kabinett in<br />
einer außerordentlichen Sitzung beschloss, das<br />
Bauprojekt »Europa-Haus« in der Bahnhofstraße<br />
55–<strong>59</strong> fallen zu lassen und »stattdessen<br />
der Errichtung eines entsprechenden Gebäudes<br />
auf dem neben dem Uniontheater gelegenen<br />
Grundstück zuzustimmen.« [42] Doch auch hier<br />
gab es ein Nachspiel. Dergestalt, dass sich der<br />
mit der Planung befasste Saarbrücker Architekt<br />
Hans Baur, der schon beim Umbau des<br />
Schlosses Halberg die Baukosten in exorbitante<br />
Höhen getrieben hatte [43] , darüber bei Botschafter<br />
Gilbert Grandval beschwert hatte, dass er bei<br />
einer Besprechung mit Oberregierungsrat Metzger<br />
vom Ministerium für Öffentliche Arbeiten<br />
und Wiederaufbau zu hören bekommen habe,<br />
das »Europahaus (gemeint war die »Maison de<br />
France«, S.G.) brauche nicht gebaut zu werden,<br />
da es noch völlig ungewiss sei, ob die Montan-<br />
Union nach Saarbrücken käme.« [44] Es stellte<br />
sich heraus, dass die Regierung lediglich den für<br />
[35] Marlis Steinert: Die Europäisierung der Saar: Eine echte<br />
Alternative? In: Grenz-Fall. Das Saarland zwischen<br />
Frankreich 1945–1960. Herausgegeben von Rainer Hudemann<br />
u.a. St. Ingbert 1997, S. 63–80; S. 78.<br />
[36] Ulrich Höhns: Saarbrücken – Verzögerte Moderne einer<br />
kleinen Großstadt, a.a.O., S. 297.<br />
[37] Stefan Martens: Gilbert Grandval. Frankreichs Prokonsul<br />
an der Saar. In: Stefan Martens (Hg.): Vom »Erbfeind«<br />
zum »Erneuerer«: Aspekte und Motive der<br />
Deutschlandpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Sigmaringen<br />
1993, S. 201–242; Anm. 181.<br />
[38] Paul Burgard: Die Botschaft aus einer anderen Welt,<br />
a.a.O., S. 34.<br />
[39] LASB AA 544: Schreiben Dr. Jäger, Amt für auswärtige<br />
und europäische Angelegenheiten an den Direktor der<br />
Präsidialkanzlei, 25. Juli 1952.<br />
[40] LASB AA 543: Schreiben Botschafter Gilbert Grandval<br />
an Ministerpräsident Johannes Hoffmann, 22. September<br />
1953.<br />
[41] LASB AA 543: Schreiben Ministerpräsident Johannes<br />
Hoffmann an Botschafter Gilbert Grandval, 12. März<br />
1954.<br />
[42] LASB AA 544: Protokoll außerordentliche Kabinettsitzung<br />
der Regierung des Saarlandes vom 30.11.1954;<br />
Siehe AA 544 auch: Mitteilung Regierung des Saarlandes,<br />
17. Dezember 1954.<br />
[43] Siehe dazu: Paul Burgard: Die Schlösser des Monsieur<br />
Grandval. Teil 1: Die Metamorphose des Halbergs. In:<br />
<strong>Saargeschichten</strong>, Heft 45, 4, 2016, S. 20–34.<br />
[44] LASB AA 1379: Schreiben Staatskommissar Dr. Schütz,<br />
Ministerium für Öffentliche Arbeiten und Wiederaufbau<br />
an Botschafter Gilbert Grandval, 26. Januar 1955.
saargeschichte|n 93<br />
seine Etatüberziehung bekannten Architekten<br />
abgelehnt hatte.<br />
Der 23. Oktober beendete auch diese Projekt,<br />
wobei eine gewisse Ironie nicht von der Hand zu<br />
weisen ist, als man das Projekt »Europahaus« im<br />
Namen Europas erledigte, um dafür die »Maison<br />
de France« zu errichten. Diese kam 19<strong>59</strong> in stark<br />
reduzierter Gestalt, als das Generalkonsulat in<br />
ein Gebäude hinter der Johanniskirche umzog<br />
und dort unter der Leitung des bereits in Zeiten<br />
Grandvals für kulturelle Angelegenheiten<br />
zuständigen Pierre Wölfflin ein »Centre Culturel«<br />
etablierte. [45]<br />
Ohnehin erwiesen sich die Europapläne des Saarlandes<br />
als weitgehend wolkig beziehungsweise<br />
»surreal« [46] und alles andere als modern, da sie<br />
in der Vorstellung von Ministerpräsident Hoffmann<br />
mehr dem christlichen Mittelalter als der<br />
europäischen Aufklärung zugetan waren. Auch<br />
die Historikerin und Zeitzeugin Marlis Steinert<br />
sah in den mit der Montanunion verknüpften<br />
Europa-Plänen für das Saarland »keine Alternative«.<br />
[47] Die Montanunion als »Restbestand<br />
großer Ideen«, wie es Heinrich Küppers formulierte<br />
[48] , vermochte wenig auszurichten, nachdem<br />
das französische Parlament die Europäische<br />
Verteidigungsunion verworfen hatte. Doch noch<br />
aus diesen »Restbestand« sog die Saar-Regierung<br />
Hoffnung, den Saarstaat zu retten und sich<br />
zum Herzen Europas zu erklären. Die Krise war<br />
erst 1957 mit Abschluss der »Pariser Verträge«<br />
behoben, als das Saarland längst Bundesland der<br />
Bundesrepublik Deutschland geworden war. Mit<br />
dem »Restbestand europäischer Ideen« war im<br />
Saarland nichts mehr zu gewinnen. Der Rest war<br />
Autosuggestion einer europäischen Vision unter<br />
Ausblendung der Wirklichkeit. Es war nur ein<br />
Gespinst, eingewebt in zwei Teppiche, in denen<br />
sich Wunsch und Wirklichkeit verfingen. Bleibt<br />
die Frage, wann das geschehen ist.<br />
Die Teppiche – Gespinste Europas an der Saar<br />
Dass der Teppich vor dem 8. November 1954<br />
von Botschafter Grandval bestellt wurde, damit<br />
er die neue Funktion des Botschaftsgebäudes<br />
beglaubigen sollte, ist unwahrscheinlich und<br />
[45] Peter Scholl-Latour: Das »Schmale Handtuch« wechselt<br />
seine Bewohner. In: Saarbrücker Zeitung, 6. Juni 19<strong>59</strong>.<br />
[46] Paul Burgard: Das Saarland und Europa. Reales und Surreales<br />
aus einer erstaunlichen Geschichte. In: Man Ray –<br />
zurück in Europa (Katalog) Saarbrücken 2019, S. 130–137.<br />
[47] Siehe Anm. 34.<br />
[48] Heinrich Küppers: Johannes Hoffmann (1890–1967).<br />
Biographie eines Deutschen. Düsseldorf 2008, S. 496.<br />
ausgeschlossen. Auch eine Bestellung direkt am<br />
8. November oder kurz danach macht eine Fertigstellung<br />
noch im Jahr 1954 unwahrscheinlich.<br />
Zumal »der Herr Botschafter die Fertigstellung<br />
seiner Residenz zwischen dem 8. und 10. Januar<br />
1955 wünsche«, wie ein Schreiben des Ministeriums<br />
für öffentliche Arbeiten und Wiederaufbau<br />
vom 29. November 1954 referiert. [49] Als Datum der<br />
Fertigstellung des »Empfangsteiles (Mittelteil)<br />
wird der 5. Dezember 1954 genannt, während der<br />
»restliche Ausbau bis 8. Januar 1955 abgeschlossen<br />
sein müsse.« Das bedeutete, wie das Schreiben<br />
vermerkte, zahlreiche Überstunden. Dazu<br />
gehörten Elektro- und Glaserarbeiten [50] in der<br />
Eingangshalle, wobei in Abänderung der Planung<br />
dort veredeltes Glas inklusive der Vergoldung, für<br />
die ein französischer Maler von der Botschaft<br />
beauftragt worden war. Am 29. Januar 1955 stellte<br />
der ausführende Architekt Hans Bert Baur die<br />
Rechnung über die gesamte Baumaßnahme, also<br />
der Bauabschnitte I, dem Verwaltungsbaus und<br />
dem Bauabschnitt II, dem »Hotel des Herrn Botschafters<br />
mit Empfangs- und Wirtschaftsräumen,<br />
einschließlich Schwimmbad, Gewächshaus und<br />
Einfriedung«. [51] Dafür hatte die Regierung des<br />
Saarlandes 880.000.000 Francs zur Verfügung<br />
gestellt, deren Verwendung Baur nun aufschlüsselte:<br />
Grundstück, Geländeerschließung<br />
sowie für die Errichtung der »Büroscheibe« wurden<br />
insgesamt 304.560.000 Francs aufgewendet.<br />
Die »restlichen Baumittel«, spricht <strong>58</strong>5.440.000<br />
Franc wurden für die Botschafterresidenz verwendet.<br />
Die Innenausstattung mit Mobiliar<br />
und damit auch den beiden Wandteppichen<br />
war in dieser Summe nicht enthalten. Die Aufträge<br />
dazu hatte Grandval selbst unter anderem<br />
dem Gestalter Jacques Dumand erteilt. [52]<br />
Dass Grandval selbst auch François Arnal beauftragt<br />
hat, ist daher wahrscheinlich. Dass dies<br />
erst nach der Fertigstellung der Botschafterresidenz<br />
der Fall war, liegt im Verfahren der Herstellung<br />
von Wandteppichen begründet. Das<br />
erläuterte kein geringerer als der für seine – auch<br />
[49] LASB AA 1375: Schreiben Oberregierungsrat Metzger an<br />
Herrn Botschafter Gilbert Grandval, 29. November 1954.<br />
[50] Siehe Anm. 4.<br />
[51] LASB AA 544: Schreiben Hans Bert Baur an Ministerpräsident<br />
Johannes Hoffmann, 29. Januar 1955.<br />
[52] Simon Texier: Die französische Botschaft in Saarbrücken.<br />
In: Die ehemalige Französische Botschaft in<br />
Saarbrücken von Georges-Henri Pingusson. Hg. Vom<br />
Deutschen Werkbund Saarland und dem Institut für<br />
aktuelle Kunst im Saarland. Saarbrücken 2014, S. 48–53;<br />
S. 48.
Der Cours d’honneur<br />
der Botschaft beim<br />
Empfang des französischen<br />
Generals<br />
Lafaille am 13. Februar<br />
1957. An der Wand ist<br />
deutlich das Sgraffito<br />
von Otto Lackenmacher<br />
zu sehen. (Foto:<br />
Landesarchiv Saarbrücken,<br />
Sammlung<br />
PhotoPressAct)<br />
in Saarbrücken [53] zahlreich vorhandenen – Wandteppiche<br />
berühmte Jean Lurcat. Das geschah<br />
im Vorwort zum Katalog der Ausstellung von<br />
50 Bildteppichen von der Gotik bis zu Moderne<br />
unter dem Titel »Französische Bildteppiche«,<br />
die das Hohe Kommissariat der Französischen<br />
Republik in Deutschland 1949 in Baden-Baden<br />
veranstaltet hatte. Darin erklärte Lurcat das Vorgehen<br />
eines Tapissiers: »Für den Wandteppich ist<br />
im Gegensatz zum Gemälde die Abhängigkeit<br />
eine Notwendigkeit. In der Tat kann der Wandteppich<br />
– unter idealsten (sic!) Bedingungen- nur<br />
»a priori« im Maß, in seiner Farbgebung und oft<br />
in seinem Gegenstand von vorneherein durch<br />
das Gebäude, das er schmücken soll bestimmt<br />
werden. (…) Wir müssen uns über das Gebäude<br />
genau im Klaren sein, in das wir ‚eingeladen‘ werden.<br />
Wir dürfen nicht vergessen, das wir Gäste<br />
sind, und ein Gast muss immer darauf halten (,)<br />
taktvoll zu bleiben und sich anzugleichen, in welcher<br />
Umgebung es auch sein mag.« [54] Das hieß<br />
für die Wandteppiche in der Botschaft, dass die<br />
Räumlichkeiten fertig gestellt und ihnen ihre<br />
Plätze zugewiesen werden konnten. Die unter-<br />
[53] Dazu sei angemerkt: Der Bruder von Jean Lurcat war<br />
der Architekt André Lurcat. Marcel Roux, einer der im<br />
Saarland wirkenden Stadtplaner war dessen Assistent<br />
gewesen.<br />
[54] Jean Lurcat: Vorwort. In: Französische Bildteppiche. (Katalog).<br />
Baden-Baden 1949, S. 14.<br />
schiedlichen Maße der Teppiche sprechen für dieses<br />
Vorgehen.<br />
Zugleich bezeugen die Wandteppiche nicht nur<br />
den Geschmack des Botschafters, sondern markieren<br />
auch die Vorreiterrolle Frankreichs in<br />
Sachen Kultur und Repräsentanz, wie schon der<br />
massive Einsatz von Wandteppichen auf Schloss<br />
Halberg, der Residenz Grandvals als Hoher Kommissar<br />
und späterem Botschafter zeigte. [55]<br />
Nicht anders ging es in der Botschafterresidenz<br />
an der Saar zu. Die eigens für die hohen Wände<br />
der Empfangshalle bestellten Teppiche hatten<br />
nicht nur die schnöde Funktion Schall zu dämmen,<br />
sondern markierten auch die Vorreiterrolle<br />
der französischen Kultur. Denn der Wandteppich<br />
aus Frankreich war stilbildend für alle fürstlichen<br />
Behausungen und betonte damit die Dominanz<br />
des französischen Geschmacks bei der Innenraumgestaltung<br />
im Europa des 18. Jahrhunderts,<br />
erklärt Dora Heinz in ihrer Publikation über<br />
»Europäische Tapisseriekunst des 17. und 18. Jahrhunderts«.<br />
Wandteppiche bezeugten »die tonangebende<br />
Rolle Frankreichs im Bereich höfischer<br />
Kultur und Lebensführung im Zeitalter Ludwig XIV.<br />
Das wurde auf dem Gebiet des kostbaren Wandteppichs,<br />
der seine größte Bedeutung stets in den<br />
Aufgaben der höfischen Repräsentation hatte,<br />
[55] Siehe Anm. 42.
saargeschichte|n 95<br />
besonders deutlich.« [56] Das galt auch noch im<br />
20. Jahrhundert, als der Franzose Jean Lurcat, den<br />
traditionellen Produktionsstätten in Aubusson<br />
zu neuer Bedeutung verhalf. Ob in einer Republik<br />
oder sogar in der NS-Diktatur, der Wandteppich<br />
galt weiterhin als »feudales Repräsentationsmedium«<br />
[57] und war eine Demonstration von<br />
Macht. Auch Gilbert Grandval war sich dieser<br />
Macht bewusst, die von einem die Wände überspannenden<br />
Teppich ausging. Selbst wenn er den<br />
Auftrag gab, um damit Saarbrücken als europäische<br />
Stadt für die Montanunion zu empfehlen,<br />
war darin eine andere Botschaft eingewoben: die<br />
von der Vormacht Frankreichs.<br />
Nach Saarbrücken war die Baden-Badener Ausstellung<br />
der Bildteppiche nicht gekommen. Dafür<br />
zeigte das Saarbrücker Möbelhaus River im Mai<br />
1954 Teppichkunst aus Frankreich. [<strong>58</strong>] François<br />
Arnal kam jedoch erst ein Jahr später mit dem<br />
Saarland in Kontakt. Die von seiner Pariser Galerie<br />
E.G.P. verfasste Ausstellungsliste nennt für das<br />
Jahr 1955: »Tapestry, Neuenkirchen, commissioned<br />
by the French Embassy« [<strong>59</strong>] Dabei handelt es<br />
sich um eine Verbindung zweier Projekte Arnals<br />
im Saarland. Denn Arnal, der bereits 1950 in der<br />
Wuppertaler Galerie Parnass ausgestellt hatte,<br />
hatte im September 1955 eine Ausstellung in der<br />
Villa des Prokuristen des Neunkircher Eisenwerks.<br />
Die Ehefrau des Prokuristen, Ursula Rietschel<br />
lud in der Goethestraße 39 in Neunkirchen seit<br />
Juni 1955 bis in das Jahr 19<strong>59</strong> regelmäßig zu Ausstellungen:<br />
»Nunmehr hat es Frau Ursula Rietschel<br />
übernommen, in ihrer Wohnung, Goethestraße<br />
39, zeitgenössische Werke junger Künstler<br />
einem größeren Kreis von Interessenten zugänglich<br />
zu machen. Wir sehen etwa 40 Gouachen und<br />
Ölbilder der Engländerin Helen Ashbee, geboren<br />
1915 in Camdean.(...) In Deutschland hat sich die<br />
Wuppertaler Galerie »Parnass« des Werkes der<br />
englischen Malerin angenommen. Von Wupper-<br />
[56] Dora Heinz: Europäische Tapisseriekunst des 17. und 18.<br />
Jahrhunderts. Die Geschichte ihrer Produktionsstätten<br />
und ihrer künstlerischen Zielsetzungen. Wien, Köln,<br />
Weimar 1995, S. 247.<br />
[57] Anja Prölß-Kammerer: Die Tapisserie im Nationalsozialismus.<br />
Propaganda, Repräsentation und Produktion.<br />
Facetten eines Kunsthandwerks im »Dritten Reich«.<br />
Hildesheim 2000, S. 27.<br />
[<strong>58</strong>] W. Weber: »Französische Teppich-Webkunst«, Ausstellung<br />
im Möbelhaus River. In: Saarbrücker Zeitung, 7.<br />
Mai 1954, Nr. 105.<br />
[<strong>59</strong>] Internetauftritt der Galerie E.G.P.: http://artegp.com/<br />
dev/wp-content/uploads/2012/11/Arnal-FullBio-EN.pdf<br />
(gelesen am 31. Dezember 2019).<br />
tal aus kamen die Bilder nach Neunkirchen in die<br />
Obhut von Frau Ursula Rietschel.« [60] Die Galeristin<br />
stand in Verbindung zu Parnass und zeigte<br />
Künstler der Galerie in Neunkirchen, so auch<br />
François Arnal, der dort im September 1955 seine<br />
Ölbilder ausstellte. [61]<br />
Es handelt sich daher um zwei unterschiedliche<br />
Projekte im Saarland: Die Ausstellung mit Malerei<br />
in »Neuenkirchen« beziehungsweise Neunkirchen/Saar<br />
und der Auftrag »Tapestry (…)<br />
commissioned by the French Embassy« für die<br />
Wandgestaltung der Französischen Botschaft.<br />
Das Jahr 1954 erweist sich daher als Entstehungsjahr<br />
der beiden Wandteppiche im Foyer des Botschaftsgebäudes<br />
als nicht korrekt. Ein ähnlicher<br />
Fehler ist auch bei der zeitlichen Zuordnung des<br />
Sgraffito von Otto Lackenmacher festzustellen.<br />
Das soll im Jahr 19<strong>58</strong> entstanden sein. [62] Eine Aufnahme<br />
von einer Truppenparade im Ehrenhof der<br />
Botschaft am 13. Februar 1957 zeigt bereits das<br />
fertige Wandbild im Hintergrund. [63]<br />
Die beiden Wandteppiche François Arnals: falsches<br />
Datum, falscher Ort. Ob Neunkirchen oder<br />
Saarbrücken. Das große Frankreich im kleinen<br />
Saarland, da kann es zu Verwechslungen kommen.<br />
Im Grunde war und ist das unerheblich.<br />
Was bleibt, ist ein Restposten der saarländischen<br />
Europaträumereien à la Française: feudal, nicht<br />
demokratisch. Das ist die Botschaft.<br />
[60] W. Weber: Im Dienst der modernen Kunst – Ausstellung<br />
in Neunkirchen« In: Saarbrücker Zeitung, 16. Juni<br />
1955, Nr. 137, S. 7.<br />
[61] Meldung »Aus dem saarländischen Kulturleben« In:<br />
Saarbrücker Zeitung, 28. September 1955, Nr. 225, S. 8:<br />
Ausstellung in Neunkirchen: In Neunkirchen, Goethestraße<br />
39 findet zur Zeit in den Räumen von Ursula<br />
Rietschel eine Ausstellung von Ölbildern von François<br />
Arnal, Paris sowie von Graphiken Willibald Kramms,<br />
Heidelberg statt.<br />
[62] Kunst im öffentlichen Raum. Band 1, a.a.O., S. 225<br />
[63] Paul Burgard: Die Botschaft aus einer anderen Welt,<br />
a.a.O., S. 28. Die Internetseite http://www.oberkirchensaar.com/Kunst-am-Bau<br />
(gelesen am 6. Januar <strong>2020</strong>),<br />
die Leben und Werk Otto Lackenmachers würdigt,<br />
führt das Bilderverkaufsbuch der Ehefrau von Otto Lackenmacher,<br />
Katja Lackenmacher-Sorg auf. Dort sind<br />
der Auftrag, das Honorar und der Beginn der Arbeit dokumentiert.<br />
Als Datum wird »1955-« genannt.
ausstellungen + + + neue publikationen<br />
... Lorenzetti, Perugino, Botticelli ... –<br />
Italienische Meister aus dem Lindenau-Museum Altenburg<br />
Saarbrücken, Saarlandmuseum, Alte Sammlung, Schlossplatz<br />
16. Bis 15. November <strong>2020</strong><br />
Das Saarlandmuseum – Alte Sammlung präsentiert Hauptwerke italienischer<br />
Meister aus dem Lindenau-Museum Altenburg. Diese außergewöhnliche<br />
Sammlung, weltweit eine der größten und bedeutendsten<br />
zur italienischen Malerei des 13. bis 15. Jahrhunderts, wurde von dem Politiker,<br />
Kunstliebhaber und Philanthropen Bernhard von Lindenau im 19.<br />
Jahrhundert in seiner thüringischen Heimatstadt Altenburg zusammengetragen.<br />
Lorenzetti, Perugino, Fra Angelico, Filippo Lippi, Ghirlandaio, Botticelli… –<br />
auf rund 40 große Künstlernamen lässt sich diese Aufzählung erweitern,<br />
die am Saarbrücker Schlossplatz zu sehen ist. Anhand herausragender Beispiele<br />
der Tafelmalerei aus den bedeutenden Kunstzentren Oberitaliens<br />
wie Florenz, Siena und Perugia wird die Entwicklung des Bildes vom späten<br />
Mittelalter zur Renaissance nachgezeichnet.<br />
Tabatieren des 18. Jahrhunderts –<br />
Eine Schenkung aus Privatbesitz<br />
Saarbrücken, Saarlandmuseum, Alte Sammlung, Schlossplatz<br />
16. Bis 31. Dezember <strong>2020</strong><br />
Die Alte Sammlung des Saarlandmuseums hat eine bedeutende Schenkung<br />
erhalten, die nicht weniger als 16 Tabatieren – kostbare Tabaksdosen<br />
– umfasst, allesamt Stücke von höchster Qualität, größter handwerklicher<br />
Präzision. Die meisten der kleinen Tabakdosen aus Gold, Silber und Email<br />
wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Paris gefertigt. Sie<br />
sind mit geometrischen Mustern, vegetabilen Dekorationen und Miniaturen<br />
(Porträts, mythologische Szenen, Landschaften) geschmückt. Mit dieser<br />
Schenkung werden die kulturgeschichtlichen Bestände des Hauses<br />
entschieden gestärkt. Zu verdanken ist dies der Großzügigkeit der in Völklingen<br />
geborenen Mäzenin Ibeth Biermann, Frankfurt a. M.<br />
Tabatieren kamen im Verlauf des 18. Jahrhunderts in Mode, als das Schnupfen<br />
die vornehmste Weise des Tabakkonsums war. Wenngleich Tabatieren<br />
auch in bürgerlichen Kreisen verwendet wurden, waren sie doch besonders<br />
wichtig für den Adel: sowohl als materieller Ausdruck von Kultiviertheit<br />
und Exklusivität, als auch als Sammelobjekte. So eigneten sie sich vorzüglich,<br />
um Hierarchien und Abhängigkeiten bei Hofe deutlich zu machen.<br />
Auch kamen die Döschen als subtile Instrumente von Diplomatie und Politik<br />
zum Einsatz.<br />
Die 20er Jahre – Leben zwischen Tradition und<br />
Moderne im internationalen Saargebiet<br />
Saarbrücken, Historisches Museum Saar, Schlossplatz 15<br />
Bis 30. August <strong>2020</strong><br />
Die Zwanzigerjahre verbindet man mit Bubikopf, Charleston und Art déco.<br />
Mit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrages im Januar 1920 schlug die<br />
Geburtsstunde des Saarlands. Die Ausstellung »Die 20er Jahre« beleuchtet<br />
die Anfangsjahre des Saarlandes und erweitert den Blick bis zum Anschluss<br />
des Saargebietes an das Deutsche Reich. Neben der gut erforschten politischen<br />
Geschichte rund um die Besatzungszeit, die französische Grubenverwaltung<br />
und den Abstimmungskampf widmet sich ein großer Teil der<br />
Ausstellung erstmals dem alltäglichen Leben im Saargebiet.<br />
Im Fokus der Ausstellung stehen Themen wie zunehmende Mobilität und<br />
Elektrifizierung, die neuen Freizeitmöglichkeiten wie das Kino, die Mode<br />
sowie die Frage nach Realität und Mythos der »Neuen Frau«. Aber auch<br />
soziale Probleme wie Armut und Arbeitslosigkeit werden thematisiert.<br />
Unter den Ausstellungsstücken befinden sich Leihgaben aus dem UN-<br />
Archiv in Genf sowie Motorräder, Charleston-Kleider und elektronische<br />
Haushaltsgeräte, die den Besuchern das Lebensgefühl vermitteln. Lebendig<br />
werden die 20er Jahre außerdem durch den umfangreichen Medieneinsatz<br />
und interaktive Stationen. Die Inszenierung ahmt eine Straßenszene<br />
mit simuliertem Tag-Nacht-Wechsel nach.<br />
60 Jahre Deutsch-Französischer Garten.<br />
Eine historische Bilderschau<br />
Saarbrücken, Stadtarchiv, Deutschherrnstraße 1<br />
Bis 15. September <strong>2020</strong><br />
Er gilt als Symbol der deutsch-französischen Freundschaft und der Völkerverständigung<br />
und er ist einer der größten und beliebtesten Parks der<br />
Region: der Deutsch-Französische Garten in Saarbrücken. Vor 60 Jahren,<br />
am 23. April 1960, wurde er offiziell eingeweiht und entwickelte sich<br />
zu einem attraktiven Ausflugsziel, für Deutsche und Franzosen gleichermaßen,<br />
nicht nur sonntags. Die Ausstellung nimmt Sie mit auf einen fotografischen<br />
Spaziergang durch die Geschichte der einstigen Gartenschau,<br />
von ihren Anfängen bis in die Gegenwart, weckt Erinnerungen und zeigt<br />
Wandel und Beständigkeit eines Gartens unmittelbar an der deutsch-französischen<br />
Grenze.<br />
Was bin ich? Berufe in Porzellan<br />
Saarlouis, Ludwig Galerie, Alte Brauerei-Straße, Kaserne VI.<br />
Verlängert bis 9. August <strong>2020</strong><br />
In der Ausstellung »Was bin ich?« steht die Festtafel als Ganzes im Mittelpunkt.<br />
Für die Tischdekoration ihrer Festtafeln gab die Aristokratie im 18.<br />
Jahrhundert ein Vermögen aus. Der gedeckte Tisch war einer der Höhepunkte<br />
luxuriöser Prachtentfaltung. Mit Porzellanfiguren holte man sich<br />
ganze Miniaturwelten auf die Desserttafel, beispielsweise Exotengruppen,<br />
Jagdszenen oder Allegorien. Zu den beliebtesten Themenwelten gehörte<br />
jedoch das Leben der einfachen Menschen. Ein besonderer Fokus liegt auf<br />
der Arbeitswelt des 18. Jahrhunderts mit Berufen, die längst der Vergangenheit<br />
angehören wie den Bänkelsänger, den Frettchenhändler oder die<br />
Galanteriewarenkrämerin. In einer Region, die über Jahrhundert von Bergbau<br />
und Hüttenwesen geprägt war, ist es wesentlich, die Veränderungen<br />
der Arbeitswelt – ausgehend von den Porzellanfiguren – zu thematisieren.<br />
Heute gilt es uns!<br />
Zweibrücken, Stadtmuseum, Herzogstraße 9–11<br />
Verlängert bis auf Weiteres<br />
Der verheerende Bombenangriff vom 14. März 1945 ließ das historische<br />
Stadtzentrum Zweibrückens zu 82 Prozent in Trümmern zurück. Kurz nach<br />
acht Uhr abends warf die kanadische Luftwaffe (RCAF) in 12 Minuten ca.<br />
800 Tonnen Sprengbomben auf die Altstadt ab. Zielpunkt war der Schlossplatz,<br />
keine wichtigen Verkehrswege oder Industrieanlagen. Trotz der Evakuierung<br />
im Spätjahr 1944 erlebten noch ca. 3.000 Menschen das Inferno<br />
in der Stadt. Dank eines großen Luftschutzkellers im Himmelsberg waren<br />
mit ca. 95 Toten weniger Menschenopfer zu beklagen als bei vergleichbaren<br />
Bombardierungen. Fassungslos stand die Bevölkerung vor den Ruinen,<br />
als sie die Bunker und Keller verließ. So hatte sie fünf Jahre zuvor die<br />
Worte von Gauleiter Josef Bürckel nicht verstanden, der versprochen hatte,<br />
»die Heimat werde nach dem Krieg noch schöner, als sie vorher war«.<br />
Die Sonderausstellung zum 75. Jahrestag der Zerstörung der alten Herzogsstadt<br />
befasst sich nicht nur mit der Zerstörung, dem Leben in der Trümmerzeit<br />
sowie der Wiederaufbauleistung der 1950er und 1960er Jahre. Es ist an<br />
der Zeit auch nach den Ursachen für die Bombardierung zu fragen und sie<br />
in den Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus zu stellen. Im Fokus<br />
steht auch die Vorgeschichte, ohne die die Bombardierung nicht gesehen<br />
werden darf: der Siegeszug der Nationalsozialisten in einer Region, die von<br />
den Folgen des Ersten Weltkrieges besonders betroffen war, sowie die Aufrüstungs-<br />
und Kriegspolitik des NS-Regimes.<br />
Variations – Ein Museum für alle<br />
Luxemburg, Villa Vauban, 18, avenue Émile Reuter<br />
Bis 17. Januar 2021<br />
Unter dem Titel »Variations« wird mit ca. 70 Gemälden, Skulpturen, Grafiken<br />
und Zeichnungen, vom 17. bis zum 21. Jahrhundert, eine farbenfrohe Auswahl<br />
aus den Sammlungen des Hauses gezeigt. Unter den ausgestellten<br />
Werken stechen mehrere Neuerwerbungen sowie eine Schenkung der
saargeschichte|n 97<br />
Amis des Musées Luxembourg hervor: zwei monochrome Portraits des<br />
Antwerpener Malers Abraham van Diepenbeeck aus dem 17. Jahrhundert.<br />
Die Ausstellung widmet sich verschiedenen spannenden Fragen rund um<br />
die Kunstgeschichte und künstlerische Techniken: Wie wurden Stiche oder<br />
Grisaillen nach einem Gemälde angefertigt? Wie kann man Fälschungen<br />
klassischer Kunstwerke erkennen? Warum und wie fertigten die Künstler<br />
Skizzen oder Zeichnungen an, ehe sie ihre Bilder malten? Parallel dazu<br />
erwarten den Besucher mehrere thematische Ensembles: u.a. bürgerliche<br />
Portraits des 19. Jahrhunderts von Karl von Pidoll und Jean-Baptiste Fresez,<br />
Landschaften und Seestücke (u.a. Canaletto, Dagnan, Calame) sowie ein<br />
»Kindermuseum« mit den Familienportraits des Impressionisten Corneille<br />
Lentz (1879–1937).<br />
Folklore<br />
Metz, Centre Pompidou, 1, parvis des Droits-de-l‘Homme<br />
Bis 21. September <strong>2020</strong><br />
Von den Anfängen der modernen Kunst bis zur Gegenwartskunst zeigt<br />
diese Ausstellung, die vom Centre Pompidou-Metz in Zusammenarbeit<br />
mit dem Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)<br />
konzipiert wurde, die manchmal ambivalenten Beziehungen auf, die<br />
Künstler zur Folklore unterhalten, und von der formalen Entlehnung bis<br />
zur Nachahmung einer Methode, von der Faszination bis zur kritischen<br />
Ironie reichen. Die Ausstellung Folklore, die sich im Wesentlichen auf eine<br />
europäische Definition und Geschichte dieses Begriffs konzentriert, bietet<br />
auch eine Begegnung von Kunstgeschichte und Geschichte der Geisteswissenschaften,<br />
da sie parallel dazu – insbesondere dank der Bestände des<br />
Mucem, Erbin des Musée National des Arts et Traditions Populaires – die<br />
Erfindung und allmähliche Institutionalisierung einer Disziplin offenbart.<br />
Der Himmel als Atelier.<br />
Yves Klein und seine Zeitgenossen<br />
Metz, Centre Pompidou, 1, parvis des Droits-de-l‘Homme<br />
Bis 2. November <strong>2020</strong><br />
Yves Klein, einem der Hauptakteure der europäischen Nachkriegskunst,<br />
widmet das Centre Pompidou-Metz eine umfangreiche Ausstellung.<br />
Bekannt ist Yves Klein für seine blauen monochromen Bildkompositionen,<br />
in Kontakt stand er mit zahlreichen europäischen Künstlern, Mitgliedern der<br />
Gruppe NUL in den Niederlanden sowie mit der Gruppe ZERO in Deutschland.<br />
Besucher können Yves Klein ab April <strong>2020</strong> in einem internationalen<br />
Kontext neu bzw. wiederentdecken. Die Werke dieser Künstlergeneration,<br />
die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von einem Elan an Freiheit<br />
ergriffen wurde, richten ihren Blick auf Raum und Weite und bieten eine<br />
Annäherung an Kunst und Universum, die sich von jeglicher Materialität<br />
distanziert. Yves Klein steht in engem Austausch mit ZERO, um während<br />
Ausstellungen Farbe, Licht und Vibration zu erkunden. Durch die Verwendung<br />
der natürlichen Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft versuchen<br />
Otto Piene, Heinz Mack und Günther Uecker eine Leere zu erzeugen.<br />
Mit seinem Freund Lucio Fontana erkundet Yves Klein den Spatialismus,<br />
eine Kunstbewegung, die eine Zeit- und Raumeinheit abbildet, wie sie<br />
aus der Interaktion mit dem Beobachter entsteht. Angeregt durch die<br />
Eroberung des Weltraums eignen sich diese Künstler den Himmel durch<br />
ihre Darstellungen des Kosmos sowie durch die Schaffung von Luftskulpturen<br />
an. So entwickelt Yves Klein 19<strong>58</strong> bis 1961 eine »Architecture de<br />
l‘air« (»Luftarchitektur«), für die Himmel, Grenzenlosigkeit, Unendlichkeit<br />
und Immaterialität zu seinem Atelier werden. Die Ausstellung zeigt zeitgenössische<br />
Werke, ergreift aber auch die Gelegenheit, ältere, nur wenig<br />
bekannte Performances zu präsentieren. Präsentiert werden daneben<br />
Werke von Bernard Aubertin, Lucio Fontana, Oskar Holweck, Eikoh Hosoe,<br />
Fumio Kamei, Piero Manzoni, Otto Piene, Jean Tinguely, Günther Uecker, Jef<br />
Verheyen und vielen anderen.<br />
Lokale Geschichte<br />
Backes, Dirk: Der Hauptfriedhof Scheib (Neunkirchen 2019), 140 Seiten,<br />
Reihe: Als alles noch in Sütterlin geschrieben wurde, Bd. 14.<br />
Bergholz, Thomas: Die Ludwigskirche zu Alt-Saarbrücken. (Saarbrücken<br />
2019), Kunstführer, hg. von der ev. Kirchengemeinde Alt-Saarbrücken, 34<br />
Seiten, illustriert.<br />
Echt, Rudolf: Von der Steinzeit bis zur Gegenwart – Nachforschungen zur<br />
Wallerfanger Geschichte. Festschrift Theodor Liebertz zu Ehren, (Verein für<br />
Heimatforschung Wallerfangen 2019), 265 Seiten, illustriert.<br />
Fontaine, Arthur: Das große Nordfenster in St. Peter Merzig im Wandel<br />
der Zeit: Zur Bau- und Ausstattungsgeschichte der Kirche, (Norderstedt<br />
<strong>2020</strong>), 45 Seiten, illustriert, ISBN 978-3-7528-9629-9.<br />
Jacobs, Ulrike und Manfred; Gundelwein, Tom (Fotos): Saarbrücken<br />
und sein barockes Erbe, (Saarbrücken <strong>2020</strong>), 192 Seiten, reich illustriert,<br />
ISBN 978-3-946036-02-9.<br />
Philippi, Nikolaus: Grenzsteine rund um die Gemeinde Saarwellingen,<br />
(Saarwellingen 2019), 75 Seiten, illustriert, Karten, Reihe: Veröffentlichung<br />
des Gemeindearchivs Saarwellingen, Bd. 3.<br />
Schönberger, Christiane: Mauern und Gräben von Wallerfangen –<br />
Hauptort der deutschen Ballei des Herzogtums Lothringen, (Tholey 2019),<br />
<strong>58</strong> Seiten, illustriert, Reihe: Archäologische Funde im Saarland, Bd. 3, ISBN<br />
978-3-946313-16-8.<br />
Stein, Jakob: Mein Onkel. Der Maler, Zeichner und Objektkünstler Willi<br />
Spiess, (Frankfurt 2019), 72 Seiten, illustriert, ISBN 978-3-9437<strong>58</strong>-66-5.<br />
Saarland allgemein<br />
Burgard, Paul; Linsmayer, Ludwig: Eisenzeit in SaarLorLux: Röchling,<br />
ARBED, Saarstahl (1960-1990), (Saarbrücken 2019), 413 Seiten, illustriert,<br />
Reihe: Echolot, Bd. 15 Landesarchiv Saarbrücken, ISBN 978-3-945087-04-6.<br />
Bussmann, Frédéric; Mönig, Roland (Hg.): ... Lorenzetti, Perugino, Botticelli<br />
...: italienische Meister aus dem Lindenau-Museum Altenburg, (Saarbrücken<br />
<strong>2020</strong>), 128 Seiten, ISBN 978-3-947554-01-0.<br />
Dölemeyer, Barbara; Jung, Heike: Die Napoleonische Gesetzgebung<br />
im politischen Widerstreit in Bern und Hessen. Kleine Schriftenreihe der<br />
Siebenpfeiffer-Stiftung Nr. 18 (Homburg <strong>2020</strong>), ISBN 978-3-9814460-6-7.<br />
Enzweiler, Jo (Hg.): Landkreis Merzig-Wadern 1945-2012: Aufsätze und<br />
Bestandsaufnahme: Gemeinde Beckingen, Gemeinde Losheim am See,<br />
Kreisstadt Merzig, Gemeinde Mettlach, Gemeinde Perl, Stadt Wadern,<br />
Gemeinde Weiskirchen, (Saarbrücken 2019), 413 Seiten, illustriert, Reihe:<br />
Kunst im öffentlichen Raum – Saarland, Bd. 5, ISBN 978-3-9819664-0-4.<br />
Mönig, Roland (Hg.): Tabatieren des 18. Jahrhunderts: eine Schenkung<br />
aus Privatbesitz. (Saarbrücken <strong>2020</strong>), 87 S., illustr., ISBN 978-3-947554-02-7.<br />
Neumann, Andreas Phelan: Brauereikultur im Saarland. Becker, Donnerbrauerei,<br />
Schloss &Co, (Luxemburg 2019), 472 Seiten, illustriert, ISBN 978-1-<br />
08-272667-5.<br />
Sander, Eckart: Saarland: die schönsten Schlösser und Burgen, (Gudensberg-Gleichen<br />
2019), 87 Seiten, illustriert, 978-3-8313-3244-1.<br />
Schäfer, Franz-Josef: Einmal Theresienstadt und zurück: Familie Lansch<br />
wehrt sich gegen die Nazis, (St. Ingbert 2019), 167 Seiten, illustriert, Reihe:<br />
Röhrig Lebensbilder Bd. 4, ISBN 978-3-86110-746-0.<br />
Über die Grenze<br />
Hildisch, Volker: Als Rotkäppchen Frankreich verlassen musste: Champagner<br />
und Sekt – eine deutsch-französische Geschichte, (Saarbrücken 2019),<br />
142 Seiten, illustriert, ISBN 978-3-9818850-3-3.<br />
Höfchen, Heinz (Hg.): All the Best: 100 Jahre Graphische Sammlung im<br />
Museum Pfalzgalerie. (Kaiserslautern 2019), 190 Seiten, illustriert, ISBN<br />
978-3-89422-226-0.<br />
Loew, Benedikt; Reyter, Isabelle; Touveron, Bruno: Versailles 1919:<br />
Moselle et Sarre, Moselle und Saargebiet, (Thionville 2019), 120 Seiten, illustriert,<br />
Karten, Französisch / Deutsch, Konferenzschrift.
ach du liebe zeit … (PB 40/41)<br />
Dieses <strong>2020</strong>ste Jahr der christlichen Zeitrechnung ist in die<br />
Geschichte eingegangen, bevor es überhaupt seinen Zenit<br />
erreicht hat. Schon seit längerem war abzusehen, dass eine<br />
völlig neuartige Krankheit auf die Menschheit zurollte, die<br />
die Weltgemeinschaft in nie dagewesener Form herausfordern<br />
musste. In viraler Geschwindigkeit nahm sie die<br />
Erde in Besitz, hochansteckend und vor allem die Teile der<br />
Gesellschaft niederwerfend, die das Leben auf unserem Planeten<br />
extrem aktiv gestalten. FOMO nannten die Experten<br />
aus Epidemiologie und Psychopathologie das neuartige<br />
Virus, eine Abkürzung des englischen fear of missing out,<br />
auf gut Deutsch: die Angst, irgendetwas zu verpassen.<br />
In der globaldigital beschleunigten Welt des 21. Jahrhunderts<br />
hatte FOMO beängstigende Ausmaße angenommen. Waren<br />
es zunächst nur einzelne Hipster oder Influencer, die fürchteten,<br />
wichtige Dinge und Trends zu verpassen, so befiel das<br />
Virus sehr bald alle halbwegs aktive Menschen zwischen 5<br />
und 55, und es betraf alle nur denkbaren Dinge und Situationen.<br />
Vulkanausbruch, Kreuzfahrt, Grillparty, Netflix-Serie,<br />
der letzte Tweet von Trump und das allerletzte Youtube-<br />
Video von Heidi Klum, eine ranzige Frikadelle oder die öde<br />
Glosse in den saargeschichte|n: Nichts und niemand durfte<br />
mehr verpasst werden, wenn man und frau noch einigermaßen<br />
sinnvoll durchs Leben gehen wollten. Da es nun<br />
aber schlichtweg unmöglich ist, dass alle alles überall und<br />
jederzeit miterleben, waren die Folgen der pandemischen<br />
Verbreitung von FOMO absehbar. Extremste Psychosen und<br />
Depressionen machten sich breit, kollektive Suizidwellen<br />
schwappten über den Globus, Paralysen und Dystopien<br />
gewannen Kontur. Es stand nichts weniger auf dem Spiel<br />
als die Zukunft der Menschheit.<br />
In dieser existenziellen Krise des homo sapiens hatten die<br />
Götter Ende des Jahres 2019 endlich ein Einsehen. Sie beauftragten<br />
ihre Stellvertreter auf Erden – als da wären: der<br />
Papst, Bill Gates, der chinesische Volkskongress und Angela<br />
Merkel –, eine Strategie zu suchen, mit der sich FOMO<br />
überlisten ließ. Die Lösung, die die glorreichen Vier fanden,<br />
war ebenso genial wie einfach; neben ihr erschien die List<br />
des Odysseus wie ein biederes Schaukelpferdchen neben<br />
Pegasus. Der Trick bestand darin, ein Virus zu kreieren, das<br />
noch viel gefährlicher und ansteckender zu sein schien<br />
als FOMO. Ein Virus, das nur dadurch zu stoppen war, dass<br />
man die gesamte Welt zum vollkommenen Stillstand verdonnerte.<br />
Die medizinnobelpreisverdächtige Idee dahinter:<br />
Wenn überall auf der Erde zu jeder Zeit stets das gleiche<br />
passiert – nämlich absolut gar nix –, dann kann auch niemand<br />
mehr irgendwo irgendetwas verpassen. Das mit göttlicher<br />
Inspiration erfundene Virus musste nur noch einen<br />
seiner Bedeutung gemäßen Namen erhalten. Wie konnte<br />
der anders lauten als Corona: die Krönung aller Viren.<br />
Die Erfindung von Corona war das eine, die Implementierung<br />
der Phantasiegeburt in der Gesellschaft das andere,<br />
noch ungleich schwierigere Problem. Der Aufwand, der<br />
dafür betrieben wurde, war gewaltig, wie das bundesdeutsche<br />
Beispiel prototypisch zeigt. Erst erhöhte man die<br />
Schlagzahlen der Schlagzeilen, die das noch nach Monaten<br />
»neuartige« Virus kommunizierten, bis aus den Nachrichten<br />
Coronachrichten geworden waren. Dann ließ man<br />
den virtuellen Erreger auf den uns Deutschen besonders<br />
vertrauten Reiserouten von Fernost über Italien und Österreich<br />
immer näher an die Bundesgrenzen rücken, um die<br />
noch aus Migrationszeiten virulenten Bedrohungsvorstellungen<br />
bis zur unerträglichen Spannung zu steigern.<br />
Schließlich revitalisierte man Cary Grant und Heinz Rühmann,<br />
die fortan tagtäglich aufs glaubwürdigste Dr. Drosten<br />
und Mr. Wieler mimten, ein populärwissenschaftliches<br />
Erfolgsduo, das das gesunde Gewissen aller Deutschen<br />
ebenso einzunehmen verstand wie einst Simon and Garfunkel<br />
die Herzen der 68er.<br />
Fast wäre das grandiose Experiment zur Überwindung<br />
der weltweiten FOMO-Krise von totalem Erfolg gekrönt<br />
gewesen, fast wären alle Menschen bereit gewesen, sich<br />
jeder Lockerungsverlockung zum Trotz freiwillig einen ewigwährenden<br />
Lockdown zu verordnen. Dummerweise zeigte<br />
sich aber, dass ausgerechnet diejenigen, die den Kampf<br />
gegen das gefährliche Virus lenken sollten, selbst die größten<br />
Fomoisten waren. Gesundheitsjens zum Beispiel verpasste<br />
zwar das rechtzeitige Verschließen von Fußball- und<br />
Karnevalshochburgen sowie ordentlich viele Fettnäpfchen,<br />
dafür aber keine Ansprache und keine Pressekonferenz.<br />
Armin, das rein westfälische Cheruskerchen, verpasste sich<br />
zunächst das shakespearianische Outfit eines Leben-und-<br />
Tod-Dramaturgen, um kurz darauf ins Gewand des Schiller‘-<br />
schen Freiheitshelden zu schlüpfen und das von ihm selbst<br />
errichtete Schreckensregiment zu bekämpfen. Auch Tobi,<br />
unser noch jugendlich strahlender Saar-König, präsentierte<br />
sich als Großmeister coronöser Kommunikation, verpasste<br />
keinen sehr persönlich gestalteten Social-Media-Auftritt<br />
und kaum eine Talkshow bei Anne und Maybritt. Bereits<br />
zu Beginn der Krise hatte er einen Super-Scoop gelandet,<br />
indem er als weltweit erster Politiker plakativ das Aussehen<br />
eines Coronavirus demonstrieren konnte, das – wie es sich<br />
in solchen Katastrophen schon oft bewährt hatte – die<br />
Größe des Saarlands zeigte.<br />
Nach so viel politischer Briilanz wundert’s niemanden, dass<br />
auf- und rechte Bürger, die verschwörungstheoretisch eben-
saargeschichte|n 99<br />
so versiert sind wie alternativfaktenmedizinisch, damit<br />
begonnen haben, die wahren Hintergründe des Fomocoronakomplotts<br />
zu recherchieren und offenzulegen. Was dabei<br />
jetzt ans Tageslicht kam, muss jeden vernünftigen Menschen<br />
tief beunruhigen. So ist zum Beispiel bereits seit Jahren<br />
unser kollektives Immunsystem absichtlich geschwächt<br />
worden, vor allem durch die Impfkampagnen von Bill Gates,<br />
der seine Kompetenz zur flächendeckenden Gesundheitssubversion<br />
zuvor an der Fertilität afrikanischen Frauen<br />
getestet hatte. Die mittlerweile hinlänglich bekannten<br />
Corona-Hotspots zwischen Norditalien, Nordrhein-Westfalen<br />
und Nordamerika sind nicht etwa auf unzählige Viren,<br />
sondern auf intensive 5-G-Bestrahlung zurückzuführen, die<br />
die Chinesen in Kooperation mit der Telekom lanciert haben.<br />
Da allen aufgeklärten Bürgern, die trotz staatsvirologischer<br />
Blendungsversuche ihre Augen stets offenhielten, noch nirgends<br />
ein einziges Coronavirus in freier Wildbahn begegnet<br />
ist, liegt die Vermutung nahe, dass es Corona gar nicht gibt<br />
(womit die Aufklärer der auf diesen Seiten entlarvten ganzen<br />
Wahrheit beängstigend nahekommen). Der Lockdown ist in<br />
Wirklichkeit nichts anderes als der durch einen angeblichen<br />
Notstand legitimierte Versuch, unsere Grund- und Freiheitsrechte<br />
schrittweise zu liquidieren. Damit das System (in<br />
längst vergangenen linken Zeiten noch als Schweinesystem<br />
bekannt), das geheime Kartell aus Politikern, Wirtschaftsbossen<br />
und IT-Moguln, unter der Anleitung von Angela Merkel<br />
und Papst Franziskus seine Macht endlos steigern und<br />
uns bis zum Jüngsten Tag lückenlos kontrollieren kann.<br />
Wenn Sie, liebe Leser_innen, nun etwa glauben, dass die<br />
unglaublichen Enthüllungen auf den noch immer fortwährenden<br />
Demonstrationen unserer neuen Demokratiebewegung<br />
in verschrobenen Hirnen entstanden seien oder<br />
aus sehr fadenscheinigen Gründen nur als Alternativen aus<br />
und für Deutschland formuliert wurden, dann muss ich<br />
Ihnen sagen: Weit gefehlt! Wie ein Rückblick auf die vergangenen<br />
500 Jahre zeigt, haben diese mutigen Damen<br />
und Herren nur das gemacht, was wir eigentlich alle tun<br />
sollten. Sie haben aus der Geschichte gelernt.<br />
In Mittelalter und Früher Neuzeit hieß Corona noch Pest,<br />
und auch das war natürlich nur eine Erfindung des klerikofeudalen<br />
Schweinesystems, um renitente Leibeigene und<br />
aufmüpfige Bürgersleut unter der Knute aristokratischer<br />
Allmacht zu halten. Die 5-G-Strahlen kamen damals, wie<br />
überlieferte Pestbilder zeigen, in Form von vergifteten Pfeilen<br />
auf die Erde, die ein Erzengel als Exekutor des göttlichen<br />
Strafgerichts von einer Wolke (aus einer Cloud!!!) auf die<br />
Menschen schoss. Statt einen Schulmediziner aufzusuchen<br />
oder sich vom verseuchten Acker zu machen (das durften<br />
nämlich nur die reichen Systemleute), empfahl die Saarbrücker<br />
Pestordnung von 1574 vor allem reumütiges Beten<br />
und Büßen aller kleinen Sünderlein in möglichst vollen Kirchen,<br />
in denen Feuer aus gigantischen und wohlriechenden<br />
Räucherstäbchen für gute Luft sorgten. Noch besser klingen<br />
die zahllosen Rezepte aus einem Pestbuch, das der Leibmedicus<br />
des Saarbrücker Grafen Philipp 1553 verfasst hatte.<br />
So empfahl er zum Beispiel sehr erfolgreich diverse Preservativa<br />
(nein, es ging noch keineswegs um Aids), die jeder<br />
Bewohner des Saarbrücker Schlosses beim allmorgendlichen<br />
Verlassen desselben am Tor verabreicht bekam, um<br />
der Pest in den stinkenden Niederungen der Stadt trotzen<br />
zu können. In solchen Preservativa befanden sich in der<br />
Regel Blüten, Wurzeln und Gewürze nebst diversen Pulvern,<br />
die bisweilen aus den Knochen eines Einhorns gewonnen<br />
waren, das »zwischen zwei Frauentagen« gefangen worden<br />
sein musste. Kein Wunder, dass das so gut funktionierte.<br />
Kein Wunder dass so viel Expertise noch heute jeden alternativmedizinischen<br />
Guru vor Neid erblassen lässt.<br />
Die schönsten Lehren für die coronöse Gegenwart sind<br />
fraglos aus dem 17. und 18. Jahrhundert überliefert. Just<br />
damals, als sich die Pest langsam aus der westlichen Welt<br />
verabschiedete, wuchs die Skepsis an den staatlichen Pestvorkehrungen<br />
ins Unermessliche. So formulierte ein englischer<br />
(!) Zeitgenosse namens John (! leider ohne son) seine<br />
Bedenken an den Quarantänevorschriften dahingehend,<br />
dass Luftveränderungen eine viel wichtigere Infektionsursache<br />
darstelle als die Ansteckung von Mensch zu<br />
Mensch. Die Abriegelung der verpesteten Stadt Königsberg<br />
musste abgebrochen werden, nachdem maßgebliche<br />
Preußen versichert hatten, die kollektive Quarantäne bringe<br />
mehr Menschen um als die Epidemie selbst. Und als 1720<br />
eine der letzten großen Pestwellen in Marseille wütete,<br />
publizierte ein königlicher Arzt seine eindeutige Erkenntnis,<br />
dass die Krankheit nicht ansteckend sei. Dass aber die<br />
mittels Quarantäne »der Freiheit zugefügte Gewalt« sowie<br />
die damit einhergehenden »Beleidigungen der Rechte der<br />
Menschen« durch eine »offenkundige Vorspiegelung falscher<br />
Tatsachen« zustande gekommen seien.<br />
Liebe Götter und Göttinnen! Falls ihr manchmal meint, ihr<br />
hättet auf uns Menschen nicht immer genug aufgepasst,<br />
falls ihr glaubt, zu oft weggeschaut und euch zu wenig für<br />
unser Schicksal interessiert zu haben, falls ihr vielleicht<br />
sogar befürchtet, im Laufe eines jahrtausendlangen Tiefschlafs<br />
wichtige Dinge in der Entwicklung der Menschheit<br />
verpasst zu haben, dann kann ich euch heute versichern: Ihr<br />
habt absolut nix verpasst! Also kein Grund zur Panik! Nie<br />
wieder Angst vor FOMO!
saargeschichte|n bildet …<br />
Wussten Sie übrigens, dass die<br />
Saarländische Regierung schon vor<br />
Jahrzehnten vorbildliches Verhalten<br />
bei der Bekämpfung von Epidemien<br />
demonstrierte? Beim Empfang der<br />
französischen Staatsgäste zeigte man<br />
1952, wie die Übertragung gefährlicher<br />
Viren vermieden wird:<br />
vorbeugende Haltung, gebührende<br />
Distanz, angedeuteter Händedruck<br />
(gegebenenfalls mit vorgestreckter<br />
Handatrappe) und auf keinen Fall<br />
den zu Begrüßenden anschauen!<br />
Die Barockresidenz Saarbrücken<br />
Von Thomas Martin<br />
Ein Rundgang auf den fürstlichen Spuren des<br />
18. Jahrhunderts<br />
Thomas Martin hat in seinem kompakten<br />
Begleiter die wichtigsten Spuren der Barockzeit<br />
in Saarbrücken zu einem Spaziergang<br />
zusammengefasst.<br />
Erhältlich im Buchhandel, bei Amazon oder<br />
bei www.edition-schaumberg.de
saargeschichte|n<br />
magazin zur regionalen kultur und geschichte<br />
Wenn Sie die Zeitschrift abonnieren, ein Jahresabo verschenken oder eine <strong>Ausgabe</strong> nachbestellen möchten,<br />
nutzen Sie dieses Formular, kopieren Sie es und schicken es per Post an:<br />
edition schaumberg, »saargeschichte|n«, Brunnenstraße 15, 66646 Marpingen.<br />
Oder E-Mail: info@edition-schaumberg.de.<br />
Sie können die Zeitschrift auch direkt auf unserer website abonnieren: www.edition-schaumberg.de<br />
1. Die »saargeschichte|n« im Abonnement<br />
• Fundierte Informationen zur<br />
regionalen Geschichte, Archäologie,<br />
Architektur, Kunst, zum<br />
Denkmalschutz oder zur Alltagskultur<br />
aus erster Hand.<br />
• Viermal jährlich Zustellung der<br />
Zeitschrift nach Hause.<br />
• Zahlung einmal jährlich gegen<br />
Rechnung (22,– EUR).<br />
• Kündigung des Abos jederzeit<br />
möglich (Anruf oder E-Mail genügen).<br />
Dieses Feld immer komplett ausfüllen!<br />
Name, Vorname<br />
Straße, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon oder E-Mail<br />
Datum, Unterschrift<br />
2. Die »saargeschichte|n« als Geschenkabo für ein Jahr<br />
• Die Zeitschrift wird für ein Jahr<br />
(= 4 <strong>Ausgabe</strong>n) an die von Ihnen<br />
ausgewählte Person geschickt.<br />
Bitte geben Sie dazu die Adresse<br />
der von Ihnen beschenkten Person<br />
im rechten Feld an.<br />
• Das Abo endet ohne Kündigung<br />
automatisch nach einem Jahr.<br />
• Sie zahlen nach Erhalt der Rechnung<br />
einmalig den Betrag von<br />
22,00 EUR.<br />
• Das Geschenkabo lässt sich<br />
jederzeit formlos in ein normales<br />
Abo umwandeln.<br />
Dieses Feld nur ausfüllen, wenn Sie jemanden ein Geschenkabo zukommen lassen!<br />
Name, Vorname des Beschenkten<br />
Straße, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Abo soll beginnen ab <strong>Ausgabe</strong><br />
Datum, Ihre Unterschrift<br />
3. Bestellservice für zurückliegende <strong>Ausgabe</strong>n (nur solange Vorrat reicht)<br />
• Wir bieten einen Nachbestellservice<br />
für zurückliegende <strong>Ausgabe</strong>n<br />
an. Kreuzen Sie dazu einfach<br />
Ihre Wunschexemplare an.<br />
Beachten Sie dabei, dass etliche<br />
Hefte bereits komplett vergriffen<br />
sind und auch nicht mehr nachgedruckt<br />
werden (geschwärzte<br />
Felder). Die grauen Felder weisen<br />
darauf hin, dass nur noch wenige<br />
Exemplare verfügbar sind. Sie finden<br />
nähere Informationen dazu<br />
auf unserer website:<br />
www.edition-schaumberg.de<br />
Dieses Feld ausfüllen, falls Sie zurückliegende <strong>Ausgabe</strong>n bestellen möchten!<br />
1-05<br />
4-08<br />
3-11<br />
3-14<br />
1-06<br />
1-09<br />
4-11<br />
4-14<br />
2-06<br />
2-09<br />
1-12<br />
1-15<br />
3-06<br />
3-09<br />
2-12<br />
2-15<br />
4-06<br />
4-09<br />
3-12<br />
3-15<br />
1-07<br />
1-05<br />
4-12<br />
4-15<br />
2-07<br />
1-10<br />
1-13<br />
1-16<br />
3-07<br />
2-10<br />
2-13<br />
2-16<br />
4-07<br />
3-10<br />
3-13<br />
3-16<br />
1-08<br />
4-10<br />
4-13<br />
4-16<br />
2-08<br />
1-11<br />
1-14<br />
1-17<br />
3-08<br />
2-11<br />
2-14<br />
2-17<br />
3-17<br />
4-17<br />
1-18<br />
2-18<br />
3-18<br />
4-18<br />
1-19<br />
2-19<br />
3-19<br />
4-19