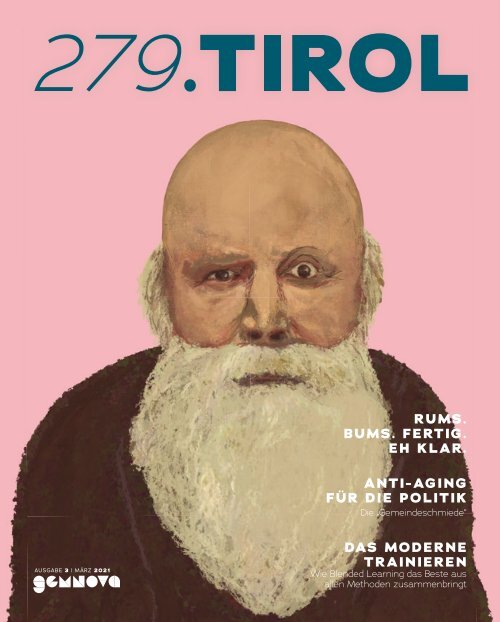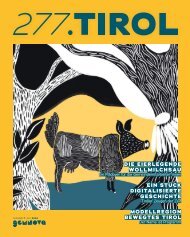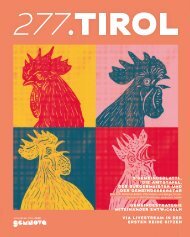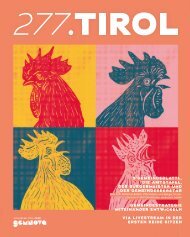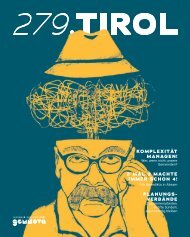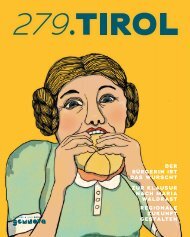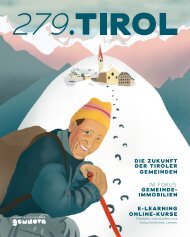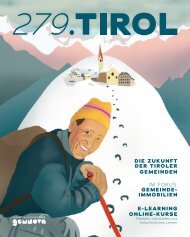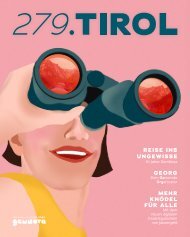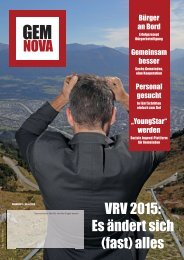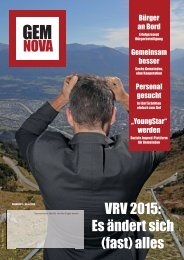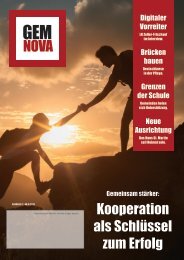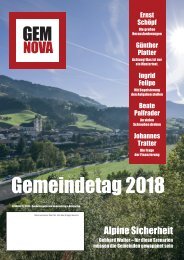279.TIROL - März 2021
Ausgabe 3, März 2021
Ausgabe 3, März 2021
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1<br />
RUMS.<br />
BUMS. FERTIG.<br />
EH KLAR.<br />
ANTI-AGING<br />
FÜR DIE POLITIK<br />
Die „Gemeindeschmiede“<br />
AUSGABE 3 | MÄRZ <strong>2021</strong><br />
DAS MODERNE<br />
TRAINIEREN<br />
Wie Blended Learning das Beste aus<br />
allen Methoden zusammenbringt
2<br />
3<br />
ZUR BESSEREN ÜBERSICHT<br />
HABEN WIR ZWEI ZENTRA-<br />
LE SCHWERPUNKTE IN DIE-<br />
SER AUSGABE WIE FOLGT<br />
GEKENNZEICHNET.<br />
DIGITALISIERUNG<br />
Die Corona-Krise hat gezeigt, welch<br />
hohen positiven Einfluss die Digitalisierung<br />
in unser aller Leben haben<br />
kann. Alle Artikel im Magazin rund um<br />
dieses Thema sind mit diesem Icon<br />
gekennzeichnet.<br />
DEINE ZEIT<br />
IST REIF.<br />
ZUKUNFT GEMEINDE<br />
Nur gemeinsam und in Kooperation<br />
mit Expert*innen können die aktuellen<br />
Herausforderungen in den Gemeinden<br />
gelöst werden. Sie finden alle Themen<br />
rund um die Zukunft der Gemeinden<br />
anhand dieser Kennzeichnung.<br />
Die GemNova bemüht sich um eine<br />
gendersensible Sprache in all ihren<br />
Texten. Dies umfasst die Ansprache<br />
nicht nur des männlichen und weiblichen<br />
Geschlechts, sondern auch<br />
des dritten Geschlechts. Dies sind<br />
Personen, die sich nicht in das binäre<br />
Geschlechtssystem „männlich“ und<br />
„weiblich“ einordnen lassen (wollen).<br />
WIE BEI MANFRED.<br />
Manfred Witsch ist ist 26 26 Jahre jung.<br />
Seit fünf Jahren schmiedet er er Pläne für für die die Weiterentwicklung<br />
seiner Heimatgemeinde Fulpmes.<br />
ALS GEMEINDERAT.<br />
Mit Mit dem Projekt Gemeindeschmiede möchten<br />
wir wir dich dabei unterstützen, in in Zukunft in in deinem<br />
Dorf mitzugestalten.<br />
MANFREDS<br />
STORY<br />
www.gemeindeschmiede.at<br />
Regionalität und Umweltverträglichkeit<br />
sind uns ein Anliegen.
INHALT<br />
tirol.digital<br />
GemNova.inside<br />
tirol.ist schön<br />
tirol.koopiert<br />
14<br />
DIGITAL<br />
KOMMUNIZIEREN<br />
IN GEMEINDEN<br />
TEIL 1<br />
06 Komplexität und Einfachheit<br />
08 Rums. Bums. Fertig. Eh klar!<br />
tirol.digital<br />
42 Zeitzeugen des<br />
kommunalen Lebens<br />
64 Förderung für Co-Working<br />
in Gemeinden<br />
66 GEKO <strong>2021</strong> – zum Vorbild<br />
für andere werden<br />
Kommunikation ist ein<br />
Schlüsselfaktor für den Erfolg<br />
von Gemeinden<br />
14 Digital kommunizieren in<br />
Gemeinden, Teil 1<br />
18 Vorausschauende<br />
Gemeindepolitik<br />
20 Eine Datenzentrale<br />
namens Georg<br />
24 Digitale Barrierefreiheit –<br />
verpflichtend für alle<br />
Gemeinden<br />
tirol.blickt über die Grenzen<br />
26 Das digitale Bürgerservice<br />
der Gemeinde Saas-Fee<br />
tirol.wissen<br />
46 Wo ist der See?<br />
tirol.spart<br />
48 GemNova-Kommunalfinanz:<br />
Kompetente Dienstleistung<br />
vor Ort<br />
tirol.wirtschaftet<br />
tirol.bildet<br />
68 Das moderne Trainieren<br />
71 Digitale Vernetzungsarbeit<br />
unter Kindergärten<br />
in Tirol<br />
74 Hand in Hand<br />
tirol.Wissen<br />
86 Semantische Technologien –<br />
Wissensmanagement der<br />
Zukunft<br />
tirol.mobil<br />
52 Vom richtigen Zeitpunkt<br />
tirol.sportlich und gesund<br />
28 Auf allen Vieren<br />
30 Nachhaltige Mobilität<br />
tirol.investiert<br />
54 Tiroler Gemeinden –<br />
ein wichtiger Motor für die<br />
heimische Bauwirtschaft<br />
78 Rodeln mit Corona<br />
80 200.000 Euro für den<br />
Everest<br />
tirol.sozial<br />
32<br />
tirol.modern und innovativ<br />
68<br />
tirol.modern und innovativ<br />
32 Wenn Landschaft zur<br />
Bühne für Marken und<br />
Produkte wird<br />
tirol.Politik<br />
34 Europa fängt in der<br />
Gemeinde an<br />
36 EU-Förderungen werden<br />
in Tirol zur Gänze<br />
ausgeschöpft<br />
40 Anti-Aging für die Politik<br />
tirol.sucht Menschen<br />
57 Zusammen geht alles<br />
leichter<br />
GemNova.Menschen<br />
60 Der bunte Hund aus<br />
Osttirol<br />
tirol.hat Recht<br />
62 Erste Urteile zur Frage:<br />
„Muss ein Geschäftsraummieter<br />
während des<br />
Lockdowns den Mietzins<br />
bezahlen?“<br />
82 Selbstbestimmtes Leben<br />
tirol.Kultur<br />
84 Die Kleinen sollen Welt<br />
retten<br />
85 Zeit für gute Bücher<br />
tirol.traditionell<br />
90 Musik schwingt in Osttirols<br />
luftigen Höhen<br />
tirol.bunt und vielfältig<br />
92 Der Duft des Orients<br />
WENN LAND-<br />
SCHAFT ZUR BÜHNE<br />
FÜR MARKEN UND<br />
PRODUKTE WIRD<br />
92<br />
tirol.bildet<br />
DAS MODERNE<br />
TRAINIEREN<br />
tirol.bunt und vielfältig<br />
DER DUFT DES<br />
ORIENTS<br />
Die Welt ist bunt, kunterbunt. Ein<br />
kleines, winziges Abbild davon findet<br />
sich am Innsbrucker Marktplatz, in<br />
der Markthalle.
6 GemNova.inside<br />
GemNova.inside 7<br />
KOMPLEXITÄT UND<br />
EINFACHhEIT<br />
Auf eine komplexe Frage<br />
eine einfache Antwort geben.<br />
Das klingt – schnell überlegt<br />
– gut und richtig.<br />
Dabei übersehen viele, dass es so eigentlich<br />
gar nicht stimmt. Natürlich sollte die<br />
Antwort einfach formuliert werden, das ist<br />
klar. Aber man sollte keinesfalls auf eine<br />
komplexe Frage eine einfache Antwort<br />
geben. Das hat sich leider vielerorts eingebürgert,<br />
und wir sehen jeden Tag, dass<br />
auf eine komplexe Frage sehr schnell eine<br />
einfache Antwort gegeben wird. Wenn diese<br />
dann mit Vehemenz und Lautstärke<br />
vorgetragen und oft wiederholt wird, wird<br />
sie zur vermeintlichen Wahrheit.<br />
Dabei wird aber ein kleines Detail übersehen,<br />
welches die Sachlage komplett<br />
verändert. Komplexe Fragen bedürfen<br />
meist komplexer Antworten, die dann<br />
einfach und verständlich formuliert<br />
werden sollten. Das ist ein wesentlicher<br />
Unterschied mit unter Umständen sehr<br />
negativen Folgen.<br />
Die kommunalen Herausforderungen<br />
sind ebenfalls sehr komplex, und es wäre<br />
wirklich fatal, einfache Lösungen dafür<br />
zu suchen. Gemeinden sind komplexe<br />
Organisationen und deutlich herausfordernder<br />
zu managen als jede Firma:<br />
Politik, Verwaltung, Bürger*innen, Bund,<br />
Land, rechtliche Themen u. v. m. Um richtig<br />
zu agieren, muss man diese Komplexität<br />
verstehen, und es muss klar sein,<br />
dass jede Gemeinde sehr individuell zu<br />
betrachten ist.<br />
Wir als GemNova haben uns dieser Herausforderung<br />
gestellt und sehen genau<br />
hier unseren größten Nutzen für Tirols<br />
Gemeinden:<br />
Wir betrachten Gemeinden gesamthaft<br />
und können mit unserem breiten<br />
Lösungsangebot Gemeinden auch<br />
gesamthaft begleiten. Denn wir wissen,<br />
wenn man an einem Rädchen dreht,<br />
drehen sich sehr viele andere mit. Das,<br />
was wir für die Gemeinden sind, ist nicht<br />
der Bauchladen, von dem manchmal<br />
gesprochen wird. Wir sind jener Partner,<br />
der auf komplexe Herausforderungen<br />
komplexe Lösungen erarbeitet und<br />
diese dann auf möglichst einfache Art<br />
und Weise gemeinsam mit der Gemeinde<br />
umsetzt.<br />
Wir verkaufen kein einzelnes Produkt, wir<br />
begleiten Gemeinden gesamthaft. Das ist<br />
unsere Stärke und darauf vertrauen mittlerweile<br />
sehr viele Tiroler Gemeinden und<br />
auch viele andere Institutionen.<br />
Und – wir haben eine Seele. Aber dazu<br />
mehr im nächsten Magazin!<br />
WIR<br />
Gratulieren<br />
Monika Miller, Amtsleiterin<br />
aus Sautens (kein Foto) und<br />
Martina Oberrauch, Finanzverwalterin<br />
aus Kematen haben<br />
jeweils eine Ausgabe des<br />
Buches „Factfulness“ gewonnen,<br />
die wir in der letzten Ausgabe<br />
von <strong>279.TIROL</strong> verlost haben.<br />
BILD: Martina Oberrauch<br />
freut sich über ihren<br />
Gewinn.<br />
Alois Rathgeb<br />
Niki Kraak
8 GemNova.inside<br />
GemNova.inside<br />
9<br />
Rums.<br />
Bums. Fertig.<br />
eh klar .<br />
Wir schreiben das Jahr 1992. Ich bin gerade erst von<br />
meiner Raumschiff-Enterprise-Zeit wieder zurück auf<br />
der Erde. Kann mich nach wie vor nicht entscheiden,<br />
ob ich lieber Captain Kirk oder Mr. Spock sein will.<br />
Dann mein erster Job. Bank. Also keiner<br />
von beiden. Doch nur Schalter-<br />
Beamter (hat man damals wirklich<br />
gesagt). Mein erstes Gehalt 13.471<br />
Schilling. Heute genau 1.000 Euro.<br />
Dann mein zweites Gehalt. Erstes<br />
Mobiltelefon. Ein Nokia<br />
1011. GSM-fähig. Preis über 15.000<br />
Schilling. Schwer wie ein großes Bier.<br />
4,5 Zentimeter dick. Mit Antenne<br />
zum Rausziehen. Das musste sein.<br />
Sonst ging nichts. 10 Minuten telefonieren<br />
kosteten 82 Schilling. Knapp<br />
6 Euro. Dafür konnte es SMS. Ich:<br />
MEGA. JETZT BIN ICH<br />
DIGITALISIERT!<br />
ALOIS RATHGEB, 1992<br />
Man möge mir die ein oder andere<br />
geschichtliche Verzerrung – früher<br />
war ja alles besser – verzeihen. Aber<br />
im Großen und Ganzen war es so.<br />
Wobei im obigen Text EIN eklatanter<br />
Fehler ist. Der zeigt, dass es<br />
oft sprachliche Kleinigkeiten sind, die<br />
einen wesentlichen Unterschied ausmachen.<br />
Ich habe gesagt: „Jetzt bin ich digitalisiert.“<br />
Das stimmt natürlich gar<br />
nicht. Ich war mit dem Mobiltelefon<br />
ein wenig in der digitalen Welt. Aber<br />
nie und nimmer digitalisiert. Ich als<br />
Person sowieso nicht. Außer ich habe<br />
was nicht mitbekommen. Das ist ein<br />
wesentlicher Unterschied, auf den ich<br />
eingehen werde.<br />
Ist alles, was digitalisiert ist,<br />
auch Digitalisierung?<br />
Selbst die Worte „digitalisiert“ und<br />
„Digitalisierung“ – eigentlich das gleiche<br />
Wort, nur einmal als Adjektiv und<br />
einmal als Nomen verwendet – haben<br />
in unserem heutigen Verständnis<br />
eine unterschiedliche Bedeutung. Und<br />
um es noch etwas komplizierter zu<br />
machen: Selbst das Wort „Digitalisierung“<br />
muss man genau hinterfragen.<br />
Das wird ja heute inflationär für alles<br />
verwendet, was nicht unmittelbar ein<br />
Hammer oder eine Säge ist. Beginnend<br />
mit dem Nokia 1011. Aber die<br />
Geschichte kennen Sie ja bereits …<br />
Und heute?<br />
Heute schreiben wir das Jahr <strong>2021</strong>.<br />
Es hat sich viel getan seit damals.<br />
Ein Raumschiff-Enterprise-Fan bin<br />
ich noch immer. Entscheiden würde<br />
ich mich heute für Captain Kirk. Der<br />
war irgendwie cooler. Und vor allem<br />
lebt der noch. Die Mobiltelefone sind<br />
dünner. Nur noch 0,5 Zentimeter und<br />
können nicht nur SMS. Auch gibt es<br />
mittlerweile viel mehr digital. Aber ist<br />
das immer echte Digitalisierung? Ist<br />
es auch immer sinnvoll, was da alles<br />
hin und her digitalisiert wird?<br />
Echte und sinnvolle Digitalisierung<br />
Wir bei GemNova reden bewusst<br />
von „echter und sinnvoller Digitalisierung“.<br />
Und das ist auch unser<br />
Ziel – echt und sinnvoll zu digitalisieren.<br />
Aber wo finden sich nun<br />
die begrifflichen Unterschiede und<br />
wieso sind diese so wichtig?<br />
Karl<br />
AUS HINTERMBERG<br />
Georg<br />
AUS VORDERMBERG
10 GemNova.inside GemNova.inside<br />
11<br />
MITTWOCH. NACHMITTAG. 15.30<br />
UHR. GEMEINDE HINTERMBERG<br />
„Gestern habe ich eine .pdf-Rechnung<br />
bekommen, die dann ausgedruckt, und das<br />
.pdf in den dazugehörigen Akt verschoben<br />
und an die Buchhaltung weitergeleitet. Die<br />
Buchhaltung hat die Rechnung danach in<br />
ihr Programm importiert und verbucht. Als<br />
Nächstes haben wir die Rechnung dem Bürgermeister<br />
zur Freigabe in sein Freigabeprogramm<br />
verschoben, und er hat sie dann<br />
freigegeben. Im zehnten Schritt haben wir<br />
einen Datenträger erstellt. Dieser wurde ins<br />
Onlinebanking importiert und alsdann fast<br />
fristgerecht überwiesen. Danach haben wir<br />
die Zahlung verbucht. Läppische 13 Schritte.<br />
Wir sind voll digitalisiert“, meint Karl aus<br />
Hintermberg.<br />
„Karl, das<br />
ist leider<br />
keine<br />
echte und<br />
sinnvolle<br />
Digitalisierung.“<br />
MITTWOCH. NACHMITTAG . 15.30<br />
UHR. GEMEINDE VORDERMBERG<br />
„Gestern kam eine E-Rechnung, die automatisch<br />
verbucht und dem Akt zugewiesen<br />
wurde. Danach ging sie automatisiert<br />
in den Freigabeprozess, und alles war mit<br />
einem Klick erledigt. Selbstverständlich<br />
wurde die Zahlung dann automatisiert verbucht<br />
und im Akt als bezahlt hinterlegt.<br />
Drei Schritte. Rums. Bums. Fertig“, sagt<br />
Georg aus Vordermberg.<br />
„Georg,<br />
das ist<br />
echte und<br />
sinnvolle<br />
digitalisierung.“<br />
Sei wie Georg. Ein Dokument zu erstellen,<br />
daraus ein .pdf zu machen und das zu versenden<br />
ist tatsächlich Digitalisierung. Das<br />
Dokument wurde wirklich digitalisiert. Und<br />
eigentlich könnte man jetzt von Digitalisierung<br />
reden. Und zufrieden sein. Aber echte<br />
Digitalisierung schaut anders aus. Georg<br />
aus Vordermberg weiß das natürlich.<br />
Durchgängige Prozesse<br />
Echte Digitalisierung in dem Fall heißt, dass<br />
der komplette Prozess durchgängig digital<br />
abgewickelt wird und möglichst automatisiert<br />
ist. Kein Ausdrucken. Kein Verschieben.<br />
Kein Zuordnen. Kein Öffnen von<br />
unterschiedlichen Programmen. Schnittstellenfrei.<br />
Medienbruchfrei. Fehlerfrei. Effizient<br />
und zeitsparend.<br />
Rums. Bums.<br />
Fertig. rechtssicher .<br />
eh klar .<br />
Und genau das haben wir uns bei Gem-<br />
Nova im Zusammenhang mit echter<br />
und sinnvoller Digitalisierung zum Ziel<br />
gesetzt. Gemeinsam mit und für Tirols<br />
Gemeinden echte und sinnvolle Digitalisierung<br />
voranzutreiben. Um das zu erreichen,<br />
benötigt es viele Bausteine und ein<br />
paar wesentliche Grundlagen.<br />
Echte Digitalisierung unterstützt die<br />
echte Welt<br />
„Ich kauf uns mal eine Software“, wie der<br />
Karl sagt. Das ist nicht gut, Karl. Georg<br />
meint: „Ich schau mir meine Prozesse an.<br />
Diese überarbeite ich dann. Erst danach<br />
bilde ich diese mit einer Software digital,<br />
medienbruchfrei ab.“ Digitalisierung spielt<br />
sich also nicht rein in der digitalen Welt<br />
ab und ist nicht einfach alles, was irgendwie<br />
digital vorhanden ist. Digitalisierung<br />
unterstützt und bildet die reale Welt digital<br />
ab. Nur dann ist es echte und sinnvolle<br />
Digitalisierung.<br />
„So, aber jetzt digitalisiere ich mal den Kindergarten.<br />
Von der Anmeldung über die<br />
Verwaltung bis hin zur Abrechnung. Da<br />
kaufe ich eine Software dafür. Dort baue<br />
ich eine Datenbank auf, in der alle Kinder<br />
in meiner Gemeinde zu finden sind. Die<br />
Eltern können dann einsteigen und sich<br />
dort mit Namen usw. registrieren und tatsächlich<br />
dann ihre Kinder für den Kindergarten<br />
anmelden.“ Zwischenzeitlich dürfte<br />
schon klar sein, wer das war. Das war<br />
Karl. Karl denkt nicht darüber nach, ob die<br />
Daten der Kinder und Eltern nicht schon<br />
vorhanden sind. Karl denkt nicht darüber<br />
nach, dass es vielleicht vorher eine Kinderkrippe<br />
und danach eine Schule gibt und<br />
Daten eigentlich durchgängig vorhanden<br />
sein sollten. Und Karl denkt nicht darüber<br />
nach, dass im gesamten Prozess auch<br />
andere Dinge wie Abrechnung, Anbindung<br />
an das Land usw. wichtig sind.<br />
Oder weiß es Karl einfach nicht besser?<br />
Oder geht das mit seiner Software fach<br />
ein-<br />
nicht?<br />
Alle in der Gemeinde<br />
und auch das Land Tirol<br />
würden sich über ein<br />
vollintegriertes System<br />
freuen. Die Daten kommen<br />
automatisch aus<br />
dem ZMR.<br />
Die Daten kommen automatisch aus dem<br />
ZMR. Eltern loggen sich mit Handysignatur<br />
ein. Sehen ihre Daten und jene der Kinder.<br />
Klicken beim Georg junior auf „Anmelden“,<br />
und dann läuft alles vollautomatisiert weiter.<br />
Rums. Bums. Fertig.<br />
„Echt? Das geht?“ Na klar, Karl. Und<br />
zwar einfach und schnell. Eben echt digitalisiert.<br />
Wichtigster Grundsatz für echte und sinnvolle<br />
Digitalisierung: ein Datenstamm.<br />
Gemeinden haben dabei wunderbare<br />
Instrumente, auf die sie zurückgreifen<br />
können. Die Register. Dort liegt alles in<br />
richtiger und vollkommen eindeutiger Art<br />
und Weise. ZMR, AGWR, UR*) usw. Eine<br />
moderne Software bindet diese Register<br />
ein und arbeitet ausschließlich mit diesen<br />
Registern als Datenbasis.<br />
Registerabgleich ist nicht<br />
Registereinbindung. Ein<br />
Apfel ist ja auch keine Birne.<br />
„Ja klar“, sagt Karl, „wir haben ja auch einen<br />
Registerabgleich.“ Georg weiß es besser:<br />
„Obwohl sich die Wörter ähneln, besteht<br />
doch ein wesentlicher Unterschied zwischen<br />
Registereinbindung und Registerabgleich.“<br />
Da hat er schon wieder recht und<br />
versteht offenbar den Unterschied zwischen<br />
Digitalisierung und echter Digitalisierung.<br />
Sei wie Georg!<br />
Georg: „Der Registerabgleich ist in etwa<br />
so: Der Karl aus Hintermberg hat eine<br />
Datei mit seinen Bürgern. Jetzt sitzt er<br />
gerade vor dieser Datei und erfasst den<br />
Bürger Alois Rathgeb. Ohne „er“ am Ende.<br />
Sonderbarer Typ mit komischem Namen,<br />
denkt er sich. Es gibt doch keinen Rathgeb.<br />
Ohne „er“. Es gibt doch nur Rathgeber.<br />
Oder? Da schaut der Karl mal ins Telefonbuch,<br />
das neben ihm liegt. Dort steht<br />
Rathgeb ohne „er“ am Ende. Ist vermutlich<br />
ein Fehler. Denkt Karl. Und schreibt trotzdem<br />
Rathgeber. Aufwändig. Fehleranfällig.<br />
Rechtsunsicher. Registerabgleich.<br />
Bei der Registeranbindung kann der Georg<br />
in Vordermberg auch Rathgeber eingeben.<br />
Das System sagt ihm dann aber: „Ja, Georg.<br />
Das ist nett. Aber in Vordermberg gibt es<br />
keinen Rathgeber laut ZMR. Schreib ihn also<br />
richtig. Sonst kannst du den Vorgang nicht<br />
abschließen.“ Einfach. Fehlerfrei. Rechtssicher.<br />
Registeranbindung.<br />
Rums. Bums.<br />
Fertig.<br />
So einfach<br />
ist das.<br />
So. Pause. Jetzt zünden wir die intellektuell<br />
nächste Stufe. Dreimal durchatmen.<br />
Sacken lassen. Schnapserl trinken. Aufpassen.<br />
Langsam lesen.<br />
* ZMR = Zentrales Melderegister, AGWR = Adress-, Grundstücks- und Wohnungsregister, UR = Unternehmensregister
OUTtAKES<br />
12 GemNova.inside GemNova.inside<br />
FREITAG. SPÄTER NACHMITTAG. nen Akten ablegen und in der Liste abhaken. Dem Karl klappt das untere Gebissteil herunter.<br />
Karl kann’s kaum glauben. Das Einzi-<br />
17.30 UHR. GEMEINDE VORDERM- (Langsames Ausschnaufen. Großer Schluck<br />
BERG.<br />
Bier) Das war’s. Habe fertig.“<br />
ge, das er in dem Moment noch rausbringt:<br />
„Zwei Bier! Bitte!“<br />
Karl und Georg treffen sich auf ein Bier. Im<br />
Gasthaus. (Anm. der Redaktion: Die Szene<br />
mit Gasthaus und Bier ist fiktiv und nicht<br />
real. Der Rest schon.) „Ha!“, sagt Karl. „Aber<br />
bei der Grundsteuer sind wir mega digitalisiert.<br />
Wirst schon sehen, wie cool das bei<br />
uns abläuft.“ Georg lehnt sich zurück. Nimmt<br />
IMMER NOCH FREITAG. MITTeinen<br />
Schluck. Denkt zurück an die Zeit, in<br />
LERWEILE SPÄTER ABEND.<br />
der das noch real möglich war. Und horcht<br />
21.00 UHR. IMMER NOCH IM<br />
aufmerksam zu.<br />
GASTHAUS IN VORDERMBERG.<br />
Karl flippt fast aus. Vor Begeisterung.<br />
Dann legt er in einem Schwall los:<br />
„Bei uns läuft das so die Einheitswertbescheide<br />
kommen in die Databox von<br />
FinanzOnline der Mitarbeiter der Gemeinde<br />
steigt also in FinanzOnline ein falls er<br />
seine Benutzerdaten noch weiß dann lädt<br />
er die ZIP-Datei aus der Databox herunter<br />
und entpackt diese die Daten der einzelnen<br />
Bescheide werden gelesen und im System<br />
erfasst (kurzes Atemholen) dann müssen<br />
die Eigentümer kontrolliert werden ob diese<br />
während des Jahres geändert wurden und<br />
dafür steigt er in eine andere Software ein<br />
um dann die ausgedruckten Einheitswertbescheide<br />
mit Aktenzahl abzulegen um im<br />
Anschluss den Bescheid zu erstellen (Punkt.<br />
Schnauf) Dann müssen diese Bescheide<br />
ausgedruckt werden wobei manchmal der<br />
Toner ausgeht oder im Drucker ein Papierstau<br />
den Ausdruck behindert egal ein RSB-<br />
Rückschein wird für jeden Bescheid per Hand<br />
oder Schreibmaschine ausgefüllt und die<br />
Bescheide werden in das Rückscheinkuvert<br />
eingegeben danach wird eine Liste geschrieben<br />
für alle Bescheide damit diese später<br />
nachvollzogen werden können (Schluck Bier.<br />
Doppelschnauf) jetzt werden die Bescheide<br />
zur Post gebracht falls die noch nicht zu hat<br />
sonst halt am nächsten Tag danach trudeln<br />
dann langsam die Rückscheine über Tage<br />
verteilt ein die wir dann bei den betroffe-<br />
„Klingt<br />
spannend.<br />
Ist aber<br />
weder<br />
sinnvoll<br />
noch handelt<br />
es<br />
sich dabei<br />
um echte<br />
Digitalisierung“,<br />
repliziert Georg und erzählt, wie das in<br />
Vordermberg abläuft:<br />
„Einheitswertbescheide kommen automatisch<br />
und direkt aus dem FinanzOnline in den<br />
Posteingang vom System. Dort werden diese<br />
kurz kontrolliert und registerbasiert gegengecheckt.<br />
Sobald das erledigt ist, werden<br />
die Bescheide ins Versandcockpit geklickt,<br />
und von da weg kann im Versandcockpit<br />
der Status jeder Sendung nachverfolgt werden.<br />
Rückscheine kommen digital zurück<br />
und werden automatisch dem Akt zugewiesen.“<br />
Das war’s. Genau drei Schritte.<br />
Rums. Bums. Fertig.<br />
Effizient. Schnell.<br />
Automatisiert.<br />
Fehlerfrei. Rechtssicher<br />
. Eh klar !<br />
Wie kann denn so was funktionieren? Vermutlich<br />
arbeitet Karl mit einem System<br />
aus dem letzten Jahrtausend. Auch diese<br />
Systeme entwickeln sich. Sie bleiben aber<br />
in ihrer Systemarchitektur einfach alt. Da<br />
können sie noch so schön ausschauen. „Vor<br />
zwei Jahren ist mir um meinen Automotor<br />
herum das Auto komplett zusammengerostet.<br />
Dann habe ich einfach ein Auto ohne<br />
Motor gekauft und dieses um den Motor<br />
herum gebaut. Schaut gut aus. Geht aber<br />
nicht“, hat wer gesagt, den wir nicht kennen.<br />
Heute programmiert man komplett<br />
anders. Offen. Durchgängig. Eine zentrale<br />
Datenbank. Registereingebunden. Doppik<br />
als Ausgangsbasis. VRV2015 fit. Eine<br />
Benutzeroberfläche für die Hauptbereiche.<br />
Echte Anbindung von Fremdsystemen. Eben<br />
echte und sinnvolle Digitalisierung.<br />
„Irgendwie war Programmierung früher wie<br />
ein geschlossener Kasten. Heute schaut das<br />
in etwa so aus wie das Virus, das da mal<br />
grassiert ist. Wie hieß das nochmal gleich?“,<br />
fragt Georg. „Keine Ahnung“, sagt Karl. „Zwei<br />
Corona! Bitte!“, brüllt Karl zur Theke. „Aber<br />
eins musst du mir jetzt noch sagen, Georg.<br />
Wo bekomme ich denn dazu mehr Informationen?“<br />
Georg hat damit schon gerechnet,<br />
denn jeder, dem er das im Detail erzählt, will<br />
diese Lösung haben. „Hier. Lies das Magazin.<br />
279.tirol. Da findest du alles dazu. Und<br />
dann ruf den Rathgeb an.“ „Der heißt Rathgeber.<br />
Den Namen Rathgeb gibt es nicht!“<br />
...<br />
„Georg! Bist endlich daheim? Und wie war<br />
es mit Karl? Hast es ihm so erklärt, wie ich<br />
es dir erklärt habe?“ Na ja. Mal ganz ehrlich.<br />
Georg hat sein ganzes Wissen eigentlich<br />
von seiner Frau Gisela. Eh wie im richtigen<br />
Leben auch …<br />
Corona-Bier fast fertig. „Du, Georgie! Wie<br />
war das denn, als ihr auf diese Lösung<br />
umgestellt habt? War das aufwändig?“<br />
„Mein Freund. Karli. Das war schon einiges<br />
an Arbeit. Weißt, das alte System hat<br />
fehlerhafte Datensätze zugelassen. Die<br />
richtigzustellen, das war echt hart. Aber<br />
jetzt läufts. Wir sind wesentlich schneller.<br />
Und vor allem fehlerfrei. Damit rechtssicher“,<br />
meint Georg final. Fast …<br />
FAST SCHON SAMSTAG. FINS-<br />
TERSTE NACHT. 23.50 UHR.<br />
UMGESTELLT AUF SELBSTBE-<br />
DIENUNG.<br />
Der Karl hört nicht auf zu fragen. „Du,<br />
Schorsch. Du hast heute mal was<br />
von VRV2015 geredet. Ich bin ja kein<br />
Bilanzbuchhalter. Aber in meiner Eröffnungsbilanz<br />
steht unser negatives Kontokorrentkonto<br />
auf der Aktivseite mit<br />
einem Minus davor. Irgendwie schon<br />
komisch. Oder?“ „Karli Bua. Da hast<br />
wohl recht. Weißt eh. Deine Software<br />
kommt aus der Kameralistik und wurde<br />
halt irgendwie zur Doppik umgebaut.<br />
Kann schon sein, dass das einfach<br />
technisch nicht geht. Ist natürlich<br />
vollkommen falsch. Unsere war schon<br />
immer doppisch. Da ist das selbstverständlich<br />
richtig dargestellt. Es gibt ja<br />
kein Minusvermögen. Oder doch?“<br />
„Der weltraum.<br />
unendliche weiten. wir<br />
schreiben das jahr 2200.”<br />
„Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner<br />
400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist,<br />
um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen.<br />
Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in<br />
Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.“<br />
AUTOR ALOIS RATHGEB<br />
13
14<br />
tirol.digital tirol.digital<br />
15<br />
DIGITAL<br />
3.<br />
IN GEMEINDEN<br />
KOMMUNIZIEREN<br />
ALPENGRENZGANG<br />
ZUM AUTOR<br />
MAG. MARTIN WEX<br />
Martin Wex ist seit 2019 bei der GemNova im Bereich<br />
Digitalisierung tätig. Darüber hinaus ist er Landtagsabgeordneter<br />
und Vizebürgermeister von Schwaz.<br />
Kontakt: m.wex@gemnova.at<br />
Teil 1: Information<br />
BILD: (© TVB Silberregion Karwendel<br />
Kommunikation ist ein<br />
Schlüsselfaktor für den<br />
Erfolg von Gemeinden.<br />
Je besser die Gemeinde in der Lage ist,<br />
Informationen intern auszutauschen<br />
und nach außen, in Richtung Bürger,<br />
zu kommunizieren, desto effizienter<br />
und bürgerfreundlicher wird sie sein.<br />
Im Zuge der Covid-19-Maßnahmen, bei<br />
denen die Mobilität und persönlichen<br />
Kontakte stark eingeschränkt wurden,<br />
zeigten sich rasch die Vorteile und<br />
Schwachstellen digitaler Kommunikation<br />
auf lokaler Ebene. Ein Statusbericht<br />
anhand der Silberstadt Schwaz.<br />
Gerade in Krisenzeiten und bei außergewöhnlichen<br />
Ereignissen gilt es die Bevölkerung<br />
rasch und klar zu informieren. Was<br />
überregional über Funk, Fernsehen und<br />
Internet passiert, kann und muss auf regionaler<br />
Ebene verstärkt und gegebenenfalls<br />
konkretisiert werden. Eine wesentliche Rolle<br />
dabei spielt die eigene Website. Gänzlich<br />
im Einflussbereich der Gemeinde kann<br />
sie selbst über deren Inhalt (Content) und<br />
deren Verfügbarkeit entscheiden. Soziale<br />
Medien wie Facebook verbreitern zwar<br />
den Adressatenkreis erheblich, ob, wann,<br />
und wo ihre Botschaften ausgespielt werden,<br />
bestimmen Sie als Gemeinde jedoch<br />
nur noch bedingt selbst.<br />
Seit Beginn der Pandemie bündelt die<br />
Silberstadt Schwaz alle ihre Covid-19-Informationen<br />
übersichtlich und verständlich<br />
ausformuliert unter www.schwaz.<br />
at. Ein einfach zu bedienendes Content-<br />
Management-System (CMS) zur Wartung<br />
der Inhalte erleichterte den bereits<br />
vorab definierten „Redakteuren“ aus der<br />
Verwaltung und dem Stadtmarketing die<br />
Aktualisierung. „Ich kann allen Gemeinden<br />
nur empfehlen, schon in ruhigen Zeiten<br />
zu definieren, wer, wann und wie für<br />
die Kommunikation nach außen zuständig<br />
ist, und das auch zu üben. Der Vorteil<br />
neuer CMS ist ja, dass grundsätzlich<br />
jeder, auch über sein Handy, Daten einpflegen<br />
kann. Es braucht jedoch klare<br />
Regeln“, so Verena Mayrhofer, Kommunikation<br />
und Öffentlichkeitsarbeit der<br />
Stadt Schwaz. „Neben jenen Informationen,<br />
die wir veröffentlichen müssen,<br />
z. B. über die digitale Amtstafel, bieten<br />
wir auch Inhalte, die von vielen gewünscht<br />
und nachgefragt werden. Waren es vor<br />
Corona noch die Hochzeitsfotos, so wollten<br />
die Schwazer im Lockdown wissen,<br />
welche Geschäfte geöffnet haben, wer<br />
liefert, Selbstabholung ermöglicht oder<br />
den Silberzehner (Schwazer Gutscheinwährung)<br />
akzeptiert. Diese Informationen<br />
konnten wir binnen weniger Tage sammeln<br />
und über eine Datenbank zugänglich<br />
machen. Nunmehr sind die Betriebe<br />
selbst für die Aktualität der Daten und<br />
Angebote verantwortlich“, berichtet Manfred<br />
Berkmann, Geschäftsführer der Saalund<br />
Stadtmarketing GmbH der Stadt<br />
Schwaz (https://www.kaufinschwaz.at/).<br />
Für ihn ist klar, dass Informationen immer<br />
mehr mobil abgerufen werden und die<br />
klassische Nutzung am PC bereits überholt<br />
hat. Ein dynamisches Design sollte<br />
darauf Rücksicht nehmen und auch<br />
andere Ausgabequellen wie Infotermi-<br />
LINKS: Mag. Verena Mayrhofer kümmert sich um<br />
alle Angelegenheit der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit<br />
in der Stadtgemeinde Schwaz.<br />
(© Gemeinde Schwaz)<br />
OBEN: Digitale Infosäulen im öffentlichen Bereich<br />
versorgen die Bürger*innen mit aktuellen Informationen.<br />
(© Martin Wex)
Die erste Adresse<br />
für leistbares Wohnen<br />
16 tirol.digital<br />
Axams, Pafnitz, 37 Mietwohnungen<br />
„Wohnen am Park“ Innsbruck, Andechsstraße,<br />
118 Miet-, 53 Eigentumswohnungen,<br />
sechs Gewerbeeinheiten<br />
5-Euro-Wohnbau Haiming, Zwieselweg,<br />
23 Miet wohnungen<br />
Fügen, Feldweg, 18 Mietwohnungen<br />
Natters, Wohn- und Pflegeheim Haus Maria,<br />
40 Pflegebetten, acht Tagesbetreuungsplätze,<br />
14 Einheiten für betreubares Wohnen, Arztpraxis<br />
„Haus der Generationen“ Volders, 13 Mietwohnungen,<br />
Kinderbetreuungseinrichtungen, Vereinsräumlichkeiten<br />
Umhausen, Platzl, 24 Mietwohnungen<br />
Wörgl, Südtiroler Siedlung, BA 1a, Josef-Steinbacher-Str.,<br />
65 Mietwohnungen, eine Einheit für den Jugendtreff<br />
Wörgl, Urban Gardening<br />
Kundl, Dr. Franz-Stumpf-Straße,<br />
14 betreubare Mietwohnungen, Arztpraxis<br />
Wenn es um leistbaren Wohnraum für die Tirolerinnen und Tiroler geht, ist die NEUE HEIMAT TIROL der erste Ansprechpartner.<br />
In über 100 Tiroler Gemeinden wurden bereits Projekte umgesetzt. Ein weiteres Geschäftsfeld<br />
ist die Errichtung von kommunalen Einrichtungen wie z.B. Wohn- und Pflegeheimen, Kinderbetreuungsstätten<br />
und betreubaren Wohnungen.<br />
NEUE HEIMAT TIROL Gemeinnützige WohnungsGmbH . Gumppstraße 47 . 6020 Innsbruck . neueheimat.tirol<br />
bezahlte Anzeige<br />
Fotos: NHT/2quadrat, Pauli, Oss, Härting<br />
nals, Monitore und TV-Geräte bedienen<br />
können. Intelligente Eingabetools („all in<br />
one“) unterstützen bei der koordinierten<br />
Bespielung mehrerer Kanäle und Ausgabegeräte.<br />
Spannend dürfte in Zukunft die Frage<br />
sein, wie wir zu unseren Informationen<br />
kommen. Big Data, kombiniert mit künstlicher<br />
Intelligenz und annotierten Inhalten<br />
(Wissensgrafen), eröffnen neue Möglichkeiten.<br />
Sprachgesteuerte Assistenten<br />
(Alexa etc.) und Chatbots zeigen, wohin in<br />
diesem Bereich die Reise geht.<br />
Ende 2017 hat die Stadt Wien einen eigenen<br />
Sprachassistenten als App auf den<br />
Markt gebracht. Den WienBot kann man<br />
nach Parkgebühren und Eintrittspreisen,<br />
Öffnungszeiten und Veranstaltungen fragen.<br />
Man kann sich von ihm im Stadtplan<br />
den nächsten Trinkbrunnen oder Müllsammelstellen<br />
in der Nähe anzeigen lassen,<br />
wann die nächste U-Bahn fährt und<br />
wie man am schnellsten in den Wiener<br />
Prater kommt. Das und noch viel mehr<br />
beantwortet der WienBot kurz und prägnant<br />
direkt in der App.<br />
Technische, juristische und<br />
inhaltliche Fragen sollten<br />
im Vorfeld geklärt werden.<br />
Zur raschen Übermittlung von Daten und<br />
Nachrichten haben sich zu den sozialen<br />
Plattformen wie Facebook, Twitter oder<br />
Instagram auch Messengerdienste hinzugesellt.<br />
Immerhin 50 Prozent der Gemeinden<br />
greifen darauf zurück –aufgrund seiner<br />
Verbreitung meist auf WhatsApp (6<br />
Millionen User in Österreich) und in letzter<br />
Zeit aus datenschutzrechtlichen Gründen<br />
auch immer öfter auf Signal, Telegram<br />
oder Threema. Meist kommen Messengerdienste<br />
noch zur internen Kommunikation<br />
in kleinen Gruppen zum Einsatz.<br />
1. Information<br />
2. Kommunikation<br />
Der Einsatz dieser Dienste als Infokanal,<br />
zu dem sich Bürger*innen aktiv anmelden,<br />
wird erst von wenigen Gemeinden<br />
genutzt. Dabei einfach loszulegen wäre<br />
jedoch ein Fehler. Technische, juristische<br />
und inhaltliche Fragen sollten im Vorfeld<br />
geklärt werden. Nicht einmal 6 Prozent der<br />
Gemeinden nutzen Videoportale wie Youtube.<br />
Es ist jedoch davon auszugehen, dass<br />
Bewegtbilder, sprich Videos, in Zukunft an<br />
Bedeutung gewinnen werden, zumindest<br />
wenn es um das Vermitteln von Emotionen<br />
geht.<br />
Kurze, knackige Videobotschaften werden,<br />
insbesondere was die Positionierung<br />
der Gemeinde und die laufende Berichterstattung<br />
betrifft, Texte und zum Teil<br />
auch Bilder ablösen. Schon jetzt werden<br />
Wetterkameras, Erklärvideos und kurze<br />
Seitenblicke am meisten geklickt. Mit<br />
der steigenden Anzahl von Videocontent<br />
ist der Weg zum eigenen Gemeinde-TV-<br />
Kanal nicht weit.<br />
Mit steigenden Bandbreiten und<br />
erschwinglicher Technologie steigt das<br />
Interesse an Liveübertragungen. Sportund<br />
Kulturveranstaltungen sind dabei<br />
ebenso Thema wie die Übertragung von<br />
Gemeinderatssitzungen. Spätestens seit<br />
dem viel zitierten Internet 2.0, dem „Mitmach-Internet“,<br />
das für interaktive und<br />
kollaborative Elemente im Internet steht,<br />
geht es nicht mehr nur darum, die Bürger*innen<br />
zu informieren, sondern ihn<br />
aktiv einzubinden. Die Gemeinde tritt in<br />
einen Dialog mit den Bürger*innen.<br />
3. Transaktion<br />
4. Personalisierung<br />
Gleichzeitig fördert und schafft die Digitalisierung<br />
gänzlich neue Möglichkeiten<br />
der Zusammenarbeit von Verwaltungseinheiten<br />
und angeschlossener Organisationen.<br />
Was vor Corona kaum genutzt und<br />
vorstellbar war, ist zwischenzeitlich zur<br />
Selbstverständlichkeit geworden: Videokonferenzen,<br />
Homeoffice, virtuelle Teams<br />
und die Nutzung von Online-Verfahren.<br />
Worauf es dabei ankommt und welche<br />
Möglichkeiten Gemeinden dabei nutzen<br />
sollten, erklären wir Ihnen in Teil 2.<br />
„Gut gemachte Videos erregen<br />
sehr große Aufmerksamkeit.<br />
Das Zielpublikum kann auf einer<br />
persönlichen Ebene direkt angesprochen<br />
werden. Videos fördern<br />
daher Beziehungen und schaffen<br />
Vertrauen. Außerdem können mit<br />
Bewegtbildern viel stärker Emotionen<br />
geweckt werden. Man<br />
kann einfacher Glaubwürdigkeit<br />
aufbauen und viel Inhalt in kurzer<br />
Form verpacken. Mit qualitativ<br />
hochwertigen Videos gelingt es<br />
weitaus besser, komplexe Sachverhalte<br />
zu erklären.“<br />
MANFRED SCHIECHTL<br />
GEMNOVA<br />
17
18 tirol.digital tirol.digital<br />
19<br />
Die Pitztaler Gemeinden bereiten<br />
sich derzeit intensiv auf<br />
mögliche künftige Krisen vor<br />
und arbeiten daran, eine Notfallstruktur<br />
bzw. Notfallpläne aufzubauen<br />
bzw. zu erstellen.<br />
Vorausschauende<br />
Gemeindepolitik<br />
PITZTALER GEMEINDEN BEREITEN<br />
SICH AUF MÖGLICHEN BLACKOUT VOR<br />
Im Fokus steht dabei die realistische<br />
Gefahr eines Blackouts, also wenn die<br />
Stromversorgung aufgrund äußerer Einflüsse<br />
für längere Zeit zusammenbricht.<br />
Ein längerfristiger Stromausfall hat weitreichende<br />
Folgen für die gesamte kommunale<br />
Infrastruktur. Deshalb ist es äußerst<br />
wichtig, sich auf dieses Szenario rechtzeitig<br />
vorzubereiten.<br />
Das Pitztal wurde im Zuge des Projektes<br />
„Interreg Alpine Space – SMART Villages“<br />
als Pilotregion ausgewählt. Das Projekt<br />
gliedert sich in vier Arbeitspakete:<br />
1.) Entwicklung einer Vision und der<br />
Digitalen Region Pitztal, 2.) Gemeindeaufgaben<br />
im digitalen Wandel, 3.)<br />
Erhebung des digitalen Status der<br />
Gemeinden und 4.) Maßnahmenplan zur<br />
Etablierung von Smart Government.<br />
„Mit den Themen<br />
von Smart<br />
Government gehen<br />
die Pitztaler<br />
Gemeinden wieder<br />
einen Schritt nach<br />
vorne und erarbeiten<br />
nachhaltige<br />
Lösungen für die<br />
Zukunft. An einer<br />
vernetzten und digitalen<br />
Infrastruktur<br />
führt kein Weg<br />
vorbei.“<br />
BILD: (© TVB Pitztal / Chris Walch)<br />
Das Ziel des Projektes ist es, den Pitztaler<br />
Gemeinderät*innen Handlungsempfehlungen<br />
und Maßnahmenpakete zur Diskussion<br />
vorzulegen, um weitere Schritte<br />
in Richtung einer nutzerfreundlichen und<br />
effizienten Verwaltung zu initiieren.<br />
In einem ersten Schritt wurde eine Ist-<br />
Stand-Analyse des derzeitigen digitalen<br />
Status der Gemeinden durchgeführt. Dazu<br />
wurden Befragungen der Bürgermeister*innen<br />
sowie diverser Institutionen der Region<br />
durchgeführt. Anhand der Erkenntnisse<br />
wurden 16 Handlungsfelder formuliert. Im<br />
Zuge eines Workshops wurden die Themen<br />
aufgrund ihrer Wichtigkeit von den Bürgermeister*innen<br />
priorisiert. Drei Handlungsfelder<br />
wurden zu Schwerpunktthemen<br />
erklärt: digitale Infrastruktur, digitales Amt<br />
und Bürgerservice. „Die Pitztaler Gemeinden<br />
machen bereits sehr viel gemeinsam,<br />
zum Vorteil des gesamten Pitztals. Mit den<br />
Themen von Smart Government gehen die<br />
Pitztaler Gemeinden wieder einen Schritt<br />
nach vorne und erarbeiten nachhaltige<br />
Lösungen für die Zukunft. An einer vernetzten<br />
und digitalen Infrastruktur führt kein<br />
Weg vorbei. Die GemNova, das Unternehmen<br />
der Tiroler Gemeinden, unterstützt bei<br />
diesem europäischen Interreg-Projekt die<br />
Pitztaler Gemeinden bei der Umsetzung,<br />
im Auftrag der Standortagentur Tirol und<br />
Regionalmanagement Imst.<br />
Großes Augenmerk wird nun bei den weiteren<br />
Arbeiten vor allem auf den Aspekt<br />
Notfallmaßnahmen bezüglich kommunaler<br />
Infrastruktur gelegt, der sowohl Schwerpunktthema<br />
eins wie Schwerpunktthema<br />
drei sehr stark betrifft. Die ersten Handlungsempfehlungen<br />
besagen, dass hinsichtlich<br />
eines Blackouts den Gemeinden<br />
empfohlen wird, sich frühzeitig mit dieser<br />
Thematik zu beschäftigen, um auf die<br />
Auswirkungen eines möglichen Stromund<br />
Infrastrukturausfalls entsprechend<br />
reagieren zu können. Erfahrungen zeigen,<br />
dass durch die Auseinandersetzung ein<br />
Mehrwert gewonnen werden kann und<br />
sich dadurch Strom- und Infrastrukturausfälle<br />
effizienter bewältigen lassen.<br />
Beispielsweise erleichtert ein bereits<br />
eingerichtetes Krisenmanagement und<br />
eingespielte Abläufe in der Gemeinde den<br />
Umgang mit möglichen Störungen. Als<br />
Erstes wird die genaue Evaluierung des<br />
Ist-Standes empfohlen. Es braucht eine<br />
gemeinsame „Karte“, die einen Überblick<br />
über die Einrichtungen und Anlagen des<br />
gesamten Pitztals gibt.<br />
In weiterer Folge gilt es, detaillierte Notfallpläne<br />
für die kommunale Infrastruktur<br />
auszuarbeiten. Bei Eintritt einer Störung<br />
wie beispielsweise eines Blackouts soll<br />
jeder und jede im Tal genau informiert<br />
sein, wie vorgegangen wird, um die Folgen<br />
abzumildern. Die vier Bürgermeister der<br />
Gemeinden Arzl im Pitztal, Jerzens, St.<br />
Leonhard im Pitztal und Wenns – Josef<br />
Knabl, Karl Raich, Elmar Haid und Walter<br />
Schöpf – sind überzeugt, mit den derzeit<br />
durchgeführten Maßnahmen wertvolles<br />
Bürgerservice zu schaffen. Denn: „Speziell<br />
in der Corona-Zeit hat sich das Bewusstsein<br />
und die Wertschätzung des Bürgers<br />
positiv verändert. Die unsichere Zeit hat<br />
gezeigt, wie wertvoll die Versorgung mit<br />
Lebensmitteln, Strom, Wasser und Internet<br />
sowie die funktionierende Abfall- und<br />
Abwasserbeseitigung ist.“ Und dieser<br />
Mehrwert soll nun auch auf andere Krisensituationen<br />
übertragen werden, damit<br />
sich die Bürger*innen auch weiterhin in<br />
Ausnahmefällen bestens betreut fühlen.<br />
ZUM AUTOR<br />
MICHAEL KIRCHMAIR<br />
Michael Kirchmair ist Experte im Bereich Informations-<br />
und Kommunikationstechnologie und<br />
unterstützt mit seinem Know-how eine Vielzahl<br />
von Digitalisierungsprojekten. Er ist seit 2013<br />
bei der GemNova und ist somit ein „alter Hase“<br />
im kommunalen Umfeld.<br />
Kontakt: m.kirchmair@gemnova.at
20 tirol.digital tirol.digital<br />
21<br />
EINE DATENZENTRALE<br />
NAMENS GEORG<br />
GARANT FÜR EFFIZIENTE VERWALTUNG<br />
Effizienz ganz allgemein betrachtet bedeutet, dass der Nutzen den Aufwand<br />
übersteigt. Dieses Prinzip ist gerade in den aktuell schwierigen Zeiten<br />
ein wichtiges Maß, wenn es um die Einteilung der knappen Ressourcen<br />
der Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung geht.<br />
ZUR AUTORIN<br />
DIPL.-KFR.<br />
VERENA KAISER<br />
Verena Kaiser ist Projektverantwortliche<br />
im Team Digitalisierung<br />
und seit 2020 bei der GemNova.<br />
Kontakt: v.kaiser@gemnova.at<br />
„Die Corona-Krise zeigt einmal mehr, wie<br />
viele komplexe Aufgaben die Mitarbeiter*innen<br />
der Gemeinden zu erledigen<br />
haben. Gerade in solchen Zeiten wünscht<br />
sich jeder Bürgermeister und jede Bürgermeisterin<br />
für die Gemeinde eine effiziente<br />
Verwaltung“, bringt es etwa der Präsident<br />
des Tiroler Gemeindeverbandes und Bürgermeister<br />
in Sölden, Ernst Schöpf, auf<br />
den Punkt. Wie kann eine hohe Effizienz<br />
in der Gemeindeverwaltung erreicht werden?<br />
Und was darf nie der Effizienz geopfert<br />
werden? Die Antwort klingt einfach,<br />
eine gelungene Umsetzung ist jedoch oft<br />
mühsam und kompliziert: Standardprozesse<br />
müssen automatisiert werden, Dateneingaben<br />
sollten nur einmal erfolgen und<br />
Ablagesysteme müssen in den Arbeitsprozess<br />
integriert sein. Denn jeder zusätzliche<br />
Schritt kostet Effizienz und raubt<br />
den Mitarbeiter*innen in den Gemeinden<br />
Zeit. Und das alles unter den obersten<br />
Prämissen im Gemeindeamt: Rechtssicherheit<br />
und Qualität.<br />
Genau diese Anforderungen erfüllt Georg.<br />
Die moderne Verwaltungssoftware zeichnet<br />
sich u. a. dadurch aus, dass sämtliche<br />
für die Gemeinde relevanten Daten nur<br />
in einer Datenbank verarbeitet werden.<br />
Georg zapft dafür die Register wie das<br />
zentrale Melderegister, das AGWR, das<br />
Grundbuch, das Firmenregister, Finanz-<br />
Online und weitere für die jeweiligen Prozesse<br />
notwendige Register an. Das hilft<br />
bei der Schaffung von Effizienz und verringert<br />
ganz klar das Fehlerrisiko (etwa<br />
durch falsch geschriebene Namen).<br />
Dadurch ergeben sich für Gemeinden<br />
eine ganze Reihe von Vorteilen:<br />
+ Es findet echte, sinnvolle Digitalisierung<br />
statt, denn die Daten werden in<br />
den Registern gepflegt und müssen<br />
nicht noch einmal in der Verwaltungssoftware<br />
„nachgezogen“ und laufend<br />
abgeglichen werden.<br />
+ Jede Abteilung der Gemeinde arbeitet<br />
nicht nur mit einheitlichen, sondern<br />
auch mit korrekten Daten.<br />
+ Prozesse können viel einfacher automatisiert<br />
werden.<br />
+ Ein sehr wesentlicher Aspekt: Die verarbeiteten<br />
Daten sind rechtlich korrekt<br />
verwendet und erfüllen die Anforderungen<br />
der Bundesabgabenordnung.<br />
Wie kann eine<br />
hohe Effizienz in<br />
der Gemeindeverwaltung<br />
erreicht<br />
werden? Und was<br />
darf nie der<br />
Effizienz geopfert<br />
werden?<br />
Was sagen die Expert*innen? Welche Prozesse<br />
werden nun beispielsweise automatisiert?<br />
Christian Lechner, einst selbst<br />
Amtsleiter, kennt die Probleme nur zu gut,<br />
die Gemeindemitarbeiter*innen oft plagen.<br />
„AUS DER VERWENDUNG VON<br />
NUR EINER SOFTWARE UND<br />
EINER DATENBANK RESUL-<br />
TIEREN GROSSE VORTEILE.<br />
ES MÜSSEN KEINE BARCODES<br />
ODER NUMMERN VERWENDET<br />
WERDEN, UM DATEN, DIE<br />
ZUSAMMENGEHÖREN,<br />
MITEINANDER ZU VERBINDEN.<br />
BEISPIELSWEISE EINE<br />
BUCHUNG MIT DEM ENTSPRE-<br />
CHENDEN BELEG.“<br />
„Weiteres Beispiel: Wenn sowohl das<br />
Bauamt als auch die Gemeindebuchhaltung<br />
im selben System arbeiten, werden<br />
Rechnungen vom Bauamt direkt in der<br />
Buchhaltung verbucht. Das Eingreifen des<br />
Buchhalters ist nicht mehr notwendig“,<br />
schildert der GemNova-Experte einen der<br />
großen Vorteile von Georg. Sein Kollege<br />
Georg Hochfilzer legt nach: „Ein weiterer<br />
Vorteil von Georg besteht darin, dass<br />
Unterlagen aus finanzonline und dem<br />
Unternehmensserviceportal direkt in den<br />
Posteingang eingespielt und zur weiteren<br />
Verarbeitung bereitgestellt werden. Automatisierte<br />
Prozesse sind hier beispielsweise<br />
bei der Grundsteuer hinterlegt,<br />
sodass etliche ‚analoge‘ Arbeitsschritte in<br />
der Gemeinde eingespart werden. Neue<br />
Bescheide bzw. Eigentümerwechsel werden<br />
den Mitarbeiter*innen in der Finanzabteilung<br />
zur Kenntnis mitgeteilt, die langwierige<br />
Arbeit, jeden Bescheid manuell zu pflegen,<br />
entfällt. Somit vermindert dieser Prozess<br />
beispielsweise zusätzlich sehr stark das<br />
Risiko einer potenziellen Verjährung durch<br />
ungenügend konsolidierte Daten.“<br />
Welche Vorteile sich für die Gemeindeleitung<br />
ergeben, darauf hat der GemNova-<br />
Finanzexperte Christoph Carotta eine klare<br />
Antwort: „Neben der höheren Effizienz der<br />
Verwaltung haben der Bürgermeister, der<br />
Amtsleiter oder auch der Abteilungsleiter<br />
die genaue Übersicht über das Budget. Bei<br />
jeder Rechnung, die freigegeben wird, ist<br />
eindeutig ersichtlich, ob auf der betreffenden<br />
Kostenstelle noch genügend Budget<br />
vorhanden ist.“<br />
Um mit der Automatisierung von Prozessen<br />
überhaupt beginnen zu können, müssen<br />
die Daten aller Register überprüft und<br />
gegebenenfalls korrigiert werden. Nur mit<br />
korrekten Daten können automatisierte<br />
Prozesse einwandfrei laufen. Die AGWR-<br />
Daten sind beispielsweise die Grundlage<br />
für die automatisierte Berechnung von<br />
gebäudebezogenen Gebühren (z. B. Müllgrundgebühr).<br />
Einmal vernünftig gepflegt<br />
und die Regeln aus der Verordnung hinterlegt,<br />
kümmert sich Georg vollautomatisch<br />
im „Regelbetrieb“ um die gesamte<br />
Abwicklung. Das Team der GemNova hat<br />
zuletzt sehr viele praktische Erfahrungen<br />
in Sachen gepflegter Registerdaten<br />
gesammelt. Das Team steht mit diesem<br />
umfangreichen Wissen – wenn gewünscht<br />
– nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat<br />
zur Seite. Etwa für die Analyse von bestehenden<br />
Registern inklusive Durchführung<br />
von Plausibilitätsprüfungen.<br />
GERNE STEHEN FÜR<br />
WEITERE INFORMATIONEN<br />
ZUR VERFÜGUNG:<br />
Gabriele Kaplenig (g.kaplenig@<br />
gemnova.at), Verena Kaiser<br />
(v.kaiser@gemnova.at), Norbert<br />
Pfleger (n.pfleger@gemnova.at)<br />
von Open Digital oder Ihr Gemeindebetreuer<br />
der GemNova.<br />
AGWR<br />
GRUND-<br />
BUCH<br />
UR<br />
ZMR<br />
DATEN-<br />
SATZ
22 tirol.digital tirol.digital<br />
23<br />
WARUM<br />
UM ALLES IN DER WELT BIN ICH EIN BLAUER KRAKE?<br />
Kinder,<br />
was ist das<br />
AGWR*?<br />
Ohhhhh Mann, Papa,<br />
das wissen wir<br />
schon lange! Bitte eine<br />
schwerere Aufgabe!<br />
2<br />
Einmal gelernte Fähigkeiten<br />
werden von Generation zu<br />
Generation weitergegeben.<br />
* Das Adressregister und das Gebäude-<br />
und Wohnungsregister ist eines<br />
der wichtigsten Register für die<br />
automatisierten Prozesse in Georg.<br />
Gestern hab ich in den Spiegel geschaut und mich gefragt,<br />
wieso ich eigentlich so aussehe, wie ich aussehe. Was<br />
haben sich die Tiroler dabei gedacht, aus mir ein blaues<br />
krakenähnliches Tier zu machen?<br />
Also hab ich mich auf die Suche nach einer Erklärung gemacht. Geschaffen<br />
haben mich meine Patinnen und Paten von der OpenDigital. Die haben mich<br />
von klein auf mit meinen Funktionsweisen, meinem Daseinsgrund und meinen<br />
Besonderheiten großgezogen. Und mittlerweile bin ich, so sagen sie, nicht mehr<br />
aus der OpenDigital-Familie wegzudenken.<br />
Kraken haben acht Arme, die<br />
sie unabhängig voneinander<br />
bewegen können. Sie können<br />
dadurch viele Aufgaben gleichzeitig<br />
lösen.<br />
3<br />
4<br />
1<br />
Kraken sind richtig intelligente Tiere.<br />
Das Gehirn von Kraken ist besonders leistungsfähig.<br />
Sie bewältigen Irrgarten-Probleme<br />
besser als die meisten Säugetiere.<br />
Sie haben ein mehrteiliges Herz.<br />
Fällt ein Teil aus, kann der andere<br />
Teil einspringen. Keine Ausfälle bei<br />
Georg und ein großes Herz bedeuten<br />
Ausfallsicherheit und Platz für jeden.<br />
Georgs Herz schlägt<br />
für Tirols Gemeinden<br />
Jetzt ist doch eigentlich alles klar! Ich führe euch<br />
aufgrund meiner hervorragenden Intelligenz durch den<br />
Irrgarten der Gemeindeverwaltung. Meine acht Arme<br />
unterstützen euch bei den unglaublich vielen und unterschiedlichen<br />
Aufgaben, die immer mehr werden. Diese<br />
Aufgaben erledige ich auch noch im Rekordtempo, weil<br />
ich meine Arme ja unabhängig voneinander bewegen<br />
kann und mehrere Aufgaben auf einmal löse. Und wenn<br />
ich erst mal alle Daten aufgesaugt und richtig verknüpft<br />
habe, dann vergessen weder ich noch meine Nachkommen,<br />
wie die Abläufe sind. Mein mehrteiliges Herz trägt<br />
dazu bei, dass ich immer für euch da bin und alle von<br />
euch in mein Herz schließen kann.
24<br />
tirol.digital tirol.digital<br />
„DAS NEUE<br />
AMTSDEUTSCH“ –<br />
EINFACH UND LEICHTE<br />
SPRACHE IM EINSATZ<br />
IN DEN GEMEINDEN<br />
Neben den technischen Voraussetzungen<br />
der digitalen Barrierefreiheit<br />
wurde in den letzten Jahren<br />
das Konzept der einfachen und<br />
leichten Sprache entwickelt. Somit<br />
ermöglicht man Menschen mit<br />
Lese- und Verständnisschwäche,<br />
Menschen mit Behinderungen,<br />
ältere Menschen oder auch Menschen<br />
mit Migrationshintergrund<br />
das Verstehen schriftlicher Texte.<br />
Viele Behörden, Nachrichtenseiten<br />
und auch private Unternehmen bieten<br />
heute bereits Informationen in<br />
einfacher und leichter Sprache an.<br />
Die Gemnova-Expertin Dr. Monika<br />
Matzegger hat einen Workshop<br />
entwickelt, der Mitarbeiter*innen in<br />
den Gemeinden auf den Einsatz der<br />
einfachen und leichten Sprache vorbereitet.<br />
Es werden Begrifflichkeiten<br />
geklärt, warum der Einsatz der einfachen<br />
und leichten Sprache immer<br />
mehr an Bedeutung gewinnt und<br />
welche Zielgruppen sie hat. Nachdem<br />
aktuelle Regelwerke erklärt und<br />
die wichtigsten Regeln besprochen<br />
wurden, geht es für die Teilnehmer*innen<br />
an die Textarbeit. Texte<br />
aus dem Alltag im Amt werden<br />
analysiert und in zielgruppengerechte<br />
Sprache gebracht. Nach den<br />
Workshops sollen selbständig Texte<br />
bearbeitet und Texte in verständlicher<br />
Sprache verfasst werden können.<br />
Ziel ist die Sensibilisierung für die<br />
einfache und leichte Sprache und<br />
einen bewussten Umgang damit.<br />
Informationen dazu bei<br />
c.eder-haslehner@gemnova.at<br />
DIGITALE<br />
BARRIEREFREIHEIT –<br />
VERPFLICHTEND FÜR<br />
ALLE GEMEINDEN<br />
Laut Tiroler Antidiskriminierungsgesetz müssen bereits<br />
seit 2005 alle Dienstleistungen und Güter öffentlicher<br />
Einrichtungen barrierefrei zugänglich sein. Das gilt auch<br />
für Websites. Eine EU-Richtlinie von 2018 gibt zur Umsetzung<br />
dieses Vorhabens gezielte Maßnahmen vor. Im Land<br />
Tirol ist die Ombudsstelle für barrierefreies Internet mit<br />
diesem Thema betraut.<br />
ZUR AUTORIN<br />
DANIELA FRIEDLE, MA<br />
Daniela Friedle ist Expertin für<br />
digitale Barrierefreiheit und<br />
leitet die Ombudsstelle für barrierefreies<br />
Internet und mobile<br />
Anwendungen im Land Tirol.<br />
BILD: © Berger<br />
Was bedeutet Barrierefreiheit im<br />
Internet?<br />
Blinde Menschen bzw. Menschen mit<br />
beeinträchtigter Sicht verwenden Programme<br />
(sog. Screenreader), die ihnen<br />
Website-Texte vorlesen. Diese Texte müssen<br />
aber so aufbereitet und eingepflegt<br />
werden, dass die Programme Zugriff auf<br />
die Informationen haben. Zum Beispiel<br />
lassen sich Bilder nicht lesen – für sie<br />
müssen daher Alternativtexte vorhanden<br />
sein, die beschreiben, was auf einem Bild<br />
zu sehen ist. Die richtige Verwendung von<br />
Überschriften und Navigationselementen<br />
ist essenziell – eine falsche Umsetzung<br />
bedeutet für blinde Menschen, dass sie<br />
Websites und Dokumente auf der Suche<br />
nach Informationen von oben bis unten<br />
durchlesen müssen und nicht schnell zwischen<br />
den einzelnen Inhalten navigieren<br />
können. Auch wenn Text zu klein geschrieben<br />
ist, haben Menschen mit einer Seheinschränkung,<br />
aber auch ältere Menschen<br />
Probleme, um hier nur ein Beispiel<br />
zu nennen.<br />
Müssen Websites barrierefrei sein?<br />
Öffentliche Stellen in allen EU-Ländern<br />
müssen die EU-Richtlinie (EU) 2016/2102<br />
für digitale Barrierefreiheit auf Websites<br />
und in Mobile-Apps umsetzen. Die Richtlinie<br />
wurde auf Landesebene durch § 14b<br />
zum barrierefreien Zugang zu Websites<br />
und mobilen Anwendungen im Tiroler<br />
Antidiskriminierungsgesetz umgesetzt.<br />
Die Richtlinie sieht außerdem ein regelmäßiges<br />
Monitoring über den Umsetzungsstand<br />
in den Mitgliedstaaten vor.<br />
Personen, die sich durch Gestaltung und<br />
Nutzungseinschränkungen benachteiligt<br />
fühlen, stehen rechtliche Schritte zur Verfügung.<br />
Sie können sich zunächst an den<br />
Inhaber der Website wenden (dieser muss<br />
aus der Barrierefreiheitserklärung hervorgehen)<br />
– und wenn es hier keine zufriedenstellende<br />
Ausräumung der Barriere<br />
gibt – an die Ombudsstelle für barrierefreies<br />
Internet und mobile Anwendungen.<br />
Ombudsstelle für barrierefreies Internet<br />
Die Ombudsstelle für barrierefreies Internet<br />
und mobile Anwendungen ist bei der<br />
Servicestelle Gleichbehandlung und Antidiskriminierung<br />
im Land Tirol angesiedelt.<br />
Sie ist Beschwerdestelle und Monitoringstelle.<br />
Sie überwacht, inwieweit Websites<br />
und mobile Anwendungen, die in den<br />
Anwendungsbereich der Richtlinie fallen,<br />
barrierefrei sind. Hierzu wird regelmäßig<br />
ein Bericht erstellt, den die Europäische<br />
Kommission von allen Mitgliedstaaten<br />
bekommt. Zudem ist ein wichtiger Aufgabenbereich<br />
die Aufklärung über das Thema<br />
digitale Barrierefreiheit. Hierzu wurden u. a.<br />
Gemeinden bereits über die Verpflichtung<br />
zur Barrierefreiheit informiert und eine<br />
Schulung angeboten. Für Herbst <strong>2021</strong> sind<br />
weitere Schulungen geplant.<br />
Was bedeutet das für Gemeinden?<br />
In Zeiten fortschreitender Digitalisierung<br />
und eingeschränkter Mobilität wird es<br />
immer wichtiger, dass allen Bürger*innen<br />
der Zugang zum Internet gewährleistet<br />
wird – unabhängig von Alter, Bildung, Herkunft<br />
oder Behinderung. Für Gemeinden ist<br />
es daher wichtig, Folgendes zu beachten:<br />
+ Richtlinien für barrierefreies Internet<br />
WCAG 2.1 AA: Als barrierefrei gilt eine<br />
Website, wenn sie den Erfolgskriterien<br />
der Richtlinie für barrierefreie Inhalte<br />
WCAG 2.1 in der Konformitätsstufe AA<br />
entspricht.<br />
Tipp: Die einzelnen Erfolgskriterien<br />
können Sie neben der offiziellen Seite<br />
der WCAG in der „Schweizer Accessibility-Checkliste<br />
2.1“ unter folgendem<br />
Link nachlesen: https://a11y.digitaleschweiz.swiss/de/criteria/.<br />
Diese<br />
Website befindet sich zwar noch in<br />
der Beta-Version, dennoch werden<br />
die Erfolgskriterien sehr gut beschrie-<br />
ben und eine Checkliste angeboten,<br />
anhand derer man seine Website auf<br />
Barrierefreiheit hin überprüfen kann.<br />
+ Barrierefreiheitserklärung: Die Barrierefreiheitserklärung<br />
ist ein Instrument,<br />
um (noch) nicht gelöste Probleme klar<br />
zu kommunizieren. Dabei kann darauf<br />
hingewiesen werden, in welchem<br />
Zeitraum mit einer Lösung gerechnet<br />
werden kann. Eine Beispielerklärung<br />
wird von der Europäischen Kommission<br />
festgelegt, und jede öffentliche<br />
Einrichtung ist verpflichtet, sie allen<br />
Benutzer*innen zugänglich zu machen.<br />
„In Zeiten<br />
fortschreitender Digitalisierung<br />
und eingeschränkter<br />
Mobilität wird es immer<br />
wichtiger, dass allen<br />
Bürger*innen der Zugang<br />
zum Internet gewährleistet<br />
wird – unabhängig von Alter,<br />
Bildung, Herkunft oder<br />
Behinderung.“<br />
25<br />
+ Barrierefreie Dokumente: Das Thema<br />
„Barrierefreies Internet“ betrifft<br />
nicht nur die Redakteur*innen, die für<br />
die Website verantwortlich sind. Auch<br />
die Gestaltung von Word-Dokumenten,<br />
PDF-Dokumenten, Einladungen im<br />
PDF-Format und allen weiteren digitalen<br />
Kommunikationsformen muss<br />
barrierefrei sein.<br />
Zur Umsetzung der genannten Bereiche<br />
wird empfohlen, die Webentwickler der<br />
Gemeinde-Website hinzuzuziehen.<br />
Weiterführende Informationen u. a.<br />
zur Barrierefreiheitserklärung und zu<br />
barrierefreien Dokumenten finden Sie<br />
auf folgender Website: www.tirol.gv.at/<br />
gesellschaft-soziales/gleichbehandlung-antidiskriminierung/barrierefreies-internet/oeffentliche-einrichtungen/
26<br />
tirol.blickt über die Grenzen<br />
DAS DIGITALE BÜRGERSERVICE<br />
DER GEMEINDE SAAS-FEE<br />
ZUM AUTOR<br />
GEORG KEUSCHNIGG<br />
Georg Keuschnigg ist seit <strong>März</strong><br />
2020 freier Mitarbeiter bei<br />
GemNova. Er war Abgeordneter im<br />
Nationalrat und Bundesrat. Nach<br />
seinem Ausscheiden aus dem Bundesrat<br />
wechselte er zum Institut<br />
für Föderalismus, wo er für Politik,<br />
Kommunikation und Projektmanagement<br />
zuständig war.<br />
Kontakt: g.keuschnigg@gemnova.at<br />
Die Digitalisierung ermöglicht<br />
im Bürgerservice und in der<br />
Gemeindeverwaltung viele neue<br />
Chancen. Aber können da auch<br />
kleine und kleinste Gemeinden<br />
mithalten?<br />
Die 1500-Einwohner*innen-Gemeinde Saas-<br />
Fee, die sich selbst gerne als „Perle der<br />
Alpen“ bezeichnet, hat schon sehr früh auf<br />
Digitalisierung gesetzt und zwischenzeitlich<br />
ein hohes Niveau erreicht. Georg Keuschnigg<br />
hat darüber mit Gemeindeschreiber (Amtsleiter)<br />
Bernd Kalbermatten gesprochen.<br />
Herr Kalbermatten, Saas-Fee hat digital<br />
viel zu bieten. Wie haben sich die<br />
Services entwickelt?<br />
Saas-Fee war im Jahre 1996 eine der ersten<br />
Kleinstgemeinden, die ihre Informationen<br />
über eine Homepage publiziert haben.<br />
Im Jahre 2006 wurde in Zusammenarbeit<br />
mit einer nationalen Unternehmung die<br />
Homepage komplett überarbeitet, und<br />
erstmals wurden diverse Online-Dienste<br />
angeboten. Die Gemeinde Saas-Fee ist<br />
mit ihrem Internetauftritt mit dem „Eugen“<br />
2008 für ausgezeichnetes Electronic-<br />
Government ausgezeichnet worden. In<br />
den vergangenen Jahren haben wir unser<br />
Angebot ständig erweitert, unter anderem<br />
entspricht unsere Homepage den behindertengerechten<br />
Anforderungen. So können<br />
sich Besucher*innen unserer Seite<br />
den Inhalt auch mittels eines Speakers<br />
vorlesen lassen. Die Inhalte der einzelnen<br />
Websites lassen sich problemlos auf<br />
portablen Geräten (Laptops, Handys usw.)<br />
ohne visuelle Einschränkungen anzeigen.<br />
Zu den einzelnen Angeboten: Was wird<br />
über den Online-Gemeindeschalter alles<br />
abgewickelt?<br />
Die Gemeinde Saas-Fee bietet in ihrem<br />
Online-Schalter eine große Vielfalt an<br />
Möglichkeiten an, die der einzelnen Person<br />
den Gang auf die Gemeindeverwaltung<br />
ersparen sollen. Neuzuzügler*innen haben<br />
die Möglichkeit, sich online anzumelden,<br />
Wegzügler*innen können sich abmelden,<br />
Gesuchsformulare können online ausgefüllt<br />
und übermittelt werden.<br />
Saas-Fee verfügt über zwei spezielle<br />
Online-Dienste. Welchen Nutzen bringen<br />
sie?<br />
Über Crossiety, dem digitalen Dorfplatz<br />
versuchen wir, dass sich unsere Einheimischen<br />
digital austauschen, den Vereinen<br />
eine Kommunikationsplattform<br />
geboten wird und über den Marktplatz<br />
Gegenstände verkauft oder ausgetauscht<br />
werden. Mit „Notify“ erhalten unsere Einwohner*innen<br />
im Übrigen zeitnahe mittels<br />
Push-Meldung wichtige Informationen<br />
zu Straßensperrungen, Anlässen und<br />
dergleichen.<br />
Welches digitale Angebot wird von den<br />
Bürger*innen am meisten genützt?<br />
Wir wissen, dass von unseren 1500 Einwohner*innen<br />
ca. 500 bei Crossiety registriert<br />
sind und über 750 Personen sich<br />
bei Notify registriert haben. Unsere Bevölkerung<br />
wünscht eine zeitnahe Information,<br />
die sie über unsere diversen digitalen<br />
Kanäle jederzeit erhält.<br />
Und was bringt die Digitalisierung bei der<br />
Optimierung der Verwaltungsabläufe?<br />
Die Digitalisierung hat den Vorteil, dass<br />
auf der Gemeindeverwaltung weniger Frequenzen<br />
zu verzeichnen sind, im Gegenzug<br />
jedoch die digitalen Anfragen zeitnahe<br />
bearbeitet werden können.<br />
„Die Gemeinde<br />
Saas-Fee ist mit ihrem<br />
Internetauftritt mit<br />
dem „Eugen“ 2008<br />
für ausgezeichnetes<br />
Electronic-Government<br />
ausgezeichnet worden.“<br />
BERND KALBERMATTEN<br />
GEMEINDESCHREIBER VON<br />
SAAS FEE,<br />
berichtet über den digitalen<br />
Bürger*innen-Service der Gemeinde.<br />
(© Gemeinde Saas-Fee)<br />
tirol.blickt über die Grenzen<br />
Mit welchen Partner*innen arbeitet<br />
Saas-Fee zusammen?<br />
Wir arbeiten mit bekannten Dienstanbieter*innen<br />
zusammen: Die Homepage wird<br />
von I-weg.ch technisch serviciert, Informationen<br />
über „Crossiety – der digitale<br />
Dorfplatz“ und über Notify holen Sie am<br />
besten über die Homepages der Anbieter*innen<br />
ein: www.crossiety.ch und www.<br />
messengerpeople.ch.<br />
Saas-Fee plant, sich am Projekt<br />
„Smart Villages“ zu beteiligen. Welche<br />
Ziele verfolgen Sie damit?<br />
Mit dieser Projektteilnahme erfolgt einerseits<br />
der Gedankenaustausch mit anderen<br />
Gemeinden in ähnlicher Situation,<br />
wie wir sie haben. Zum anderen versuchen<br />
wir, ein digitales Projekt umzusetzen,<br />
welches für unsere Bürger*innen<br />
einen Vorteil mit sich bringen soll. Aus<br />
dem Projekt heraus entstanden ist unter<br />
anderem die Realisierung eines Coworking-Angebotes<br />
sowie der digitale Dorfplatz,<br />
der mittlerweile zum Bestandteil<br />
der internen und externen Kommunikation<br />
gehört.<br />
Wie weit sind Sie mit dem Coworking-<br />
Angebot?<br />
Das Angebot wurde leider aufgrund der<br />
aktuellen Covid-Situation immer wieder<br />
nach hinten verschoben. Aktuell<br />
gehen wir davon aus, dass Saas-Fee auf<br />
den Sommer <strong>2021</strong> hin entsprechende<br />
Arbeitsplätze zur Verfügung stellen kann.<br />
Abschließend: Wie ist es gelungen,<br />
sich im digitalen Bereich so offensiv<br />
aufzustellen?<br />
Die operative Leitung der Gemeinde<br />
Saas-Fee hat den permanenten Rückhalt<br />
der strategischen Ebene, sprich des<br />
Gemeinderats erhalten. Der Gemeinderat<br />
unterstützt die Digitalisierung und<br />
erkennt den Mehrwert dieser Dienste.<br />
BILD: (© SaastalTourismusAG, levinstudio)<br />
27
28 tirol.mobil<br />
tirol.mobil<br />
29<br />
AUF ALLEN VIEREN<br />
Schnee, Eis und glatte Straßen, aber auch bei unwegsamem Gelände: Ein Allradantrieb<br />
verbessert maßgeblich die Fahrstabilität, hat aber durch das höhere Gewicht zumeist<br />
auch einen gewissen Mehrverbrauch. Mit dem Suzuki Vitara gehören die höheren Verbrauchskosten<br />
jedoch der Vergangenheit an.<br />
ZUM AUTOR<br />
ROBERT BALAZINEC KOLLNIG<br />
Robert B. Kollnig ist von Beginn an bei der<br />
GemNova tätig. Er koordiniert den Bereich<br />
Beschaffung und ist darüber hinaus im Fuhrparkmanagement<br />
tätig. Im Laufe der Jahre hat<br />
er zahlreiche Gemeinden und Feuerwehren bei<br />
der Beschaffung von Fahrzeugen unterstützt.<br />
Kontakt: r.kollnig@gemnova.at<br />
„Think Hybrid – Drive Suzuki“<br />
Alle Modelle, angefangen vom Suzuki Swift<br />
bis hin zum Vitara, sind mittlerweile ausschließlich<br />
mit dem Mild-Hybrid-System<br />
ausgestattet. Die innovative Kombination<br />
aus Benzin- und Elektromotor reduziert<br />
den Verbrauch sowie CO2-Emissionen. Die<br />
Aufladung erfolgt automatisch, sodass man<br />
sich um nichts kümmern muss, was das<br />
Thema Elektrifizierung betrifft. Darüber<br />
hinaus meistert der 129 PS starke Motor<br />
die steilsten Passagen und unbefestigtes<br />
Terrain mühelos.<br />
www.auto-sparer.at<br />
Verbrauch „kombiniert“: 5,7-6,2 l/100 km, CO₂-Emission: 128-141 g/km*<br />
Auto Sparer GmbH<br />
Innsbruckerstraße 21<br />
6380 St. Johann in Tirol<br />
Tel: +43 5352 62385<br />
* WLTP-geprüft. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Symbolfoto.<br />
Mehr Informationen auf www.auto-sparer.at oder bei uns im Autohaus.<br />
Neuer GemNova-Partner in Sachen Allrad-<br />
und Elektroantrieb<br />
Mit dem Autohaus Sparer hat die GemNova<br />
einen neuen starken Partner an ihrer<br />
Seite. Neben der Fachexpertise im Allradbereich<br />
bietet Sparer nicht nur innovative<br />
Elektrofahrzeuge, sondern auch ein zertifiziert<br />
ausgebildetes Team, welches sich<br />
um Lösungen im Bereich Elektromobilität<br />
kümmert. „Wir freuen uns sehr, dass wir<br />
gemeinsam mit dem GemNova-Fuhrparkmanagement<br />
den Tiroler Gemeinden ein<br />
innovatives Allradfahrzeug anbieten können.<br />
Der Suzuki Vitara bietet<br />
neben seinem neuen<br />
Motor optional auch<br />
Allgrip Select, welches<br />
einen hervorragenden<br />
Halt und perfekte Kontrolle<br />
auf jedem Untergrund<br />
bietet“, so Herbert<br />
Sparer. Mit Allgrip<br />
Select kann aus vier<br />
verschiedenen Fahrmodi<br />
gewählt werden:<br />
Auto, Sport, Snow und<br />
Lock. Mit Letzterem ist<br />
es ein Leichtes, sich<br />
aus Schnee, Sand oder<br />
Schlamm zu befreien.<br />
Walter Steiger vom<br />
GemNova-Fuhrparkmanagement<br />
ergänzt:<br />
„Mit dem Suzuki Vitara<br />
können wir ein<br />
Fahrzeug anbieten,<br />
dass alle Bedürfnisse<br />
abdeckt, Kosten reduziert<br />
und die Umwelt<br />
entlastet.“<br />
OBEN: Walter Steiger (links) von der<br />
GemNova und Herbert Sparer vom<br />
Autohaus Sparer freuen sich über die<br />
Zusammenarbeit. (© Autohaus Sparer)<br />
RECHTS: Der neue Suzuki Vitara<br />
ist über die GemNova zu günstigen<br />
Konditionen erhältlich. (© Suzuki)<br />
„Mit dem Suzuki<br />
Vitara können wir<br />
ein Fahrzeug anbieten,<br />
das alle Bedürfnisse<br />
abdeckt, Kosten reduziert<br />
und die Umwelt<br />
entlastet.“<br />
VITARA HYBRID 1.4 DITC HYBRID 1.4 DITC HYBRID 6AT 1.4 DITC HYBRID ALLGRIP 1.4 DITC HYBRID ALLGRIP 6AT<br />
Bauart<br />
Wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor mit Abgasturbolader, 2 obenliegende Nockenwellen, Direkteinspritzung<br />
Hubraum<br />
1.373 ccm<br />
Max. Leistung<br />
95 kW (129 PS) bei 5.500 U/min<br />
Max. Drehmoment<br />
235 Nm bei 2.000-3.000 U/min<br />
Höchstgeschwindigkeit<br />
190 km/h<br />
Beschleunigung (0–100 km/h) 9,5 Sek. 9,5 Sek. 10,2 Sek. 10,2 Sek.<br />
Abgasnorm<br />
EURO 6d-ISC-FCM<br />
FAHRWERK<br />
Lenkung<br />
Elektrisch unterstützte Servolenkung<br />
ABS/ESP<br />
ESP<br />
Bereifung 215/60R16 od. 215/55R17<br />
KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br />
Kraftstoffverbrauch<br />
5,4 l/100 km – 5,6 l/100 km 5,7 l/100 km – 5,9 l/100 km 5,8 l/100 km – 6,1 l/100 km 6,2 l/100 km – 6,5 l/100 km<br />
kombinierter Testzyklus 1 2<br />
CO₂-Ausstoß kombinierter<br />
121 g/km – 125 g/km 128 g/km – 133 g/km 131 g/km – 136 g/km 140 g/km – 146 g/km<br />
Testzyklus 1 2<br />
Kraftstoffart<br />
Benzin<br />
Tankinhalt<br />
47 l<br />
QUELLE: Suzuki
30<br />
tirol.mobil<br />
tirol.mobil<br />
31<br />
NACHHALTIGE<br />
MOBILITÄT<br />
UNTEN:<br />
Thomas Hilber<br />
von HilberSolar<br />
(© HilberSolar)<br />
Das PV Bikeport verkörpert<br />
Innovation und Umweltbewusstsein,<br />
ist überaus flexibel, robust<br />
und richtig smart!<br />
DIE AUTARKE UND MOBILE LADESTATION FÜR<br />
E-BIKES UND E-ROLLER: AUFSTELLEN UND LOSLEGEN!<br />
ausgezeichnet<br />
mit dem Preis<br />
für "Nachhaltige<br />
alpine Technologie"<br />
ZUM AUTOR<br />
DIPL-BW. ANDREAS KNAPP, MBA<br />
Andreas Knapp ist bei der GemNova im Bereich<br />
Multimodale Mobilität tätig. Er verfügt über jahrelange<br />
Erfahrung bei der Planung, Finanzierung und Ausschreibung<br />
von regionalen Mobilitätskonzepten.<br />
Kontakt: a.knapp@gemnova.at<br />
fixfertige<br />
Lieferung<br />
problemloser Stellplatzwechsel,<br />
unabhängig vom<br />
bestehenden Untergrund<br />
Thomas<br />
Hilber<br />
BILD:<br />
Thomas Hilber<br />
von HilberSolar<br />
(© HilberSolar)<br />
Zu einem funktionierenden regio-<br />
nalen Mobilitätskonzept gehört auch die<br />
Einbindung und Abbildung lokaler und regionaler<br />
Bedürfnisse von Radfahrer*innen. Ins-<br />
besondere seit dem Einzug des E-Bikes in<br />
unseren Alltag ist das Biken nicht mehr nur<br />
sportliches Betätigen, sondern auch in der<br />
Alltagsmobilität angekommen.<br />
Neben einem funktionierenden Radwegenetz ist<br />
vor allem die Radinfrastruktur am Zielort ausschlaggebend,<br />
ob das Rad als alltagstaugliches<br />
Verkehrsmittel angenommen wird. Die Suche<br />
nach funktionierenden, flexiblen und innovativen<br />
Lösungen führte uns zur Firma HilberSolar<br />
(www.hilbersolar.at).<br />
Da es nicht nur Abstellmöglichkeiten bei Bahnhöfen,<br />
Gemeindeämtern, Bergbahnen, Geschäften<br />
usw. braucht, sondern auch bei Ausflugszielen,<br />
Haltestellen oder Berghütten bieten die<br />
Radabstellanlagen mit Photovoltaik-Überdachung<br />
diesen wichtigen Vorteil direkt vor Ort,<br />
wenn keine direkte Stromversorgung für das<br />
Laden eines Akkus vor Ort vorhanden ist.<br />
„Das PV Bikeport wird fixfertig geliefert und<br />
ist die perfekte Lösung mit einfacher Montage<br />
und Inbetriebnahme – aufstellen und loslegen!“,<br />
so Thomas Hilber. „Mit diesem Produkt<br />
können Unternehmen, Tourismusverbände und<br />
Gemeinden zeigen, wie sie zur Mobilitätswende<br />
stehen, und einen aktiven Beitrag leisten. Ob für<br />
Mitarbeiter*innen, Kund*innen, Anwohner*innen<br />
oder Besucher*innen – das PV Bikeport verkörpert<br />
Innovation und Umweltbewusstsein,<br />
ist überaus flexibel, robust und richtig smart!“<br />
BILD: Das PV Bikeport<br />
kann überall aufgestellt werden<br />
und ist Teil einer aktiven Mobilitätswende.<br />
(© HilberSolar)<br />
So kann das mobile PV Bikeport zum Beispiel<br />
ohne Probleme den Stellplatz wechseln, was<br />
aufgrund der Verwendung eines Gewichtsfundaments<br />
unabhängig vom bestehenden Untergrund<br />
und ohne zusätzliche Befestigungsmaßnahmen<br />
erfolgen kann. Das bedeutet auch eine<br />
einfache modulare Erweiterung des Bikeports.<br />
Das eigens installierte WLAN ermöglicht es<br />
dem Betreiber oder einem Servicebeauftragten,<br />
per Fernzugriff die Anlage zu überwachen und<br />
Einstellungen vorzunehmen. Durch die Variante<br />
mit integriertem Speicher wird zudem vollständige<br />
Autarkie erreicht.<br />
Neben den eigentlichen Funktionen einer Ladestation<br />
und Sammelstelle für E-Bikes oder<br />
E-Roller gibt es weitere konfigurierbare Features<br />
wie etwa beleuchtete Werbeflächen (City-<br />
Light-Formate) oder spezielle Fahrradständer<br />
zur sicheren Verwahrung der wertvollen E-Bikes<br />
mit Zahlenschloss sowie versperrbare Schränke<br />
zum Beispiel für die Verwahrung von Gegenständen<br />
(Rucksack, Wetterschutz, Helm).<br />
Für das innovative PV Bikeport erhielt die Firma<br />
Hilber im Dezember 2020 einen Preis für<br />
„Nachhaltige alpine Technologien“ und wurde<br />
für den Eurobike Award vorgeschlagen.
32 tirol.modern und innovativ tirol.modern und innovativ<br />
33<br />
ZUM AUTOR<br />
JAN SCHÄFER<br />
Jan Schäfer ist Experte für Marketing<br />
und Kommunikation. Er war<br />
maßgeblich bei der Entstehung<br />
des neuen GemNova-Buches „Wir<br />
alle sind Gemeinde“ beteiligt und<br />
unterstützt seit heuer die<br />
GemNova als Gemeindebetreuer<br />
in Osttirol.<br />
Kontakt: j.schaefer@gemnova.at<br />
OBEN:<br />
Porträtaufnahmen am<br />
Hochstadel/Lienzer Dolomiten<br />
(© Martin Lugger)<br />
WENN<br />
LANDSCHAFT<br />
ZUR BÜHNE<br />
FÜR MARKEN UND<br />
PRODUKTE WIRD<br />
Bekanntlich sagt ein Bild mehr als<br />
tausend Worte. Im Marketing und<br />
in der Werbung ist das ein elementarer<br />
Aspekt beim Kommunizieren<br />
von Botschaften und aktueller<br />
denn je.<br />
Angesichts der stetig wachsenden<br />
Informationsflut kommt aussagekräftigen<br />
Bildmotiven immer öfter eine<br />
bedeutende Rolle zu. Der Fotograf Martin<br />
Lugger aus Lienz setzt daher bei<br />
seiner Arbeit auf die vielfältige Landschaft<br />
Osttirols.<br />
Gerade in der Kommunikation und im<br />
Marketing ist der subtile Einfluss von Bildern<br />
auf uns bekannt. Sie wirken automatisch<br />
und unbewusst. Mit Bildern lassen<br />
sich sekundenschnell Botschaften platzieren,<br />
die für das menschliche Gehirn<br />
nicht zu kontrollieren sind. „Schlecht fotografierte<br />
oder falsch ausgewählte Motive<br />
verfehlen ihre Wirkung, weil der jeweilige<br />
Betrachter sich nicht angesprochen fühlt.<br />
Im umgekehrten positiven Fall erfolgt<br />
eine Identifizierung mit dem Bild – und<br />
die Information wird verankert. Bei der<br />
Präsentation von Marken, Produkten oder<br />
Persönlichkeiten muss das im Hinblick<br />
auf Zielgruppen sorgfältig berücksichtigt<br />
werden“, erläutert Martin Lugger. Deshalb<br />
ist der Hintergrund eines Motivs ebenso<br />
wichtig wie die zu fotografierende Person<br />
oder das Objekt.<br />
Mensch, Marke und Landschaft im perfekten<br />
Augenblick verbinden<br />
Osttirol bietet dem Lienzer dafür eine große<br />
Auswahl an Möglichkeiten, ob es die beeindruckenden<br />
Hohen Tauern sind, das urige<br />
Oberland oder die markanten Lienzer Dolomiten.<br />
„Bei uns gibt es unzählige schöne<br />
Plätze zum Fotografieren, die jemand von<br />
außerhalb nicht kennt oder unterschätzt. Es<br />
lassen sich in Osttirol tolle Projekte umsetzen<br />
und das zu jeder Jahreszeit“, betont<br />
Lugger. Die Landschaft versteht der Fotograf<br />
als Bühne, auf der er ein Thema, eine<br />
Marke und Botschaften inszeniert. Gekonnt<br />
versteht er es, im perfekten Augenblick<br />
Menschen mit Materie und Umgebung zu<br />
einer Einheit zu verbinden. Auch das Spiel<br />
mit dem natürlichen Licht ist ihm wichtig.<br />
Je nach Stand der Sonne und Bewölkung<br />
des Himmels verändert sich der Charakter<br />
einer Landschaft. Ganz eigene Stimmungen<br />
entstehen, die die Emotionalität der<br />
Motive zusätzlich unterstreichen. So entstehen<br />
die Geschichten, die Martin Lugger<br />
mit seinen Aufnahmen erzählen will.<br />
„In Osttirol kenne ich jeden<br />
Winkel. Da weiß ich, wo ich<br />
welchen Hintergrund für<br />
ein Thema finde und wann<br />
ich vor Ort sein muss.“<br />
Zur Profifotografie kam der 1980 geborene<br />
Osttiroler erst nach seinem Studium<br />
der Umwelt- und Verfahrenstechnik. Die<br />
Begeisterung für die Fotografie an sich<br />
entdeckte er hingegen schon sehr früh.<br />
Die Grundlagen brachte er sich autodidaktisch<br />
bei und brachte es so schließlich zu<br />
einem erfolgreichen Abschluss zum Fotografenmeister.<br />
Mit diesem Zertifikat stieg<br />
Lugger endgültig in die professionelle<br />
Fotografie ein. Der Lienzer setzte bereits<br />
Projekte für Red Bull oder die Spar-Gruppe<br />
um, ferner arbeitet er für den aus Osttirol<br />
stammenden Handschuhhersteller Zanier.<br />
Aber auch für klein- und mittelständische<br />
Betriebe aus der Region setzte er deren<br />
Produkte und Dienstleistungen ausdrucksstark<br />
in Szene.<br />
Der passende Hintergrund erfordert<br />
genaue Ortskenntnis<br />
Natürlich arbeitet der Fotograf auch in<br />
anderen Regionen Österreichs, Deutschlands<br />
oder Italiens. Martin Lugger ist<br />
BILD:<br />
Zusammenarbeit mit dem Sportkletterer<br />
Herbert Ranggetiner: Shooting für das Red-<br />
Bull-Magazin „Bulletin“ am „Roten Turm“ in<br />
den Lienzer Dolomiten. (© Martin Lugger)<br />
immer dort, wo der Kunde seinen Auftrag<br />
umgesetzt haben möchte. Doch „Dahoam<br />
isch dahoam“. „Zur Vorbereitung eines<br />
Shootings gehört selbstverständlich auch<br />
die Auswahl der Location. Das fällt mir<br />
in Osttirol auf jeden Fall leichter als auswärts.<br />
Dort muss ich mich erst orientieren.<br />
In Osttirol kenne ich jeden Winkel.<br />
Da weiß ich, wo ich welchen Hintergrund<br />
für ein Thema finde und wann ich vor Ort<br />
sein muss“, schmunzelt Martin Lugger.<br />
Dass er den Bezirk gut kennt, liegt nicht<br />
nur daran, dass er in Lienz wohnt. In seiner<br />
Freizeit zieht es ihn in die Berge zum<br />
Sporteln. Dabei hält er immer seine Augen<br />
offen für geeignete Plätze, die er später<br />
für seine Arbeiten nutzen kann.<br />
Seine Leidenschaft für den Sport unterstützt<br />
seine Arbeit in der Bergwelt Osttirols:<br />
Sie erleichtert die Annäherung an<br />
sportliche Themen der Fotografie. Martin<br />
Lugger hat nicht zuletzt dadurch ein<br />
Gespür für das Gelände entwickelt und<br />
dafür, welchen Einfluss die Landschaft<br />
auf die Bewegung hat. Für die Firma<br />
Zanier beispielsweise setzt er Handschuhe<br />
in Szene. Schutz vor Kälte, Robustheit<br />
oder Beweglichkeit der Finger spielen<br />
hier eine Rolle. Und wo ließen sich diese<br />
Eigenschaften besser vermitteln als beim<br />
Freeriden an den schneebedeckten Hängen<br />
der markanten Berge Osttirols? „Bei<br />
solchen Aufnahmen muss man natürlich<br />
wissen, wo man als Fotograf stehen kann.<br />
Da geht es nicht nur um Hintergrund, Story,<br />
Produkt oder Licht. Es kommt ebenso auf<br />
das Timing an“, weiß der Osttiroler.<br />
Gletscher, Flüsse und Fels bringen ihre<br />
eigene Story mit<br />
An Aufnahmen rund um den Sport hat<br />
Martin Lugger viel Freude. Jede Sportart<br />
ist anders und hat ihr eigenes Umfeld.<br />
Dadurch entsteht eine eigene Dynamik,<br />
der Rahmen für die darzustellende Story<br />
und ihre individuelle Dramaturgie. „Es ist<br />
jedes Mal neu. Wenn ich einen Kajakfahrer<br />
auf der Isel fotografiere, ist das<br />
etwas ganz anderes als jemanden beim<br />
Eisklettern an einem Gletscher abzulichten.<br />
Gleiches gilt beim Radfahren, Freeclimbing<br />
oder Golfen. Und Osttirol ist so<br />
vielfältig, dass ich hier nahezu alles in<br />
Szene setzen kann“, sagt Lugger. Selbst<br />
wenn sich die Motive nicht wie beim<br />
Sport bewegen, überlegt sich der Fotograf,<br />
welche Rolle die jeweilige Gegend<br />
– beispielsweise bei der Darstellung von<br />
Immobilien oder Räumlichkeiten – im<br />
Gesamtkonzept der Aufnahmen spielen<br />
kann. Für ihn ist die Landschaft ein<br />
Detail, das gleichberechtigt neben allen<br />
anderen Objekten steht. Zwar kann man<br />
eine Landschaft nicht einfach umstellen<br />
wie etwas, das sich bewegen lässt. Dafür<br />
lässt sich aber die Perspektive ändern.<br />
Und das gelingt um so besser, je genauer<br />
man eine Gegend kennt. Und das trifft für<br />
Martin Lugger und Osttirol zu.
34 tirol.Politik<br />
tirol.Politik<br />
35<br />
EUROPA FÄNGT IN<br />
DER GEMEINDE AN<br />
© Julia Moll<br />
Wir müssen über die<br />
Gemeinde hinaus in<br />
Regionen denken.<br />
2020 war das Jahr des 25-jährigen<br />
Jubiläums der österreichischen EU-<br />
Mitgliedschaft. Was uns diese 25 Jahre<br />
auf regionaler Ebene gebracht haben,<br />
manifestiert sich für mich sehr gut in<br />
der Europaregion Tirol/Südtirol/Trentino.<br />
Es war und ist ein sehr wichtiger<br />
Schritt in der Zusammenarbeit über<br />
die Grenzen hinaus, ein Eckpfeiler,<br />
der auch wesentlichen Einfluss auf<br />
die Arbeit der heimischen Gemeinden<br />
hat. Sei es die Wirtschaft, sei es<br />
der Tourismus, aber auch die kulturelle<br />
Identität der Menschen in der Region,<br />
die gestärkt werden. Ermöglicht wurde<br />
dies durch die Europäische Union, die<br />
Schaffung des Schengen-Raumes und<br />
die gemeinsame Währung Euro. Dies<br />
förderte das wirtschaftliche Zusammenwachsen<br />
der Region.<br />
Auf EU-Seite ist hierbei als Wegbereiter<br />
vor allem die Schaffung des Europäischen<br />
Verbundes territorialer Zusammenarbeit<br />
(EVTZ) hervorzuheben. Der<br />
EVTZ ist ein von der EU 2011 initiierter<br />
Zusammenschluss von Regionen, die<br />
Basis für die Europaregion. Damit kann<br />
die Zusammenarbeit über die Grenzen<br />
hinaus auf eine höhere institutionelle<br />
Ebene gehoben werden.<br />
Ein positives Faktum der letzten Jahre<br />
ist die immer enger werdende Kooperation<br />
im Allgemeinen und die immer<br />
enger werdenden Wirtschaftskooperationen<br />
im Besonderen innerhalb unserer<br />
Europaregion. Neben der Europaregion<br />
ist aber auch Interreg ein Werkzeug,<br />
das in verschiedensten Bereichen die<br />
Zusammenarbeit in den Regionen fördert.<br />
Die Gemeinschaftsinitiative des<br />
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung<br />
(EFRE) ist ein wertvolles Instrument<br />
der europäischen Strukturentwicklung<br />
zur Stärkung der regionalen<br />
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung.<br />
Interreg ist aus Tiroler Sicht<br />
sowohl Richtung Deutschland (Bayern)<br />
als auch Richtung Italien (Südtirol, Trentino)<br />
sehr wertvoll.<br />
Zahlreiche grenzüberschreitende Programme<br />
und Projekte sorgen dafür,<br />
dass auch die einzelnen Gemeinden<br />
davon profitieren. Das ist sehr hilfreich,<br />
wenn man bedenkt, dass die Aufgaben,<br />
die Gemeinden lösen müssen, immer<br />
komplexer werden. Wir müssen über die<br />
Gemeinde hinaus in Regionen denken.<br />
Allein deshalb würde ein bisschen mehr<br />
Europabegeisterung in den Gemeinden<br />
nicht schaden. Da ist sicher noch Luft<br />
nach oben.<br />
Bgm. Mag. Ernst Schöpf<br />
© Land Tirol/Cammerlander<br />
Die EU hat einen wesentlichen<br />
Einfluss auf die<br />
Regionalpolitik und die<br />
Tiroler Gemeinden.<br />
Die Europäische Union beschäftigt sich<br />
unter anderem einerseits mit internationalen<br />
Themen wie Migration, Grenzschutz<br />
oder Digitalisierung. Andererseits<br />
hat sie auch einen Einfluss auf<br />
die Regionen und ihre Entwicklung.<br />
Beim Land Tirol ist ein eigener Fachbereich<br />
„EU Regionalpolitik“ eingerichtet,<br />
mit dem Ziel, Tirol und seine Regionen<br />
als attraktive Lebens- und erfolgreiche<br />
Wirtschaftsräume zukunftsorientiert<br />
weiterzuentwickeln. Gleichzeitig soll<br />
damit auch der wirtschaftliche, soziale<br />
und territoriale Zusammenhalt im<br />
Land gestärkt werden. Die so genannten<br />
EU-Strukturfondsprogramme stellen<br />
dabei ein wesentliches Element zur<br />
Umsetzung der EU-Regionalpolitik dar.<br />
Gemeindereferent LR Johannes Tratter<br />
sieht in vielen Förderungsprogrammen<br />
einen Mehrwert für die Tiroler Gemein-<br />
den und damit in weiterer Folge direkt<br />
für die Bevölkerung: „Ganz klar: Wo ein<br />
Mehrwert, dort steigt auch das Europabewusstsein.<br />
Daher ist es mir ein<br />
wesentliches Anliegen, die Idee Europa<br />
als Vertreter der Landesregierung und<br />
damit als Schnittstelle in die Gemeinden<br />
zu transportieren. Die Europäische<br />
Union fängt bereits im kommunalen<br />
Bereich an. Die zahlreichen Vorteile –<br />
beispielsweise eine einheitliche Notrufnummer,<br />
das Studien- und Jugendaustauschprogramm<br />
Erasmus und nicht<br />
zuletzt die Regionsförderungen für<br />
benachteiligte Gebiete – müssen laufend<br />
vor den Vorhang geholt werden,<br />
um den Menschen den europäischen<br />
Gedanken bereits auf regionaler Ebene<br />
näherzubringen.“<br />
Förderprogramme für regionale<br />
Entwicklung<br />
Ein Aushängeschild für ein regionales<br />
und nachhaltiges Programm, das<br />
unter anderem von der EU gefördert<br />
wird, stellt die so genannte LEADER-<br />
Initiative dar. Diese ist Teil des österreichischen<br />
Programms für ländliche<br />
Entwicklung und ermöglicht Beteiligten<br />
direkt aus der Region die Teilhabe an<br />
der Planung und Ausführung von Strategien<br />
sowie an der Herbeiführung von<br />
Entscheidungen und an der Verteilung<br />
von Mitteln zur Entwicklung des ländlichen<br />
Raums in ihrer Region. Die LEA-<br />
DER-Initiative bildet in Tirol auch die<br />
Basis für die Tiroler Regionalmanagementvereine.<br />
„Fachliche Begleitung der<br />
Umsetzung von lokalen Entwicklungsstrategien,<br />
finanzielle Unterstützung<br />
und die enge Abstimmung mit der<br />
Landes-, Bundes- sowie EU-Ebene sind<br />
ausschlaggebend, um innovative Vorhaben<br />
in den Tiroler Gemeinden umzusetzen“,<br />
so LR Tratter abschließend.<br />
LR Mag. Johannes Tratter<br />
Mahlzeit!<br />
Mit Jausengeld.at,<br />
dem intelligenten<br />
Essensgutschein.<br />
www.jausengeld.at
36 tirol.Politik tirol.Politik<br />
37<br />
EU-Förderungen<br />
werden in Tirol zur<br />
Gänze ausgeschöpft.<br />
Bei der Europawahl 2019 kandidierte Barbara Thaler als Tiroler<br />
ÖVP-Spitzenkandidatin. Dank der Vorzugsstimmenregelung gelang<br />
ihr der Einzug ins EU-Parlament. Damit ist die Unternehmerin,<br />
Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Tirol und Landesparteiobmann-Stellvertreterin<br />
der Tiroler Volkspartei seit 2. Juli<br />
2019 Mitglied des Europäischen Parlaments.<br />
„Als einzige Tiroler<br />
EU-Abgeordnete ist es<br />
mir ein großes Anliegen,<br />
direkt vor Ort in<br />
den Tiroler Gemeinden<br />
und Regionen<br />
mit den Menschen in<br />
Kontakt zu sein<br />
und ihre Anliegen<br />
zu hören.“<br />
BARBARA THALER<br />
BILD: Barbara Thaler ist<br />
eine starke Verbündete<br />
für alle Tiroler*innen<br />
im EU-Parlament.<br />
(© Pristach)<br />
ZUM AUTOR<br />
MANFRED SCHIECHTL<br />
25 Jahre Medienerfahrung in<br />
verschiedensten Bereichen bei<br />
der Tiroler Tageszeitung und dem<br />
Kurier sind die Basis für eine<br />
umfangreiche Expertise in allen<br />
Kommunikationsbelangen.<br />
Kontakt: m.schiechtl@gemnova.at<br />
Vordergründig ist die EU und ihr Agieren<br />
hauptsächlich auf der bundesstaatlichen<br />
Ebene sehr präsent. Welche Bedeutung<br />
hat die Europäische Union jedoch für die<br />
Regionen, in unserem Fall Tirol?<br />
Kaum ein anderes Bundesland ist so von<br />
europäischen Themen betroffen wie wir<br />
in Tirol. Sei es beim Verkehr, beim Tourismus<br />
oder z. B. auch beim Thema Problemwölfe.<br />
Viele Projekte sind in den letzten 26<br />
Jahren, seit Österreich der Europäischen<br />
Union beigetreten ist, entstanden und mit<br />
europäischem Geld finanziert worden.<br />
Die EU bringt Regionen und Menschen<br />
zusammen, fördert den Austausch und<br />
unterstützt in der Entwicklung. Allein in<br />
der Förderperiode 2014–2020 bekamen<br />
die Tiroler Regionen durch den Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung<br />
(EFRE) einen Beitrag von rund 33,7 Millionen<br />
Euro. Gefördert wurden zum Beispiel<br />
die Tiroler Cluster. Das sind Netzwerke<br />
zur Förderung von Gemeinschaftsprojekten<br />
von Wirtschaft, Forschung und Bildung<br />
in den Bereichen erneuerbare Energien,<br />
Technologie, Life Sciences, Mechatronik<br />
und Wellness.<br />
Als einzige Tiroler EU-Abgeordnete ist es<br />
mir ein großes Anliegen, direkt vor Ort in<br />
den Tiroler Gemeinden und Regionen mit<br />
den Menschen in Kontakt zu sein und ihre<br />
Anliegen zu hören. Aufgrund der Corona-<br />
Krise mussten viele dieser Termine im<br />
letzten Jahr abgesagt werden. Trotzdem<br />
ist mir auch in der momentanen Situation<br />
der direkte Austausch durch Webinare und<br />
Telefonkonferenzen sehr wichtig, weil Fakt<br />
ist: Europa fängt in den Gemeinden an.<br />
Und darüberhinausgehend die Europaregion<br />
Tirol/Südtirol/Trentino?<br />
Tirol zeigt in der EUREGIO, wie ein Europa<br />
der Regionen funktioniert, und pflegt so<br />
die historische Verbundenheit mit Südtirol<br />
und dem Trentino. Regionsübergrei-<br />
fende Projekte wie die der EUREGIO bringen<br />
Menschen, Wirtschaft und vor allem<br />
den ländlichen Raum dazu, noch stärker<br />
zusammenzuarbeiten. Die Förderung von<br />
gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten<br />
sowie der Austausch von<br />
Bildungsangeboten trägt dazu bei, die<br />
Regionen näher zusammenzubringen. Die<br />
EUREGIO ist besonders in der Corona-Krise<br />
durch viele Herausforderungen wie z. B.<br />
die Grenzschließungen gefordert. Dennoch<br />
zeigen die drei Landesteile einen starken<br />
Zusammenhalt in der gegenseitigen Unterstützung<br />
und Bekämpfung der Pandemie.<br />
Derzeit werden in Tirol eine ganze Reihe<br />
von Projekten unter dem Dach von<br />
EUREGIO durchgeführt. Welchen Vorteil<br />
sehen Sie für Gemeinden, die sich<br />
an derartigen Projekten beteiligen?<br />
Vor allem für Tirols Gemeinden ergibt<br />
sich durch die EUREGIO eine einzigartige<br />
Möglichkeit, an vielfältigen Projekten<br />
teilzunehmen. Ein Blick über den Tellerrand<br />
bietet oft Zugang zu neuen Ideen<br />
und anderen Herangehensweisen. Durch<br />
dieses Netzwerk kann viel neues Potenzial<br />
für unsere Gemeinden entstehen.<br />
Das Projekt des EUREGIO-Tickets ist ein<br />
gutes Beispiel für grenzübergreifende<br />
Möglichkeiten. Im August 2020 startete<br />
die neue Mobilitätsoffensive Euregio-<br />
2Plus-Ticket, die in allen drei Ländern eingeführt<br />
worden ist. So können Familien<br />
günstig mit fast allen Verkehrsmitteln<br />
und mit einem Tagesticket quer durch<br />
alle Länder fahren. Für die Zukunft ist ein<br />
EUREGIO-Jahresticket in Ausarbeitung.<br />
Ich selbst habe vor vielen Jahren auch<br />
an einem EU-Projekt mitgearbeitet. Den<br />
administrativen Aufwand habe ich haut-
38 tirol.Politik tirol.Politik<br />
39<br />
„Dass wir diese Förderungen auch<br />
wirklich nutzen, bringt bedeutende<br />
Wertschöpfung für die einzelnen<br />
Regionen. Als Tirolerin bin ich stolz, dass<br />
hier das große Potenzial der EU-Fördermöglichkeiten<br />
ausgeschöpft wird.“<br />
nah mitgemacht und weiß, wie abschreckend<br />
solche Antragsformulare sein können,<br />
jedoch lohnt es sich jedes Mal. Wir können<br />
hier viel Geld für die Regionen Europas<br />
gewinnen.<br />
Interreg fördert wiederum die Zusammenarbeit<br />
zwischen Bayern und Österreich,<br />
daher auch Tirol. Worin liegt der<br />
Mehrwert der grenzüberschreitenden<br />
Zusammenarbeit über diesen Weg?<br />
Interreg fördert grenzübergreifende Zusammenarbeit<br />
z. B. in der gemeinsamen Infrastruktur<br />
oder auch in der Raumplanung.<br />
Solche Initiativen helfen Bürger*innen in<br />
der Europäischen Union, die in der Nähe<br />
einer Grenze wohnen, die geografischen<br />
und technischen Barrieren abzubauen.<br />
Zwischen Bayern und Österreich herrscht<br />
schon lange eine Tradition in der Zusammenarbeit.<br />
In meinem Heimatbezirk Kufstein gibt es<br />
einige konkrete Ansätze, die die grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit verbessern.<br />
Durch die Euregio Inntal, wo die Bezirke<br />
Kufstein und Kitzbühel mit den Landkreisen<br />
Rosenheim und Traunstein zusammenarbeiten,<br />
wurde letztes Jahr eine Verkehrsstudie<br />
für eine öffentliche Verkehrsverbindung<br />
der Geigelstein-Linie von Rosenheim und<br />
Kufstein gemacht. Diese Studie kann jetzt<br />
als eine Entscheidungsgrundlage zum<br />
regionalen Ausbau des grenzüberschreitenden<br />
Öffentlichen Personen-Nahverkehrs<br />
(ÖPNV) herangezogen werden. Das große<br />
Ziel dahinter sind verbesserte Erreichbarkeit<br />
für Tagesgäste, attraktivere Mobilitätsangebote<br />
für Pendler*innen und insgesamt<br />
mehr Flexibilität in der Mobilität. Ein tolles<br />
Beispiel für ein „Europa ohne Grenzen“.<br />
Stichworte Europäischer Fonds für regionale<br />
Entwicklung (EFRE), Europäischer<br />
Sozialfonds (ESF), Europäischer Landwirtschaftsfonds<br />
für die Entwicklung<br />
des ländlichen Raumes (ELER): Wird die<br />
EU-Regionalförderung in Tirol ausreichend<br />
genutzt oder werden viele Möglichkeiten<br />
ausgelassen?<br />
Die EU-Förderungen werden in Tirol zur<br />
Gänze ausgeschöpft. Teilweise werden<br />
sogar „Reserveprojekte“ geplant und vom<br />
Land Tirol vorfinanziert. Da andere Bundesländer<br />
und andere Mitgliedstaaten ihre zur<br />
Verfügung stehenden Gelder nicht komplett<br />
abholen, können somit auch unsere „Reserveprojekte“<br />
aus den Fördertöpfen finanziert<br />
werden. Dass wir diese Förderungen auch<br />
wirklich nutzen, bringt bedeutende Wertschöpfung<br />
für die einzelnen Regionen. Als<br />
Tirolerin bin ich stolz, dass hier das große<br />
Potenzial der EU-Fördermöglichkeiten ausgeschöpft<br />
wird.<br />
Welche Möglichkeiten gibt es noch, vor<br />
allem für die Gemeinden?<br />
Neben den klassischen Fördertöpfen bietet<br />
die EU immer wieder Förderprogramme<br />
oder Initiativen an, die unter anderem auch<br />
direkt von unseren Gemeinden abgeholt<br />
werden können. Die Gemeinde Kauns im<br />
Bezirk Landeck hat sich z. B. im November<br />
2018 gemeinsam mit 13.000 Städten und<br />
Gemeinden aus ganz Europa bei der Initiative<br />
WIFI4EU beworben. Die 500-Einwohner-<br />
Gemeinde war eine von 2800 Gewinnergemeinden<br />
und hat eine tolle Summe an<br />
Fördergeld für den Ausbau des öffentlichen<br />
WLAN-Netzes erhalten.<br />
Neben der neuen Förderperiode <strong>2021</strong>–<br />
2027 hat sich die EU für die Zeit nach der<br />
Corona-Krise auf einen Wiederaufbauplan<br />
für Europa geeinigt. Der Hauptteil davon<br />
fließt in den Recovery and Resilience Fund,<br />
wo für die kommenden Jahre Mittel in der<br />
Höhe von 672,5 Milliarden Euro den Mitgliedstaaten<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
Zum Wiederaufbau können hier Projekte im<br />
Bereich der Innovation und Digitalisierung<br />
sowie rund um den Green Deal eingereicht<br />
werden. Außerdem stehen Mittel für Kleinund<br />
Mittelunternehmen, Infrastruktur und<br />
Jugend zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten<br />
sind jetzt an der Reihe, ihre Pläne anzumelden,<br />
welche durch die Europäische Kommission<br />
und das Parlament geprüft werden und<br />
anschließend national ausgeschrieben werden.<br />
Das Ziel besteht darin, die Auswirkungen<br />
der Corona-Pandemie auf Wirtschaft<br />
und Gesellschaft bestmöglich abzufedern.<br />
2020 war das Jahr des 25-jährigen Jubiläums<br />
der österreichischen EU-Mitgliedschaft.<br />
Wie sieht Ihre Bilanz aus Tiroler<br />
Sicht aus? Überwiegen die Vorteile oder<br />
die Nachteile, wie etwa die hierzulande<br />
für die Tiroler*innen täglich sehr präsente<br />
Transitproblematik?<br />
Für mich ist ganz klar, dass die Vorteile der<br />
EU-Mitgliedschaft überwiegen.<br />
Die Menschen und<br />
Regionen in Tirol und<br />
Österreich profitieren<br />
von der Europäischen<br />
Gemeinschaft.<br />
Die steht nicht nur für Friede und Sicherheit,<br />
sondern prägt auch einen starken<br />
gemeinsamen Binnenmarkt, der uns in der<br />
Welt positioniert. Wir haben heute dreimal<br />
so viele exportierende Betriebe in Tirol als<br />
vor dem Beitritt zur Europäischen Union.<br />
Auch wenn die EU besonders in der Corona-<br />
Krise vor großen Herausforderungen steht,<br />
ist es gelungen, den größten EU-Haushalt<br />
mit 1,8 Billionen Euro in der Geschichte der<br />
EU zu beschließen, um die Langzeitfolgen<br />
der Krise einzudämmen.<br />
Im Verkehrsbereich steht noch viel Arbeit<br />
vor uns. Wichtig für Tirol und das Thema<br />
Transit sind die Verhandlungen zur Wegekostenrichtlinie,<br />
die seit Ende Jänner laufen.<br />
Dort bin ich im Verhandlungsteam<br />
des Europaparlaments und gehe mit ganz<br />
konkreten Punkten in die Verhandlungen.<br />
Um eine Modernisierung des Verkehrssystems<br />
zu erreichen, brauchen wir zum einen<br />
Kostenwahrheit auf der Straße und zum<br />
anderen eine Zweckbindung der Umweltaufschläge.<br />
Die Kostenwahrheit soll nach<br />
dem Nutzer- und Verschmutzerprinzip hergestellt<br />
werden. Das soll nicht nur auf einigen<br />
Streckenabschnitten gelten, sondern<br />
verpflichtend in ganz Europa. Jeder LKW<br />
soll die tatsächlich verursachten Umweltkosten<br />
als Bestandteil der Maut verrechnet<br />
bekommen. Die Einnahmen sollen direkt in<br />
den Verkehrssektor und in die Regionen<br />
zurückfließen. Das steht für mich bei den<br />
Verhandlungen an erster Stelle, um in Tirol<br />
eine Verbesserung der Transitproblematik<br />
zu erreichen. Darüber hinaus sollen Mitgliedstaaten<br />
in Bergregionen, wo Infrastrukturkosten<br />
und Umweltschäden von Haus<br />
aus höher sind, das Recht haben, die Grundmaut<br />
um bis zu 50 Prozent zu erhöhen.<br />
Eine Mitsprache der Nachbarländer steht<br />
hier für mich persönlich nicht zur Debatte.<br />
Was bedeutet es für Sie persönlich, Tirol<br />
im EU-Parlament zu vertreten?<br />
Eine starke Verbündete für alle Tiroler*innen<br />
zu sein, steht für mich an erster Stelle.<br />
Meine Heimat im EU-Parlament vertreten<br />
zu dürfen, ist eine großartige und zugleich<br />
herausfordernde Aufgabe. Die komplexen<br />
Zusammenhänge und der enge Austausch<br />
zwischen den verschiedenen Personen, Institutionen<br />
und Stakeholdern in Tirol, Österreich<br />
und Brüssel machen die Arbeit aber<br />
zu einer ganz besonderen.<br />
TlROLER<br />
Blaulichtpolizze<br />
Spezialkonzept für Feuerwehrfahrzeuge<br />
inkl. Aufbauten und Ausrüstungsgegenstände.<br />
Versicherte Sparten: Kfz-Haftpflichtversicherung,<br />
Vollkaskoversicherung, Kfz-Rechtsschutzversicherung<br />
Neuerungen:<br />
• Erhöhung der Versicherungssumme in der<br />
Haftpflichtversicherung auf EUR 20 Mio.<br />
• Erhöhung der Versicherungssumme in der<br />
Rechtsschutzversicherung auf EUR 200.000<br />
• Anhänger können im neuen Versicherungskonzept<br />
aufgenommen werden<br />
Unser Spezialisten-Team erreichen<br />
Sie unter 0512 5313-1701 oder per<br />
mail@tiroler.at.<br />
LINKS:<br />
Barbara Thaler ist seit 2. Juli<br />
2019 Mitglied des Europäischen<br />
Parlaments und vertritt<br />
ihre Heimat in Brüssel.<br />
(© Europäisches Parlament)
40<br />
tirol.Politik<br />
tirol.Politik<br />
41<br />
Anti-Aging für die Politik<br />
DIE „GEMEINDE-<br />
SCHMIEDE“<br />
Dieses gemeinsame Projekt vom<br />
Land Tirol, dem Tiroler Gemeindeverband<br />
und GemNova verfolgt das<br />
Ziel, junge Menschen zwischen 15<br />
und 30 für Politik zu begeistern.<br />
Gleichzeitig soll ihnen eine profunde<br />
Grundausbildung in der Gemeindepolitik<br />
vermittelt werden. Neben<br />
speziellen Workshops zu den verschiedensten<br />
Themen, zu konkreten<br />
Aufgaben und Herausforderungen<br />
in den Gemeinden sind auch landesweite<br />
Vernetzungstreffen sowie<br />
regionale Schulungen vorgesehen.<br />
parteiunabhängig<br />
Wissensvermittlung<br />
Vernetzung von<br />
erfahrung & wissbegieRde<br />
Die Auftaktveranstaltung findet im<br />
Juni in Fieberbrunn, der Heimatgemeinde<br />
von Sophie Brunner, statt.<br />
In weiterer Folge werden diese Veranstaltungen<br />
auch in den anderen<br />
Bezirken Tirols abgehalten. Die<br />
Gemeinden werden vorab darüber<br />
informiert. Läuft alles nach Plan,<br />
sollen einige dieser jungen Leute<br />
bereits bei der Gemeinderatswahl<br />
2022 auf den verschiedenen Listen<br />
kandidieren.<br />
Kontakt: Sandra Wimmer,<br />
s.wimmer@gemnova.at<br />
Tel. +43 660 201 32 27<br />
Sophie Brunner<br />
aus Fieberbrunn, eine der<br />
engagierten Initiatorinnen der<br />
„Gemeindeschmiede“<br />
Sophie Brunner ist 20 Jahre alt, gebürtige Fieberbrunnerin, politisch<br />
interessiert. Die junge Frau studiert am Management Center Innsbruck<br />
Tourismus und Freizeitwirtschaft, lacht viel, denkt positiv und ist auch<br />
bereit, Verantwortung zu übernehmen.<br />
„Gemeindepolitik hat mich schon immer<br />
interessiert. Weil es ja mein unmittelbares<br />
Lebensumfeld betrifft. Schnelles Internet,<br />
Verkehr, Umwelt, Sport, Wohnen – all<br />
das sind Themen, wo ich gerne etwas<br />
bewegen würde. Nur, wie funktioniert das<br />
im Detail?“Eher zufällig stolperte Brunner<br />
dann über das Buch „Wir alle sind<br />
Gemeinde“, so der Titel, herausgegeben<br />
vom Tiroler Gemeindeverband und Gem-<br />
Nova. Sie steckte ihre Nase hinein und zog<br />
diese dann lange nicht mehr zurück. „Einfach<br />
weil ich beim Lesen so viele Antworten<br />
auf meine Fragen bekommen habe.<br />
Da wurde Gemeindepolitik einfach sehr<br />
anschaulich erklärt, außerdem wurden viele<br />
praktische Beispiele angeführt. Das hat<br />
mein Interesse an Politik nochmals gesteigert,<br />
das kann ich schon sagen.“<br />
EULEN IN ATHEN<br />
Ernst Schöpf in Tirol vorzustellen, hieße<br />
wohl Eulen nach Athen zu tragen. Er ist<br />
seit 35 Jahren Bürgermeister von Sölden,<br />
Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes<br />
sowie Vorsitzender des Finanzausschusses<br />
des Österreichischen Gemeindebundes.<br />
Außerdem war der ausgebildete<br />
Betriebswirt<br />
beinahe zehn Jahre<br />
lang Abgeordneter<br />
im Tiroler Landtag.<br />
Und ja, Schöpf ist<br />
auch ein Macher,<br />
ein Umsetzer,<br />
einer, der in<br />
der Gemeinde<br />
etwas bewegen<br />
will.<br />
„Wir haben hier in Tirol 279<br />
Gemeinden, also 279 Bürgermeister*innen.<br />
222 davon sind<br />
bereits über 50 Jahre alt und<br />
denken ernsthaft darüber nach,<br />
nicht mehr zu kandidieren.“<br />
ERNST SCHÖPF<br />
„Zum einen gibt es eine gewisse Politikmüdigkeit,<br />
zum anderen ein steigendes Interesse<br />
insbesondere von jungen Menschen, sich<br />
aktiv in der Gemeindepolitik zu engagieren.<br />
Letztere wollen wir nun offensiv ansprechen<br />
und entsprechend fördern“, so Schöpf.<br />
Das bohren<br />
harter bretter<br />
Politik, so formulierte seinerzeit Max<br />
Weber, sei das langsame Bohren harter<br />
Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß.<br />
In der Gemeindepolitik werden diese Bretter<br />
wohl immer härter, kommen doch<br />
laufend neue Aufgaben dazu, womit sich<br />
auch die Komplexität deutlich erhöht. Es<br />
treten neue Fragen auf, die auch neue<br />
Antworten verlangen, neue Herangehensweisen.<br />
Denken wir nur an den Bereich<br />
der Digitalisierung.<br />
Junge Menschen wie Sophie Brunner sind<br />
in einer völlig anderen Lebenswelt aufgewachsen<br />
als etwa Ernst Schöpf. 40 Jahre<br />
liegen zwischen den beiden, eine Zeit, in<br />
der sich vieles völlig verändert hat. Handy,<br />
Internet, soziale Medien – all das hat es<br />
vor 40 Jahren noch nicht gegeben. „Wenn<br />
wir jetzt unsere eigenen Ideen einbringen,<br />
gleichzeitig von den Erfahrungen und vom<br />
Wissen der Älteren lernen, dann kann das<br />
für eine Gemeinde ja nur gut sein“, sagt<br />
Brunner. Darum waren sie und ihr Team<br />
auch mit großem Engagement dabei, die<br />
„Gemeindeschmiede“ mit zu konzipieren<br />
und schrittweise umzusetzen (siehe<br />
Kasten links). „Auch wir Junge tragen<br />
eine große Verantwortung. Allein beim<br />
Thema Umweltschutz gibt es noch so viel<br />
zu tun. Oder beim menschlichen Umgang<br />
mit Flüchtlingen. Und in den Gemeinden<br />
haben wir einfach die Möglichkeit, ganz<br />
direkt mitzugestalten. Das ist schon eine<br />
spannende, eine ungemein faszinierende<br />
Herausforderung.“<br />
Wissen ist Macht<br />
lindner-traktoren.at<br />
Wer im Gemeinderat ein politisches Mandat<br />
ausübt, sollte zumindest die Grundzüge<br />
der Tiroler Gemeindeordnung kennen. Oder<br />
die zentralen Punkte des Baurechts, des<br />
Budgets, der Verwaltung und der öffentlichen<br />
Dienste. Denn bei den Abstimmungen<br />
im Gemeinderat, natürlich auch in den<br />
Ausschüssen, geht es um Inhalte, um sachpolitische<br />
Fragen. „Dieses Wissen ist natürlich<br />
nicht nur für Politikneulinge interessant,<br />
auch langgediente Mandatar*innen sollen<br />
sich laufend weiterbilden. Weil sich Gesetze<br />
ändern. Für unsere Gemeinden kommen<br />
immer wieder neue Aufgaben dazu. Wir sollten<br />
also schon wissen, warum wir worüber<br />
wie abstimmen“, erklärt Schöpf.<br />
Ebendiese Basisinformation ist es, die in<br />
der „Gemeindeschmiede“ vermittelt werden<br />
soll.Zudem soll ein praxisbasierter Erfahrungsaustausch<br />
mit „alten Hasen“ Wissen<br />
sichern und eine Vernetzung zwischen Jung<br />
und Alt ermöglichen. Sophie Brunner freut<br />
sich auf alle Fälle schon auf diese Schulungen<br />
und Ausbildungen. Denn ihr Ziel ist klar:<br />
eine Kandidatur bei den Gemeinderatswahlen<br />
im Februar 2022 in Fieberbrunn.<br />
AUTOR REINHOLD OBLAK<br />
STUFENLOSER LINTRAC IN BBG-AUSFÜHRUNG ERHÄLTLICH<br />
Zu den Ausstattungs-Highlights gehören das ZF-Stufenlosgetriebe<br />
made in Austria, die 4-Rad-Lenkung und die leistungsstarke<br />
Hydraulik. Mit dem TracLink-System macht Lindner seine<br />
Traktoren zu den intelligentesten Fahrzeugen ihrer Klasse. Dazu<br />
sind perfekt abgestimmte Anbaugeräte erhältlich.<br />
Mit dem Lintrac bietet Lindner<br />
Kommunalprofis vielseitige,<br />
wendige und leicht zu bedienende<br />
Traktoren für den Ganzjahreseinsatz.<br />
Jetzt ist der Lintrac<br />
in einer eigenen BBG-Ausführung<br />
erhältlich und kann im<br />
E-Shop der Bundesbeschaffung<br />
bestellt werden. Bei anspruchsvollen<br />
Einsätzen kommt der Perkins-4-Zylinder-Motor mit 113 PS<br />
und 450 Nm Drehmoment zum Tragen. Für effizientes Arbeiten<br />
steht das ZF-Steyr-Stufenlosgetriebe „Made in Austria“. Wendigkeit<br />
gewährleistet die 4-Rad-Lenkung. Weitere Highlights sind die<br />
Bosch-Rexroth Hydraulik mit Axialkolbenpumpe und vier EHS-Steuergeräten,<br />
die Kabinenfederung und die Kommunalbereifung.<br />
Zusätzlich kann eine umfangreiche Kommunalausstattung zum<br />
BBG-Vorteilspreis geordert werden: vom TracLink-System bis zur<br />
Forstausrüstung. Das TracLink-System unterstützt bei der Bedienung<br />
aller Anbaugeräte und sorgt immer für die optimale Abstimmung<br />
von Fahrzeug und Gerät.<br />
MEHR INFOS AUF<br />
LINDNER-TRAKTOREN.AT<br />
AB 70.638 €<br />
JETZT IN BBG-AUSFÜHRUNG<br />
IM E-SHOP BESTELLBAR!<br />
Grundpreis endrabattiert exkl. MwSt. Bestellbar unter BBG-GZ 2801.03404.004<br />
mit passenden Kommunalgeräten wie Frontlader, Schneepflug, Streuautomat<br />
oder Böschungsmäher.<br />
Der Beste am Berg<br />
PARTNER DER<br />
BUNDESBESCHAFFUNG<br />
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
42 tirol.sportlich und gesund tirol.ist schön<br />
43<br />
ZEITZEUGEN<br />
DES KOMMUNALEN<br />
LEBENS<br />
Sie waren einst das soziale Zentrum der<br />
Gemeinden. Heute liefern sie einen Einblick<br />
in über 1000 Jahre Geschichte:<br />
unsere Kirchen und Stifte.<br />
FOTOGRAF FELIX RICHTER<br />
LINKS: Die Kirche Maria Heimsuchung<br />
in Kolsass wurde Im Jahr<br />
788 n. Chr. zur Urpfarre erhoben.<br />
Es wird vermutet, dass bereits vor<br />
dem 8. Jahrhundert ein Kirchenbau<br />
bestand. Im 13. und 15. Jahrhundert<br />
wurde die Kirche gotisch erweitert,<br />
im 18. Jahrhundert barockisiert.<br />
(© Felix Richter)<br />
OBEN: Das Stift Stams<br />
wurde 1284 gegründet,<br />
um als Begräbnisstätte<br />
der Grafen von Görz-Tirol<br />
zu dienen. 1984 erhob<br />
Papst Johannes Paul II.<br />
die Stiftskirche in den<br />
Rang einer Basilika minor.<br />
Das Stift Stams zählt zu<br />
den prachtvollsten historischen<br />
Bauten Tirols.<br />
(© Felix Richter)<br />
LINKS: Die Kalvarienbergkirche<br />
wurde<br />
zwischen 1803 und 1805<br />
erbaut. Sie befindet sich<br />
über der Ehnbachklamm<br />
auf einem steilen Felsen.<br />
Die Kreuzwegstationen<br />
wurden 1975 mit Mosaikbildern<br />
des Künstlers<br />
Anton Plattner neu aufgebaut.<br />
(© Felix Richter)
44 tirol.sportlich und gesund tirol.ist schön<br />
45<br />
UNTEN: Die Wallfahrtskirche<br />
Maria Locherboden<br />
in Mötz stammt aus dem<br />
Ende des 19. Jahrhundert,<br />
aber bereits im 18. Jahrhundert<br />
war der Locherboden<br />
für angebliche Wunderheilungen<br />
berühmt. Die Lage<br />
der Kirche ist besonders<br />
eindrucksvoll mit Blick über<br />
das Inntal und zur Mieminger<br />
Kette. (© Felix Richter)<br />
RECHTS: Die Pfarrkirche<br />
St. Michael in<br />
Gnadenwald wird seit<br />
dem 14. Jahrhundert<br />
urkundlich erwähnt, aber<br />
bereits im 11. Jahrhundert<br />
soll hier eine kleine Kirche<br />
gestanden sein.<br />
(© Felix Richter)<br />
OBEN: Die Pfarrkirche<br />
St. Georg zu Leiblfing<br />
wurde Ende des<br />
15. Jahrhunderts in den<br />
gotischen Stil umgebaut.<br />
Der einzigartige Kirchturm<br />
mit Zwiebelhelm<br />
und gleichzeitig schlanker<br />
Spitze wurde 1710 erbaut.<br />
Die Kirche ist angeblich<br />
die „meist fotografierte<br />
Kirche Tirols“ und gilt<br />
als ein Wahrzeichen<br />
des Oberlandes. (© Felix<br />
Richter)
46 tirol.Wissen<br />
tirol.Wissen<br />
47<br />
WO IST<br />
DER SEE?<br />
DER SPEICHER<br />
ACHENSEE<br />
Kein Grund zur Sorge, bald ist der<br />
Achensee wieder voll.<br />
AMPELSBACH<br />
942 MMH<br />
ZUM AUTOR<br />
FELIX RICHTER<br />
Felix Richter studierte Journalismus<br />
an der Universität von Rio<br />
de Janeiro. Seit 1997 war Richter<br />
als Berufsfotograf, Verleger und<br />
Schriftsteller in Brasilien tätig. Er<br />
veröffentlichte 20 Fotografiebücher,<br />
fünf Romane und hatte<br />
zahlreiche Fotoausstellungen. 2017<br />
übersiedelte Richter mit seiner<br />
Familie nach Innsbruck und arbeitet<br />
heute als Social-Media-Manager<br />
und Fotograf.<br />
Kontakt: f.richter@gemnova.at<br />
Manch ahnungsloser Urlauber mag sich im Frühjahr<br />
erschrecken, bei einem Ausflug nach Maurach am<br />
Achensee: Ein grobsandiger, teils sumpfiger Strand<br />
erstreckt sich mehrere dutzend Meter über die Fläche<br />
des Sees. Aber kein Grund zur Sorge, bald ist<br />
der Achensee wieder voll. Im Winter sinkt der Wasserspiegel<br />
vom Achensee um bis zu fünf Meter und<br />
verändert somit das Landschaftsbild. Bis Anfang<br />
Juni erreicht der See normalerweise wieder seinen<br />
ursprünglichen Wasserstand und ermöglicht somit die<br />
Schiffsfahrt in den Sommermonaten. Grund für den<br />
niedrigen Pegelstand ist ein geringerer Wasserzufluss<br />
im Winter und die Nutzung des Naturspeichers<br />
Achensee zur Energiegewinnung des Wasserkraftwerkes<br />
der TIWAG.<br />
DÜRRACHBEILEITUNG<br />
9,7 KM<br />
ACHENSEE<br />
928,78 MMH<br />
38,4 MIO. M 3<br />
ENERGIEINHALT<br />
OBEN:<br />
Zum Vergleich:<br />
der Wasserspiegel<br />
im Spätsommer<br />
(© Felix Richter)<br />
LINKS:<br />
Wasserspiegel<br />
Achensee bei Maurach<br />
im Frühjahr<br />
(© Felix Richter)<br />
Im Zuge der Speicherbewirtschaftung<br />
wird dem Achensee im Winterhalbjahr<br />
(Oktober bis <strong>März</strong>)<br />
mehr Wasser entnommen, als ihm<br />
zufließt, wodurch der Seespiegel<br />
um bis zu fünf Meter absinken<br />
kann. Bis zum Frühling füllen Niederschläge,<br />
Schmelzwässer sowie<br />
die Bachzuleitungen den See wieder<br />
auf. Anfang Juni erreicht der<br />
Seespiegel wieder den Pegelnullpunkt,<br />
der bei 928,78 mMh liegt.<br />
133 M<br />
MAXIMALE TIEFE<br />
CA. 9 KM<br />
LÄNGE<br />
QUELLE:<br />
INN<br />
532,80 MMH<br />
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG
48 tirol.spart<br />
tirol.spart<br />
49<br />
GEMNOVA-<br />
KOMMUNALFINANZ<br />
KOMPETENTE<br />
DIENSTLEISTUNG<br />
VOR ORT<br />
AUTOR MANFRED SCHIECHTL<br />
Die aktuelle Situation durch die Covid-19-Pandemie stellt<br />
die Gemeinden vor große Herausforderungen. Ständig neue<br />
Maßnahmen sowie geänderte bzw. angepasste Verordnungen<br />
bedürfen der Umsetzung. Außerdem muss das Testen oder<br />
Impfen organisiert und die kritische Infrastruktur gesichert<br />
werden. Und – all diese zusätzlichen Aufgaben müssen mit<br />
dem bestehenden Personalstand bewältigt werden.<br />
„Christoph Carotta und<br />
Georg Hochfilzer haben es<br />
geschafft, durch kompetente<br />
und auch individuelle<br />
Betreuung mir und meinen<br />
Mitarbeiter*innen die nötige<br />
Sicherheit in der täglichen<br />
Arbeit zu geben.“<br />
FRIEDRICH STEINER<br />
BÜRGERMEISTER<br />
RAMSAU IM ZILLERTAL<br />
Raum zum Wohlfühlen<br />
Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung<br />
(z.B. Kindergärten und Schulen)<br />
Optimale Wärmedämmung<br />
Brandschutz (R)EI30 serienmäßig<br />
www.containex.com<br />
Zwar mit weitaus längerer Vorlaufzeit<br />
als die Aufgaben, die aus der Pandemie<br />
resultieren, kam dann noch die Umsetzung<br />
der VRV 2015 hinzu. Der Paradigmenwechsel<br />
bei der kommunalen<br />
Buchhaltung in Richtung Doppik stellt<br />
vor allem die Finanzverwaltungen vor<br />
umfangreiche Herausforderungen.<br />
* U-Werte gem. OIB RL6<br />
OIB6<br />
konform *<br />
CTX_Inserat_279.tirol (195x118)_121-rz.indd 1 01.03.21 15:31<br />
Kommt dann noch, wie im Fall von Ramsau<br />
im Zillertal, der komplette Wechsel der<br />
Verwaltungsmitarbeiter*innen hinzu, kann<br />
es schon mehr als eng werden. Daher griff<br />
der Bürgermeister der Zillertaler Gemeinde<br />
auf die Dienstleistungen der GemNova<br />
zurück. Nicht nur, um seine Mitarbeiter*innen<br />
zu entlasten, sondern auch um<br />
die VRV 2015 rechtskonform umzusetzen.<br />
Die Finanzexperten Christoph Carotta<br />
und Mag. Georg Hochfilzer begleiten die<br />
neue Finanzverwalterin Isabella Rahm seit<br />
ihrem ersten Arbeitstag durch ihr Tagesgeschäft.<br />
Christoph Carotta unterstützt bei<br />
der Eröffnungsbilanz und beim Rechnungsabschluss<br />
und erstellte nach den vorgegebenen<br />
Fakten den Voranschlag <strong>2021</strong>.<br />
Im laufenden Tagesgeschäft können so<br />
aufkommende Fragen schnell und nachhaltig<br />
beantwortet werden. Georg Hochfilzer<br />
unterstützt derweilen im Bereich Grundsteuern,<br />
der nicht nur die Abgaben an sich<br />
umfasst, sondern auch die Aspekte Datenqualität<br />
und Rechtssicherheit.<br />
Besonders begeistert zeigte sich Bürgermeister<br />
Friedrich Steiner aus Ramsau: „Die<br />
GemNova war sofort zur Stelle und hat uns<br />
direkt und unbürokratisch geholfen. Christoph<br />
Carotta und Georg Hochfilzer haben<br />
es geschafft, durch kompetente und auch<br />
individuelle Betreuung mir und meinen Mitarbeiter*innen<br />
die nötige Sicherheit in der<br />
täglichen Arbeit zu geben.“<br />
Darüber hinaus lobte er auch die Begleitung<br />
der GemNova in den Ausschreibungsprozessen:<br />
„Wie sollen wir Bürgermeister<br />
in so vielen rechtlichen Themen,<br />
die unser Amt betreffen, ohne die Unterstützung<br />
der GemNova-Spezialisten<br />
unser Amt seriös und rechtskonform<br />
ausüben?“<br />
Neben den Finanzverwaltern stellt die<br />
VRV 2015 aber auch die Gemeinderät*innen<br />
und hier insbesondere den Prüfungsausschuss<br />
vor neue Aufgaben. Auch hier<br />
unterstützt Christoph Carotta mehrere<br />
Gemeinden in ihren Budget- oder Eröffnungsbilanzsitzungen<br />
mit seinem Fachwissen.<br />
Vor allem die Unabhängigkeit des<br />
Experten schätzen die Gemeinderäte sehr.<br />
„Die professionelle und<br />
einfach nachvollziehbare<br />
Aufbereitung der Eröffnungs-<br />
bilanz durch Herrn Carotta<br />
im Gemeinderat führte zu<br />
einer raschen fassung.“<br />
Beschluss-<br />
KARL REICH<br />
BÜRGERMEISTER<br />
JERZENS
50 ENTGELTLICHE GemNova.inside EINSCHALTUNG<br />
ENTGELTLICHE GemNova.inside EINSCHALTUNG 51<br />
DIE MULTIMEDIA-PLAYER<br />
Professionelle audiovisuelle Lösungen haben einen Namen, einen Firmennamen: J. Klausner Professional Multimedia<br />
GmbH. Mit Sitz in Innsbruck hat sich das bereits 2005 gegründete Familienunternehmen mittlerweile zum Ideengeber<br />
in vielen Bereichen entwickelt. Bestes Beispiel dafür: die interaktive Schultafel im digitalen Klassenzimmer.<br />
Mit der Generalvertretung von Clevertouch<br />
für Österreich hat die Firma Klausner<br />
nochmals an Dynamik und Innovation<br />
gewonnen. Auch deswegen, weil Clevertouch<br />
2008 in London als erstes Unternehmen<br />
ein Multitouch-Display mit integriertem<br />
Android-Modul vorgestellt hat.<br />
Und das hat Schule gemacht. Mehrfach<br />
ausgezeichnet, bietet das Team der Firma<br />
Klausner diese interaktiven Multitouch-Displays<br />
nun vor allem auch im Bildungs- und<br />
Businessbereich an. Womit wir wieder bei<br />
der interaktiven Schultafel im digitalen<br />
Klassenzimmer sind.<br />
BILD: Mit der<br />
digitalen Schultafel,<br />
hier an der Volksschule<br />
Brixlegg,<br />
überzeugt die Firma<br />
Klausner Lehrende<br />
und Lernende.<br />
(© GemNova)<br />
Digitales Klassenzimmer<br />
„Wir haben mit diesem System Lehrende<br />
und Lernende an den Schulen völlig überzeugt,<br />
inspiriert und begeistert“, freut sich<br />
Geschäftsführerin Jasmin Klausner. „Weil<br />
mit der Entwicklung des digitalen Klassenzimmers<br />
werden Zusammenarbeit und<br />
Interaktivität einfach zur Norm. Und das ist<br />
gerade in der heutigen Zeit das Entscheidende.“<br />
Mit wenigen Klicks kann der Unterricht<br />
auch gestreamt und so ein hybrider<br />
Unterricht ohne zusätzlichen Aufwand<br />
gehalten werden. Clevertouch ist Technikpartner<br />
der führenden Anbieter, wie MS<br />
Teams, Zoom, Intel oder z. B. Logitech, und<br />
garantiert zertifizierte Lösungen, die sich<br />
im täglichen Einsatz bestens bewähren.<br />
Businesslösungen<br />
Was in der Schule gilt, nimmt natürlich<br />
auch im Geschäftsbereich einen wichtigen<br />
Platz ein. Geschäftsabläufe müssen<br />
stets aufs Neue optimiert werden, weswegen<br />
an interaktiven Technologien keine<br />
Wege vorbeiführen. Das Ziel dabei ist klar:<br />
optimale Kommunikation, Konnektivität und<br />
Zusammenarbeit. Mit anderen Worten: Die<br />
natürliche Leichtigkeit eines Gesprächs soll,<br />
nein, muss sich auch auf moderne Meetings<br />
übertragen lassen. Jasmin Klausner<br />
Wir haben mit diesem System Lehrende an den<br />
Schulen völlig überzeugt, inspiriert und begeistert.<br />
weiß, wie es funktioniert: „Es ist wichtig,<br />
dass Office-Technologien mit anderen Systemen<br />
und Geräten kompatibel sind. Das<br />
Ergebnis ist ein Touchscreen mit offener<br />
Plattform, der nahtlos mit bereits vorhandener<br />
Hard- und Software funktioniert.“<br />
Weltweit wurden im letzten Jahr 80 % aller<br />
Konferenz- und Besprechungsräume mit<br />
Touchdisplays ausgestattet. Der E-Learning-Markt<br />
wächst im Businessbereich<br />
jährlich um 15 % und wird sich in den kom-<br />
menden fünf Jahren somit verdoppeln.<br />
Großzügiger Schauraum<br />
Ein Herzstück der Firma Klausner ist zweifelsohne<br />
der großzügig bemessene und<br />
interessant gestaltete Schauraum in der<br />
Eduard-Bodem-Gasse 6 in Innsbruck. So<br />
bietet diese umfassende Ausstellung eine<br />
einzigartige Gelegenheit, sich mit mobilen<br />
Systemen, mit elektrischen und manuellen<br />
Höhenverstellungen, aber auch mit verschiedenen<br />
Video- und Audiokonferenzlösungen<br />
im Detail auseinanderzusetzen.<br />
JASMIN KLAUSNER<br />
Womit die Tiroler Multimedia-Player Tag<br />
für Tag überzeugen? Die große Stärke des<br />
Teams der Firma Klausner liegt vor allem<br />
in der individuellen und bedarfsorientierten<br />
Betreuung der Kundschaft. Außerdem<br />
werden ausschließlich maßgeschneiderte<br />
Lösungen für die jeweiligen Anforderungen<br />
erarbeitet.<br />
Und ja, natürlich, mit im Paket sind auch<br />
Montage, Service, Wartung, Reparatur<br />
und Reinigung. Weitere Informationen<br />
finden Sie rund um die Uhr auf<br />
www.klausner.at<br />
RECHTS: Jasmin<br />
und Edwin Klausner<br />
(© Klausner)<br />
„IMPACT Plus Serie“ —<br />
So viel mehr als nur ein<br />
interaktiver Touchscreen!<br />
Leistungsstark und funktionsreich – Die IMPACT Plus<br />
Serie ist für den modernen Unterricht konzipiert.<br />
Hybride Bildungskonzepte sind die Zukunft, da immer mehr<br />
Schulen und Hochschulen Lehrpläne für Fernunterricht und<br />
Homeschooling entwickeln.<br />
Connecting people with teachnology.<br />
klausner.at | +43 512 391940 | clevertouch@klausner.at<br />
#clevertouch
52 tirol.wirtschaftet tirol.wirtschaftet<br />
53<br />
Vom richtigen<br />
Zeitpunkt<br />
Paulo Coelho hat mit „Elf<br />
Minuten“ ein eigenes Buch<br />
darüber geschrieben. Warren<br />
Buffett hat es damit wohl<br />
zum erfolgreichsten Investor<br />
der Welt gebracht. Und<br />
Robert Fuschelberger? Auch<br />
der Absamer hat den richtigen<br />
Zeitpunkt optimal genutzt<br />
und mit den Corona-<br />
Antigen-Schnelltests sein<br />
Unternehmen stark nach<br />
vorne gepusht.<br />
ZUM AUTOR<br />
MAG. REINHOLD<br />
OBLAK<br />
Aufgewachsen in Kärnten.<br />
Studium an den Universitäten Wien<br />
und Perugia, Italien. Er war viele<br />
Jahre Journalist, Konzernsprecher,<br />
Vorstand und Aufsichtsrat. Seit 2018<br />
ist er bei der GemNova für die Unternehmenskommunikation<br />
zuständig.<br />
Kontakt: r.oblak@gemnova.at<br />
Kennen Sie „Kiweno“? Nein? Kein Problem,<br />
viele andere kennen Kiweno auch nicht. 2014<br />
gegründet, 2015 bereits zum Start-up-Unternehmen<br />
Österreichs gekürt, seit einem Jahr,<br />
also seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie,<br />
mit randvollen Auftragsbüchern. Warum?<br />
Weil sich Robert Fuschelbergers Unternehmen<br />
auf Schnelltests spezialisiert hat, im<br />
konkreten Fall auf Corona-Antigen-Schnelltests.<br />
„Natürlich war auch Glück dabei, die<br />
Covid-19-Epidemie hat ja niemand vorhersagen<br />
können. Wir haben einfach zum richtigen<br />
Zeitpunkt die richtigen Tests angeboten, mit<br />
anderen Worten, die sich plötzlich ergebene<br />
Chance voll genutzt“, so Fuschelberger.<br />
Und klar, in den vergangenen Wochen und<br />
Monaten war die Nachfrage nach solchen<br />
Tests einfach riesengroß. In Tirol, in Österreich,<br />
weltweit.<br />
Nahrungsmittelunverträglichkeitsselbsttests<br />
;-)<br />
Angefangen hat das alles natürlich ganz<br />
klein, damals, im Jahre 2012. Fuschelberger<br />
war gerade dabei, sein Studium der<br />
Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck zu<br />
beenden, sein Vater praktizierte damals als<br />
Arzt in Aldrans. Somit waren ihm medizinische<br />
Schnelltests natürlich vertraut. „Da<br />
hab ich mir halt gedacht, warum nicht das<br />
eine mit dem anderen verbinden. Auch weil<br />
wir an der Uni gerade über Unternehmensgründungen<br />
diskutiert haben. Gemeinsam<br />
mit zwei Studienkollegen habe ich dann<br />
Ideen gewälzt, Pläne geschmiedet, Business-Modelle<br />
entworfen,“ so der gebürtige<br />
Absamer heute im Rückblick.<br />
Zwei Jahre später, 2014, war es dann soweit.<br />
Die Kiweno wurde gegründet, Fuschelberger<br />
firmierte fortan als Geschäftsführer. Der Firmenzweck<br />
in drei Worten: Durchführung von<br />
Unverträglichkeitstests. Das Bewusstsein<br />
dem eigenen Körper, der richtigen Ernährung<br />
gegenüber, das Gesundheitsbewusstsein<br />
insgesamt war in dieser Zeit gerade kräftig<br />
im Steigen begriffen. Klar, dass man daraus<br />
auch ein Geschäft machen kann. Ein recht<br />
gutes sogar. Der Selbsttest für die Unverträglichkeit<br />
von Nahrungsmitteln, in einem<br />
Wort Nahrungsmittelunverträglichkeitsselbsttests,<br />
war das praktische Vehikel dazu.<br />
BILD: Robert<br />
Fuschelberger, Gründer<br />
und Geschäftsführer<br />
der Kiweno, hat den<br />
richtigen Zeitpunkt<br />
genutzt. (© Kiweno)<br />
Für uns war das einfach der<br />
richtige Zeitpunkt, wir hatten<br />
das richtige Netzwerk, das<br />
richtige Produkt, waren damit<br />
eine der Ersten am Markt.<br />
Blut aus dem Finger<br />
Der Vorteil von Selbsttests besteht vor<br />
allem darin, dass man diese in aller Ruhe<br />
von zu Hause aus erledigen kann. Eh klar,<br />
darum heißen sie ja auch so. Kiweno bot<br />
also allen gesundheitsbewussten Menschen<br />
an, sich selbst auf eine mögliche<br />
Nahrungsmittelunverträglichkeit zu testen.<br />
Das entsprechende Werkzeug, sprich das<br />
„Abnahmebesteck“ (ja, das heißt wirklich<br />
so), wurde frei Haus geliefert, danach sollte<br />
sprichwörtlich Blut fließen.<br />
Fuschelberger zu den Details: „Er oder sie<br />
musste sich in den Finger stechen, ein<br />
paar Tropfen Blut in ein Röhrchen hineintropfen<br />
lassen und dieses dann an uns<br />
zurücksenden. Wir haben es dann ausgewertet<br />
und den Befund, also die Unverträglichkeit<br />
in Bezug auf bestimmte Nahrungsmittel,<br />
online zur Verfügung gestellt.<br />
Innerhalb von 24 Stunden.“ Was es dazu<br />
außerdem noch gab: eine detaillierte Auswertung<br />
zu den einzelnen Nahrungsmitteln,<br />
sinnvolle Alternativen zum möglicherweise<br />
nicht sinnvollen Verzehr von Brot,<br />
Nudeln oder Milch, detaillierte Einkaufslisten<br />
oder konkrete Tipps zum richtigen<br />
Essen im Restaurant. Vor allem auch beim<br />
Urlaub in fernen Ländern.<br />
Sat.1ProSieben Deutschland<br />
Das Geschäft lief gut, in- und ausländische<br />
Investoren – nein, Warren Buffetts Berkshire<br />
Hathaway war ganz sicher nicht darunter<br />
– begannen sich für das kleine Tiroler<br />
Unternehmen zu interessieren. Zuerst<br />
stiegen zwei Investoren aus Wien ein, 2016<br />
schließlich der renommierte Medienkonzern<br />
Sat.1ProSieben. Der Grund dafür laut<br />
Fuschelberger: „Die Deutschen investierten<br />
damals in ganz verschiedene Cluster. In den<br />
Reisemarkt, in Hotelketten oder eben in den<br />
Gesundheitsbereich. So sind sie eben auf<br />
uns gekommen, vielleicht auch deshalb, weil<br />
wir ja im Jahr davor zum Start-up-Unternehmen<br />
Österreichs gewählt wurden.“<br />
Knapp zwei Jahre dauerte die Zusammenarbeit,<br />
danach trennte man sich wieder.<br />
Beide Teilen sollen darüber recht froh gewesen<br />
sein. Nur wenige Zeit später, also noch<br />
im Jahre 2018, wurde Kiweno schließlich zu<br />
100 Prozent von der Immundiagnostik-<br />
Gruppe in Deutschland übernommen. Ein<br />
weiterer Meilenstein. Der Firmenname blieb<br />
freilich erhalten, der Geschäftsführer hieß<br />
auch danach noch Robert Fuschelberger,<br />
mit den Selbsttests konnte man nach wie<br />
vor gutes Geld verdienen.<br />
Und dann kam Corona<br />
Seit mehr als einem Jahr ist nichts mehr<br />
so wie früher. Die Corona-Epidemie hat die<br />
Lebensgewohnheiten aller einschneidend<br />
verändert. Neben den allzu vielen Verlierern,<br />
gab es – wirtschaftlich gesehen –<br />
auch einige wenige Gewinner. Die Kiweno<br />
etwa, mit Sitz in Wattens, Tirol. „Wir hatten<br />
schon davor große Pläne mit neu entwickelten<br />
Tests. Deshalb konnten wir bereits<br />
im Frühjahr und im Sommer vergangenen<br />
Jahres die erforderlichen Mengen an Antikörperschnelltests<br />
und Antikörperlabortests<br />
österreichweit anbieten.<br />
Das war natürlich ein großer<br />
Wachstumsschub für<br />
unser Unternehmen“,<br />
so Fuschelberger.<br />
Doch damit nicht genug. Als im Herbst dann<br />
die Nachfrage nach Antigenschnelltests<br />
rapide anstieg, weltweit wohlgemerkt, war<br />
Kiweno abermals der große Gewinner. Der<br />
Grund: Das Wattener Unternehmen hatte<br />
ausgezeichnete Kontakte zu allen Herstellern<br />
dieser Schnelltests und konnte damit<br />
auch die entsprechend hohen Stückzahlen<br />
locker am Markt anbieten. „Für uns war das<br />
einfach der richtige Zeitpunkt, wir hatten<br />
das richtige Netzwerk, das richtige Produkt,<br />
waren damit eine der Ersten am Markt.<br />
Besser hätte es nicht laufen können“, freut<br />
sich Fuschelberger.<br />
Hunderttausende Tests ausgeliefert<br />
Alleine in diesem Jahr lieferte Kiweno<br />
Hunderttausende dieser Corona-Antigen-<br />
Schnelltests in Österreich aus. Darunter<br />
auch jene sogenannten „Nasenbohrertests“,<br />
die für Kinder und Jugendliche an den Schulen<br />
verwendet werden. Der große Vorteil all<br />
dieser Tests: Das Ergebnis liegt innerhalb<br />
von 15 Minuten vor und ist relativ problemlos<br />
durchführbar.<br />
Übrigens: Im Auftrag des Landes Tirol<br />
führte die GemNova rund um die Antigen-<br />
Schnelltests eine Bedarfserhebung in allen<br />
Tiroler Gemeinden, in den Alten- und Pflegeheimen,<br />
bei den niedergelassenen Ärzten<br />
und Sozialsprengeln durch. Galt es doch,<br />
ebendiese Tests auch in der erforderlichen<br />
Menge rasch zu bestellen und in weiterer<br />
Folge zu verteilen. Auf der Suche nach dem<br />
entsprechenden Lieferanten wurde man<br />
nach intensiver Recherche überraschend<br />
schnell fündig. Den Zuschlag erhielt nämlich<br />
Kiweno aus Wattens.<br />
UNTEN: Alleine in diesem<br />
Jahr lieferte Kiweno<br />
Hunderttausende dieser<br />
Corona-Antigen-Schnelltests<br />
in Österreich<br />
aus. Und so schaut<br />
dieser aus. (© Kiweno)
54 tirol.investiert tirol.investiert<br />
55<br />
TIROLER GEMEINDEN<br />
EIN WICHTIGER MOTOR FÜR DIE<br />
HEIMISCHE BAUWIRTSCHAFT<br />
BILD: Thiersee –<br />
eine Gemeinde, die auch<br />
in Krisenzeiten investiert<br />
und damit die örtliche<br />
Infrastruktur auf den neuesten<br />
Stand bringt.<br />
(© shutterstock)<br />
Eine der wichtigsten Aufgaben einer Gemeinde ist die Bereitstellung von<br />
Infrastruktur und in weiterer Folge die Gewährleistung der reibungslosen<br />
Funktionalität. Mit dieser Infrastruktur wird das grundlegende Gemeindeleben<br />
erst ermöglicht.<br />
ZUM AUTOR<br />
DI ALEXANDER<br />
GOSTNER<br />
Alexander Gostner ist seit 2016<br />
bei der GemNova und verantwortet<br />
den Bereich Infrastruktur. In den<br />
letzten Jahren hat die GemNova<br />
Infrastruktur bereits über 140 Projekte<br />
begleitet.<br />
Kontakt: a.gostner@gemnova.at<br />
Seit Ausbruch der Corona-Krise gewinnt<br />
diese kommunale Aufgabe weiter enorm<br />
an Wichtigkeit. Während die Privatwirtschaft<br />
mit Investitionen mittlerweile<br />
sehr zurückhaltend geworden ist,<br />
investieren die Gemeinden weiter und<br />
kurbeln damit wichtige regionale Wertschöpfung<br />
an. Viele Betriebe sind froh<br />
um diese Aufträge.<br />
Das Land Tirol stellt nicht weniger als 279<br />
politische Gemeinden, und sie alle sehen<br />
sich ständig neuen Herausforderungen<br />
gegenüber. Die COVID-19-Pandemie hinterlässt<br />
wie kein anderes Ereignis unserer<br />
jüngeren Geschichte tiefe Spuren in allen<br />
Bereichen des täglichen Lebens und geht<br />
mit dem Rückgang der Ertragsanteile und<br />
der Kommunalsteuer nicht spurlos an den<br />
Gemeinden vorüber. Darüber hinaus verändern<br />
die demografischen Entwicklungen<br />
schneller denn je unsere Gesellschaftsstrukturen.<br />
Den Gemeinden obliegt die<br />
Aufgabe, ihre Infrastruktur an die immer<br />
vielfältiger werdenden Anforderungen ihrer<br />
Bewohner*innen anzupassen.<br />
Gerade kleinere Gemeinden sehen sich<br />
mit Aufgaben konfrontiert, die mangels<br />
zur Verfügung stehender Ressourcen in all<br />
ihrer Komplexität nur schwer zu bewältigen<br />
sind. Hinter der kommunalen Infrastruktur,<br />
mit der das grundlegende Gemeindeleben<br />
erst ermöglicht wird und die oft als<br />
selbstverständlich erachtet wird, stehen bei<br />
genauerer Betrachtung häufig aufwändige<br />
und kostspielige Planungs-, Vergabe- und<br />
Realisierungsverfahren.<br />
Die Notwendigkeit, neue Einrichtungen zu<br />
schaffen sowie bestehende zu adaptieren<br />
bzw. zu modernisieren und permanent<br />
deren optimale Funktionalität zu gewährleisten,<br />
kommt aber nicht nur der Tiroler<br />
Bevölkerung, sondern insbesondere auch<br />
heimischen Wirtschaftsbetrieben zugute.<br />
Investitionen in die Daseinsvorsorge fließen<br />
in die lokale und regionale Wirtschaft vor<br />
Ort und hier insbesondere in die Bauwirtschaft.<br />
Die Baubranche gilt als Schlüsselbranche<br />
für den heimischen Arbeitsmarkt.<br />
Zudem verfügt der Bau über vielfältige Verflechtungen<br />
mit anderen Branchen und hat<br />
eine entsprechende Multiplikatorwirkung.<br />
Viele Tiroler Betriebe sehen aktuell unsicheren<br />
Zeiten entgegen. Es ist jetzt wichtiger<br />
denn je, höchstes Augenmerk auf eine lokale<br />
Wertschöpfung zu legen und ortsansässigen<br />
Firmen die Möglichkeit zur dringend benötigten<br />
Umsatzgenerierung einzuräumen.<br />
Hier kommt den Tiroler Gemeinden somit<br />
eine besondere Rolle als wirtschafts-<br />
Es ist jetzt wichtiger denn je, höchstes Augenmerk<br />
auf eine lokale Wertschöpfung zu legen und<br />
ortsansässigen Firmen die Möglichkeit zur dringend<br />
benötigten Umsatzgenerierung einzuräumen.<br />
treibendem Faktor zu: Sowohl Betriebsstandorte<br />
als auch Arbeitsplätze können<br />
gehalten werden, und das erwirtschaftete<br />
Kapital fließt in Form von Kommunalsteuer<br />
und erhöhter Kaufkraft zum Teil<br />
wieder in die Gemeinden zurück. Die Tiroler<br />
Gemeinden erkennen hier ihre Verantwortung,<br />
investieren in die Zukunft, und<br />
einheimische Betriebe sind froh um diese<br />
Aufträge.<br />
Ein Beispiel für eine Gemeinde, die auch<br />
in Krisenzeiten investiert und damit die<br />
Wirtschaft unterstützt, ist Thiersee. Auch<br />
wenn nicht absehbar ist, wie lange die Krise<br />
dauert, wird am Plan festgehalten, die<br />
örtliche Infrastruktur auf den neuesten<br />
Stand zu bringen. In diesem speziellen<br />
Fall mit einem Bildungszentrum mit Kinderkrippe,<br />
Kindergarten, Volksschule, Bibliothek<br />
und Turnsaal. Es geht dabei um<br />
Investitionskosten von etwa 14 Millionen<br />
Euro. Bürgermeister Hannes Juffinger:<br />
„Der Bau des neuen Bildungszentrums ist<br />
einerseits eine dringliche Investition für<br />
die Thierseer Bevölkerung, da neben dem<br />
akuten Platzmangel in der Volksschule<br />
und in den Kinderbetreuungseinrichtungen<br />
auch der pädagogische Anspruch mit der<br />
Nachmittags- und Ferienbetreuung gestiegen<br />
ist. Andererseits ist die Gemeinde<br />
mit diesem Bauprojekt auch ein wichtiger<br />
Motor für die Wirtschaft und trägt ihren<br />
Teil zur Sicherung der Arbeitsplätze bei.“<br />
„Der Bau des neuen Bildungszentrums<br />
ist einerseits eine<br />
dringliche Investition für die<br />
Thierseer Bevölkerung, da<br />
neben dem akuten Platzmangel<br />
in der Volksschule und in<br />
den Kinderbetreuungseinrichtungen<br />
auch der pädagogische<br />
Anspruch mit der Nachmittags-<br />
und Ferienbetreuung<br />
gestiegen ist. Andererseits<br />
ist die Gemeinde mit diesem<br />
Bauprojekt auch ein wichtiger<br />
Motor für die Wirtschaft und<br />
trägt ihren Teil zur Sicherung<br />
der Arbeitsplätze bei.“<br />
HANNES JUFFINGER<br />
BÜRGERMEISTER<br />
GEMEINDE THIERSEE
56 ENTGELTLICHE tirol.Politik tirol.sucht EINSCHALTUNG<br />
Menschen tirol.sucht Menschen<br />
57<br />
RAUS AUS ÖL<br />
OHNE INVESTITIONEN<br />
ZUSAMMEN GEHT<br />
ALLES LEICHTER<br />
IHRE VORTEILE<br />
AUF EINEN BLICK<br />
Im Vergleich zu herkömmlichen Energielösungen<br />
überzeugt das Contracting-<br />
BILD: Referenz Mutters.<br />
In Mutters können sich die<br />
Gemeindemitarbeiter*innen<br />
auf die Anliegen der Bürger*innen<br />
konzentrieren. Die<br />
IKB kümmert sich um die<br />
Heizungsanlage.<br />
Es ist nur noch eine Frage der Zeit,<br />
bis fossile Brennstoffanlagen endgültig<br />
ausgedient haben. Doch der<br />
Umstieg auf nachhaltige Heiz- und<br />
Kühlsysteme ist oft mit hohen<br />
Investitionen verbunden. Besonders<br />
in Gemeinden mit mehreren<br />
öffentlichen Gebäuden und Sportstätten<br />
belasten die Energie- und<br />
Wartungskosten das Haushaltsbudget<br />
enorm.<br />
Legen Sie als Gemeindeverantwortliche<br />
den Tausch Ihrer Anlagen in<br />
professionelle Hände eines regionalen<br />
Partners vor Ort. Als Energieund<br />
Infrastrukturunternehmen hat<br />
die Innsbrucker Kommunalbetriebe<br />
AG (IKB) über Jahrzehnte viel Erfahrung<br />
in der Planung, Umsetzung und<br />
Wartung von Kälte-, Wärme- und<br />
Luftanlagen gesammelt. Besonders<br />
mit ihrer Contracting-Lösung für<br />
Gemeinden bietet die IKB ein interessantes<br />
Produkt für die Erneuerung<br />
vor allem größerer Anlagen an.<br />
Dabei liefert die IKB nicht nur eine<br />
maßgeschneiderte Lösung, sondern<br />
finanziert diese auf Wunsch auch. Im<br />
Gegenzug bezahlt die Gemeinde eine<br />
fixe monatliche Grundgebühr und die<br />
Kosten für die verbrauchte Energie.<br />
Nach Ablauf der Laufzeit geht die<br />
Anlage ins Eigentum der Gemeinde<br />
über. Während der Vereinbarung sind<br />
die 24-Stunden-Störungsbehebung<br />
und die regelmäßige Wartung der<br />
Anlagen durch die IKB inbegriffen.<br />
Für eine kostenlose Beratung kontaktieren<br />
Sie uns am besten noch<br />
heute – wir freuen uns auf Sie!<br />
MARTIN ANGERER<br />
Geschäftsbereich Energieservices<br />
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG<br />
+43 512 502 5234, martin.angerer@ikb.at<br />
www.ikb.at<br />
Modell der IKB mit einer Reihe von Vorteilen:<br />
+ Komplettlösung mit einem kompetenten<br />
Ansprechpartner: Alle notwendigen<br />
Arbeiten – von der Planung über<br />
den Bau bis hin zum Betrieb der Anlage<br />
– werden von der IKB professionell abgewickelt.<br />
+ Keine Investitionskosten, dafür höhere<br />
Liquidität und Kostenplanbarkeit:<br />
Die IKB übernimmt im Rahmen des<br />
Contracting-Modells die Investitionskosten<br />
und verteilt sie über die Vertragslaufzeit.<br />
Dadurch wird die Liquidität der<br />
Kunden nicht belastet, und sie übernehmen<br />
bei Vertragsende eine hochwertige<br />
Anlage.<br />
+ Höchste Energieeffizienz und niedrige<br />
Energiekosten durch einen besseren<br />
Preis beim Energieeinkauf: Bei<br />
der Planung der Anlage greift die IKB<br />
auf die neueste Technik zurück und<br />
plant maßgeschneidert nach den Bedürfnissen<br />
der Kunden.<br />
+ 100-prozentige Sicherheit durch<br />
Vollgarantie: 24-Stunden-Service an<br />
365 Tagen im Jahr garantiert IKB-<br />
Kunden eine konstante Überwachung<br />
der Anlage sowie ein sofortiges Eingreifen<br />
bei Problemen.<br />
+ Wegfall der Wartungs- und Reparaturkosten:<br />
Die IKB ist während der<br />
gesamten Laufzeit für die Wartung<br />
und Reparatur zuständig. Das schützt<br />
Sie vor unerwarteten Kosten und spart<br />
Personalressourcen.<br />
ZUR AUTORIN<br />
VERENA BROSZIO<br />
Verena Broszio ist seit 2017<br />
bei der GemNova und war<br />
Mitwirkende bei den Projekten<br />
Tiroler Sommerschulwochen<br />
und Tirol testet.<br />
Kontakt: v.broszio@gemnova.at<br />
Land Tirol, Gemeinden und GemNova be-<br />
wältigen gemeinsam die Herausforderungen<br />
„Das Unmögliche zu schaffen, gelingt<br />
einem nur, wenn man es für möglich<br />
befindet.“ – Dies hat schon der verrückte<br />
Hutmacher aus Alice im Wunderland<br />
behauptet.<br />
Auch wenn Aufgaben zu Beginn oft noch<br />
so aussichtslos erscheinen, können sich<br />
sämtliche Verwaltungsebenen in unserem<br />
Land sowie besonders Bürger*innen<br />
stets auf die Tiroler Gemeinden verlassen.<br />
Das Jahr 2020 hat besondere
58 tirol.sucht Menschen tirol.sucht Menschen 59<br />
„Das Projekt ‚Tirol testet‘ bedeutete<br />
für alle eine enorme Herausforderung,<br />
dies nicht zuletzt aufgrund der knapp<br />
bemessenen Vorlaufzeit.<br />
Die organisatorische Vorbereitung und<br />
eigentliche Durchführung an den drei<br />
Testtagen vor Ort erforderte daher<br />
ein Höchstmaß an Kooperation der<br />
Beteiligten – Land, Gemeinden und<br />
Gemeindeverband. Die Leistungen<br />
der GemNova, die als kommunale<br />
Schnittstelle unter anderem mit ihrer<br />
zentralen Hotline und der teilweisen<br />
Bereitstellung des erforderlichen medizinischen<br />
Personals mitwirkte, trugen<br />
wesentlich zum erfolgreichen Verlauf<br />
der Aktion bei.“<br />
MAG. CHRISTINE SALCHER<br />
VORSTÄNDIN ABTEILUNG<br />
GEMEINDEN LAND TIROL<br />
Maßnahmen erfordert, welche durch den<br />
unermüdlichen Einsatz der Gemeinden<br />
bewältigt werden konnten. Dabei durfte<br />
auch die GemNova bei dem einen oder<br />
anderen Projekt unterstützen. Von der<br />
Durchführung gemeinsamer Beschaffungsaktionen<br />
von Schutzausrüstung<br />
und Covid-19-Tests bis hin zur Abwicklung<br />
umfangreicher Projekte scheut das Team<br />
der GemNova keine Herausforderungen,<br />
um die Tiroler Gemeinden zu entlasten.<br />
Unabhängig vom Vorhaben hatten<br />
eine Vielzahl an Maßnahmen,<br />
welche die Tiroler Gemeinden<br />
im abgelaufenen Jahr umsetzen<br />
mussten, eines gemein – die oft<br />
kurze Vorlaufzeit.<br />
Anhand zweier Beispiele möchten wir<br />
einen kleinen Einblick in die Abwicklung<br />
von Projekten geben, bei denen das Land<br />
Tirol, die Tiroler Gemeinden und die<br />
GemNova Hand in Hand agierten.<br />
Im Sommer 2020 war es dem Land<br />
Tirol ein Anliegen, den Tiroler*innen in<br />
der Betreuung ihrer Kinder in den Sommermonaten<br />
unter die Arme zu greifen.<br />
So wurde das Projekt der Tiroler Sommerschulwochen<br />
ins Leben gerufen, bei<br />
denen Gemeinden ein kostenloses Bildungs-<br />
und Betreuungsangebot an den<br />
Ganztagesschulen anbieten konnten. Mit<br />
der Abwicklung des gesamten Projektes<br />
wurde der Verein GEMeinsam Ferien<br />
der GemNova beauftragt. In einer Vorbereitungszeit<br />
von nur 14 Tagen wurden<br />
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden<br />
und der Bildungsdirektion für Tirol das<br />
gesamte Konzept erarbeitet, pädagogische<br />
Fachkräfte rekrutiert und geschult<br />
sowie die Koordination mit den Schulleitungen<br />
vorgenommen, um pünktlich<br />
am ersten Montag in den Ferien starten<br />
zu können. Dank der guten Zusammenarbeit<br />
aller beteiligten Institutionen und<br />
Personen konnte in Rekordzeit ein wertvolles<br />
Bildungs- und Betreuungsangebot<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
Ähnlich kurzfristig wie die Tiroler Sommerschulwochen<br />
sollten auch die Massentestungen<br />
unter dem Projektnamen<br />
„Tirol testet“ im vergangenen Dezember<br />
von den Tiroler Gemeinden organisiert<br />
werden. Auch in diesem Projekt durfte<br />
die GemNova als Bindeglied zwischen<br />
dem Land Tirol und den Gemeinden fungieren<br />
und die Kommunen und das Land<br />
in der Abwicklung unterstützen. Die kurze<br />
Vorlaufzeit, gepaart mit einer Flut an<br />
Informationen und Vorgaben von Seiten<br />
des Bundes machte die Organisation zu<br />
einer überaus komplexen Aufgabe für<br />
alle Beteiligten. Mit der Erteilung von<br />
Auskünften, der Anstellung von Personal<br />
und der Koordination von Springern bei<br />
kurzfristigen Ausfällen hoffen wir, dass<br />
wir den Gemeinden bestmöglich zur Seite<br />
stehen konnten.<br />
Angelehnt an die einleitende Devise<br />
scheuen die Tiroler Gemeinden keine<br />
Herausforderungen, und auch das Team<br />
der GemNova freut sich, die Kommunen<br />
bei weiteren Projekten unterstützen zu<br />
dürfen, um diese gemeinsam bewältigen<br />
zu können.<br />
Die Tiroler Sommerschulwochen und<br />
‚Tirol testet‘ stehen beispielhaft für<br />
Herausforderungen, welche trotz einer<br />
sehr kurzen Vorlaufzeit durch die gute<br />
Zusammenarbeit von Land Tirol, den<br />
Gemeinden und der GemNova bewältigt<br />
werden konnten. Das Team der<br />
GemNova freut sich bereits auf die<br />
nächsten gemeinsamen Projekte.<br />
MAXIMILIAN HUBER, MA<br />
GEMNOVA<br />
Am Montag, 13. Juli 2020 starteten die<br />
Tiroler Sommerschulwochen des Landes<br />
Tirol in Zusammenarbeit mit der<br />
Bildungsdirektion für Tirol, den Tiroler<br />
Gemeinden und der GemNova mit einem<br />
umfangreichen Kinderbetreuungsprogramm.<br />
Wir wollten sicherstellen, dass wir Tiroler<br />
Familien eine qualitativ hochwertige<br />
Ferienbetreuung während des Sommers<br />
2020 anbieten. Viele Eltern hatten ihren<br />
Urlaub aufgrund der Corona-Krise aufgebraucht<br />
und benötigten deshalb während<br />
der Ferien Unterstützung – diese leisteten<br />
wir mit den Tiroler Sommerschulwochen.<br />
Neben der Unterstützung von Familien<br />
war es unser Ansinnen, den Kindern im<br />
Rahmen der Sommerschulwochen eine<br />
sinnvolle Freizeitgestaltung anzubieten. In<br />
der Gemeinschaft lernen sie soziale Kompetenz,<br />
was wiederum die Persönlichkeit<br />
bildet. Schließlich setzten wir auch einen<br />
Fokus auf Gesundheitserziehung, was auch<br />
hinsichtlich der derzeitigen Situation besonders<br />
wichtig war und ist.<br />
Es freut mich, dass die Zusammenarbeit<br />
zwischen Bildungsdirektion, den Gemeinden<br />
als Schulerhalter der Ganztagsschulen<br />
und dem Verein „GEMeinsam Ferien“<br />
der GemNova so hervorragend funktioniert<br />
hat“, betont Dr. Gappmaier abschließend.<br />
DR. PAUL GAPPMAIER<br />
BILDUNGSDIREKTOR<br />
FAKTEN<br />
TIROLER<br />
SOMMERSCHULWOCHEN<br />
278<br />
BETREUTE KINDER<br />
53<br />
16<br />
EINRICHTUNGEN<br />
stellten das Bildungs- und Betreuungsangebot<br />
zur Verfügung.<br />
PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE<br />
waren im Einsatz und haben 3365 Stunden für die<br />
Tiroler*innen gearbeitet.<br />
TIROL<br />
TESTET<br />
ALLE 279 GEMEINDEN<br />
ORGANISIERTEN TESTUNGEN FÜR DIE TIROLER*INNEN<br />
ÜBER 1500<br />
BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE<br />
wurden bei der GemNova für das Projekt „Tirol testet“ geschlossen<br />
1500<br />
STUNDEN UNTERSTÜTZUNG<br />
der Gemeinden in der Organisation und Abwicklung durch<br />
das Team der GemNova
60 GemNova.Menschen<br />
GemNova.Menschen<br />
61<br />
DER BUNTE HUND<br />
AUS OSTTIROL<br />
Er hat 21 Bücher geschrieben. Bisher.<br />
DieBürgermeister*innen schätzen<br />
das vertrauliche Gespräch mit ihm.<br />
Er redet freilich, wenn’s sein muss,<br />
auch 24 Stunden am Tag. Die Einsamkeit<br />
in der Natur schätzt er ebenso<br />
wie die Geselligkeit auf Ski- und<br />
Berghütten. Jan Schäfer ist der<br />
bunte Hund aus Osttirol.<br />
MATREI IN<br />
OSTTIROL<br />
„Aber was,<br />
wenn<br />
mir ein<br />
Stein auf<br />
den Kopf<br />
fällt ?<br />
Das kann<br />
dann sehr<br />
schnell<br />
sehr wehtun.“<br />
Prägende Erlebnisse in Afrika<br />
Was einen „bunten Hund“ ausmacht? Die<br />
Buntheit, klar, im Falle Schäfers etwa, dass<br />
er jeweils fast ein Jahr in Norwegen, Schweden<br />
oder den USA gelebt hat. Außerdem<br />
war er beruflich in Afrika unterwegs. 2005<br />
und 2006 etwa bei einem Entwicklungshilfeprojekt<br />
in Guinea. Was er dort gesehen,<br />
was er dort erlebt hat, war prägend:<br />
„Bürgerkrieg. Überfälle. Verletzte. Tote. Und<br />
ich mittendrin. Letztendlich wurde der Einsatz<br />
abgebrochen, einfach weil die eigene<br />
Sicherheit in Gefahr war. Ein Teil meines<br />
Herzens ist dennoch in Afrika geblieben.“<br />
Ein anderer Teil seines Herzens befindet<br />
sich wohl auf der Regensburger Hütte, im<br />
Herzen der Stubaier Alpen. Dort half er<br />
2010 und 2011 für je zwei Monate kräftig<br />
an allen Ecken und Enden mit. Mit Helm<br />
am Kopf besserte er etwa unterhalb der<br />
Hütte im steilen Gelände den Wanderweg<br />
aus. „Natürlich hat sich der eine oder andere<br />
über meine Kopfbedeckung gewundert. Aber<br />
was, wenn mir ein Stein auf den Kopf fällt?<br />
Das kann dann sehr schnell sehr wehtun.“<br />
Mittlerweile ist Jan Schäfer nicht nur in<br />
Osttirol felsenfest angekommen. Läuft<br />
alles nach Plan, werden er und seine Britta<br />
spätestens 2023 die österreichische<br />
Staatsbürgerschaft erhalten. Weil es ihm<br />
wichtig ist, ein klares Bekenntnis zu setzen.<br />
Und weil er, der politisch denkende Mensch,<br />
endlich auch wählen will. Gerade in diesen<br />
fürwahr außergewöhnlichen Zeiten.<br />
AUTOR REINHOLD OBLAK<br />
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG<br />
MULTIGO 150<br />
„Du, darf ich dir kurz etwas erzählen?“<br />
Jan Schäfer hat angerufen, und damit ist<br />
die nächste halbe Stunde blockiert. Zum<br />
einen, weil er wirklich viel zu erzählen<br />
hat, zum anderen, weil ihm dabei immer<br />
wieder Neues einfällt. Gestern war er<br />
etwa mit Britta, seinem Lebensmenschen,<br />
auf einer Skitour in den Osttiroler<br />
Bergen. „Unglaublich, diese Stille, diese<br />
Ruhe, diese gewaltige Landschaft. Wir<br />
haben das so genossen, und dann diese<br />
Aussicht. Der Glockner unmittelbar vor<br />
dir, links dahinter der Venediger, dann<br />
noch …“<br />
Wenn er in den Bergen unterwegs ist,<br />
geht ihm schon mal das Herz über, auch<br />
deshalb, weil er ja im deutschen Plön<br />
geboren wurde. Gut, dieses kleine Dörfchen<br />
kennen nicht mal die Deutschen. Es<br />
liegt in der Nähe von Kiel, im äußersten<br />
Norden des Landes. Und dort gibt es halt<br />
bekanntermaßen nicht so viele Berge.<br />
Rein sprachlich ist vom geborenen Nordgermanen<br />
nicht mehr viel übriggeblieben.<br />
Bereits seit 2013 lebt er mit seiner Frau<br />
in Matrei in Osttirol, hat auch schon den<br />
örtlichen Dialekt angenommen. Das klingt<br />
dann zuweilen doch recht interessant. Mit<br />
einer Größe von knapp zwei Metern und<br />
einem entsprechend stattlichen Gewicht<br />
macht er schon etwas her, der Herr Jan<br />
Schäfer. „Ich wollte mich schon immer in<br />
Tirol niederlassen, auch weil ich als Kind<br />
mit meinem Vater hier in den Bergen<br />
unterwegs war. Da könnte ich dir stundenlang<br />
davon erzählen. Meinen Militärdienst<br />
habe ich in Mittenwald, also direkt<br />
an der Grenze zu Tirol, abgeleistet. Da<br />
fällt mir ein …“<br />
Bücher, Bücher, Bücher<br />
Können Sie sich vorstellen, ein Buch zu<br />
schreiben? Eben. Jan Schäfer hat gleich<br />
21 geschrieben. Vor allem als sogenannter<br />
Ghostwriter, als schreibender Geist<br />
also. In Summe werden das wohl weit<br />
über fünftausend Seiten gewesen sein.<br />
Sein bisher letztes Buch hat er übrigens<br />
für die GemNova verfasst. „Wir alle sind<br />
Gemeinde“ so der Titel, eine Handlungsanleitung<br />
aus der Praxis für die Praxis.<br />
Mit vielen konkreten Beispielen aus den<br />
Gemeinden, mit vielen Statements von<br />
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern.<br />
Gleich danach wurde er von der GemNova<br />
fix engagiert. So ist er seit April des<br />
Vorjahres als Gemeindebetreuer für die<br />
33 Gemeinden in Osttirol unterwegs. Von<br />
den Bürgermeister*innen, die er natürlich<br />
schon alle besucht hat, wird er geschätzt.<br />
Wohl auch deshalb, weil gerade in diesen<br />
Tagen ein größeres interkommunales<br />
Projekt langsam Form annimmt. „Nein,<br />
dazu kann ich jetzt nichts sagen. Wir sind<br />
noch mitten in der Abstimmung. Sobald<br />
finalisiert, wird es breit vorgestellt“, so<br />
Schäfer.<br />
VIELSEITIGKEIT<br />
TRIFFT AUF<br />
HÖCHSTE<br />
PERFORMANCE<br />
Die Kompaktkehrmaschine Multigo150<br />
verbindet hervorragende Kehreigenschaften<br />
sowie eine hohe Zuladung<br />
mit den Vorteilen eines multifunktionalen<br />
Geräteträgers und bietet Ihnen<br />
damit eine wirtschaftlich interessante<br />
Ergänzung innerhalb Ihres Fuhrparks.<br />
Die perfekte Abstimmung zwischen Fahrzeug<br />
und Anbaugerät hat einen großen<br />
Einfluss auf die Effektivität – ein schneller<br />
Gerätewechsel und passgenaue Anbaugeräte<br />
machen die Multigo 150 zum kleinsten<br />
Allrounder in der Schmidt-Kehrmaschinen-Familie<br />
Im Sommerdienst ebenso<br />
wie im Winterdienst. Eine Investition in<br />
Flexibilität, die sich für Sie auszahlt.<br />
AEBI SCHMIDT | SCHIESSSTAND 4, 6401 INZING<br />
T: +43 5238 5359, F: +43 5238 5359 050<br />
AT@AEBI-SCHMIDT.COM | WWW-AEBI-SCHMIDT.AT<br />
UNSER MULTITALENT –<br />
IHRE VORTEILE:<br />
+ 1 Gerät, 5 Möglichkeiten –<br />
vielseitiger Nutzungsgrad und<br />
effiziente Auslastung<br />
+ Mit dem B -Führerschein (PKW) fahrbar<br />
+ Der Perkins-Dieselmotor mit 75 PS,<br />
4 Zylinder Common-Rail mit 2,2 Liter<br />
Hubraum erfüllt die Umweltvorgabe<br />
der EU-Stufe 5<br />
+ Extrem wendig dank Knick -Gelenk<br />
+ Geringere Unterhaltskosten dank<br />
kleinerem Fuhrpark<br />
+ Einfaches Wechseln der Anbaugeräte<br />
+ Automatischer Allradantrieb (4x4),<br />
automatische Kraftverteilung<br />
+ Hohe Nutzlast von 1 Tonne, zulässiges<br />
Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen<br />
+ Bestes Level PM10/PM2.5 Zertifikat<br />
(4 Sterne)
62 tirol.hat Recht tirol.hat Recht<br />
63<br />
ERSTE URTEILE ZUR FRAGE:<br />
„MUSS EIN GESCHÄFTSRAUMMIETER WÄHREND<br />
DES LOCKDOWNS DEN MIETZINS BEZAHLEN?“<br />
ZUM AUTOR<br />
RA MAG. DANIEL S.<br />
AZEM, MSC,<br />
HEID & PARTNER<br />
RECHTSANWÄLTE<br />
Daniel Azem studierte an der Universität<br />
Wien und am International<br />
Law Institute in Washington. Er<br />
ist u. a. spezialisiert auf Liegenschaftsrecht<br />
und Vertragsrecht.<br />
Er betreut diverse Bauträger und<br />
begleitet Unternehmen wie Privatpersonen<br />
in sämtlichen Bereichen<br />
des Liegenschaftsrechts.<br />
Bei behördlich angeordneten<br />
Betriebsschließungen und Nichtbenutzbarkeit<br />
des Geschäfts-<br />
lokals kann die Mietzinszahlungspflicht<br />
entfallen.<br />
Gemäß ersten Urteilen – jedoch nur auf<br />
bezirksgerichtlicher Ebene – ist die Covid-<br />
19-Pandemie als Seuche anzusehen und<br />
befreit unter Umständen Geschäftsraummieter*innen<br />
von der Mietzinszahlungspflicht.<br />
Eine über 100 Jahre alte Gesetzesstelle,<br />
die viele Jahre nur eine sehr<br />
eingeschränkte Praxisrelevanz hatte, soll<br />
nun Antworten auf aktuelle Probleme zahlreicher<br />
Mieter*innen bieten. § 1104 ABGB<br />
erreichte durch die Covid-19-Pandemie an<br />
Bedeutsamkeit für zahlreiche Mieter*innen<br />
von Geschäftsräumen, welche aufgrund der<br />
behördlichen Anordnungen zur Schließung<br />
ihrer Geschäftslokale während des ersten<br />
und zweiten Lockdowns verpflichtet waren<br />
und – aktuell während des dritten Lockdowns<br />
– wieder sind.<br />
Die zentrale Frage, die sich stellt, ist:<br />
„Befreit die behördlich angeordnete Verpflichtung<br />
zur Schließung den Mieter/die<br />
Mieterin von der Pflicht zur Zahlung des<br />
Mietzinses?“ Mit der Auseinandersetzung<br />
mit dieser Frage sind zahlreiche Gerichte<br />
derzeit beschäftigt. Eine eindeutige Antwort<br />
auf diese Frage gibt es nach wie vor nicht.<br />
Zwei Gerichtsentscheidungen des Bezirksgerichts<br />
Meidling zeigen nun jedoch eine<br />
erste Tendenz und ermöglichen eine erste<br />
branchenbezogene Einschätzung.<br />
Das Bezirksgericht Meidling entschied in<br />
zwei Verfahren zugunsten der Mieter*innen<br />
– betroffen waren ein Friseursalon sowie<br />
ein Bekleidungsgeschäft – und sprach aus,<br />
dass aufgrund der durch die Covid-19-Pandemie<br />
bedingten behördlich angeordneten<br />
Betriebsschließungen die Verpflichtung<br />
zur Mietzinszahlung für den Zeitraum des<br />
ersten Lockdowns entfallen sei. Beide Entscheidungen<br />
wurden von derselben Richterin<br />
gefällt, sodass sich auch die rechtlichen<br />
Beurteilungen weitgehend gleichen.<br />
Die zentrale Norm beider Urteile stellt<br />
§ 1104 ABGB dar. Diese sieht vor, dass kein<br />
Miet- oder Pachtzins zu entrichten ist, wenn<br />
die Bestandssache wegen außerordentlichen<br />
Zufalls nicht benutzt werden kann.<br />
Beispielhaft für einen außerordentlichen<br />
Zufall führt das Gesetz die Seuche an. Unter<br />
außerordentlichem Zufall wird in der Literatur<br />
ein vom Menschen nicht beherrschbares<br />
Elementarereignis verstanden, welches<br />
schon seiner Art nach, nämlich aufgrund<br />
seiner Größe und Unabgrenzbarkeit, aus<br />
den Mustern regelmäßiger Abläufe herausfällt<br />
und einen größeren Personenkreis<br />
massiv betrifft.<br />
Das Bezirksgericht Meidling hielt fest, dass<br />
die Covid-19-Pandemie als Seuche im Sinne<br />
des § 1104 ABGB anzusehen sei und daher<br />
einen außerordentlichen Zufall darstelle, der<br />
nicht den Mieter*innen zuzurechnen sei<br />
und kein „allgemeines Lebensrisiko“ darstelle,<br />
sondern einen größeren Personenkreis<br />
betreffe.<br />
Ob dies tatsächlich zu einem Entfall der<br />
Verpflichtung zur Mietzinszahlung führe, sei<br />
abhängig davon, ob eine vertragsgemäße<br />
Nutzung der Bestandssache möglich sei.<br />
Es komme nicht darauf an,<br />
ob die Benützung absolut unmöglich<br />
sei, sondern es sei<br />
– laut Ansicht des Bezirksgerichts<br />
Meidling – ausreichend,<br />
wenn die Benutzung zum bedungenen<br />
Gebrauch unmöglich sei.<br />
Nicht relevant sei also, ob das Objekt noch<br />
auf irgendeine andere Art und Weise – zum<br />
Beispiel für Lagerzwecke – genutzt werden<br />
könne. Da von 16.3.2020 bis zum 30.4.2020<br />
per Verordnung der Zutritt zum Kundenbereich<br />
bestimmter Betriebsstätten des Handels<br />
und von Dienstleistungsunternehmen<br />
sowie von Freizeit- und Sportbetrieben verboten<br />
war, waren die betroffenen Branchen<br />
zum Großteil gezwungen, ihre Geschäfte für<br />
den Kundenverkehr geschlossen zu halten.<br />
Die Möglichkeit, in den Geschäftslokalen<br />
Waren zu lagern, sei nach Ansicht des<br />
Bezirksgerichts unerheblich. Folglich bejahte<br />
das Gericht die gänzliche Unbenutzbarkeit<br />
zum bedungenen Gebrauch, da<br />
das Lagern von Sachen sowohl für einen<br />
Friseursalon als auch für das Bekleidungsgeschäft<br />
nur Ausfluss der eigentlichen<br />
Geschäftstätigkeit sei.<br />
Auch wenn das Bestandsobjekt nach<br />
Beendigung des Lockdowns wieder zur<br />
Verfügung stehe, sei ein gänzlicher Entfall<br />
der Verpflichtung zur Zahlung des Mietzinses<br />
nach dem ausdrücklichen Wortlaut des<br />
§ 1104 ABGB möglich, wenn die in Bestand<br />
genommene Sache wegen einer „Seuche<br />
[...] gar nicht gebraucht oder benutzt werden<br />
kann“. Das Bezirksgericht Meidling verwies<br />
diesbezüglich auf eine OGH-Entscheidung<br />
aus dem Jahr 1953, nach welcher es<br />
zu einem Entfall der Mietzinszahlungspflicht<br />
aufgrund einer Beschlagnahme<br />
eines Geschäftslokals durch eine Besatzungsmacht<br />
gekommen ist.<br />
Interessant wird sein, ob die vorgenannten<br />
Entscheidungen auch für andere Branchen<br />
– z. B. für Büromietverträge oder Restaurants<br />
– relevant sein werden.<br />
Zentrale Entscheidungsmerkmale<br />
für den Entfall der Mietzinszahlungspflicht<br />
sind nach<br />
dem Bezirksgericht Meidling<br />
einerseits der vereinbarte<br />
Verwendungszweck des Mietobjekts<br />
sowie andererseits die<br />
branchenbedingte Betroffenheit.<br />
Während sowohl die Friseur*innen als auch<br />
der Einzelhandel, von einigen Ausnahmen<br />
abgesehen, zur gänzlichen Schließung verpflichtet<br />
waren, bestand in der Gastronomie<br />
grundsätzlich die Möglichkeit, Speisen<br />
zur Abholung anzubieten oder diese<br />
auszuliefern. Auch Büronutzungen waren<br />
VORÜBER-<br />
GEHEND<br />
GESCHLOSSEN<br />
und sind – mit Einschränkungen – zulässig.<br />
In diesem Fall kann also nicht davon<br />
gesprochen werden, dass die angemieteten<br />
Geschäftslokale bzw. Büroräumlichkeiten<br />
aufgrund der Covid-19-Pandemie<br />
nicht mehr zum vertraglich vereinbarten<br />
Zweck benutzt werden konnten. Bietet<br />
z. B. ein Gastronom ein Lieferservice<br />
oder die Möglichkeit der Abholung von<br />
Speisen an und bleibt ihm daher ein<br />
beschränkter Gebrauch des Mietobjekts,<br />
wird die Verpflichtung zur Mietzinszahlung<br />
nicht gänzlich entfallen, aber haben<br />
die Mieter*innen wohl ein Recht auf Minderung<br />
des Mietzinses (§ 1105 ABGB).<br />
Zu überlegen ist auch, ob Mieter*innen<br />
von Geschäftslokalen, die von den Betretungsverboten<br />
ausgenommen waren,<br />
allerdings aufgrund der eingeschränkten<br />
Möglichkeit des Betretens des öffentlichen<br />
Raums kaum Kund*innen empfangen<br />
konnten, von der Mietzinszahlung<br />
befreit sein könnten. Da das Geschäftslokal<br />
in diesen Fällen weiterhin zum vertraglich<br />
vereinbarten Zweck gebraucht<br />
werden konnte und lediglich die Kundenfrequenz<br />
geringer war, ist der Anwendungsbereich<br />
des § 1104 ABGB wohl nicht<br />
eröffnet. Allerdings ist es denkbar, dass<br />
die durch die behördlichen Maßnahmen<br />
bedingte Reduktion des Kundenverkehrs<br />
in diesen Bereichen eine Minderung des<br />
Mietzinses rechtfertigt.<br />
Weil die beiden vorgenannten – mittlerweile<br />
rechtskräftigen – Entscheidungen nur<br />
auf bezirksgerichtlicher Ebene vorliegen,<br />
bleiben noch viele Fragen ungeklärt, etwa<br />
ob eine bloß mittelbare Betroffenheit von<br />
den behördlich angeordneten Schließungen<br />
Auswirkungen auf die Mietzinszahlungspflicht<br />
haben kann. Auch ob der Betrieb<br />
eines Online-Shops oder die Nutzung eines<br />
Teils der Geschäftsräume als Lagerraum<br />
Auswirkungen auf diese haben kann, muss<br />
noch geklärt werden. Ferner bleibt die Rolle<br />
des Umsatzersatzes und des Fixkostenzuschusses<br />
offen. Verwirkt ein solcher die<br />
Befreiung nach § 1104 ABGB?<br />
Die beiden vorgenannten Entscheidungen<br />
und die daraus ableitbaren Tendenzen<br />
der Rechtsprechung treffen nicht nur auf<br />
Erleichterung bei Mieter*innen, sondern<br />
auch auf harsche Kritik auf Seite vieler<br />
Vermieter*innen und aus Teilen der Literatur.<br />
Es ist jedenfalls davon auszugehen,<br />
dass diese Rechtsfrage die österreichischen<br />
Gerichte in den kommenden Monaten<br />
weiterhin stark beschäftigen wird,<br />
sodass es wohl nur eine Frage der Zeit<br />
ist, bis sich der OGH ausführlich mit dieser<br />
Thematik auseinanderzusetzen hat.<br />
OBEN: Viele Geschäftslokale sind derzeit<br />
geschlossen. Müssen Mieter*innen trotzdem Miete<br />
bezahlen? (© shutterstock)
64 tirol.kooperiert tirol.kooperiert 65<br />
FÖRDERUNG FÜR<br />
CO-WORKING IN<br />
GEMEINDEN<br />
Trotz der vorherrschenden Covid-19-Pandemie ist der Trend an<br />
Innovationsvorhaben und auch entsprechenden Neugründungen,<br />
u. a. Start-ups, ungebrochen.<br />
Vor allem die relevanten Covid-19-Auflagen,<br />
die ein Abstandhalten sowie digitale<br />
Interaktionswege empfehlen und vorschreiben,<br />
sorgten schlussendlich dafür,<br />
dass diverse neue digitale Geschäftsmodelle,<br />
u. a. im Bereich von Handelsplattformen<br />
sowie bei Dienstleistungen<br />
entstanden sind. Die überwiegend<br />
jungen Unternehmen konnten im Zuge<br />
ihrer Gründungen und Entwicklungsarbeiten<br />
auf umfassende Fördermöglichkeiten<br />
zurückgreifen, sodass auch deren<br />
Geschäftsbetrieb rasch gestartet werden<br />
konnte. Die hierfür notwendigen „Unternehmensflächen“<br />
waren insofern rasch<br />
gefunden, als dass sich die Gründer*innen<br />
zum Teil von zuhause aus und via<br />
ZUM AUTOR<br />
BERNHARD HOFER, MSC<br />
Bernhard Hofer ist CEO der Cemit<br />
Speeding up Innovation GmbH, welche<br />
sowohl Start-ups, Gemeinden als<br />
auch Großunternehmen im Innovationsprozess<br />
begleitet.<br />
virtuellen Austauschs mit ihren Gründerkolleg*innen<br />
und auch ersten Kund*innen<br />
abstimmen konnten.<br />
UNTER INTERAKTIVEM STAND-<br />
ORT VERSTEHEN DIESE UNTER-<br />
NEHMEN VOR ALLEM PLÄTZE,<br />
AN DENEN SICH AUCH ANDERE<br />
JUNGUNTERNEHMEN AUFHAL-<br />
TEN UND WODURCH EINE OPTI-<br />
MIERUNG DER MÖGLICHKEITEN<br />
ERREICHT WERDEN KANN.<br />
Dies ist vor allem in Zeiten von Homeoffice<br />
und virtuellen Arbeitswelten essenziell,<br />
auch wenn es ja hoffentlich eine Zeit<br />
nach Covid-19 geben wird. Und gerade<br />
dieser Zeitfaktor spielt aktuell eine große<br />
Rolle, denn die digitalen Jungunternehmen<br />
werden sich zum Teil rasch entwickeln<br />
und in Zukunft mehr Arbeitsplätze und<br />
Office-Space benötigen, damit trotz der<br />
mittlerweile etablierten virtuellen Arbeitswelten<br />
ein Miteinander an einem Unternehmensstandort<br />
entstehen kann.<br />
U. a. rechnet die Cemit damit, dass bis zu<br />
30 digitale Jungunternehmen ab ca. 2022<br />
Office-Möglichkeiten suchen werden, die<br />
zum Teil vorhanden sind, jedoch nicht an<br />
einem interaktiven Standort. Unter interaktivem<br />
Standort verstehen diese Unternehmen<br />
vor allem Plätze, an denen sich<br />
auch andere Jungunternehmen aufhalten<br />
und wodurch eine Optimierung der Möglichkeiten,<br />
das heißt Ressourcen – Partnernetzwerke<br />
– Investoren etc., erreicht<br />
werden kann.<br />
Diesbezüglich besteht aktuell die einzigartige<br />
Möglichkeit, dass mittels Förderungen<br />
relevante Coworking-Plätze geschaffen<br />
werden können, die gegebenenfalls<br />
auch thematisch ausgerichtet sind. So<br />
könnten sich auch gewisse Gemeinden<br />
und Planungsverbände zu einer strategischen<br />
Coworking-Ausrichtung zusammenschließen,<br />
anhand derer Schwerpunkte<br />
statt Redundanzen geschaffen<br />
werden können. Weiters ermöglichen die<br />
Coworking-Plätze sogenannte Voucher-<br />
Systeme, anhand derer die Vermieter (u.<br />
a. Gemeinden) begünstigte Plätze nur mit<br />
klar definierten Outputs vergeben. Darüber<br />
hinaus können sich u. a. Gemeinden<br />
auf eine zum Teil notwendige Expansion<br />
dieser Jungunternehmen vorbereiten,<br />
sodass diese auch mittels eigener Infrastrukturen<br />
im Gemeindegebiet dauerhaft<br />
angesiedelt werden können.<br />
Das bedeutet: Jetzt planen und bereits<br />
die Wirtschaftsbetriebe von morgen<br />
verorten.<br />
Gerade in Zeiten wie diesen,<br />
wo alle Fördermöglichkeiten<br />
maximal ausgeschöpft werden<br />
sollten, um das ohnehin<br />
schon angespannte Budget<br />
zu entlasten und Investitionen<br />
tätigen zu können, ist es essenziell,<br />
den Überblick im Förderdschungel<br />
zu bewahren.<br />
Ob bei Infrastrukturprojekten,<br />
im Bereich der Digitalisierung<br />
oder in Bezug auf Thematiken<br />
rund um Umwelt, Mobilität<br />
und Klima – das Spektrum<br />
an unterschiedlichen Förderprogrammen<br />
auf den diversen<br />
Ebenen (Land, Bund, EU) ist<br />
weitreichend. Gerne unterstützen<br />
wir die Gemeinden<br />
dabei, sämtliche Förderpotenziale<br />
bestmöglich zu nutzen.<br />
Bei Fragen zu Fördermöglichkeiten<br />
von Coworking-<br />
Arbeitsplätzen, aber auch<br />
zu allen anderen Förderthemen<br />
stehen wir Ihnen gerne<br />
zur Verfügung.<br />
KONTAKT:<br />
Maximilian Huber<br />
+43 660 29 68 969<br />
m.huber@gemnova.at
66 tirol.kooperiert 67<br />
GEKO <strong>2021</strong> –<br />
zum Vorbild für<br />
andere werden<br />
(© Land Tirol/Cammerlander)<br />
AUTOR<br />
MANFRED SCHIECHTL<br />
Der vom Land Tirol und dem Tiroler<br />
Gemeindeverband initiierte und von<br />
der GemNova unterstützte Gemeindekooperationspreis<br />
GEKO geht <strong>2021</strong><br />
in die bereits fünfte Runde. Im Fokus<br />
steht dabei gemeindeübergreifende<br />
Zusammenarbeit in Form von Kooperationen<br />
und gemeinsamen Projekten.<br />
Und Tirols Gemeinden haben dabei einmal<br />
mehr viel zu bieten.<br />
Auch heuer sollen wieder gelungene<br />
Best-Practice-Beispiele vor den Vorhang<br />
geholt und die besten Projekte in Tirol<br />
ausgezeichnet werden. Landesrat Johannes<br />
Tratter freut sich bereits auf die Einsendungen<br />
für die heurige Ausgabe des<br />
GEKO: „Das Denken über die Gemeindegrenzen<br />
hinaus funktioniert in Tirol in vielen<br />
Gemeinden auf sehr hohem Niveau.<br />
Das haben die bisherigen GEKO-Einreichungen<br />
eindrucksvoll bewiesen.“ Und für<br />
Tratter ist wichtig, dieses Engagement<br />
vieler Kommunen auch dementsprechend<br />
zu würdigen: „Mit dem GEKO <strong>2021</strong> wollen<br />
wir auch in diesem Jahr wieder die besten<br />
Projekte in Tirol auszeichnen.“<br />
Ganz ähnlich sieht dies Gemeindeverbandspräsident<br />
Ernst Schöpf: „Welche<br />
Vorteile die Zusammenarbeit von<br />
Gemeinden bringen kann, haben uns die<br />
Siegerprojekte der letzten Jahre bereits<br />
ausführlich gezeigt. Gemeinden müssen<br />
nicht zwingend fusioniert werden,<br />
um bestmöglich zusammenarbeiten zu<br />
können. Funktionierende gemeindeübergreifende<br />
Kooperationen sollen daher<br />
mit diesem Preis besondere Anerkennung<br />
erlangen und als Vorbilder für<br />
andere Gemeinden dienen.“ Der Gem-<br />
Nova-Geschäftsführer kann dem nur<br />
zustimmen: „Es ist uns ein sehr wichtiges<br />
Anliegen, gemeindeübergreifende<br />
Zusammenarbeit zu fördern. Wir sind<br />
überzeugt, dass durch Kooperation weitaus<br />
mehr erreicht werden kann. Deshalb<br />
unterstützen wir auch <strong>2021</strong> wieder<br />
den Gemeindekooperationspreis GEKO.<br />
Sowohl finanziell als auch ideell.“<br />
„Das Denken über<br />
die Gemeindegrenzen<br />
hinaus<br />
funktioniert in<br />
Tirol in vielen<br />
Gemeinden auf<br />
sehr hohem Niveau.<br />
Das haben<br />
die bisherigen<br />
GEKO-Einreichungen<br />
eindrucksvoll<br />
bewiesen.“<br />
MAG. JOHANNES TRATTER<br />
LANDESRAT<br />
Eingereicht können bereits umgesetzte<br />
kommunale Vorhaben werden, die zur<br />
Stärkung und Erhöhung der Attraktivität<br />
bzw. der Wettbewerbsfähigkeit der Region<br />
beitragen. Oder die zu einem nachhaltigen<br />
Ausbau der Lebensqualität, zu<br />
einer integrativen und zukunftsorientierten<br />
Raum- und Regionsentwicklung sowie<br />
zur aktiven Bewältigung der gesellschaftlichen<br />
Herausforderungen beitragen. Dazu<br />
zählen beispielsweise positive Impulse<br />
für die Dorf- und Stadtentwicklung in<br />
von Abwanderung betroffenen Regionen,<br />
aber auch die Vernetzung von Bildungsmöglichkeiten,<br />
gemeinsame Freizeitangebote<br />
sowie die Zusammenarbeit auf<br />
kommunaler, wirtschaftlicher und touristischer<br />
Ebene. Die Einreichungen werden<br />
von einer Fachjury bewertet, die besten<br />
Vorschläge stellen sich dann einem<br />
Online-Voting. Der Lohn für die Gewinner-<br />
Gemeinde sind eine Prämie von 8.000<br />
Euro, außerdem eine Preisträger-Feier.<br />
Für Platz zwei und drei sind 4.000 bzw.<br />
3.000 Euro ausgelobt.<br />
Weitere Infos unter www.geko.tirol<br />
DIE TIROLER<br />
LÖSUNG, DAMIT<br />
DAS VIRUS<br />
HOPS GEHT.<br />
Ein schlüssiges Hygienekonzept mit reiner Naturkosmetik für Schulen und Kindergärten. Mit den medizinischen<br />
Flüssigseifen, Hand-Hygienegelen und Hautpflege von VIRUHOPS schaffen Sie ein Gefühl der professionellen<br />
Fürsorge für Ihre Schüler, Kindergartenkinder aber auch für sich selbst und die Eltern. JETZT BESTELLEN!<br />
BESCHAFFUNG@GEMNOVA.AT, +43 (0) 50 4711 4711<br />
GEMNOVA DIENSTLEISTUNGS GMBH | ADAMGASSE 7A | A-6020 INNSBRUCK<br />
WWW.GEMNOVA.AT
68 tirol.bildet tirol.bildet<br />
69<br />
ZUR AUTORIN<br />
MAG. SANDRA WIMMER<br />
Sandra Wimmer verantwortet den Bereich<br />
Aus- und Weiterbildung. Sie hat selbst als<br />
Deutschtrainerin gearbeitet und ist Expertin<br />
im Bereich Sprach- und Wissensvermittlung.<br />
Kontakt: s.wimmer@gemnova.at<br />
Das<br />
moderne<br />
Trainieren<br />
Zeit. Zeit ist eines der kostbarsten<br />
Güter, die wir Menschen<br />
haben. Bildung. Bildung<br />
öffnet Türen und schafft die<br />
Möglichkeit zu Veränderung.<br />
Leider ist oftmals die Zeit so<br />
knapp bemessen, dass man es<br />
nicht schafft, an umfangreichen<br />
Aus- und Weiterbildungen<br />
teilzunehmen, die die persönliche<br />
Entwicklung positiv unterstützen<br />
können.<br />
Was braucht es also, um trotz der knappen<br />
Zeitressourcen dennoch an Ausund<br />
Weiterbildungen teilzunehmen? Ein<br />
Umdenken in der Konzepterstellung und<br />
die Anwendung moderner Methoden zur<br />
Wissensvermittlung. Aus- und Weiterbildung<br />
ist derzeit einem enormen Wandel<br />
unterlegen und schafft zugleich innovative<br />
und zeitgenössische Möglichkeiten, sein<br />
Wissen zu erweitern. Wurde früher vermehrt<br />
auf Eigenstudium mittels Bücher<br />
gesetzt, findet heutzutage viel Wissensaneignung<br />
online mittels E-Learning am<br />
Smartphone, Laptop oder Tablet statt.<br />
Durch E-Learning kann ich selbst entscheiden,<br />
was ich lernen will, wo ich mir<br />
mein Wissen aneigne, für welche Themen<br />
ich mehr Zeit und eine tiefergehende Auseinandersetzung<br />
benötige.<br />
Der soziale Aspekt darf beim<br />
Aus- und Weiterbilden nicht<br />
vernachlässigt werden.<br />
Präsenzseminare beanspruchen oft viel<br />
Zeit, man hat eine lange Anreise und aufgrund<br />
der heterogenen Gruppe werden die<br />
vorgetragenen Inhalte meist sehr allgemein<br />
gehalten. Von großem Vorteil sind die persönlichen<br />
Gespräche, der Austausch mit<br />
den Seminarteilnehmer*innen und den Vortragenden.<br />
Vor allem Pausen bieten Zeit für<br />
Reflexion und Erfahrungsaustausch. Der<br />
soziale Aspekt darf beim Aus- und Weiterbilden<br />
nicht vernachlässigt werden.<br />
Live-Online-Trainings eignen sich hervorragend,<br />
um ortsunabhängig an Seminaren<br />
teilnehmen zu können. Man benötigt<br />
einen Laptop, eine gute Internetverbindung<br />
und bestenfalls noch Kopfhörer, um<br />
alles gut mitverfolgen zu können. Aufgrund<br />
ihrer zunehmenden Bedeutung werden<br />
auch die Live-Online-Trainings vielfältig<br />
gestaltet: Online-Vorträge werden mittels<br />
Whiteboard-Einheiten, Arbeitsgruppen,<br />
Diskussionen, Chats, Umfragen u.<br />
v. m. dynamisch gestaltet und bringen<br />
Abwechslung in die Veranstaltung.<br />
Blended Learning bedeutet,<br />
das Beste aus allen Methoden<br />
zusammenzubringen.<br />
Um wieder zum Einstieg und zum stetigen<br />
Wandel zurückzukommen, soll betont<br />
werden, dass es vor wenigen Jahren größtenteils<br />
nur möglich war, an Seminaren<br />
und Veranstaltungen vor Ort teilzunehmen.<br />
Heute gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten,<br />
wie man Aus- und Weiterbildung<br />
im Alltag integrieren kann. Damit man<br />
die Vorteile aller drei Methoden genießen<br />
kann, gibt es die hybride Form des Blended<br />
Learning. So wie bei hybriden PKW (Verbrennungsmotor<br />
für lange Distanzen und<br />
Elektromotor für Stadtfahrten) werden bei<br />
diesem Ansatz Präsenzseminare, E-Learning<br />
und Online-Live-Trainings kombiniert.<br />
Beispielsweise sei hier das Blended Learning<br />
zur „VRV 2015: Wie erstelle ich einen<br />
Rechnungsabschluss korrekt“ genannt.<br />
Prinzipiell ein recht trockenes Thema (bitte<br />
nicht böse nehmen), im Blended-Learning-Stil<br />
bekommt man allerdings viel<br />
Abwechslung geboten. Interessierte können<br />
sich im ersten Schritt im Selbststudium<br />
mittels E-Learning die Grundlagen zum<br />
„VRV-2015-Rechnungsabschluss“ aneignen.<br />
Anhand dieser ersten theoretischen<br />
Auseinandersetzung mit dem Thema wird<br />
Basiswissen aufgebaut. Erfahrungsgemäß<br />
kommen hier einige Fragen auf, die von<br />
einem Spezialisten beantwortet werden.<br />
Im Anschluss an das erfolgreich abgeschlossene<br />
E-Learning findet ein Live-<br />
Online-Training mit einem Experten/einer<br />
Expertin statt. Hier werden tiefergehende<br />
Fragen beantwortet und zusätzliches Wissen<br />
aufgebaut. Mit der Anwendung des<br />
spezifischen Wissens in der Gemeinde<br />
kommen nochmals gemeindespezifische<br />
Fragen auf. Da jede Gemeinde individuell<br />
agiert, führt ein allgemein ausgeschriebenes<br />
Präsenzseminar nicht zum Erfolg.<br />
Daher kommen die Expert*innen in die<br />
Gemeinde und schließen mit den Kolleg*innen<br />
in der Gemeinde die noch vorhandenen<br />
Wissenslücken in kurzen, kompakten<br />
Einheiten vor Ort.<br />
Blended Learning bedeutet somit, das<br />
Beste aus allen Methoden zusammenzubringen:<br />
individuell, maßgeschneidert, zeitund<br />
ortsunabhängig, abwechslungsreich,<br />
modern. Man muss als Bildungsinstitut<br />
nur den Mut und die Kreativität haben, sich<br />
dieser herausfordernden Unterrichtsweise<br />
zu stellen. Aber wir wären nicht die Gem-<br />
Nova-Akademie, wenn wir uns Innovativem<br />
mit größtem Kundennutzen verschließen<br />
würden. Denn besonders in der Aus- und<br />
Weiterbildung geht es darum, einen Beitrag<br />
für die Gemeinschaft zu leisten und<br />
die Bildung zu fördern.<br />
Merkmale<br />
Blended Learning<br />
+ Abwechslungsreich<br />
+ Hohe Abschlussquote<br />
+ Individuell steuerbar<br />
+ Individuelle Begleitung<br />
der Lernenden<br />
+ Lerntempo selbst<br />
bestimmbar<br />
+ Nachhaltiges Lernen<br />
+ Orts- und zeitunabhängig
70 ENTGELTLICHE tirol.bildet EINSCHALTUNG<br />
tirol.bildet<br />
71<br />
GAS UND GASNETZ – BEREIT FÜR DIE ENERGIEZUKUNFT<br />
Die Energiewende kann nur durch das<br />
kombinierte Zusammenwirken aller erneuerbaren<br />
Energieressourcen und der entsprechenden<br />
Infrastrukturen der Strom-,<br />
Gas- und Fernwärmenetze gelingen.<br />
Die Energieversorgung der Zukunft soll<br />
dekarbonisiert, aber auch sicher und wirtschaftlich<br />
sein. Die TIGAS unterstützt die<br />
Ziele der Energiestrategie des Landes<br />
Tirol, bis 2050 die Klimaneutralität zu<br />
erreichen, und leistet mit ihrer Gas- und<br />
Fernwärmestruktur sowie mit der Bereitstellung<br />
regenerativer Energieträger und<br />
bisher ungenutzter Wärmepotenziale<br />
einen wichtigen Beitrag dazu.<br />
Anteil an „grünem Gas“ steigt<br />
Eine wirtschaftliche, sichere und klimaneutrale<br />
Energieversorgung kann nur<br />
im Zusammenspiel aller erneuerbarer<br />
Energieformen und der entsprechenden<br />
Infrastrukturen erreicht werden. Erdgas<br />
soll unter Berücksichtigung der Versorgungssicherheit<br />
und zu vertretbaren Kosten<br />
für Haushalte und die Wirtschaft sukzessive<br />
durch erneuerbare Gase ersetzt<br />
werden. Regenerative Gase sind neben<br />
Biogas auch aus Ökostrom in Power-to-<br />
Gas-Anlagen erzeugter Wasserstoff und<br />
synthetisches Gas.<br />
Die TIGAS ist seit 2003 mit dem Einstieg<br />
in die Biogasproduktion und seit 2009 mit<br />
der Errichtung der Fernwärmetransportschiene,<br />
mit der bevorzugt industrielle<br />
Abwärme und Biowärme für Heizzwecke<br />
nutzbar gemacht werden, im Rahmen ihrer<br />
Möglichkeiten aktiv in der angestrebten<br />
Reduzierung der CO 2<br />
-Emissionen vorangegangen,<br />
um die künftige Energieversorgung<br />
in Tirol in den Sektoren Wärme und<br />
Verkehr zunehmend erneuerbar und bis<br />
2050 klimaneutral zu gestalten.<br />
Energiezukunft vernetzt denken<br />
Die Sektorkopplung, also die intelligente<br />
Verschränkung der Infrastrukturen Strom-,<br />
Gas- und Wärmenetze, ermöglicht eine<br />
effiziente Bereitstellung regenerativer<br />
Energie in der gewünschten Form und<br />
Menge sowie zum gewünschten Zeitpunkt.<br />
Zudem trägt die Sektorkopplung dazu<br />
bei, die Auslastung dieser Verteilnetzinfrastrukturen<br />
zu optimieren und dadurch<br />
die Investitionen in den weiteren Ausbau<br />
gering zu halten. Das gesamte Energiesystem<br />
ist dadurch stabiler, flexibler und<br />
kostengünstiger.<br />
Die TIGAS baut daher das Gasnetz und<br />
ihre Fernwärmenetze weiter bedarfsgerecht<br />
aus und forciert die Mobilisierung<br />
aller Biogas- und Wärmepotenziale in Tirol<br />
zur Bereitstellung heimischer, feinstaubfreier<br />
und klimaneutraler Energie.<br />
DIGITALE VERNETZUNGSARBEIT<br />
UNTER KINDERGÄRTEN IN TIROL<br />
Neue Wege zur Qualitätsentwicklung sprachlicher<br />
Bildung in der elementarpädagogischen Arbeit<br />
Die Plattform Sprachliche Bildung ist<br />
ein Angebot der regionalen und überregionalen<br />
fachlichen Vernetzung sowie<br />
der Weiterentwicklung pädagogischer<br />
Praxis für Fach- und Assistenzkräfte<br />
im Kindergarten.<br />
Schon gehört?<br />
TIGAS sorgt für Wärme in Tirol<br />
Die TIGAS gibt Sicherheit, sucht Ihre Nähe und ist immer für Sie da. Kurz: Die TIGAS spendet Wärme. Dank kluger und<br />
einfacher Lösungen. Und damit Sie es auch in Zukunft warm genug haben, setzt die TIGAS gleich auf mehrere Wärmequellen.<br />
So sorgt die TIGAS langfristig für Behaglichkeit und ein gesundes Klima.<br />
Digitale Medien stellen in Zeiten von<br />
Corona auch in der Elementarpädagogik<br />
eine unentbehrliche Arbeitsgrundlage<br />
dar: Sie schaffen noch nie dagewesene<br />
Formen qualitätsvoller pädagogischer<br />
Zusammenarbeit unter Kindergärten aus<br />
unterschiedlichen Gemeinden und Bezirken<br />
sowie die Möglichkeit der Fortsetzung<br />
von kollegialer und individueller Beratung<br />
auf Distanz.<br />
Etablierung neuer Lernfelder und Vernetzungsräume<br />
Das Team der Tiroler Sprachberaterinnen<br />
des GemNova-Bildungspools Tirol hat im<br />
Rahmen der Richtlinie Sprachförderung<br />
gemäß der Vereinbarung § 15a B-VG für<br />
8.000 Elementarpädagog*innen aus den<br />
insgesamt 480 Kindergärten in Tirol eine<br />
digitale Arbeits- und Vernetzungsplattform<br />
mit dem Namen Plattform Sprachliche<br />
Bildung konzipiert und aufgebaut.<br />
Damit soll gewährleistet werden, dass<br />
statt der ursprünglich geplanten ganzjährigen<br />
regionalen Vernetzungstreffen in<br />
allen Bezirken, die aufgrund der aktuellen<br />
Pandemie in Präsenz nicht stattfinden<br />
können, das pädagogische Netzwerken<br />
über alle Bezirke hinweg im virtuellen<br />
Raum fortgesetzt werden kann. Die Plattform<br />
Sprachliche Bildung bietet mit vielen<br />
Praxis-, Wissens- und Reflexionsbausteinen<br />
zu verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten<br />
ein fachliches Grundgerüst für<br />
die Einschätzung und Weiterentwicklung<br />
der Interaktionsqualität in der pädagogischen<br />
Arbeit im Kindergarten. Zusätzlich<br />
wird allen interessierten Teams in Kindergärten<br />
die Gelegenheit geboten, über<br />
die Plattform ihre eigene Fachexpertise<br />
rund um die alltagsintegrierte sprachliche<br />
Bildung zu teilen und somit auch pädagogische<br />
Teams aus anderen Einrichtungen<br />
daran teilhaben zu lassen.<br />
OBEN: Sprache wird am besten in<br />
Interaktionen erlernt. Hohe Qualität in der<br />
sprachlichen Bildung im Kindergarten unterstützt<br />
die Sprachentwicklung von Kindern<br />
massiv. Die Plattform Sprachliche Bildung bietet<br />
den Kindergartenteams zahlreiche Angebote<br />
zur Einschätzung und Weiterentwicklung<br />
des eigenen Interaktionsverhaltens.<br />
(© shutterstock)<br />
TIGAS-Erdgas Tirol GmbH<br />
Ein Unternehmen der TIWAG-Gruppe<br />
Weiter denken. Besser bleiben. TIGAS.<br />
www.tigas.at
72 tirol.bildet tirol.bildet<br />
73<br />
„Hilf mir, es selbst zu tun“ –<br />
Dieses Zitat von Maria Montessori<br />
findet sich in vielen<br />
pädagogischen Konzeptionen<br />
von elementaren Bildungseinrichtungen<br />
in Tirol wieder.<br />
Mit der Plattform Sprachliche<br />
Bildung ist es gelungen, während<br />
der Pandemie die Maßnahmen<br />
zur Ausweitung und<br />
Vertiefung sprachförderlicher<br />
Kompetenzen des Personals<br />
in Kindergärten in den virtuellen<br />
Raum zu verlegen. Somit<br />
wird weiterhin gewährleistet,<br />
dass an den erforderlichen<br />
Schritten zur Umsetzung des<br />
sprachlichen Bildungsauftrages<br />
auch in Lockdownzeiten<br />
teilgenommen werden kann.<br />
Pädagogische Teams können<br />
sich in diesem virtuellen Raum<br />
eigenverantwortlich und aktiv<br />
bewegen und auf jene fachlichen<br />
Inhalte, die sie benötigen,<br />
immer wieder zugreifen – ganz<br />
im Sinne von „Hilf mir, es selbst<br />
zu tun“. Gleichzeitig profitieren<br />
alle von geteilten Fachbeiträgen,<br />
die auch aus den einzelnen<br />
pädagogischen Teams beigesteuert<br />
werden. Dieser Möglichkeitsraum<br />
zeugt von hoher<br />
Qualität und ist somit ein wichtiger<br />
Beitrag in der Qualitätssicherung<br />
der pädagogischen<br />
Arbeit in Tirol.<br />
JULIA RAICH<br />
LAND TIROL, ABTEILUNG<br />
GESELLSCHAFT UND ARBEIT<br />
FACHINSPEKTORIN FÜR<br />
ELEMENTARPÄDAGOGIK<br />
Nachhaltigkeitsgedanken im Sinne der<br />
Chancengleichheit von Kindern<br />
Umfassendes und kontinuierlich geteiltes<br />
Fachwissen auf Basis eines digitalen<br />
Wissensmarktplatzes für Elementarpädagog*innen<br />
kann erstmals der pädagogischen<br />
Qualität in der frühen sprachlichen<br />
Bildung in allen Tiroler Kindergärten<br />
zugutekommen und somit die Professionalisierung<br />
des pädagogischen Personals<br />
in Kindergärten aller Gemeinden stärken.<br />
Mit Qualitätsmaßnahmen wie diesen, die<br />
letztlich eine positive Entwicklung und<br />
Teilhabe von Kindern ermögilchen, wird<br />
nachhaltig ein zentraler Beitrag zur Chancengleichheit<br />
von Kindern geleistet, denn:<br />
„Sprachliche Bildung ist der Schlüssel zur<br />
Bildung.“<br />
Feedback aus der elementarpädagogischen<br />
Community<br />
Die bunte Vielfalt an Fachartikeln, Reflexionsimpulsen<br />
sowie Video-, Audio- und<br />
Fotoimpulsen auf der Plattform Sprachliche<br />
Bildung hat Pädagog*innen in ganz<br />
Tirol dazu bewegt, dem Team der Sprachberaterinnen<br />
praxisnahe Rückmeldungen<br />
in Bezug auf die Bildungsarbeit mit Kindern,<br />
Teamarbeit sowie Bildungspartnerschaft<br />
mit Eltern und Erziehungsberechtigten<br />
zukommen zu lassen. Hier finden<br />
sich einige anonymisierte Feedbacks:<br />
[…] Die Plattform hilft mir als Multiplikatorin<br />
sehr in meiner Arbeit,<br />
da sie mir neue Eindrücke und<br />
Ideen gibt, die ich sehr gerne mit<br />
dem Team teile, und wir dann<br />
gemeinsam Projekte, wie dem oben<br />
beschriebenen, erarbeiten können.<br />
Ein Meilenstein auch in der österreichischen<br />
Bildungslandschaft<br />
Der Vernetzungsgedanke unter Elementarpädagog*innen<br />
hat sich inzwischen<br />
auch schon bundesländerübergreifend<br />
etabliert.<br />
Tirol kann ein starkes Signal<br />
zur überregionalen Vernetzung<br />
und somit zur Qualitätsentwicklung<br />
der Elementarpädagogik<br />
in Österreich setzen.<br />
Die vom Bundesministerium für Bildung<br />
(BMBWF) und dem Österreichischen<br />
Integrationsfonds (ÖIF) initiierte virtuelle<br />
Sprachkonferenz im Jänner <strong>2021</strong> hat nicht<br />
nur das große Interesse am gegenseitigen<br />
fachlichen Austausch seitens der 50<br />
Vertreter*innen aus allen Bundesländern<br />
aufgezeigt, sondern war auch aus Sicht<br />
der Fachabteilung Elementarbildung des<br />
Landes Tirol ein besonderer Erfolg: Die<br />
von den Tiroler Sprachberaterinnen des<br />
GemNova-Bildungspools Tirol gegründete<br />
Plattform Sprachliche Bildung findet jetzt<br />
schon österreichweit großen Anklang und<br />
soll demnächst auch in anderen Bundesländern<br />
in die Praxisumsetzung gehen.<br />
Somit kann Tirol ein starkes Signal zur<br />
überregionalen Vernetzung und somit zur<br />
Qualitätsentwicklung der Elementarpädagogik<br />
in Österreich setzen.<br />
Qualitätsmaßnahme Sprachberatung<br />
auf neuen digitalen Wegen<br />
Großen Anklang finden in der aktuell kontaktlosen<br />
Zeit auch die mit Februar <strong>2021</strong><br />
gestarteten kollegialen Online-Beratungen,<br />
die als weitere Qualitätsmaßnahme<br />
zur Umsetzung der sprachlichen Förderung<br />
im Kindergarten von den neun<br />
Tiroler Sprachberaterinnen im Frühjahr<br />
moderiert werden: 30 Online-Veranstaltungen<br />
waren binnen weniger Tage<br />
restlos ausgebucht. Sie stellen ein völlig<br />
neues Beratungsformat dar und schaffen<br />
einen digitalen Raum der persönlichen<br />
Begegnung in kleinen Gruppen für<br />
gegenseitige Beratung unter Kolleg*innen<br />
zu aktuellen pädagogischen Herausforderungen.<br />
Dank dieses neu konzipierten<br />
Formats haben pädagogische Fachkräfte<br />
erstmalig die Chance, sich über den<br />
eigenen Bezirk hinaus fachlich auszutauschen,<br />
die gelebte Praxis im Kindergarten<br />
vom Außerfern bis Lienz und Kitzbühel<br />
kennenzulernen und sich gegenseitig mit<br />
Wissen, Reflexionsimpulsen und Handlungsstrategien<br />
zu unterstützen. Ein<br />
gelungenes Projekt, das vielleicht auch in<br />
Zeiten nach der Pandemie im Sinne der<br />
Qualitätsentwicklung der elementarpädagogischen<br />
Praxis in Tiroler Kindergärten<br />
aufrechterhalten bleibt.<br />
[…] Ich werde bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall<br />
bewusster auf die Dinge achten, die ich jetzt gelesen und<br />
gehört habe. Besonders freut es mich, dass sich die Inhalte<br />
nicht ausschließlich auf Mehrsprachigkeit beziehen. Denn<br />
als Kindergarten einer kleinen, ländlichen Gemeinde betrifft<br />
uns dies momentan einfach nicht so sehr. Doch mit Themen<br />
zu Spracherwerb, Elterngesprächen etc. können auch wir viel<br />
anfangen und viel Praxisbezug herstellen.<br />
ZUR AUTORIN<br />
MAG. NINA REDLICH,<br />
MA ECED<br />
Nina Redlich leitet das Team<br />
Sprachberatung des Landes Tirol<br />
und koordiniert den Fachbereich<br />
Elementarpädagogik im GemNova<br />
Bildungspool Tirol.<br />
Kontakt: n.redlich@gemnova.at<br />
[…] Danke für die digitalen Unterlagen und die interessanten Beiträge<br />
zum Thema Sprachbildung. Besonders interessant finde ich den Beitrag<br />
über effektive Elterngespräche. […] Ich habe die Erfahrung gemacht,<br />
dass ein wertschätzender Umgang, genügend Zeit für den gegenseitigen<br />
Austausch, eine angenehme Atmosphäre, gute Dokumentation und<br />
Vorbereitung und der Fokus auf die Stärken des Kindes wesentliche<br />
Voraussetzungen für ein gutes Gespräch sind. Und der Gedanke, dass<br />
wir das „Wohl des Kindes“ im Vordergrund sehen, ist ausschlaggebend.
74 tirol.bildet tirol.bildet<br />
75<br />
TEAM-<br />
BETREUUNG<br />
HAND in<br />
HAND<br />
Unvorstellbar, dass die Bildungspool Tirol gem. Tirol GmbH<br />
2016 mit knapp 30 Personen für die schulische Betreuung<br />
gestartet ist und nunmehr ein Kollegium mit über 400 Personen<br />
in ganz Tirol fasst.<br />
Es hat sich über die Jahre ein Team von<br />
motivierten, liebenswerten und engagierten<br />
Personen entwickelt, die in ihren<br />
unterschiedlichen Rollen als Schulassistent*innen,<br />
Freizeitbetreuer*innen, Teambetreuer*innen<br />
und Koordinator*innen<br />
gemeinsam, miteinander und füreinander<br />
tätig sind. Es wird Hand in Hand gearbeitet<br />
mit dem gemeinsamen Ziel, Qualität in der<br />
schulischen Betreuung zu bieten und einer<br />
Tätigkeit nachzugehen, die Freude und<br />
Erfüllung sowie Wertschätzung erfahren<br />
lässt. Gerade die Vielzahl an unterschiedlichen<br />
Persönlichkeiten und Professionen<br />
machen das Team des GemNova-Bildungspools<br />
so vielfältig und besonders.<br />
Ina Anker<br />
TEAMBETREUUNG<br />
Ina Anker ist bereits seit 2016 in<br />
unterschiedlichen Funktionen Teil des<br />
GemNova-Bildungspools. Aktuell ist sie<br />
als Teambetreuerin im Raum Kufstein<br />
im Einsatz.<br />
„Der Beginn meiner Geschichte steht im<br />
Zusammenhang mit einem Spiel, genauer<br />
gesagt dem Schachspiel. Mein Engagement<br />
im Bereich Kinder- und Jugendschach<br />
führte mich in die schulische Betreuung.<br />
„Die Arbeit als Schulassistenz<br />
geht mit unzähligen<br />
Herausforderungen<br />
einher, stellte ich in meinem<br />
täglichen Arbeitsalltag von<br />
Anfang an fest.“<br />
Es gibt einfach immer etwas zu tun, zu (er-)<br />
klären oder jemanden zu unterstützen. Als<br />
mir die Teambetreuung angeboten wurde,<br />
sagte ich sofort zu! Ich freue mich über diese<br />
neue Aufgabe, versuche, der damit einhergehenden<br />
Verantwortung mit stetigem<br />
Einsatz gerecht zu werden und eine verlässliche<br />
Ansprechpartnerin für alle Kolleg*innen<br />
in der schulischen Betreuung zu sein.<br />
Die enge Zusammenarbeit mit der Koordinatorin<br />
ist mir sehr wichtig. Eine gute und<br />
offene Kommunikation ist für mich das A<br />
und O. Am meisten freut es mich, wenn wir<br />
wieder neue Kolleg*innen ins Team bekommen,<br />
die sich toll mit einbringen können:<br />
ob Freizeit- oder Theaterpädagog*innen,<br />
Erziehungswissenschaftler*innen, Kinderbuchautor*innen,<br />
Musikstudent*innen …<br />
jede Person bringt neuen Input, und diese<br />
Diversität bereichert uns alle ungemein. Zu<br />
guter Letzt freue ich mich, dass auch aus<br />
meiner ursprünglichen Mission etwas Bleibendes<br />
entstanden ist: Das Schachspiel ist<br />
in Volksschulen in Kufstein angekommen!“<br />
Schulassistenz<br />
Sieglinde Hobl ist seit 2019 im Gem-<br />
Nova-Bildungspool-Team und als Schulassistentin<br />
bereits fünf Jahre an der<br />
Allgemeinen Sonderschule (ASO) in Hall<br />
tätig.<br />
„Meine Entscheidung zu diesem Job fiel<br />
mir sehr leicht, da Kinder mit besonderen<br />
Bedürfnissen für mich immer schon einen<br />
hohen Stellenwert hatten, besonders seitdem<br />
mein Sohn mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung<br />
(ADHS)<br />
und Autismus-Spektrum zur Welt kam. Ich<br />
arbeite seit fünf Jahren in der ASO Hall,<br />
und meine Rolle als Schulassistenz wechselt<br />
jährlich. Anfangs war ich Klassen mit<br />
mehrfach behinderten Kindern zugeteilt.<br />
Dort waren meine Aufgaben einerseits die<br />
Unterstützung und die Pflege der Kinder,<br />
das heißt, ihnen den Alltag so gut wie möglich<br />
zu erleichtern. Andererseits war auch<br />
die Weiterbildung ein wichtiger Bestandteil<br />
meiner Arbeit. Zurzeit bin ich in einer Sonderschulklasse<br />
mit lernschwachen und verhaltensauffälligen<br />
Kindern. Dort stehen die<br />
Motivation für das Lernen und die Unterstützung<br />
im Vordergrund.“<br />
Sieglinde Hobl<br />
SCHULASSISTENZ<br />
„Wichtig und zentral ist für<br />
mich, dass die Zusammen-<br />
arbeit mit unserem Koordinator<br />
gut funktioniert.“
76 tirol.bildet tirol.bildet<br />
Kontakt:<br />
bildungspool@gemnova.at<br />
Kathrin<br />
Malina<br />
KOORDINATION<br />
Koordination<br />
Kathrin Malina arbeitet seit 2019 im<br />
GemNova-Bildungspool und ist als Koordinatorin<br />
für die Region Kufstein, derndorf und Waidring<br />
Niezuständig.<br />
„Als Koordinatorin bin ich im ständigen<br />
Austausch mit meinen acht Kolleg*innen<br />
aus dem Bildungspool-Team in Innsbruck,<br />
der Teambetreuerin für Kufstein, den 55<br />
Kolleg*innen, die an den Schulen als zeitbetreuer*innen und Schulassistent*in-<br />
Freinen<br />
arbeiten, den Vertreter*innen der drei<br />
Gemeinden und den acht Direktor*innen<br />
der verschiedenen Schulen. Der Kontakt<br />
mit so vielen Menschen macht meinen<br />
Berufsalltag spannend, bunt und vor allem<br />
nie langweilig. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen<br />
und Überraschungen mit<br />
sich. An manchen Tagen steht schon ab<br />
6.30 Uhr das Telefon nicht still – daran<br />
kann man manchmal frühzeitig ablesen,<br />
dass die nächste Grippewelle angekommen<br />
ist. Aber gerade dieses spontane und<br />
flexible Arbeiten macht für mich den Reiz<br />
meiner Arbeit aus.<br />
„Man trifft viele interessante<br />
Menschen, hat bereichernde<br />
Begegnungen und<br />
wächst persönlich an den<br />
Herausforderungen.“<br />
Obwohl ich weitgehend meine Arbeit aus<br />
dem Homeoffice erledige – auch schon in<br />
Zeiten vor Corona, bin ich froh, Teil unseres<br />
großen Koordinationsteams zu sein.<br />
Wir haben sehr unterschiedliche berufliche<br />
Backgrounds, und auch altersmäßig sind<br />
wir bunt gemischt. Doch uns einen das<br />
Engagement für den Job und die gegenseitige<br />
Wertschätzung. Auch der ständige<br />
Austausch mit der Teambetreuerin vor<br />
Ort ist für mich wichtig, um die vielen kleinen<br />
und großen alltäglichen Ereignisse zu<br />
koordinieren und neue Ideen umzusetzen.“<br />
Julian<br />
Raidel<br />
Freizeitbetreuung<br />
FREIZEIT-<br />
BETREUUNG<br />
„Mein Interesse<br />
an diesem Beruf<br />
wurde schon<br />
früh geweckt, da<br />
mehrere meiner<br />
Familienmitglieder<br />
im sozialen Bereich<br />
tätig sind.“<br />
Julian Raidel ist seit 2017 Teamkollege<br />
im GemNova Bildungspool und aktuell<br />
als Freizeitpädagoge und Leitung des<br />
Betreuungsteils an der Volksschule<br />
Angergasse tätig. Darüber hinaus ist<br />
Julian Teambetreuer und arbeitet tatkräftig<br />
an Projekten mit.<br />
„Mein Interesse an diesem Beruf wurde<br />
schon früh geweckt, da mehrere meiner<br />
Familienmitglieder im sozialen Bereich<br />
tätig sind. Zu Beginn betreute ich eine<br />
Tagesheimgruppe. In meinem zweiten<br />
Dienstjahr wechselte ich in eine Klasse<br />
mit verschränkter Schulform (Ganztagesschule).<br />
Gleichzeitig erweiterte<br />
sich mein Tätigkeitsbereich, in dem mir<br />
die Leitung des Betreuungsteils anvertraut<br />
wurde. Im Jahr 2019 begann ich<br />
als Teambetreuer an mehreren Volksschulen<br />
in Innsbruck zu arbeiten, was<br />
mir persönlich neue Erfahrungen und<br />
Perspektiven einbrachte. Die Möglichkeit<br />
an Projekten, wie der „Betrieblichen<br />
Gesundheitsförderung“ sowie „Ernährung<br />
und Bewegung“ mitzuarbeiten,<br />
bringt eine Vielfalt und Abwechslung in<br />
meinen Arbeitsalltag.“<br />
Machen Sie Schluss<br />
mit Ihrem alten<br />
Business Banking.<br />
Wechseln Sie jetzt zu TELEBANKING PRO, dem modernsten<br />
Business Banking Österreichs: Das wird ständig erweitert und immer smarter.<br />
sparkasse.at/telebanking-pro<br />
Freizeitbetreuung<br />
Jetzt<br />
umsteigen<br />
Jessica Groß arbeitet seit 2020 im<br />
GemNova-Bildungspool und ist als Freizeitbetreuerin<br />
und Leiterin des Betreuungsteils<br />
für elf Gruppen an der Schule<br />
Innere Stadt in Innsbruck tätig.<br />
„Die Arbeit als Freizeitpädagogin gibt mir<br />
genau diese Möglichkeit. Zusätzlich empfand<br />
ich die Stelle als Leiterin des Betreuungsteils<br />
als neue Herausforderung, um<br />
mich in einer Leitungsfunktion zu beweisen.<br />
Die zeitgleiche Bewältigung der organisatorischen<br />
und pädagogischen Leitung stellt<br />
oftmals eine besondere Herausforderung<br />
dar und bedeutet ein hohes Maß an Engagement<br />
und zeitlicher Investition. Damit der<br />
Ablauf im Tagesheim reibungslos verläuft,<br />
muss ebenso eine gute Organisation und<br />
Planung im Hintergrund stehen.<br />
Besonders in der Volksschule haben Kinder<br />
einen großen Drang an Bewegung,<br />
Spiel und Sport und sind überaus kreativ<br />
und motiviert. Genau dies lässt mich<br />
meine Arbeit als Freizeitpädagogin mit<br />
Freude ausüben. Die Zusammenarbeit<br />
mit meiner Koordinatorin erleichtert mir<br />
meine Arbeit in vielerlei Hinsicht. Neben<br />
schneller und kompetenter Hilfe bei Fragen<br />
aller Art ist kein Hierarchiegefälle<br />
erkennbar, und es herrscht ein freundschaftlicher<br />
und respektvoller Umgang<br />
miteinander.“<br />
„Nach meinem Sportpädagogikstudium<br />
in<br />
Deutschland wollte<br />
ich einer Tätigkeit<br />
nachgehen, in welcher<br />
ich bei Kindern Spaß<br />
an der Bewegung<br />
fördern kann.“<br />
Jessica<br />
Groß<br />
FREIZEITBETREUUNG<br />
77
78 tirol.sportlich und gesund tirol.sportlich und gesund<br />
79<br />
Rodeln mit Corona<br />
Die Weltmeisterschaft der Naturbahnrodler im Ötztal war heuer wohl eine der sportlichen<br />
Höhepunkte in Tirol. Coronabedingt freilich ohne Publikum, dafür mit überaus strengen<br />
Sicherheitsauflagen. Ein kurzer Blick zurück.<br />
Gerhard Pilz war im Ötztal natürlich mit<br />
dabei. Mit seinen fünf Weltmeistertiteln,<br />
zwei Europameistertiteln, zwei Gesamtweltcupsiegen<br />
sowie 19 Siegen in Weltcuprennen<br />
ist er in der Szene der Naturbahnrodler<br />
wohl das große, das unerreichbare<br />
Vorbild. Seinen ersten Weltmeistertitel feierte<br />
der gebürtige Oberösterreicher übrigens<br />
1986 in Fenis, im italienischen Aostatal.<br />
Zehn Jahre später, 1996, kürte er sich<br />
hier in Tirol, in Oberperfuss, zum fünften<br />
Mal zum Weltmeister. Weitere elf Jahre<br />
später, 2007, beendete er seine unglaubliche<br />
Karriere im Alter von 41 Jahren. Natürlich<br />
auf seine Art – mit dem der Gewinn<br />
der Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften<br />
im kanadischen Grande Prairie.<br />
Die beiden Ötztaler Brüder Thomas und<br />
Gerald Kammerlander erreichten damals<br />
übrigens die Plätze sechs und sieben.<br />
„EIN KONTAKT ZU AUSSEN-<br />
STEHENDEN IST LEIDER<br />
NICHT MÖGLICH, SOGAR<br />
STRIKT UNTERSAGT.“<br />
GERHARD PILZ<br />
Strenge Corona-Auflagen<br />
„Du, das geht leider überhaupt nicht. Es<br />
gibt hier dermaßen strenge Corona-Auflagen,<br />
dass wir nur in unseren geschlossenen<br />
Teams unterwegs sein dürfen. Ein<br />
Kontakt zu Außenstehenden ist leider<br />
nicht möglich, sogar strikt untersagt.“<br />
LINKS: Die Organisatoren der Weltmeisterschaft<br />
mit dem Covid-Beauftragten: Bruno<br />
Kammerlander, Hansjörg Posch und Michael Radl.<br />
(© ÖRB/Miriam Jennewein)<br />
Gerhard Pilz, dem 2004 gemeinsam mit<br />
dem Autor dieser Zeilen die österreichische<br />
Erstbesteigung des Siebentausenders<br />
Himlung Himal an der nepalesischtibetischen<br />
Grenze gelang, konnte sich<br />
also nicht mit mir treffen. Er war wieder<br />
im Ötztal, diesmal als Bundestrainer der<br />
deutschen Naturbahnrodler, streng abgeschirmt<br />
und isoliert. „Die Verantwortlichen<br />
haben das hier sehr sauber gelöst, es gibt<br />
klare Bestimmungen, unmissverständliche<br />
Regeln, damit nur ja nichts passiert. Aber<br />
vielleicht schaffen wir zwei ja im Sommer<br />
eine lässige Tour“, so Pilz. „Gerne auch bei<br />
dir in Tirol.“<br />
Ein 30-seitiges Konzept<br />
Die Weltmeisterschaft der Naturbahnrodler<br />
in Umhausen zählte heuer neben der Vierschanzentournee<br />
der Skispringer in Inns-<br />
bruck sowie dem Hahnenkammrennen der<br />
Skifahrer in Kitzbühel wohl zu den sportlichen<br />
Highlights in Tirol. Allen drei Veranstaltungen<br />
war gemein, dass sie coronabedingt<br />
ohne Publikum und mit strengen<br />
Sicherheitsauflagen über die Bühne gingen.<br />
„Das war für uns schon sehr hart und herausfordernd“,<br />
so Hansjörg Posch, der für<br />
die gesamte Organisation der Weltmeisterschaft<br />
im Ötztal verantwortlich zeichnete.<br />
„Schon allein, wenn ich an die ganzen<br />
Covid-Bestimmungen und Maßnahmen und<br />
Kontrollen denke. Da haben wir einfach auch<br />
professionelle Unterstützung von außen<br />
gebraucht.“<br />
Rund 30 Seiten umfasste dann auch das<br />
detaillierte Covid-19-Präventionskonzept,<br />
welches von der GemNova erstellt wurde.<br />
Im Konkreten von Manfred Schiechtl, der<br />
sich dafür beim Wiener Roten Kreuz extra<br />
zum Corona-Experten ausbilden ließ. „Drei<br />
Mal musste dieses Konzept umgeschrieben,<br />
überarbeitet, ergänzt werden, einfach<br />
weil es immer wieder Anpassungen und<br />
Änderungen der Covid-19-Notfallmaßnahmenverordnung<br />
gab. Die Gemeinden sind<br />
mit diesem Konzept freilich auf der sicheren<br />
Seite“, so Schiechtl, „damit sind alle<br />
Eventualitäten abgedeckt.“<br />
„Mir ist ganz schwindlig geworden“<br />
Als ich dieses Konzept durchgelesen hab, ist<br />
mir ganz schwindlig geworden“, merkt auch<br />
Kammerlander an. „Auf was es da alles zu<br />
achten gab, was da alles eingehalten werden<br />
musste, ein Wahnsinn.“ Nur einige Beispiele<br />
daraus: Die teilnehmenden Personen<br />
mussten in mehrere funktionelle Gruppen<br />
aufgeteilt werden, die am Veranstaltungsgelände<br />
dann auch noch räumlich zu trennen<br />
waren. Es bedurfte eines dezidierten<br />
Testlabors zur autonomen Durchführung der<br />
Covid-19-Tests. Für Verdachtsfälle musste<br />
ein eigener Sicherheitsbereich eingerichtet<br />
werden, spezielle Ordnerdienste wurden<br />
ebenso vorgeschrieben wie die allerstrengsten<br />
Hygienemaßnahmen. Für die Einhaltung<br />
und Kontrolle all dessen waren besonders<br />
geschulte Covid-Beauftragte verantwortlich.<br />
„EINE BESONDERE HER-<br />
AUSFORDERUNG BESTAND<br />
BEREITS IM VORFELD DARIN,<br />
AUF DIE IMMER STRIKTE-<br />
REN VORGABEN RASCH ZU<br />
REAGIEREN.“<br />
MICHAEL RADL<br />
BILDER: Thomas<br />
Kammerlander<br />
freut sich<br />
über seinen Sieg.<br />
(© ÖRB/Miriam<br />
Jennewein)<br />
Vom VIP-Zelt zum Aufwärmzelt<br />
Michael Radl, ebenfalls von der GemNova,<br />
war der Covid-Beauftragte und während<br />
der Weltmeisterschaften natürlich immer<br />
vor Ort anwesend. „Eine besondere Herausforderung<br />
bestand bereits im Vorfeld<br />
darin, auf die immer strikteren Vorgaben<br />
rasch zu reagieren. Dass keine Zuseher<br />
erlaubt waren, stand ja von Anfang an<br />
fest. Aber dann hieß es plötzlich, es gibt<br />
auch keine Ehrengäste. Naja, dann haben<br />
wir aus dem VIP-Zelt halt ein zusätzliches<br />
Aufwärmzelt für die Athlet*innen gemacht.<br />
Denn hier im Ötztal kann es schnell mal<br />
minus 15, minus 20 Grad haben.“<br />
Die Weltmeisterschaft selbst lief dann reibungslos<br />
und ohne Probleme ab. Alle Covid-<br />
Sicherheitsvorkehrungen wurden eingehalten,<br />
die rund 250 anwesenden Personen<br />
vor Ort verhielten sich überaus diszipliniert<br />
und einsichtig. „Natürlich hätten sich alle<br />
Beteiligten gewünscht, wenn es hier auch<br />
viele Zuseher gegeben hätte. Einfach weil<br />
die Atmosphäre dann eine ganz andere ist“,<br />
so Bruno Kammerlander, der als die Seele<br />
dieser Veranstaltung gilt. „Andererseits<br />
haben wir mit dieser Weltmeisterschaft<br />
eindrucksvoll gezeigt, dass auch in diesen<br />
sehr schwierigen Zeiten ganz besondere<br />
Veranstaltungen möglich sind. Hier bei uns<br />
in Tirol, im Ötztal.“<br />
Thomas und Gerald Kammerlander<br />
Ach ja, eine nette Geschichte gibt es<br />
abschließend auch noch. Sie handelt von<br />
den beiden Brüdern Thomas und Gerald<br />
Kammerlander. Gerald Kammerlander, seit<br />
2013 Sportdirektor des österreichischen<br />
Rodel-Nationalteams, errang 2011 bei den<br />
Weltmeisterschaften der Naturbahnrodler<br />
im Ötztal die Goldmedaille. Hier auf<br />
der anspruchsvollen und legendären Grantaubahn<br />
in Umhausen, die mit ihren neun<br />
Kurven auf 950 Metern und einem durchschnittlichen<br />
Gefälle von 13,9 Prozent einfach<br />
ungemein sauber gefahren werden<br />
muss. Ein kleiner, winziger Fehler nur und<br />
schon ist der Traum vom Weltmeistertitel<br />
vorbei.<br />
Bei der heurigen Weltmeisterschaft, genau<br />
zehn Jahre nach Gerald Kammerlanders<br />
Sieg, trat sein Bruder Thomas in seine Fußstapfen.<br />
Auch er machte keinen Fehler und<br />
kürte sich auf der selektiven Grantaubahn<br />
in Umhausen mit Bestzeit in beiden Läufen<br />
zum Weltmeister. Einen Tag nach seinem<br />
31. Geburtstag. Fein, dass es im Hause Kammerlander<br />
nun gleich zwei Goldmedaillen<br />
der beiden Brüder gibt.<br />
AUTOR<br />
REINHOLD OBLAK
80<br />
tirol.sportlich und gesund tirol.sportlich und gesund<br />
81<br />
200.000 EURO<br />
FÜR DEN EVEREST<br />
Mit der Gründung von „Furtenbach Adventures“ stieg der Tiroler Lukas Furtenbach 2014 ins<br />
kommerzielle Höhenbergsteigen ein – als Anbieter von Expeditionen auf den Mount Everest.<br />
Sehr erfolgreich, sehr umstritten. Im Interview spricht er Klartext.<br />
Lukas Furtenbach: Lass mal mich mit<br />
einer Frage beginnen, Reinhold. Warum<br />
bist du eigentlich nie meinen Einladungen<br />
zum Everest gefolgt?<br />
Reinhold Oblak: Weil ich mit kommerziellen<br />
Expeditionen nichts anfangen<br />
kann. Ich mag mich nicht von Sherpas<br />
am Seil auf Achttausender hinaufziehen<br />
lassen. Das hat mit meinem Verständnis<br />
von eigenverantwortlichem<br />
Bergsteigen nichts zu tun. Zum Zweiten<br />
interessiert mich der Everest überhaupt<br />
nicht: ein massiv überlaufener<br />
Berg, zu viel Expeditionstourismus,<br />
Warteschlangen vor dem höchsten<br />
Punkt. Aber nun zu dir: Wie bist du<br />
eigentlich auf die Idee gekommen, ausgerechnet<br />
ein Expeditionsunternehmen<br />
zu gründen? Hier in Tirol noch dazu.<br />
Du redest ja fast schon so wie Reinhold<br />
Messner (lacht). Der glaubt nämlich auch,<br />
kommerzielle Expeditionen sind der Tod<br />
des „echten“ Alpinismus. So ein Blödsinn.<br />
Aber zurück zu deiner Frage. Das Expeditionsbusiness<br />
war eine sehr verstaubte<br />
Branche mit einer sehr tradierten Philosophie.<br />
Der Gast musste sich der angebotenen<br />
Expedition anpassen. Ich sehe es<br />
genau andersherum. Wir müssen uns an<br />
den Bedürfnissen des Gastes orientieren.<br />
Das verlangt natürlich sehr viel Expertise,<br />
Innovationswillen und Erfahrung.<br />
Reinhold Messner scheinst du nicht<br />
wirklich zu mögen. Dabei hast du selbst<br />
ja auch als selbstständiger Bergsteiger<br />
begonnen – bei deinen Achttausender-<br />
Besteigungen und bei vielen anderen<br />
Expeditionen. Erst bei deinen zwei Everest-Besteigungen<br />
warst du dein eigener<br />
Kunde.<br />
Messner sehe ich sehr differenziert. Zum<br />
einen ist unbestritten, dass er Herausragendes<br />
geleistet hat. Nicht nur als Kletterer<br />
und Expeditionsbergsteiger. Zum anderen<br />
ist aber auch festzuhalten, dass er etwa<br />
bei seiner Everest-Besteigung ohne Sauerstoff<br />
die installierten Fixseile benutzt hat,<br />
einer ausgetretenen Spur gefolgt ist, volle<br />
Unterstützung eines großen Teams hatte.<br />
Und ja, auch ich habe bei meinen beiden<br />
Everest-Besteigungen die Hilfe von Sher-<br />
OBEN: Lukas Furtenbach beim Aufstieg zum Everest.<br />
Als erstem Österreicher gelang es ihm, den<br />
Gipfel sowohl von der Süd- als auch von der Nordseite<br />
zu erreichen. (© furtenbachadventures.com)<br />
pas in Anspruch genommen, genauso wie<br />
Sauerstoff. Aber ich habe dort ja gearbeitet,<br />
musste leistungsbereit sein und war<br />
für unsere Kunden verantwortlich. Das ist<br />
eben mein Verständnis von verantwortungsvollem<br />
Bergsteigen. Alles zu tun, um<br />
die Risiken sehr klein, die Sicherheit sehr<br />
groß zu halten.<br />
Und deine Kundinnen und Kunden zahlen<br />
dafür fast jeden Preis. Du bist ja mittlerweile<br />
der teuerste Everest-Anbieter<br />
weltweit.<br />
Maximale Sicherheit ist das eine, größtmöglicher<br />
Komfort das andere. Das Wichtigste<br />
freilich ist die Zeit. Wir bieten den<br />
Everest in der Flash-Variante in nur 21<br />
Tagen an. Von jedem Airport der Welt auf<br />
den höchsten Punkt der Erde und wieder<br />
zurück. Viele unserer Teilnehmer verfügen<br />
über finanzielle Ressourcen, aber nur über<br />
sehr wenig Zeit. Und unsere 100-prozentige<br />
Erfolgsrate ohne einen einzigen Unfall<br />
spricht halt auch für sich.<br />
Wieviel verlangst du nun wirklich für den<br />
Everest?<br />
In der Standardvariante 60.900 Euro, für<br />
Flash 99.000 Euro. Dabei bieten wir auch<br />
eigene Hypoxiezelte an, damit sich die Teilnehmer<br />
bereits zu Hause akklimatisieren<br />
können. Das verschafft uns vor Ort abermals<br />
einen Zeitpolster, wodurch wir noch<br />
schneller und sicherer auf den Gipfel und<br />
wieder zurück kommen.<br />
Du bietest ab heuer auch Everest-<br />
Besteigungen für nur eine Person an.<br />
Wie an der Eiger-Nordwand, eigentlich<br />
verrückt. Was verlangst du dafür?<br />
Verrückt wäre, genau das nicht anzubieten.<br />
Mit dieser „Signature-Expedition“ reagieren<br />
wir auf die Nachfrage. Die Kosten liegen bei<br />
200.000 Euro pro Person. Es ist also eine<br />
1:1-Führung mit entsprechenden Sicherheitsreserven,<br />
Unterstützung und Komfort.<br />
Das bedeutet individuelle Ernährungsberatung,<br />
personalisiertes Trainingsprogramm<br />
und geht bis zum Live-Monitoring<br />
Unsere 100-prozentige<br />
Erfolgsrate ohne einen einzigen Unfall<br />
spricht halt auch für sich.<br />
durch unseren Expeditionsarzt während<br />
der Besteigung. Dabei sprechen wir vom<br />
hochauflösenden Echtzeit-EKG bis auf den<br />
Gipfel. Somit können nicht nur beginnende<br />
Höhenkrankheit, sondern auch andere<br />
medizinische Probleme frühzeitig erkannt<br />
werden. Herzinfarkte oder Schlaganfälle<br />
sind in großer Höhe bisher nur wenig<br />
untersuchte Todesursachen mit einer sehr<br />
hohen Dunkelziffer.<br />
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation<br />
haben 2020 ja keine kommerziellen<br />
Expeditionen stattgefunden, für heuer<br />
sieht es auch nicht sehr viel besser aus.<br />
Wie gehst du damit um?<br />
Es war ein wirtschaftlich sehr schweres<br />
Jahr, aber wir waren nicht in unserer<br />
Existenz bedroht. Wir würden auch noch<br />
ein Jahr Pandemie aushalten. Im Februar<br />
2020 führten wir ein Team über den<br />
direkten Polengletscher auf den Aconcagua.<br />
Im Sommer gab es dann nur einen<br />
Expeditionskurs in den Westalpen. Vergangenen<br />
November hatten wir bereits<br />
wieder die ersten Expeditionen in Nepal,<br />
auf die Ama Dablam, Nirkeha und Mera<br />
Peak. Aufgrund der Reisebeschränkungen<br />
war das eine große logistische Herausforderung,<br />
aber es hat alles geklappt. Menschen<br />
wollen reisen, Abenteuer erleben,<br />
hohe Berge besteigen. Ich gehe davon aus,<br />
dass wir in den nächsten Wochen und<br />
Monaten sowohl den Everest als auch die<br />
Karakorum-Saison mit K2, Broad Peak,<br />
Gasherbrum I und II durchführen können.<br />
Natürlich mit entsprechendem Corona-<br />
Sicherheits- und -Hygienekonzept und<br />
eigener Teststrategie.<br />
Du bist verheiratet, hast zwei Kinder<br />
und bist doch viele Monate im Jahr auf<br />
den Bergen der Welt unterwegs. Wie<br />
kriegst du das alles unter einen Hut?<br />
Mittlerweile hab ich meine eigenen Expeditionen<br />
sehr reduziert. Schließlich möchte<br />
ich miterleben, wie meine Kinder aufwachsen.<br />
Eigentlich bin ich nur mehr beim<br />
Everest selbst dabei. Und bei ein bis zwei<br />
kleineren Expeditionen, wo ein Filmprojekt<br />
dranhängt oder wir neue Ziele erkunden.<br />
Dank Vorakklimatisation geht das heute<br />
alles viel schneller.<br />
Eine letzte Frage: Welches bergsteigerische<br />
Ziel hast du eigentlich noch?<br />
Im Moment stehen Familie und Unternehmen<br />
im Vordergrund. Ich möchte das<br />
Höhenbergsteigen weiterentwickeln. Da<br />
gibt es noch viel Luft nach oben.<br />
DAS GESPRÄCH FÜHRTE<br />
REINHOLD OBLAK<br />
ZUR<br />
PERSON<br />
Der Tiroler Lukas Furtenbach, 42,<br />
hat in seinem Leben schon viel<br />
erlebt. Der ausgebildete Geograf<br />
war etwa Shrimpsfischer in den<br />
USA, Private Concierge in Belize<br />
oder Flyfishing-Guide in Kanada.<br />
Er ließ sich auf einer unbewohnten<br />
Atlantikinsel aussetzen, ist<br />
Steilwandskifahrer und bestieg<br />
als erster Österreicher den Everest<br />
von der Nord- und Südseite.<br />
Mit der Gründung von furtenbachadventures.com<br />
trat er als<br />
Anbieter ins kommerzielle Höhenbergsteigen<br />
ein. Furtenbach ist<br />
verheiratet, hat zwei Kinder und<br />
lebt in Innsbruck.
82 tirol.sozial tirol.sozial<br />
83<br />
ZUR AUTORIN<br />
DGKP MARTINA<br />
BACHLER<br />
Martina Bachler ist diplomierte<br />
Gesundheits- und Krankenschwester<br />
und seit 2019 bei der<br />
GemNova tätig. Sie verantwortet<br />
die Aus- und Weiterbildung im<br />
Bereich Pflege und ist mit ihrem<br />
umfangreichen Wissen eine Expertin<br />
auf ihrem Gebiet.<br />
Kontakt: m.bachler@gemnova.at<br />
Das Jahr 2020 hat sehr überzeugend<br />
gezeigt, welche<br />
Bedeutung Würde und Menschenrechte<br />
für den und im<br />
Beruf Pflege haben. Eine gute<br />
und von Transparenz gekennzeichnete<br />
Zusammenarbeit<br />
ist gerade beim Thema „FBM“<br />
daher zwischen Heimen und<br />
Bewohnervertretungen enorm<br />
wichtig! In meiner Wahrnehmung<br />
funktioniert die Synergie<br />
zwischen beiden erfreulich und<br />
mit gegenseitiger Achtung –<br />
zum Vorteil der bei uns lebenden<br />
Menschen. Dennoch denke<br />
ich, ein Mehr an Schulungen<br />
in dieser Sache wäre sehr<br />
willkommen und ist natürlich<br />
immer sinnvoll.<br />
RICHARD KUSTER,<br />
KLARAHEIM DER<br />
TERTIARSCHWESTERN<br />
SelbstbestimmTes<br />
Leben<br />
Ein Leben in Sicherheit mit Freiheit und Selbstbestimmung sind<br />
Qualitätsmerkmale unserer Gesellschaft. Qualitäten, die sich im<br />
zeitlichen Lebensablauf langsam auf- und wiederabbauen.<br />
Wir werden in der Sicherheit unseres<br />
Elternhauses geboren, und nach und nach<br />
übernehmen wir Selbstverantwortung. Freiheit<br />
ist uns dabei ein individuelles Bedürfnis<br />
in allen Lebenslagen. Ein Bedürfnis, das<br />
in seiner Stärke variiert. Es ist abhängig<br />
von unserer Persönlichkeit, den individuellen<br />
Lebenserfahrungen und der aktuellen<br />
Situation. Bedürfnisse sind nicht dauerhaft<br />
messbar vorhanden. Sie verändern sich im<br />
Laufe des Lebens.<br />
Freiheit im Erwachsenenleben ist geregelt.<br />
Gesellschaftliche Normen und Gesetze<br />
geben uns vor, was wir frei entscheiden<br />
und bestimmen. Wir kennen die Rahmenbedingungen<br />
und wissen genau, wo wir<br />
uns einfügen und unterordnen. So unterscheiden<br />
wir Arbeitszeiten von Freizeiten<br />
usw. Denken wir an unseren Lebenslauf.<br />
Wir starten mit wenig Freiheit und Selbstbestimmung,<br />
verbuchen jeden Schritt in<br />
unsere Selbstständigkeit als Erfolg bis in<br />
unser Erwachsenendasein. Und irgendwann<br />
– dreht sich das Blatt.<br />
Nach langer Zeit mit mehr oder weniger<br />
Selbstständigkeit beginnt der Alterungsprozess,<br />
wir werden körperlich und geistig<br />
schwächer, brauchen wieder Hilfe und<br />
Fürsorge. Das fällt uns schwer. Und dazu<br />
geben wir langsam unsere Freiheit und<br />
Selbstbestimmung, Schritt für Schritt, wieder<br />
ab.<br />
In unseren sozialen Einrichtungen werden<br />
hilfsbedürftige Menschen gepflegt und<br />
umsorgt. Sie erhalten Pflege in Form von<br />
Betreuung und Hilfe. Pflegekräfte machen<br />
jeden Tag aufs Neue eine professionelle<br />
Bestandsaufnahme: Wie viel Freiheit und<br />
Selbstbestimmung ist noch möglich? Ist<br />
„JEDER HAT DAS<br />
RECHT AUF LEBEN,<br />
FREIHEIT UND<br />
SICHERHEIT DER<br />
PERSON.“<br />
UN-MENSCHENRECHTS-<br />
CHARTA IN ARTIKEL 3<br />
Langzeitpflege in der Pandemie<br />
– eine Berufsgruppe muss sich<br />
neu erfinden …<br />
Unverzichtbar: eine Bildungsoffensive<br />
in der Qualitätssicherung<br />
Pflege und ein sensibles<br />
Abwägen zwischen „Bewohnergesundheit“<br />
versus „Bewohnerfreiheit“<br />
– Lebensqualität …<br />
MARTINA MAIR,<br />
WOHN- UND PFLEGEHEIM<br />
FLIRSCH<br />
ein ausreichendes Maß an Sicherheit<br />
gewährleistet? Wie groß ist die Sturzund<br />
Verletzungsgefahr? Eine tägliche<br />
Gratwanderung, bei der auch die eigenen<br />
Grenzen der Pflegekraft überschritten<br />
werden. Grenzen der Belastbarkeit …<br />
Pflegekräfte garantieren für die Sicherheit<br />
ihrer Schützlinge, haben die Aufgabe der<br />
professionellen Pflegeberatung, strukturieren<br />
den Pflegeplan, um Schäden zu vermeiden,<br />
helfen und beaufsichtigen, wann<br />
immer sie können. Was aber passiert mit<br />
jenen Menschen, die aufgrund einer psychischen<br />
Erkrankung oder geistigen Behinderung<br />
selbstgefährdend sind oder sogar<br />
OBEN:<br />
Frau Emmi Unterrainer mit<br />
der Bereichsleitung der Station<br />
„Sonnenplatzl“ Andrea<br />
Schwaiger (© Sabine Thaler)<br />
OBEN:<br />
Martina Mair (rechts) mit<br />
Kolleginnen aus ihrem Team<br />
im Wohn- und Pflegeheim<br />
Flirsch (© Martina Mair)<br />
andere Menschen gefährden? Jene, die<br />
eine Gefahr nicht mehr erkennen – wieviel<br />
Recht an Freiheit und Selbstbestimmung<br />
haben diese?<br />
Die Beachtung der Würde und der Menschenrechte<br />
ist die Aufgabe der professionellen<br />
Pflege. Sollte zur Erhaltung der<br />
Sicherheit eine gesetzlich legitimierte<br />
Freiheitsbeschränkung zur Anwendung<br />
kommen, dann immer nur mit jenen Mitteln,<br />
die diese Selbstbestimmung am<br />
wenigsten beeinträchtigen und die soziale<br />
Integrität und Menschenwürde erhalten.<br />
Für diese schwierigen pflegefachlichen<br />
Entscheidungen und Herausforderungen<br />
braucht es Erfahrung, Kommunikationsfähigkeit,<br />
Fachkenntnis zur Gesetzeslage, zur<br />
Dokumentation und vor allem Kenntnisse<br />
über alternative Pflegetechniken.<br />
GemNova bietet eine neue Fortbildungsreihe<br />
für Pflegekräfte in allen Einrichtungen:<br />
Pflege Online. Die Kurse sind als Blended<br />
Learning konzipiert und beinhalten die<br />
fachliche Begleitung beim Selbststudium,<br />
Online-Sprechstunden, praktische Reflexionen,<br />
Arbeitsaufträge und Praxisanleitung<br />
vor Ort in der Einrichtung. Der erste Kurs<br />
– freiheitseinschränkende Pflegemaßnahmen<br />
– gibt Klarheit über das Thema<br />
Freiheit und Selbstbestimmung und kann<br />
bereits gebucht werden.<br />
Ich bin DGKP und arbeite im Wohnund<br />
Pflegeheim Ebbs. In unserem<br />
Haus wird in vier Pflegeteams<br />
gearbeitet; es wohnen 97 Klient*innen<br />
im Haus. Seit <strong>März</strong> 2020 ist<br />
es für uns alle (Pflege, Verwaltung,<br />
Wirtschaftsbereich, Ergotherapie,<br />
Physiotherapie) eine besondere<br />
Herausforderung, aufgrund<br />
der Bestimmungen und Empfehlungen<br />
vom Land Tirol bezüglich<br />
Covid-19-Maßnahmen weiterhin<br />
gemeinsam gute Arbeit und Pflege<br />
zu leisten.<br />
In unserem Haus herrscht eine<br />
sehr hohe Wertschätzung gegenüber<br />
allen Mitarbeiter*innen.<br />
Somit ist es für uns alle wesentlich<br />
leichter, diese Krise zu überstehen,<br />
weiter ein „gemeinsames<br />
Miteinander“ zu leben und sich<br />
auch ständig weiterzuentwickeln.<br />
Besonders jetzt sind die Kontakte<br />
zu Angehörigen, die Gespräche<br />
mit Angehörigen sehr intensiv, und<br />
auch die Seelen der Bewohner*innen/Klient*innen<br />
benötigen nun<br />
vermehrt unsere ganze Zuwendung<br />
und Aufmerksamkeit. Ohne<br />
eine stabile Struktur des Heims,<br />
von Heimleiter, Pflegedienstleister,<br />
Bereichsleiter, wäre das nie möglich.<br />
Für mich sind Fort- und Weiterbildungen<br />
in ALLEN Bereichen sehr<br />
wichtig und notwendig, denn nur<br />
so kann Qualitätssicherung in der<br />
Pflege geleistet und der Austausch<br />
mit anderen Institutionen gelebt<br />
werden und können Diskussionen<br />
und Erfahrungsaustausch mit Kolleg*innen<br />
erfolgen. All dies kommt<br />
letztendlich unseren Klient*innen<br />
und allen Mitarbeiter*innen im<br />
Wohnheim zugute.<br />
SABINE THALER,<br />
WOHN- UND PFLEGEHEIM<br />
EBBS
MAZON<br />
ST BÖSE,<br />
DIE KLEINEN SOLLEN<br />
IESELAUTOS<br />
WELT RETTEN.<br />
IND BÖSE,<br />
RIMARK<br />
ST BÖSE,<br />
ISH IST<br />
84<br />
tirol.kultur<br />
Hier könnte IHRE WERBUNG<br />
stehen!<br />
Tut sie aber nicht.<br />
Sondern meine.<br />
Gabriel Castañeda<br />
Kabarettist und Autor<br />
Amazon ist böse, Dieselautos sind böse, Primark<br />
ist böse, Wish ist ultra böse, und in den Urlaub<br />
fliegen ist so verpönt wie Fußpilz im Hallenbad.<br />
Die Liste der Geschäfte und Online-Portale, in<br />
denen die Österreicher*innen nicht einkaufen<br />
sollen, ist lang. Der Konsument soll bitte die heimische<br />
Kaufkraft stärken. Am besten, er kauft<br />
sein Fleisch vom Bio-Bergbauernhof um die Ecke,<br />
die Patschen von der ICH-AG-Nachbarin, die Stereoanlage<br />
beim<br />
ansässigen Elektrohändler<br />
und<br />
macht Urlaub im<br />
Nachbarort. Der<br />
Konsument ist<br />
durch sein egoistisches<br />
Kaufverhalten<br />
schuld<br />
an der Massentierhaltung,<br />
am<br />
Transit, an der<br />
Klimakrise, an der<br />
Ausbeutung asiatischer<br />
Kinder in<br />
der Textilindustrie<br />
und natürlich<br />
auch an der Verödung<br />
des eigenen<br />
Ortes, weil<br />
er in den kleinen<br />
Geschäften in der<br />
Innenstadt nicht<br />
mehr einkauft.<br />
AUTOR<br />
GABRIEL CASTANEDA<br />
Verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich sind<br />
Amazon und Co „böse“, und natürlich ist „der<br />
Konsument“ schuld, aber wieso nur er? Ich stelle<br />
mir folgende Frage: Der „kleine Konsument“ liest<br />
täglich in den Nachrichten, wie viele Steuern<br />
Starbucks, Amazon, IKEA, KTM usw. NICHT<br />
bezahlt haben. Steuervermeidung gehört im Big<br />
Business zum guten Ton, und wenn es also ok<br />
ist, dass milliardenschwere Konzerne das „Geiz<br />
ist geil“-Prinzip durchziehen, warum spricht man<br />
diesen Wunsch dem kleinen Konsumenten ab?<br />
Der Paul, die Irmgard, der Johannes und die<br />
Maria sollen jetzt mit ihren 1.600 Euro netto<br />
im Monat die heimische Wirtschaft, das Gasthaus,<br />
den kleinen Lebensmittelhändler und den<br />
Kinderskilift retten? Könnte schwierig werden.<br />
Auch in Tirol veröden die kleineren Orte zusehends.<br />
Und auch hier werden die Kleinen allein<br />
das Ruder nicht herumreißen. Jeff Bezos oder<br />
René Benko werden in den meisten Tiroler Orten<br />
eher nicht investieren. Wer bleibt übrig? Die regionale<br />
Hautevolee und die Gemeinden. Wer in 15<br />
Jahren noch in einem lebenswerten Ort leben<br />
will, wird aktiv mithelfen müssen, denn der Paul<br />
und die Irmi werden’s nicht alleine schaffen. Und<br />
irgendwann wird man auch die Big Player zur<br />
Kasse bitten müssen.<br />
ZUR PERSON<br />
WWW.CASTANEDA.TV<br />
ALLES NEU IM FRÜHLING<br />
Der Frühling eignet sich hervorragend, um etwas Neues zu beginnen. Unsere Kurse und Weiterbildungen im<br />
aktuellen Blended Learning Format bringen Sie persönlich und beruflich ans Ziel.<br />
NÄCHSTE SEMINARE<br />
AB 22. MÄRZ <strong>2021</strong><br />
PFLEGE ONLINE<br />
Frau Erna hat ein Problem: Freiheitseinschränkende<br />
Pflegemaßnahmen! Mittels Blended<br />
Learning und Praxisanleitung täglich verfügbar<br />
AB 15. APRIL <strong>2021</strong><br />
WIR ALLE SIND GEMEINDE<br />
Fit für Bauamt und Bauhof!? E-Learning-Kurs<br />
AB 21. APRIL <strong>2021</strong><br />
SEI NICHT WIE DIE TITANIC<br />
Erkenne den Eisberg – (Leichter) Führen<br />
mit Neuer Autorität<br />
AB 10. JUNI <strong>2021</strong><br />
GEMEINDESEMINAR<br />
Der Tiroler Bodenfonds<br />
Alle aktuellen Fortbildungsveranstaltungen,<br />
ob online oder offline findet man unter:<br />
www.gemeindeveranstaltungen.at<br />
tirol.kultur<br />
85<br />
www.castaneda.tv<br />
www.gemnova.at
86<br />
tirol.Kultur<br />
tirol.Kultur<br />
87<br />
GUTE<br />
ZEIT FÜR<br />
BÜCHER<br />
Eine Generation, die ohne Selbstwert und<br />
ohne Sprache heranwächst, weil ihr keiner<br />
zuhört, und die sich nicht ausreichend<br />
verständlich machen kann. – Darum geht<br />
es in Melisa Erkurts Erstlingswerk. Veranlasst<br />
durch ihre eigenen Erfahrungen<br />
als Lehrerin hat die Journalistin ein Buch<br />
über Bildungsverliererinnen und -verlierer<br />
geschrieben, denen es durch ihren Migrationshintergrund<br />
oft unmöglich gemacht<br />
wird, aus den überkommenen Strukturen<br />
des Systems auszubrechen. Kern des<br />
Buches bilden eigene Erinnerungen an<br />
die Doppelbelastung ihrer Kindheit, als<br />
Melisa Erkurt ihre Eltern unterstützen<br />
musste, da sie kein Deutsch konnten, und<br />
sie selbst in der Schule ohne Unterstützung<br />
Leistung erbringen musste.<br />
EMPFOHLEN VON<br />
DIPL. SOZ. PÄD.<br />
KATHRIN MALINA<br />
Kathrin Malina hat im <strong>März</strong> 2016<br />
als Sprachtrainerin bei der<br />
GemNova begonnen, seit Mai 2019<br />
ist sie zudem im GemNova-Bildungspool<br />
für die Koordination der<br />
Schulassistentinnen und Freizeitbetreuer<br />
im Tiroler Unterland<br />
zuständig.<br />
Kontakt: k.malina@gemnova.at<br />
„Generation Haram“ übt immer wieder<br />
allgemeine Kritik am österreichischen<br />
Bildungssystem: „Es scheint, als würde<br />
das ganze Land hinnehmen, dass hier<br />
eine Bevölkerungsgruppe über Jahrzehnte<br />
hinweg auf der Strecke bleibt.“ Grund<br />
dafür sei eine tiefliegende Ignoranz<br />
gegenüber den kulturellen, sozialen und<br />
häuslichen Verhältnissen, in denen Migrantinnen<br />
und Migranten oftmals leben<br />
– Schüler*innen, die sich mit mehreren<br />
Geschwistern ein Zimmer, einen Computer<br />
und eine schlechte dung<br />
WLAN-Verbinteilen.<br />
Zsolnay, Paul<br />
Juli 2020<br />
192 Seiten, € 20,60<br />
Das Besondere an diesem Buch ist die<br />
Perspektive einer Bildungsaufsteigerin, die<br />
verschiedene kulturelle Milieus von innen<br />
her kennt und weiß, wie es sich anfühlt,<br />
wenn man sich fremd im eigenen Land<br />
fühlt. Melisa Erkurts ausgeprägtes Gespür<br />
für gesellschaftliche Widersprüche prägen<br />
den Ton des Buchs – streitlustig, kämpferisch<br />
und manchmal spöttisch. „Generation<br />
Haram“ ist ein Buch, das jede und<br />
jeder lesen sollte, die oder der nur etwas mit Bildung zu tun<br />
irgendhat.<br />
GENERATION<br />
HARAM<br />
MELISA ERKURT
88<br />
tirol.Kultur<br />
tirol.Kultur<br />
89<br />
Tief im Marschgebiet von North Carolina,<br />
dort, wo das Land langsam ins Meer übergeht<br />
und neben Möwen und Insekten nur<br />
ein paar Fischerboote gelegentlich den<br />
Sumpf durchqueren, spielt der Debütroman<br />
von Delia Owens. In ihm beschreibt<br />
die amerikanische Zoologin die Lebensgeschichte<br />
eines Mädchens, das in dieser<br />
einsamen Umgebung aufwächst und lernt,<br />
mit und von der Natur zu leben.<br />
Der Roman vereint viele Genres und verbindet<br />
sie gekonnt: eine moderne Robinsonade,<br />
ein bisschen Coming-of-Age, eine<br />
Naturerzählung, dazu Liebesgeschichte<br />
und obendrein auch noch ein Krimi. Die<br />
Hauptfigur Kya ist die jüngste Schwester<br />
in einer Großfamilie, die in den 1950er<br />
Jahren unter ärmlichen Bedingungen in<br />
einem Häuschen in der Marschlandschaft<br />
lebt. Durch den Alkoholmissbrauch des<br />
Vaters zerfällt die Familie nach und nach<br />
und überlässt das junge Mädchen seinem<br />
Schicksal.<br />
Im Laufe der Jahre muss Kya lernen, allein<br />
zu überleben, und wird dabei von der Dorfgemeinschaft<br />
immer weiter in die Einsamkeit<br />
getrieben. Nur die Natur gibt ihr<br />
Halt, versorgt sie und spendet der Außenseiterin<br />
Trost. Als Jahre später die Leiche<br />
von Chase Andrews gefunden wird, einem<br />
angesehenen jungen Mann aus dem Ort,<br />
ist für die Bewohner des Städtchens klar,<br />
dass nur Kya, das merkwürdige Marschmädchen,<br />
schuld an seinem Tod gewesen<br />
sein kann.<br />
Wortgewandt, gefühlvoll und poetisch<br />
beschreibt Delia Owens menschliche<br />
Abgründe, Einsamkeit, Verzweiflung,<br />
aber auch Freundschaft und Liebe und<br />
vor allem die einzigartige Natur der Marschen<br />
an der Küste North Carolinas.<br />
DARK<br />
CANDICE FOX<br />
Eine ehemals angesehene Ärztin, die nach einer Haftstrafe ihr<br />
Leben wieder in den Griff bekommen muss, eine Polizistin, der eine<br />
unerwartete Erbschaft in den Schoß fällt, eine talentierte Diebin,<br />
die ihre Tochter wiederfinden möchte, und eine Gangsterin, die vor<br />
nichts zurückschreckt – das sind die vier ungewöhnlichen Hauptfiguren<br />
in Candice Fox‘ Roman „Dark“. Die vier Frauen, die nicht<br />
unterschiedlicher sein könnten, machen sich auf die Suche nach<br />
einem verschwundenen Mädchen.<br />
Die Autorin entwirft in ihrem neuen Thriller einen ausgefeilten Plot,<br />
der bis zum Ende spannend bleibt, und lässt ihr exzentrisches Team<br />
zwischen skurrilen Nebenfiguren ermitteln.<br />
Große Teile der Erzählung schlittern in rasantem Tempo am Rande<br />
eines Wahnsinns entlang, der die Leserinnen und Leser völlig mitreißt.<br />
Manches bleibt zunächst rätselhaft, doch nach und nach fügen<br />
sich die Hintergrundgeschichten und Ereignisse wie Puzzlestücke<br />
ineinander. Ungewöhnliche Protagonistinnen, irrwitzige Ereignisse<br />
und eine Menge tiefschwarzer Humor sind die Zutaten für den<br />
gelungenen Start dieser neuen Krimireihe.<br />
DER GESANG<br />
DER FLUSSKREBSE<br />
DELIA OWENS<br />
Heyne Verlag, Jänner <strong>2021</strong><br />
464 Seiten, € 11,77<br />
Thomas Wörtche<br />
November 2020,<br />
395, € 16,50<br />
EINMAL<br />
NOCH<br />
SCHLAFEN<br />
DANN IST<br />
MORGEN<br />
MANUEL RUBEY<br />
EINE KURZE<br />
GESCHICHTE<br />
VON FAST<br />
ALLEM<br />
BILL BRYSON<br />
Manuel Rubey ist vermutlich vielen als<br />
erfolgreicher Film- und Fernsehdarsteller<br />
und Kabarettist in seinen Bühnenshows<br />
bekannt. Jetzt hat er sein erstes Buch<br />
geschrieben. Darin geht es um ganz Privates,<br />
verbunden mit etwas Fiktion – und<br />
seinen großen Faible für Listen, die sich<br />
über das ganze Buch verteilen. Diese sollen<br />
bei der Entschleunigung im hektischen<br />
Alltag helfen und Struktur ins Chaos bringen.<br />
In einer Zeit der ständigen Überanstrengung<br />
beendet Rubey toxische Beziehungen,<br />
befreit sich von Panikattacken<br />
und hört mit dem Rauchen auf.<br />
Mit seinem Debüt als Autor ist ihm ein<br />
interessantes Werk gelungen, das nicht<br />
so recht in eine Kategorie zu stecken ist.<br />
Sachbuch oder Biografie, Ratgeber oder<br />
Roman, es lässt sich schwer sagen, aber<br />
ein Buch ist es auf jeden Fall. Es erzählt<br />
aus Rubeys Leben mit Arbeit, Freizeitstress,<br />
Beziehungszwängen und Seelenmüll,<br />
vermischt mit Zitaten – mal von Hermann<br />
Hesse, mal von Rubeys Nachbarn.<br />
Witzig, kurzweilig, verrückt, das macht<br />
den einzigartigen Reiz des Buches aus.<br />
Außerdem gibt es viele Serien-, Buch- und<br />
Filmtipps, dazu persönliche Gedanken –<br />
und ein bisschen Klatsch und Tratsch ist<br />
auch dabei.<br />
„ICH WILL FORMEL-1-<br />
FAHRER WERDEN,<br />
WEIL DAS IST EIN<br />
BERUF, DER IM SITZEN<br />
AUSGEFÜHRT WIRD.<br />
AUSSERDEM IST MAN<br />
BERÜHMT.”<br />
MANUEL RUBEY ALS 5-JÄHRIGER<br />
Molden Verlag, August 2020<br />
192 Seiten, € 22,58<br />
„Wenn wir die Arme auf beiden Seiten so weit wie möglich ausstrecken und uns vorstellen, sie stellten<br />
die 4,5 Milliarden Jahre dar, die unsere Erde existiert, dann nimmt das Präkambrium die Entfernung<br />
von den Fingerspitzen einer Hand bis zum Handgelenk der anderen ein. Die gesamte Geschichte der<br />
komplexen Lebensformen spielt sich in der zweiten Hand ab, und die gesamte Menschheitsgeschichte<br />
könnte man mit einem einzigen Strich einer Nagelfeile auslöschen.“<br />
So plastisch erklärt Bill Bryson in diesem Buch die relative Bedeutungslosigkeit der menschlichen<br />
Existenz. Er zeichnet die Geschichte der Naturwissenschaften von der Astronomie über die Geologie,<br />
Chemie und Physik zur Entstehung der Erde und erzählt von frühen Erkenntnissen und heutigem Wissensstand.<br />
Dabei ist Bryson kein Wissenschaftler, sondern Journalist. Weil er eines Tages merkte, dass<br />
er so gar nichts wusste über das, was ihn im Alltag umgab, machte er sich auf, die Welt ein bisschen<br />
besser zu verstehen. Seine Fähigkeit, viel Information in sehr kurzweiliger Form zu transportieren,<br />
macht das Buch so lesenswert. Auf diese Weise schafft es Bill Bryson zu begeistern, und seine Neugierde<br />
wirkt so ansteckend wie gute Laune.<br />
Goldmann Verlag, September 2005, 688 Seiten, € 10,79
90 tirol.traditionell tirol.traditionell 91<br />
Musik schwingt<br />
in Osttirols luftigen Höhen<br />
Unternimmt man eine Ski- oder Bergtour in Osttirol, kann man mit etwas Glück den Klang einer<br />
Trompete vernehmen. Das mag zunächst nichts Außergewöhnliches sein. Schließlich ist Musik Teil<br />
der Tiroler Tradition und wird auf vielen Hütten gespielt. Doch wenn Musik direkt vom Gipfel des<br />
höchsten Bergs Österreichs, des Großglockners oder vom Glödis, dem Matterhorn Osttirols, herabklingt,<br />
dann ist das ungewöhnlich.<br />
Dabei handelt es sich nicht um eine<br />
akustische Täuschung oder ein außergewöhnliches<br />
Naturphänomen. Hinter<br />
den Trompetenklängen steckt der<br />
Kalser Bergwanderführer und Musiker<br />
Martin Gratz. Er hat es sich zur Tradition<br />
gemacht, nach einem erfolgreichen<br />
Gipfelsturm seine Trompete aus dem<br />
Rucksack zu holen und ein Lied zu spielen.<br />
Die Trompete ist fester Bestandteil<br />
seiner Bergausrüstung: Egal ob es auf<br />
den Großglockner geht, einen der vielen<br />
anderen Berge in Osttirol oder ob Gratz<br />
mit einer geführten Wandertour durch<br />
den Nationalpark Hohe Tauern unterwegs<br />
ist – das Instrument hat er immer<br />
dabei. „Die Trompete hat mich bereits<br />
auf vielen Bergtouren begleitet. Sie war<br />
sogar schon mit auf dem Matterhorn“,<br />
sagt Martin Gratz.<br />
Alter Glanz zu neuem Leben erweckt<br />
Zu seiner Trompete hat der Kalser ein<br />
besonderes Verhältnis. Die beiden haben<br />
sich buchstäblich gefunden, weil zusammenführt,<br />
was eben zusammengehört.<br />
„Vor Jahren war ich in einem Musikgeschäft.<br />
Dort fand ich diese Trompete. Sie<br />
war in keinem guten Zustand und nicht<br />
bespielbar. Der Verkäufer sagte zu mir,<br />
wenn ich einen Ton aus der Trompete bringe,<br />
dann könne ich sie einfach so haben“,<br />
erzählt der studierte Musiker. Gratz setzte<br />
an und tatsächlich gelang es ihm, einen<br />
Ton zu erzeugen. Damit gehörte das Instrument<br />
ihm. Er ließ die Trompete kurz darauf<br />
professionell reparieren und bespielbar<br />
machen. Seitdem ist sie mit ihm nicht nur<br />
in den Bergen unterwegs, sondern auch<br />
bei verschiedenen Konzerten und Auftritten,<br />
beispielweise mit dem Iseltaler Blechbläser-Ensemble.<br />
BILD: Alles schwingt: Musik ist ein Teil der<br />
Natur, lautet die Philosophie von Martin Gratz.<br />
(© Martin Gratz)<br />
Auf die Frage, warum er ausgerechnet in<br />
luftigen Höhen oder nach einer Wanderung<br />
ein Lied auf der Trompete spiele, antwortet<br />
Gratz ganz philosophisch: „Musik gehört<br />
für mich zur Natur, denn alles schwingt.<br />
Die Natur ist in Schwingung, damit auch<br />
die Berge, und Musik ist ebenfalls nichts<br />
als melodische Schwingung. Es geht einfach<br />
zusammen.“ Für den Musiker gibt es<br />
nichts Schöneres, als sich diesen Schwingungen<br />
hinzugeben und aus der jeweiligen<br />
Stimmung heraus eine Melodie anzustimmen.<br />
Nicht nur Gratz bereitet das Freude,<br />
sondern auch vielen anderen Menschen,<br />
von denen manche sogar tief bewegt sind.<br />
Musik ist eine Sprache, die jeder versteht<br />
„Als ich letztes Jahr oben am 3.206 Meter<br />
hohen Glödis war, spielte ich ‚Hallelujah‘<br />
von Leonard Cohen. Diesen Moment filmte<br />
ein Bergsteiger. Er schickte mir diesen<br />
kleinen Clip, den ich auf Facebook stellte.<br />
Dazu schrieb ich ‚Dieser Film ist all jenen<br />
gewidmet, die in den Bergen ihr Leben<br />
ließen. Danke, dass wir anderen gesund<br />
heimkehren dürfen.‘ Innerhalb kürzester<br />
Zeit erhielt dieser Post über 10.000 Klicks.<br />
Das überraschte und bewegte mich“,<br />
gesteht Martin Gratz. Ein weiteres Beispiel<br />
für emotionale Momente, in denen<br />
eine einzigartige positive Wechselwirkung<br />
zwischen Natur und Trompetenspiel entsteht,<br />
sind die von Martin Gratz geführten<br />
Gästetouren im Nationalpark Hohe<br />
Tauern, die er zu Tagesanbruch unternimmt.<br />
Kurz vor Sonnenaufgang holt er<br />
seine Trompete aus dem Rucksack, setzt<br />
an und begrüßt den gerade erwachenden<br />
Tag mit einem Lied.<br />
Trompetenklänge vermitteln Emotionen<br />
und Botschaften<br />
Welches Musikstück Martin Gratz spielt,<br />
wird aber nicht nur durch die jeweilige<br />
Stimmung bestimmt. Wenn er mit seinen<br />
Gästen durch die Bergwelt Osttirols<br />
streift, sind auch Geburtstage, Hochzeitstage<br />
oder Jubiläen Inspiration für ihn. So<br />
kann es „Happy Birthday“, „Ave Maria“<br />
oder ein spezieller Wunsch eines Gastes<br />
sein, das der passionierte Trompeter<br />
darbietet. Jeder dieser Augenblicke<br />
ist für die Menschen etwas Besonderes.<br />
Sie lauschen andächtig den Klängen der<br />
Trompete, der Botschaft des Musikstücks<br />
– und das immer vor der beeindruckenden<br />
Kulisse der Osttiroler Berge. Die Musik<br />
wird auf diese Weise viel intensiver wahrgenommen,<br />
wie der Musiker etliche Male<br />
beobachten konnte.<br />
„Musik hat etwas<br />
Magisches und<br />
Verbindendes. Sie<br />
berührt die Herzen<br />
der Menschen. Es<br />
ist eine Form von<br />
Kommunikation,<br />
eine Sprache, die<br />
jeder versteht.“<br />
„Musik hat etwas Magisches und Verbindendes.<br />
Sie berührt die Herzen der<br />
Menschen. Es ist eine Form von Kommunikation,<br />
eine Sprache, die jeder versteht.<br />
Daher heißt es auch aus gutem Grund:<br />
Musik verbindet über Grenzen hinweg.<br />
Ich spiele Musik nicht nur aus der reinen<br />
Freude am Musizieren heraus. Es hat für<br />
mich jedes Mal eine tiefere Bedeutung.<br />
Wenn ich in dieser herrlichen, ursprünglichen<br />
Natur stehe und auf meiner Trompete<br />
spiele, schwingt auch leise die Botschaft<br />
des Friedens mit. Die Töne einer<br />
Trompete vermitteln das auf eine klare,<br />
einfache und schöne Weise“, sagt der Kalser<br />
Musiker.<br />
Man braucht sich also nicht zu wundern,<br />
wenn man auf einer seiner nächsten<br />
Bergtouren in Osttirol den Klang einer<br />
Trompete vernimmt. Dann sollte man kurz<br />
innehalten und den Augenblick genießen.<br />
Es ist bestimmt Martin Gratz, der mit<br />
seiner Trompete von irgendeinem<br />
Gipfel eine frohe Botschaft<br />
in die Welt hinaussendet.<br />
AUTOR JAN SCHÄFER<br />
Wer ist<br />
Martin<br />
Gratz?<br />
Martin Gratz wurde 1966 in Kals<br />
am Großglockner geboren und lebt<br />
auch dort. Er war Mitglied der Militärmusik<br />
Tirol und studierte am<br />
Tiroler Landeskonservatorium Instrumental<br />
und Gesangspädagogik.<br />
Gratz ist ausgebildeter Bergwanderführer<br />
und Nature-Watch-Guide.<br />
Sein Performance-Projekt „Mythos<br />
Großglockner“ sorgte für internationale<br />
Aufmerksamkeit. Ebenso machte<br />
er sich als Filmemacher mit Dokumentationen<br />
über Johann Stüdl und<br />
Markgraf Alfred von Pallavicini einen<br />
Namen.<br />
Der vielseitige Kalser ist Kapellmeister<br />
der Trachtenmusikkapelle<br />
Kals am Großglockner. Er gründete<br />
das Iseltaler Blechbläser Ensemble,<br />
mit dem er federführend an<br />
der Multivisions-Performance<br />
„Friede-Freiheit-Fairness“ beteiligt<br />
ist. Außerdem ist Martin Gratz erster<br />
Obmann-Stellvertreter des Tourismusverbands<br />
Osttirol und Bürgermeister-Stellvertreter<br />
der Gemeinde<br />
Kals am Großglockner.<br />
BILD: Martin Gratz<br />
und seine Trompete am<br />
Gipfel des Großglockners<br />
(© Martin Gratz)
92 tirol.bunt und vielfältig<br />
tirol.bunt und vielfältig<br />
93<br />
DER DUFT<br />
DES ORIENTS<br />
Die Welt ist bunt, kunterbunt. Ein kleines, winziges Abbild davon findet sich am<br />
Innsbrucker Marktplatz, in der Markthalle. Auch hier geht es um Vielfalt, die der Einfalt<br />
entgegentritt. Bechir Benattia aus Tunesien ist ein Beispiel dafür. Und natürlich auch<br />
Kurt Waldheim war damals Bundespräsident.<br />
International war er aufgrund seines<br />
ungeklärten Verhältnisses zur NS-Vergangenheit<br />
isoliert, zu Staatsbesuchen wurde<br />
er nur in den Vatikan und in ganz wenige<br />
arabische Staaten eingeladen. So etwa<br />
nach Tunesien. Und genau dort, beim offiziellen<br />
Staatsbesuch Waldheims in Tunis,<br />
Ende der 1980er Jahre, passierte es dann<br />
auch. Bechir Benattia aus einem kleinen<br />
Vorort von Tunis und Bettina aus Zirl lernten<br />
sich kennen. Und verliebten sich ineinander.<br />
„Ich kann mich noch sehr gut erinnern“,<br />
so Bechir Benattia lächelnd. „Bettina war<br />
zu der Zeit Kindermädchen an der österreichischen<br />
Botschaft, ich selbst betrieb<br />
eine gut gehende Bilderrahmenhandlung.<br />
Kurt Waldheim brachte als Gastgeschenk<br />
einen sündteuren Bösendorfer Konzertflügel<br />
nach Tunis mit, zur Einweihung desselben<br />
im Theater gab es ein großes Konzert.<br />
Eingeladen dazu waren neben der offiziellen<br />
Politik auch Diplomaten, Botschafter,<br />
Künstler. Dann noch, wohl mehr am Rande,<br />
Bettina und ich. Ja, so hat alles begonnen.<br />
Langsam aber stetig, unaufhaltsam.“<br />
Sidi Bou Said, Tunesien<br />
Aufgewachsen ist Bechir übrigens in Sidi<br />
Bou Said, einem kleinen, verträumten<br />
Künstlerdorf am Felsen von Karthago,<br />
gerade mal 20 Kilometer von Tunis entfernt.<br />
Ein malerisches, buntes, kleines Dorf<br />
direkt am Golf von Tunis, in dem Langsam-<br />
und Gemütlichkeit bestimmend<br />
seine Frau, Bettina. Eine kleine Bestandsaufnahme.<br />
waren, heute wohl eine der bekanntesten<br />
Tourismusattraktionen des Landes. Nachdem<br />
er zwölf Jahre in London lebte, dort in<br />
den 1970er Jahren das erste tunesische<br />
Reisebüro für Europa eröffnet und auch<br />
das Handwerk der Fotografie erlernte,<br />
kehrte er nach Sidi Bou Said zurück. 1982<br />
eröffnete er eine Bilderrahmenhandlung<br />
samt Fotostudio, baute sich ein schönes<br />
Haus direkt am Meer und bediente seine<br />
Kunden, zumeist Botschafter und Künstler.<br />
Einmal, und daran erinnert sich Bechir<br />
noch heute gerne zurück, kam sogar die<br />
Frau des ersten Präsidenten der Tunesischen<br />
Republik, die einflussreiche und<br />
später faktisch die Amtsgeschäfte führende<br />
Wassila Ben Ammar, bei ihm im<br />
Geschäft vorbei.<br />
Was ihm dabei neben seinen handwerklichen<br />
Fähigkeiten half, waren natürlich die<br />
Sprachen. Bechir verfügt wohl über viele<br />
Zungen, spricht er doch neben der Amtssprache<br />
Arabisch auch perfekt Französisch<br />
und Englisch. Und ein wenig Deutsch.<br />
Bei seiner Stammkundschaft aus aller<br />
Herren Länder ein großer Vorteil. Außerdem<br />
verfügt er über ein äußerst gewinnendes<br />
Wesen, über lachende Augen und ja,<br />
er ist auch ein begnadeter Geschichtenerzähler,<br />
für arabische Menschen freilich<br />
nicht ganz ungewöhnlich.<br />
Zirl, Tirol, Österreich<br />
„Mich zeichnet das Fernweh aus, ich mag<br />
einfach andere Länder, andere Kulturen,<br />
Menschen mit einer ganz anderen<br />
Geschichte“, sprudelt es aus Bettina heraus.<br />
Für eine gebürtige Tirolerin – gut,<br />
das mag ein vereinfachtes Klischee sein<br />
– eher ungewöhnlich. Im zarten Alter von<br />
18 Jahren zog es sie bereits an die österreichische<br />
Botschaft nach Rom, gleich für<br />
knapp vier Jahre. Als der Botschafter dann<br />
nach Tunis wechselte, nahm er Bettina<br />
gleich mit. Sie wagte somit einen noch<br />
größeren Sprung und übersiedelte für neun<br />
Jahre nach Tunesien. Zuerst als Kindermädchen<br />
an der Botschaft tätig, lernte<br />
sie in weiterer Folge eben Bechir kennen.<br />
Im Sommer 1991 wurde schließlich geheiratet.<br />
Wo? Raten Sie mal. Falsch, die Hochzeit<br />
fand beim Goldenen Dachl im Herzen<br />
von Innsbruck statt. Bettina in einem<br />
bunt bestickten arabischen Hochzeitskleid,<br />
Bechir in einem westlichen Leinenanzug<br />
mit Strohhut am Kopf. Verkehrte Welten.<br />
Nach der Hochzeit freilich ging es gleich<br />
wieder zurück nach Tunesien. Drei Jahre<br />
später wurde Adel, ihr erster Sohn geboren,<br />
in Sidi Bou Said. Das Geschäft, die<br />
Bilderrahmenhandlung, Sie erinnern sich,<br />
lief ausgezeichnet, das Leben war einfach,<br />
aber schön.<br />
Zine el-Abidine Ben Ali<br />
In dieser Zeit, eigentlich von 1987 bis<br />
2011, hieß der tunesische Präsident Zine<br />
el-Abidine Ben Ali, der das Land autokratisch,<br />
nein, diktatorisch regierte. 2011, am<br />
Höhepunkt des Arabischen Frühlings und<br />
nach breiten öffentlichen Protesten, flüchtet<br />
er dann Hals über Kopf nach Saudi-<br />
OBEN: Folgen Sie einfach Ihrer<br />
Nase und atmen Sie den Duft des<br />
Orients. So finden Sie ganz schnell<br />
zu Bechirs Stand „Tuareg Gewürze“.<br />
(© Felix Richter)<br />
Arabien. Doch zurück ins Jahr 1997 und zu<br />
Bettina und Bechir. „Wir wohnten damals<br />
an einem wunderschönen Platz, Wohnung<br />
und Geschäft befanden sich in einem<br />
Haus, und alles schien perfekt. Doch dann<br />
wollte der Präsident direkt dort, wo wir<br />
wohnten, sein neues Palais gebaut haben.<br />
Somit wurde uns fast über Nacht alles<br />
weggenommen. Das Geschäft, unser Haus,<br />
unser ganzes bisheriges Leben. Ich habe<br />
zwar noch einiges versucht, doch was soll<br />
ich gegen den Präsidenten in einem fast<br />
rechtlosen Land unternehmen“, erinnert<br />
sich Bechir bitter zurück.<br />
Es hieß, sich rasch neu zu organisieren,<br />
die Koffer zu packen und ein neues Leben<br />
aufzubauen. „Vor allem für Bechir ein fast<br />
unerträglicher Einschnitt“, so Bettina, „weil<br />
es gibt niemanden, der sein Land so liebt<br />
wie er.“ Somit ging es also zurück nach<br />
Österreich, nach Tirol, „heim“ zu Bettinas<br />
ursprünglicher Familie nach Zirl. Wenig<br />
später kam dann auch Aziz, der zweite<br />
Sohn, zur Welt. Was für ein großer Lichtblick,<br />
in dieser Zeit, 1997.<br />
Marktplatz, Markthalle, Innsbruck<br />
Jede Medaille hat zwei Seiten. Das Unglück<br />
der Familie Benattia war das Glück von<br />
Innsbruck. „Ende der 1990er Jahre haben<br />
wir dann beim Eingang der Markthalle<br />
in Innsbruck ganz klein angefangen. Wir<br />
haben typisch tunesische Sachen verkauft,<br />
allerdings nur am Samstag. Körbe, Handarbeiten,<br />
freilich auch Gewürze, Olivenseife,<br />
Kräuter. Das ist sehr gut angekommen,<br />
vielleicht auch, weil es etwas Exotisches<br />
an sich hatte. Und das zieht mitunter halt<br />
Wir wohnten damals an einem wunderschönen<br />
Platz, Wohnung und Geschäft befanden sich in<br />
einem Haus, und alles schien perfekt. Doch dann<br />
wollte der Präsident direkt dort, wo wir wohnten,<br />
an“, erzählt Bechir. Wobei es noch eine<br />
weitere Besonderheit gab: Wie damals in<br />
Tunesien üblich, verzichtete Bechir seit<br />
1999 auch in Tirol auf Plastik. Stattdessen<br />
verpackte er seine Ware in selbstgemachten<br />
Papiertüten.<br />
Die Mundpropaganda trug dazu bei, dass<br />
sich das Geschäft sehr positiv entwickelte,<br />
schon bald wurde im Inneren der Markthalle<br />
ein eigener Stand gemietet. Die<br />
Kundschaft nahm weiter zu, was zuerst<br />
ein Geheimtipp war, wird mittlerweile fleißig<br />
auf Social Media geteilt. Die Benattias<br />
sind wohl endgültig in Tirol angekommen,<br />
wenngleich ein gewisses Kribbeln nahe<br />
des Herzens bleibt. Bei Bettina, die vormittags<br />
in einem Kindergarten arbeitet,<br />
ist es wohl das Fernweh. Bei Bechir der<br />
Blick zurück, in die Vergangenheit, nach<br />
Sidi Bou Said.<br />
AUTOR REINHOLD OBLAK<br />
sein neues Palais gebaut haben.<br />
LINKS: Bechir<br />
Benattia ist unübersehbar,<br />
sein kleines<br />
Geschäft in der<br />
Markthalle Innsbruck<br />
überzeugt<br />
mit typisch orientalischer<br />
Atmosphäre.<br />
(© Felix Richter)<br />
TUAREG-GEWÜRZE<br />
Am Marktplatz, in der Markthalle<br />
Innsbruck, mitten im<br />
Bauernmarkt. Freitag und<br />
Samstag jeweils am Vormittag<br />
geöffnet. Ein kleiner, feiner orientalischer<br />
Laden. Das Angebot<br />
reicht von selbst gemahlenen<br />
und gemischten Gewürzen<br />
über verschiedene Teemischungen,<br />
feinen Ölen bis hin<br />
zu arabischen Dattelkeksen.<br />
Außerdem werden Rezepte verraten,<br />
welche die Tür in die arabische<br />
Küche weit öffnen. Was<br />
es sonst noch gibt? Folgen Sie<br />
einfach Ihrer Nase, Sie werden<br />
überrascht sein. Kontakt:<br />
benattiabettina@gmail.com
94<br />
95<br />
GeOrg<br />
taucht auf.<br />
Und kommt jetzt<br />
auch bald zu dir.<br />
open-digital.at<br />
Die Software für Tiroler Gemeinden.<br />
Wir<br />
bleiben wir<br />
selbst.<br />
Wir sind davon überzeugt, dass Menschen selbstbestimmt handeln können. Wir erwarten von allen<br />
Kolleg*innen, dass sie Verantwortung übernehmen und ihr Tun darauf ausrichten, einen gesellschaftlichen<br />
Beitrag zu leisten. Wir sind alle gleich, wir unterscheiden nicht nach Funktion und<br />
Verantwortlichkeit und begegnen allen mit Wertschätzung. Wir lieben und leben Vielfalt in all ihren<br />
Farben und bleiben bei unserem Handeln authentisch. Jede Person, die diese Grundsätze mitträgt,<br />
kann innerhalb unseres Rahmens mitgestalten, sich einbringen, eigenverantwortlich und eigenorganisiert<br />
handeln und dabei individuelle Wege wählen.<br />
Wir<br />
vertrauen<br />
einander.<br />
IMPRESSUM: Herausgeber, Medieninhaber und Verleger: GemNova Dienstleistungs GmbH | Adamgasse 7a, A-6020 Innsbruck, office@gemnova.at,<br />
+43 (0) 50 4711, www.gemnova.at, © <strong>2021</strong>. Herstellung und Druck: Alpina Druck GmbH, www.alpinadruck.com. Auflage: 11.500 Stück. Anzeigenverkauf:<br />
Mag. Bernhard Müssiggang, www.bmw-agentur.at. Konzept & Gestaltung: Mitspieler – Kommunikation & Gestaltung, www.mitspieler.at. Textkorrekturen:<br />
Text:Quell, Innsbruck, www.text-quell.at. Redaktionsschluss: 12.3.<strong>2021</strong>. Mit „Entgeltliche Einschaltung“ gekennzeichnete Artikel sind bezahlte Informationen<br />
und fallen nicht in die Verantwortlichkeit der Redaktion.<br />
WIR ALLE SIND GEMEINDE.
96<br />
Es gibt<br />
viele gute Gründe,<br />
qualitätsvolle<br />
auf denen wir schon<br />
Wohnanlagen<br />
und ansehnliche<br />
gebaut haben.<br />
Nun sind wir auf der<br />
Suche nach weiteren<br />
guten Bau-Gründen<br />
betreubares Wohnen<br />
für ein Projekt im Bereich<br />
in Ihrer Gemeinde.<br />
Gemeinnützige Hauptgenossenschaft<br />
des Siedlerbundes regGenmbH<br />
Wir sind auf der Suche nach neuem Baugrund für<br />
unsere nächsten gemeinnützigen Wohnprojekte<br />
im Bereich betreubares Wohnen. Wir wollen für<br />
ältere Menschen aus Ihrer Umgebung ein<br />
wohliges zu Hause schaffen, in dem sie ihren<br />
Lebensabend genießen können.<br />
Wir suchen<br />
Baugrund!<br />
Machen Sie mehr aus<br />
Ihrem Grundstück –<br />
und kontaktieren<br />
Sie uns!<br />
Kontakt:<br />
Vorstand Dr. Peter Heiss oder Marlene Resch<br />
Ing.-Etzel-Straße 11 . A-6020 Innsbruck<br />
T +43 (0)512 52 0 61 -31<br />
E m.resch@ghs-wohnbau.com<br />
www.ghs-wohnbau.com