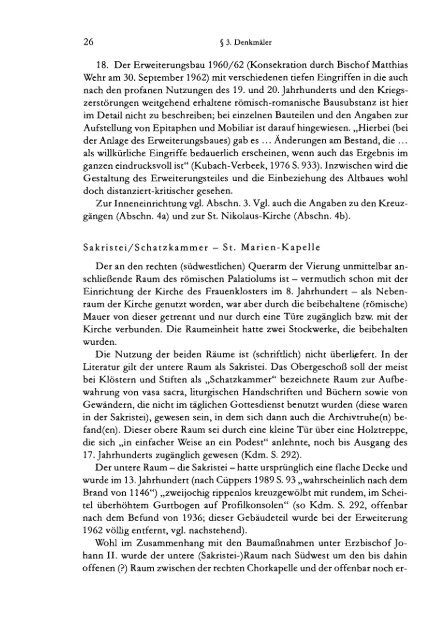- Seite 1 und 2: G ERMANIA SACRA HISTORISCH-STATISTI
- Seite 3: § Gedruckt auf säurefreiem Papier
- Seite 6 und 7: VI Vorwort die Porta Nigra). Als si
- Seite 8 und 9: VIII Inhaltsverzeichnis 2. Archiv u
- Seite 10 und 11: x Inhaltsverzeichnis § 23. Tod, Be
- Seite 13 und 14: ABKÜRZUNGEN UND SIGLEN Neben den i
- Seite 15 und 16: 1. QUELLEN, LITERATUR UND DENKMÄLE
- Seite 17 und 18: 2. Gedruckte Quellen 3 Ehrentraut H
- Seite 19 und 20: 2. Gedruckte Quellen 5 2.1378-1415.
- Seite 21 und 22: § 2. Literatur und Nachschlagewerk
- Seite 23 und 24: § 2. Literatur und Nachschlagewerk
- Seite 25 und 26: § 2. Literatur und Nachschlagewerk
- Seite 27 und 28: A 1. Der Stiftsbering 13 Werner Mat
- Seite 29 und 30: A 1. Der Stiftsbering 15 Abb. 2. Ge
- Seite 31 und 32: A 2. Die Stiftskirche als Bauwerk 1
- Seite 33: A 2. Die Stiftskirche als Bauwerk 1
- Seite 37 und 38: Sc. Stiftskirche, Blick aus dem Cho
- Seite 39: A 2. Die Stiftskirche als Bauwerk 2
- Seite 43 und 44: A 3a. Altäre, Bilder, Skulpturen 2
- Seite 45: A 3a. Altäre, Bilder, Skulpturen 3
- Seite 50 und 51: 36 § 3. Denkmäler Glocken Die Kir
- Seite 54 und 55: 40 § 3. Denkmäler d) Protokoll de
- Seite 57 und 58: A 3b. Gräber, Epitaphe 43 Nebencho
- Seite 59: A 3b. Gräber, Epitaphe 45 Abb. 8.
- Seite 62 und 63: 48 § 3. Denkmäler Grabmal, jetzt
- Seite 64 und 65: 50 § 3. Denkmäler sem oben ein se
- Seite 67: A 4a. Kreuzgang mit St. Peter-Kapel
- Seite 70 und 71: 56 § 3. Denkmäler zerstört. Auch
- Seite 73: A 4b. Stifts-Pfarrkirche St. Nikola
- Seite 77 und 78: A 5. Wohn- und Wirtschaftsgebäude
- Seite 79 und 80: A Sa. Kurien 65 hend genannten Höc
- Seite 81: A Sa. Kurien 67 Kurie Zum Turm (Ad
- Seite 85 und 86: A Sd. Arbeits- und Gemeinschaftsrä
- Seite 87 und 88: A.6. Gebäude in Pfalzel außerhalb
- Seite 89 und 90: A 6a. Burg und Residenz der Erzbisc
- Seite 91 und 92:
A 6a. Burg und Residenz der Erzbisc
- Seite 93 und 94:
A 6a. Burg und Residenz der Erzbisc
- Seite 95 und 96:
A 6c. Pfarrkirche St. Martin 81 hal
- Seite 97 und 98:
A 6c. Pfarrkirche St. Martin 83 alt
- Seite 99 und 100:
A 6c. Pfarrkirche St. Marcin 85 Nr.
- Seite 101 und 102:
A 6c. Pfarrkirche St. Martin 87 Ver
- Seite 103 und 104:
B. Kirchenschatz, liturgische Hands
- Seite 105 und 106:
B. Kirchenschatz, liturgische Hands
- Seite 107 und 108:
B. Kirchenschatz, liturgische Hands
- Seite 109:
2. Die noch vorhandenen Bestände 9
- Seite 112 und 113:
98 § 5. Bibliothek Das Buch war ur
- Seite 114 und 115:
100 § 5. Bibliothek Handschrift De
- Seite 116 und 117:
102 § 7. Vorgeschichte des Gebäud
- Seite 118 und 119:
104 § 7. Vorgeschichte des Gebäud
- Seite 120 und 121:
106 § 7. Vorgeschichte des Gebäud
- Seite 122 und 123:
108 § 7. Vorgeschichte des Gebäud
- Seite 124 und 125:
110 § 7. Vorgeschichte des Gebäud
- Seite 126 und 127:
112 § 8. Geschichte des Stiftes vo
- Seite 128 und 129:
114 § 8. Geschichte des Stiftes vo
- Seite 130 und 131:
116 § 8. Geschichte des Stiftes vo
- Seite 132 und 133:
118 § 8. Geschichte des Stiftes vo
- Seite 134 und 135:
120 § 8. Geschichte des Stiftes vo
- Seite 136 und 137:
122 § 8. Geschichte des Stiftes vo
- Seite 139 und 140:
C. Die Reformen des 15. Jahrhundert
- Seite 141 und 142:
C. Die Reformen des 15. Jahrhundert
- Seite 143 und 144:
C. Die Reformen des 15. Jahrhundert
- Seite 145 und 146:
C. Die Reformen des 15. Jahrhundert
- Seite 147 und 148:
D. Vom Beginn des 16. bis zum Ende
- Seite 149 und 150:
D. Vom Beginn des 16. bis zum Ende
- Seite 151 und 152:
§ 9. Die Aufhebung des Stiftes 137
- Seite 153 und 154:
§ 9. Die Aufhebung des Stiftes 139
- Seite 155 und 156:
§ 10. Die Statuten 141 Nr. 302; no
- Seite 157 und 158:
Alb. Möglichkeiten der Aufnahme. E
- Seite 159 und 160:
Alb. Möglichkeiten der Aufnahme. E
- Seite 161 und 162:
A Id. Wartezeiten. Karenz- und Exsp
- Seite 163 und 164:
A 2c. Beichtverpflichtung 149 Der E
- Seite 165:
A 3f. Das Gnadenjahr 151 stimmen, d
- Seite 168 und 169:
154 § 12. Dignitäten und Ämter a
- Seite 170 und 171:
156 § 12. Dignitäten und Ämter a
- Seite 172 und 173:
158 § 12. Dignitäten und Ämter a
- Seite 174 und 175:
160 § 12. Dignitäten und Ämter a
- Seite 176 und 177:
162 § 12. Dignitäten und Ämter a
- Seite 178:
164 § 12. Dignitäten und Ämter a
- Seite 181 und 182:
2. Die Universitätspfründe 167 Nr
- Seite 183 und 184:
1. Der Kellner 169 Das Amt des Kell
- Seite 185 und 186:
§ 15. Vikarien und AltarpfrüDden
- Seite 187 und 188:
Vikare (Belege in § 36): 1460 Walt
- Seite 189 und 190:
§ 15. Vikarien und Altarpfründen
- Seite 191 und 192:
Vikare (Belege in § 36): 1746-1778
- Seite 194 und 195:
180 § 17. Die familia des Stiftes.
- Seite 196 und 197:
182 § 18. Äußere Bindungen und B
- Seite 198 und 199:
184 § 19. Siegel xerunt archiepisc
- Seite 200 und 201:
186 § 19. Siegel Die Gewandspange
- Seite 202 und 203:
188 § 19. Siegel Abb.: Ewald, Rhei
- Seite 204 und 205:
190 § 20. Adela als Heilige. Das F
- Seite 206 und 207:
192 § 20. Adela als Heilige. Besta
- Seite 209 und 210:
§ 20. Adela als Heilige. 195 In Au
- Seite 211 und 212:
§ 20. Adela als Heilige. 197 die "
- Seite 213 und 214:
§ 21. Reliquien 199 1047/49 nach S
- Seite 215 und 216:
§ 21. Reliquien 201 Das "Abendmahl
- Seite 217 und 218:
§ 23. Tod, Begräbnis, Anniversari
- Seite 219 und 220:
3. Zur Ordnung für den Chordienst
- Seite 222 und 223:
208 § 23. Tod, Begräbnis, Anniver
- Seite 224 und 225:
210 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 226 und 227:
212 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 228 und 229:
214 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 230 und 231:
216 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 232 und 233:
218 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 234 und 235:
220 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 236 und 237:
222 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 238 und 239:
224 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 240 und 241:
226 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 242 und 243:
228 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 244 und 245:
230 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 246 und 247:
232 § 24. Chor- und Gottesdienst,
- Seite 248:
234 § 25. Ablässe Ergänzungen in
- Seite 251 und 252:
6. DER BESITZ § 26. Übersicht 1.
- Seite 254 und 255:
240 § 26. Übersicht Zu den Kapita
- Seite 256 und 257:
242 § 26. Übersicht In der histor
- Seite 258 und 259:
244 § 26. Übersicht Cochem), hier
- Seite 260 und 261:
246 § 27. Gliederung der Besitzung
- Seite 262:
248 § 27. Gliederung der Besitzung
- Seite 265 und 266:
B 3. Kurien und Allode 251 O bjekt
- Seite 267 und 268:
B5. Präsenzgelder 253 5. Präsenzg
- Seite 269 und 270:
C. Die Fabrik 255 Über die Verteil
- Seite 271 und 272:
§ 28. Liste der Herrschafts-, Geri
- Seite 273 und 274:
§ 28. Liste der Herrschafts-, Geri
- Seite 275 und 276:
§ 28. Liste der Herrschafts-, Geri
- Seite 277 und 278:
§ 28. Liste der Herrschafts-, Geri
- Seite 280 und 281:
266 § 28. Liste der Herrschafts-,
- Seite 282 und 283:
268 § 28. Liste der Herrschafts-,
- Seite 284 und 285:
270 § 28. Liste der Herrschafts-,
- Seite 286 und 287:
272 § 29. Liste der inkorporierten
- Seite 288 und 289:
274 § 29. Liste der inkorporierten
- Seite 290 und 291:
276 § 29. Liste der inkorporierten
- Seite 292 und 293:
278 § 29. Liste der inkorporierten
- Seite 294:
280 § 29. Liste der inkorporierten
- Seite 297 und 298:
§ 29. Liste der inkorporierten Kir
- Seite 299 und 300:
§ 29. Liste der inkorporierten Kir
- Seite 302 und 303:
288 § 29. Liste der inkorporierten
- Seite 304 und 305:
290 § 29. Liste der inkorporierten
- Seite 306 und 307:
7. PERSONALLISTEN Vorbemerkung Nebe
- Seite 308 und 309:
294 1650-1689 1689-1701 1701-1709 1
- Seite 310 und 311:
296 1695-1701 1701-1717 1717-1734 1
- Seite 312 und 313:
298 § 30. Liste der Pröpste der f
- Seite 314 und 315:
300 § 30. Liste der Pröpste Siege
- Seite 316 und 317:
302 § 30. Liste der Pröpste Johan
- Seite 319 und 320:
7. Personallisten 305 Inhaber des S
- Seite 321 und 322:
7. Personallisten 307 § 31. Liste
- Seite 323 und 324:
7. Personallisten 309 dem 15. Novem
- Seite 326 und 327:
312 § 31. Liste der Dekane Goldman
- Seite 328:
314 § 31. Liste der Dekane Mag. (1
- Seite 331 und 332:
7. Personallisten 317 tore Treveren
- Seite 333 und 334:
7. Personallisten 319 (K Best. 1 A
- Seite 335 und 336:
7. Personallisten 321 und 1658 als
- Seite 337 und 338:
7. Personallisten 323 157 Nr. 197).
- Seite 339 und 340:
7. Personallisten 325 per nicht bes
- Seite 341 und 342:
7. Personallisten 327 Bruno, Archid
- Seite 343:
7. Personallisten 329 Siegfried (Si
- Seite 346 und 347:
332 § 32. Liste der Scholaster Ver
- Seite 348 und 349:
334 § 32. Liste der Scholaster als
- Seite 350 und 351:
336 § 32. Liste der Scholaster (Ur
- Seite 352 und 353:
338 § 32. Liste der Scholaster in
- Seite 357:
7. Personallisten 343 kastel diesen
- Seite 360:
346 § 33. Liste der Kustoden (fhes
- Seite 364 und 365:
350 § 34. Liste der Kantoren Claud
- Seite 366 und 367:
352 § 34. Liste der Kantoren zeß
- Seite 368 und 369:
354 § 35. Liste der Kanoniker (Kap
- Seite 370 und 371:
356 § 35. Liste der Kanoniker (Kap
- Seite 373 und 374:
7. Personallisten 359 Scholaster vo
- Seite 375 und 376:
7. Personallisten 361 Dienst der Er
- Seite 377 und 378:
7. Personallisten 363 Nittel, doch
- Seite 379:
7. Personallisten 365 J ohann Eligi
- Seite 384:
370 § 35. Liste der Kanoniker (Kap
- Seite 389 und 390:
7. Personallisten 375 Theoderich Le
- Seite 391 und 392:
7. Personallisten 377 piar StadtBi
- Seite 393 und 394:
7. Personallisten 379 Generalkapite
- Seite 395 und 396:
7. Personallisten 381 C Nr. 43 S. 1
- Seite 397 und 398:
7. Personallisten 383 Mühlheim-Tal
- Seite 399 und 400:
7. Personallisten 385 canonicus res
- Seite 401 und 402:
7. Personallisten 387 11. Juli ange
- Seite 403 und 404:
7. Personallisten 389 Nikolaus Hein
- Seite 405 und 406:
7. Personallisten 391 Kapelle zu Dh
- Seite 407 und 408:
7. Personallisten 393 Franz Georg S
- Seite 409 und 410:
7. Personallisten 395 Peter Ludwig.
- Seite 412:
398 § 36. Liste der Vikare und Alt
- Seite 416:
402 § 36. Liste der Vikare und Alt
- Seite 420 und 421:
406 § 36. Liste der Vikare und Alt
- Seite 422 und 423:
408 § 36. Liste der Vikare und Alt
- Seite 424 und 425:
410 § 36. Liste der Vikare und Alt
- Seite 426 und 427:
A Aach nw Trier 237, 256f., 299 Aac
- Seite 430:
416 Index der Personen- und Ortsnam
- Seite 433 und 434:
Holler, Johann, Dekan St. Simeon/Tr
- Seite 435:
- Thome v. Schweich, Kan. 360 - Vog
- Seite 438 und 439:
424 Index der Personen- und Ortsnam
- Seite 440 und 441:
426 Index der Personen- und Ortsnam
- Seite 443 und 444:
- Mühle 203; Mühlenbach 221 Tore
- Seite 446 und 447:
432 Index der Personen- und Ortsnam
- Seite 448 und 449:
434 Index der Personen- und Ortsnam
- Seite 450 und 451:
436 Index der Personen- und Ortsnam