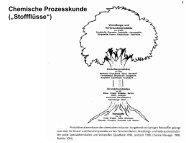- Seite 1: Die Restrukturierung des Arbeitsmar
- Seite 5: Indisciplin I do remember one thing
- Seite 8 und 9: - 8 - 1.5 Diskussion des Flexibilit
- Seite 10 und 11: - 10 - 3.3 Ausgewählte Befunde zur
- Seite 12 und 13: - 12 - 5.3 Regulierung des anhalten
- Seite 14 und 15: - 14 - Abbildung 19: Indexierte Rea
- Seite 16 und 17: - 16 - Abbildung 51: Median (in Tag
- Seite 18 und 19: - 18 - Tabelle 18: Hazard Ratios vo
- Seite 20 und 21: - 20 - Tabelle 45: Hazard Ratios 1
- Seite 22 und 23: - 22 -
- Seite 24 und 25: - 24 - sen sind. In der sich Schrit
- Seite 26 und 27: - 26 - nehmen bereit waren. Folge w
- Seite 28 und 29: - 28 - nen der betrieblichen Arbeit
- Seite 30 und 31: - 30 - (b) Die „Entsrukturierungs
- Seite 34 und 35: - 34 - unabhängig vom hier verfolg
- Seite 36 und 37: - 36 - wenngleich es jenseits diese
- Seite 38 und 39: - 38 - deutlicht. Daran schließt s
- Seite 40 und 41: - 40 - Güter. 5 Entscheidend für
- Seite 42 und 43: - 42 - 1.1.1 Individuum als Akteur
- Seite 44 und 45: - 44 - Sichtweise gewählt wird, he
- Seite 46 und 47: - 46 - begrenzt informierten Subjek
- Seite 48 und 49: - 48 - (2) Faktorspezifität Unter
- Seite 50 und 51: - 50 - rational handelnden Nutzenma
- Seite 52 und 53: - 52 - „RREEMM“; vgl. LINDENBER
- Seite 54 und 55: - 54 - Zwischenebene zwischen der
- Seite 56 und 57: - 56 - Wie vorstehend zu sehen war,
- Seite 58 und 59: - 58 - abhängige Entscheidung. „
- Seite 60 und 61: - 60 - aktives und ein passives Ele
- Seite 62 und 63: - 62 - Tausch innerhalb eines Ratio
- Seite 64 und 65: - 64 - (POLANYI 1957). Ausgehend vo
- Seite 66 und 67: - 66 - Die Entstehung des modernen
- Seite 68 und 69: - 68 - privaten Reichtum (vgl. dazu
- Seite 70 und 71: - 70 - 1.3.3 Verträge Für die Tra
- Seite 72 und 73: - 72 - trag deutlich verbessert wir
- Seite 74 und 75: - 74 - hältnis ist so bspw. durch
- Seite 76 und 77: - 76 - besteht die Gefahr, dass die
- Seite 78 und 79: - 78 - welchen arbeitsvertraglichen
- Seite 80 und 81: - 80 - Wenn ein Betrieb entschieden
- Seite 82 und 83:
- 82 - • zur Erstellung von Güte
- Seite 84 und 85:
- 84 - von Haushaltsproduktion durc
- Seite 86 und 87:
- 86 - 1.4.3 Der Arbeitsvertrag als
- Seite 88 und 89:
- 88 - man eine statische Sichtweis
- Seite 90 und 91:
- 90 - Verhältnisses zum einen dur
- Seite 92 und 93:
- 92 - Bedeutung einzelner Lohnelem
- Seite 94 und 95:
- 94 - rie „Flexibler Einsatzort
- Seite 96 und 97:
- 96 - entscheidung sowie Allokatio
- Seite 98 und 99:
- 98 - ger Beschäftigungsverhältn
- Seite 100 und 101:
- 100 - sungsfähigkeit des Arbeits
- Seite 102 und 103:
- 102 - Familie renoviert werden (
- Seite 104 und 105:
- 104 - 1.6.1 Der historische und r
- Seite 106 und 107:
- 106 - Auf der Supraebene ist gera
- Seite 108 und 109:
- 108 - Anreizwirkung staatlicher M
- Seite 110 und 111:
- 110 - (b) Die drei zentralen Bere
- Seite 112 und 113:
- 112 - änderlichkeit der vier Ebe
- Seite 114 und 115:
- 114 - Die Nachfrage nach Arbeitsk
- Seite 116 und 117:
- 116 - marktgeschehen als Abbild d
- Seite 118 und 119:
- 118 - Des Weiteren sind zwei Kate
- Seite 120 und 121:
- 120 -
- Seite 122 und 123:
- 122 - „Megatrends“ vor. Im An
- Seite 124 und 125:
- 124 - Abbildung 9: Relative Antei
- Seite 126 und 127:
- 126 - dass mit der IAB-Beschäfti
- Seite 128 und 129:
- 128 - ben, der unterschiedliche M
- Seite 130 und 131:
- 130 - führende allgemeinbildende
- Seite 132 und 133:
- 132 - rend sich die Fachhochschul
- Seite 134 und 135:
- 134 - halte dargestellt wird (Abb
- Seite 136 und 137:
- 136 - Abbildung 14: Absolute Zahl
- Seite 138 und 139:
- 138 - (Abbildung 19) eine wesentl
- Seite 140 und 141:
- 140 - 2.4 „Globalisierung“ un
- Seite 142 und 143:
- 142 - der Makroebene wirkender
- Seite 144 und 145:
- 144 - menhängend mit einer inter
- Seite 146 und 147:
- 146 - den handelt. 45 Durch die E
- Seite 148 und 149:
- 148 - Tarifpolitik (SCHMIDT/TRINC
- Seite 150 und 151:
- 150 - In Deutschland hat ein vorg
- Seite 152 und 153:
- 152 - gangsvoraussetzungen für E
- Seite 154 und 155:
- 154 - für industrielle Großorga
- Seite 156 und 157:
- 156 - tisch müsste dies auch dan
- Seite 158 und 159:
- 158 - 2.7 Wesentliche Veränderun
- Seite 160 und 161:
- 160 - ligung und die dadurch verb
- Seite 162 und 163:
- 162 - reverlauf von Frauen widers
- Seite 164 und 165:
- 164 - Zahl der Auszubildenden hat
- Seite 166 und 167:
- 166 - Nomaden“ der Dienstleistu
- Seite 168 und 169:
- 168 - schaft tendenziell eher ste
- Seite 170 und 171:
- 170 - bestehender Unternehmen [..
- Seite 172 und 173:
- 172 - wicklung entscheidenden Ein
- Seite 174 und 175:
- 174 - nehmer werden vor allem in
- Seite 176 und 177:
- 176 -
- Seite 178 und 179:
- 178 - jedoch einen Einblick, wie
- Seite 180 und 181:
- 180 - Betriebe, die Stichprobenmi
- Seite 182 und 183:
- 182 - tigt waren65 . Durch die Be
- Seite 184 und 185:
- 184 - chertenkonto unmittelbar un
- Seite 186 und 187:
- 186 - Abbildung 21: Schematische
- Seite 188 und 189:
- 188 - bezugsmeldung der Arbeitslo
- Seite 190 und 191:
- 190 - schaftlichen Untersuchungen
- Seite 192 und 193:
- 192 - Hypothese 2: Seit den 1970e
- Seite 194 und 195:
- 194 - Abbildung 24: Eintritts-, A
- Seite 196 und 197:
- 196 - Unter diesen beiden Prämis
- Seite 198 und 199:
- 198 - finden sich in Abbildung 25
- Seite 200 und 201:
- 200 - cher Anteil der „Arbeitsm
- Seite 202 und 203:
- 202 - von dieser „verhärteten
- Seite 204 und 205:
- 204 - Beschäftigungsmeldung in J
- Seite 206 und 207:
- 206 - tete Arbeitslosigkeit“; v
- Seite 208 und 209:
- 208 - 3.3.1 Arbeitsmarktentwicklu
- Seite 210 und 211:
- 210 - Abbildung 29: Beschäftigun
- Seite 212 und 213:
- 212 - oder aber die Stabilität v
- Seite 214 und 215:
Fluktuationsraten (in %) - 214 - Ab
- Seite 216 und 217:
- 216 - Medianwerte kaum unterschei
- Seite 218 und 219:
- 218 - u. U. turbulenteren Einstie
- Seite 220 und 221:
- 220 - beitsmarkt deutlich untersc
- Seite 222 und 223:
- 222 - ger als was bzw. geringer i
- Seite 224 und 225:
- 224 - Abbildung 36: Eintritts-, A
- Seite 226 und 227:
- 226 - Abbildung 38: Überlebensra
- Seite 228 und 229:
- 228 - Die Ergebnisse zeigen somit
- Seite 230 und 231:
- 230 - verdoppelt; ihr Anteil an a
- Seite 232 und 233:
- 232 - um in der anschließenden B
- Seite 234 und 235:
- 234 - bis fünf Prozent. Gleichze
- Seite 236 und 237:
- 236 - Im Anhang in Abbildung 58 d
- Seite 238 und 239:
- 238 - Insofern sind die vorliegen
- Seite 240 und 241:
- 240 - kern verhält sich bezügli
- Seite 242 und 243:
- 242 - ben die rechtlichen Vorgabe
- Seite 244 und 245:
- 244 - zent und in Kleinbetrieben
- Seite 246 und 247:
- 246 - Beständigkeit von Beschäf
- Seite 248 und 249:
- 248 - solche Veränderungen sind
- Seite 250 und 251:
- 250 - bzw. Tätigkeitsgruppen (au
- Seite 252 und 253:
- 252 - es im Zeitverlauf Anteilsve
- Seite 254 und 255:
- 254 - Tabelle 11: Fünf Gruppen v
- Seite 256 und 257:
- 256 - Dienstleistungsberufen zu e
- Seite 258 und 259:
- 258 - Beschäftigungsverhältniss
- Seite 260 und 261:
- 260 - 3.4 Zusammenfassung der des
- Seite 262 und 263:
- 262 -
- Seite 264 und 265:
- 264 - sollen auf Basis der prozes
- Seite 266 und 267:
- 266 - nisse einer Competing-Risk-
- Seite 268 und 269:
- 268 - b) Sample 2 umfasst erstens
- Seite 270 und 271:
- 270 - können die Analysen dennoc
- Seite 272 und 273:
- 272 - Beschäftigungsverhältniss
- Seite 274 und 275:
- 274 - das Stichprobenmitglied zum
- Seite 276 und 277:
- 276 - nahezu aller Informationen
- Seite 278 und 279:
- 278 - die Beständigkeit von Besc
- Seite 280 und 281:
- 280 - werden. Hierzu sind die Ber
- Seite 282 und 283:
- 282 - zutrifft; ansonsten ‚0‘
- Seite 284 und 285:
- 284 - unterschiedlicher makroöko
- Seite 286 und 287:
- 286 - [...]“ (HOSMER/LEMESHOW 1
- Seite 288 und 289:
- 288 - Analyseperioden hier im Zei
- Seite 290 und 291:
- 290 - Tabelle 16: Hazard Ratios n
- Seite 292 und 293:
- 292 - Tabelle 17: Hazard Ratios 1
- Seite 294 und 295:
- 294 - Tabelle 18: Hazard Ratios v
- Seite 296 und 297:
- 296 - hatten Frauen in den 1980er
- Seite 298 und 299:
- 298 - zeigt diese Beschäftigteng
- Seite 300 und 301:
- 300 - Gradmesser für Arbeitsmark
- Seite 302 und 303:
- 302 - ger Nivellierungsprozess. N
- Seite 304 und 305:
- 304 - gungsverhältnissen in Zusa
- Seite 306 und 307:
- 306 - Das bedeutet, dass dieses e
- Seite 308 und 309:
- 308 - zu verstehen (und insofern
- Seite 310 und 311:
- 310 - wechsel oder auf Übergäng
- Seite 312 und 313:
- 312 - Zusätzlich müssen noch Sc
- Seite 314 und 315:
- 314 -
- Seite 316 und 317:
- 316 - als Resultat dieser fundame
- Seite 318 und 319:
- 318 - tung der Arbeitsanbieter an
- Seite 320 und 321:
- 320 - das Arbeitslosigkeitsrisiko
- Seite 322 und 323:
- 322 - die zunehmende „Verhärtu
- Seite 324 und 325:
- 324 - vor allem „sklerotisiert
- Seite 326 und 327:
- 326 - wahrscheinlich eher eine ex
- Seite 328 und 329:
- 328 - der Männer - anpassen. Die
- Seite 330 und 331:
- 330 - wicklung von Beschäftigung
- Seite 332 und 333:
- 332 - zu investieren, da sie davo
- Seite 334 und 335:
- 334 - Hauptverantwortung für die
- Seite 336 und 337:
- 336 - zukünftiges Risiko durch e
- Seite 338 und 339:
- 338 - Arbeitsmarktes weder von ei
- Seite 340 und 341:
- 340 - duale System der Berufsausb
- Seite 342 und 343:
- 342 - therapie etc.) zu optimiere
- Seite 344 und 345:
- 344 - der Nutzen einer langfristi
- Seite 346 und 347:
- 346 - durch die Rentenreform im J
- Seite 348 und 349:
- 348 - Abgabesätzen. [...] Zudem
- Seite 350 und 351:
- 350 - wird in der aktuellen Arbei
- Seite 352 und 353:
- 352 - geeignete bildungs- und arb
- Seite 354 und 355:
- 354 -
- Seite 356 und 357:
- 356 -
- Seite 358 und 359:
- 358 - • die Abmeldung (§4 DEVO
- Seite 360 und 361:
- 360 - • STYP kennzeichnet die M
- Seite 362 und 363:
- 362 - Meldung 583 weist für Pers
- Seite 364 und 365:
- 364 -
- Seite 366 und 367:
- 366 - D.1 Das Cox-Modell mit peri
- Seite 368 und 369:
- 368 - läutern wird, muss ein Ver
- Seite 370 und 371:
- 370 - schlechtsspezifischen Unter
- Seite 372 und 373:
- 372 - coefficients [or Hazard Rat
- Seite 374 und 375:
- 374 -
- Seite 376 und 377:
- 376 - Tabelle 23: Arbeitslosigkei
- Seite 378 und 379:
- 378 - Tabelle 25: 1. und 2. Quart
- Seite 380 und 381:
- 380 - Tabelle 27: Zuordnung der i
- Seite 382 und 383:
Fortsetzung Tabelle 27 Produzierend
- Seite 384 und 385:
Fortsetzung Tabelle 27 Dienstleistu
- Seite 386 und 387:
Fortsetzung Tabelle 27 Dienstleistu
- Seite 388 und 389:
Fortsetzung Tabelle 28 Produzierend
- Seite 390 und 391:
Tabelle 29: Beschäftigungsentwickl
- Seite 392 und 393:
Fortsetzung Tabelle 30 - 392 - Vari
- Seite 394 und 395:
- 394 - Tabelle 32: Hazard Ratios n
- Seite 396 und 397:
- 396 - Tabelle 34: Hazard Ratios n
- Seite 398 und 399:
- 398 - Tabelle 36: Hazard Ratios n
- Seite 400 und 401:
- 400 - Tabelle 38: Hazard Ratios n
- Seite 402 und 403:
- 402 - Tabelle 40: Hazard Ratios n
- Seite 404 und 405:
- 404 - Tabelle 42: Hazard Ratios 1
- Seite 406 und 407:
- 406 - Tabelle 44: Hazard Ratios 1
- Seite 408 und 409:
- 408 - Tabelle 46: Hazard Ratios 1
- Seite 410 und 411:
- 410 - Tabelle 48: Hazard Ratios 1
- Seite 412 und 413:
- 412 - Tabelle 50: Hazard Ratios 1
- Seite 414 und 415:
- 414 - Tabelle 52: Hazard Ratios 5
- Seite 416 und 417:
- 416 - Tabelle 54: Hazard Ratios 5
- Seite 418 und 419:
- 418 - Tabelle 56: Hazard Ratios 5
- Seite 420 und 421:
- 420 - Tabelle 58: Hazard Ratios 5
- Seite 422 und 423:
- 422 - Tabelle 60: Hazard Ratios 5
- Seite 424 und 425:
- 424 -
- Seite 426 und 427:
- 426 - Abbildung 58: Überlebensra
- Seite 428 und 429:
- 428 - Bäcker, Gerhard / Stolz-Wi
- Seite 430 und 431:
- 430 - Bendor, Jonathan / Swistak,
- Seite 432 und 433:
- 432 - Bosch, Gerhard (1990): Qual
- Seite 434 und 435:
- 434 - Castells, Manuel (1996): Th
- Seite 436 und 437:
- 436 - Doeringer Peter B./ Piore,
- Seite 438 und 439:
- 438 - Esser, Hartmut (1985): Logi
- Seite 440 und 441:
- 440 - Geißler, Karlheinz A. (199
- Seite 442 und 443:
- 442 - Haisken-DeNew, John / Horn,
- Seite 444 und 445:
- 444 - Hutchison, Terence (1988):
- Seite 446 und 447:
- 446 - Konietzka, Dirk (1999a): Be
- Seite 448 und 449:
- 448 - Macneil, Ian R. (1978): Con
- Seite 450 und 451:
- 450 - Mutz, Gerd / Ludwig-Mayerho
- Seite 452 und 453:
- 452 - Parmentier, Klaus / Schreye
- Seite 454 und 455:
- 454 - Samuels, Warren J. (1995):
- Seite 456 und 457:
- 456 - Sennett, Richard (1998): De
- Seite 458 und 459:
- 458 - Tsui, Anne S. / Pearce, Jon
- Seite 460 und 461:
- 460 - Willke, Helmut (1989): Syst