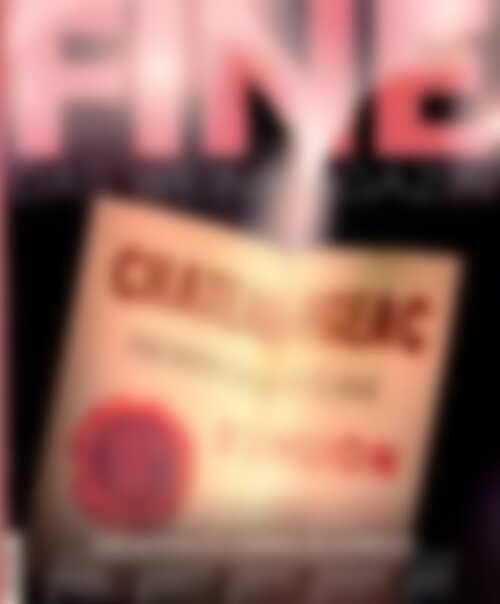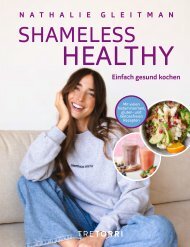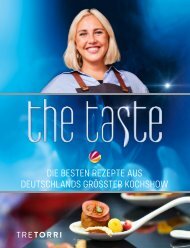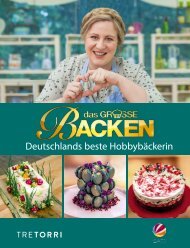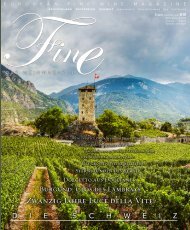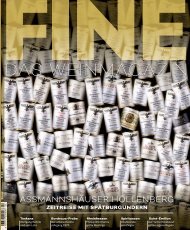FINE Das Weinmagazin 55. Ausgabe - 04/2021
Das Hauptthema dieser Ausgabe ist: BORDEAUX Château Figeac: Eine Legende im Aufbruch BORDEAUX Château Le Dôme: Mit dem Ufo aufs Kalkplateau BORDEAUX Château Beauséjour: Die Rückkehr der Erbin Weitere Themen dieser Ausgabe: CHARTA Die FINE-Weinbewertung RHEINHESSEN Hans Oliver Spanier: Glückskind und Visionär DAS GROSSE DUTZEND Ein König der Portweine: Fonseca Vintage Port KATALONIEN Familia Torres: Fünf Generationen Exzellenz KATALONIEN Umweltschutz bei Torres: Die grüne Revolution KATALONIEN Das filmreife Leben des Weinpioniers Jean Leon RIOJA Bodegas Campillo: Der Palast des Don Julio DIE PIGOTT-KOLUMNE Die Last des eigenen Erfolgs: Umdenken in Burgund TOSKANA Castello di Brolio: An der Wiege der Chianti-Formel WORTWECHSEL Warum der Terroir-Kult ein Missverständnis ist TASTING Große Reserven: Österreichs höchste Sektklasse GENIESSEN Fleischloses Fest mit edlen Weinen? Aber klar! CHAMPAGNE Die 100 wichtigsten Champagner, Teil 3 WEIN & SPEISEN Jürgen Dollase im »Alten Haferkasten« in Neu-Isenburg WEIN & ZEIT Hugh Johnson und das deutsche Weinwunder TASTING Ten Years After: Deutsche Rieslinge von 2011 PORTRÄT Hans Onstein: Kein Sammler, sondern ein Teiler PROVENCE Château Galoupet: Bio-Wende für den Rosé ABGANG Besinnung und Neuanfang 144 Seiten | zahlr. Farbfotos 24,5 × 29,5 cm | Magazin/Paperback € 15,00 (D) ISBN: 978-3-96033-115-5
Das Hauptthema dieser Ausgabe ist:
BORDEAUX Château Figeac: Eine Legende im Aufbruch
BORDEAUX Château Le Dôme: Mit dem Ufo aufs Kalkplateau
BORDEAUX Château Beauséjour: Die Rückkehr der Erbin
Weitere Themen dieser Ausgabe:
CHARTA Die FINE-Weinbewertung
RHEINHESSEN Hans Oliver Spanier: Glückskind und Visionär
DAS GROSSE DUTZEND Ein König der Portweine: Fonseca Vintage Port
KATALONIEN Familia Torres: Fünf Generationen Exzellenz
KATALONIEN Umweltschutz bei Torres: Die grüne Revolution
KATALONIEN Das filmreife Leben des Weinpioniers Jean Leon
RIOJA Bodegas Campillo: Der Palast des Don Julio
DIE PIGOTT-KOLUMNE Die Last des eigenen Erfolgs: Umdenken in Burgund
TOSKANA Castello di Brolio: An der Wiege der Chianti-Formel
WORTWECHSEL Warum der Terroir-Kult ein Missverständnis ist
TASTING Große Reserven: Österreichs höchste Sektklasse
GENIESSEN Fleischloses Fest mit edlen Weinen? Aber klar!
CHAMPAGNE Die 100 wichtigsten Champagner, Teil 3
WEIN & SPEISEN Jürgen Dollase im »Alten Haferkasten« in Neu-Isenburg
WEIN & ZEIT Hugh Johnson und das deutsche Weinwunder
TASTING Ten Years After: Deutsche Rieslinge von 2011
PORTRÄT Hans Onstein: Kein Sammler, sondern ein Teiler
PROVENCE Château Galoupet: Bio-Wende für den Rosé
ABGANG Besinnung und Neuanfang
144 Seiten | zahlr. Farbfotos
24,5 × 29,5 cm | Magazin/Paperback
€ 15,00 (D)
ISBN: 978-3-96033-115-5
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4| <strong>2021</strong> Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00 Benelux € 17,90<br />
4197772 515002 <strong>04</strong><br />
CHÂTEAU FIGEAC<br />
EINE BORDEAUX-LEGENDE IM AUFBRUCH<br />
Rheinhessen Castello di Brolio Familia Torres Große Reserven Öko-Rosé<br />
Der Aufstieg von An der Wiege Fünf Generationen Wie top ist Top-Sekt Neues aus<br />
Hans Oliver Spanier der Chianti-Formel Exzellenz aus Österreich? der Provence
<strong>FINE</strong><br />
CHÂTEAU LE DÔME 24<br />
CHÂTEAU BEAUSÉJOUR 32<br />
FÜNF GENERATIONEN TORRES 52<br />
UMWELTSCHUTZ BEI TORRES 60<br />
JEAN LEON 68<br />
HANS OLIVER SPANIER 38<br />
BODEGAS CAMPILLO 78 BARONE RICASOLI 90<br />
6 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> INHALT
DAS WEINMAGAZIN 4|<strong>2021</strong><br />
ÖSTERREICHS GROSSE RESERVEN 98<br />
WEIN & ZEIT: HUGH JOHNSON 122<br />
CHÂTEAU GALOUPET 136<br />
CHÂTEAU FIGEAC 14<br />
9 <strong>FINE</strong> EDITORIAL _________________ Unterwegs in Raum und Zeit<br />
11 <strong>FINE</strong> CHARTA ____________________ Die <strong>FINE</strong>-Weinbewertung<br />
14 <strong>FINE</strong> BORDEAUX _________________ Château Figeac: Eine Legende im Aufbruch<br />
24 <strong>FINE</strong> BORDEAUX _________________ Château Le Dôme: Mit dem Ufo aufs Kalkplateau<br />
32 <strong>FINE</strong> BORDEAUX _________________ Château Beauséjour: Die Rückkehr der Erbin<br />
38 <strong>FINE</strong> RHEINHESSEN _____________ Hans Oliver Spanier: Glückskind und Visionär<br />
48 <strong>FINE</strong> DAS GROSSE DUTZEND ___ Ein König der Portweine: Fonseca Vintage Port<br />
52 <strong>FINE</strong> KATALONIEN _______________ Familia Torres: Fünf Generationen Exzellenz<br />
60 <strong>FINE</strong> KATALONIEN _______________ Umweltschutz bei Torres: Die grüne Revolution<br />
68 <strong>FINE</strong> KATALONIEN _______________ <strong>Das</strong> filmreife Leben des Weinpioniers Jean Leon<br />
78 <strong>FINE</strong> RIOJA _______________________ Bodegas Campillo: Der Palast des Don Julio<br />
86 <strong>FINE</strong> DIE PIGOTT-KOLUMNE _____ Die Last des eigenen Erfolgs: Umdenken in Burgund<br />
90 <strong>FINE</strong> TOSKANA __________________ Castello di Brolio: An der Wiege der Chianti-Formel<br />
96 <strong>FINE</strong> WORTWECHSEL ____________ Warum der Terroir-Kult ein Missverständnis ist<br />
98 <strong>FINE</strong> TASTING ____________________ Große Reserven: Österreichs höchste Sektklasse<br />
106 <strong>FINE</strong> GENIESSEN ________________ Fleischloses Fest mit edlen Weinen? Aber klar!<br />
108 <strong>FINE</strong> CHAMPAGNE _______________ Die 100 wichtigsten Champagner, Teil 3<br />
114 <strong>FINE</strong> WEIN & SPEISEN ___________ Jürgen Dollase im »Alten Haferkasten« in Neu-Isenburg<br />
122 <strong>FINE</strong> WEIN & ZEIT ________________ Hugh Johnson und das deutsche Weinwunder<br />
128 <strong>FINE</strong> TASTING ____________________ Ten Years After: Deutsche Rieslinge von 2011<br />
134 <strong>FINE</strong> PORTRÄT ___________________ Hans Onstein: Kein Sammler, sondern ein Teiler<br />
136 <strong>FINE</strong> PROVENCE _________________ Château Galoupet: Bio-Wende für den Rosé<br />
146 <strong>FINE</strong> ABGANG ___________________ Besinnung und Neuanfang<br />
INHALT<br />
<strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 7
LIEBE LESERINNEN,<br />
LIEBE LESER,<br />
der Wert eines Netzwerks zeigt sich besonders in schwierigen Zeiten. <strong>FINE</strong> hat schon immer quer<br />
durch die Weinwelt gute Beziehungen gepflegt, und davon profitieren jetzt nicht zuletzt Sie, wenn<br />
Sie durch diese aktuelle <strong>Ausgabe</strong> blättern: Unseren Autoren und Fotografen haben sich in diesem<br />
Jahr die Tore von Châteaux geöffnet, die nicht nur für die üblichen Besucher, sondern auch für die<br />
meisten anderen Medien verschlossen geblieben wären. <strong>Das</strong> macht uns schon ein bisschen stolz,<br />
und wir danken den Betreibern herzlich für Vertrauen und Gastfreundschaft.<br />
Trotzdem – auch wir kommen im Augenblick weniger weit herum, als wir es gewohnt waren<br />
und als es hoffentlich bald wieder möglich sein wird. Zum Ausgleich gehen wir verstärkt in die Tiefe,<br />
betrachten einzelne Produzenten, Regionen und Entwicklungen gewissermaßen unter dem Vergrößerungsglas.<br />
Saint-Émilion zum Beispiel: Mit Reportagen aus gleich drei sehr verschiedenen<br />
Châteaux gibt Rainer Schäfer einen vielschichtigen Eindruck von dem Prozess der Erneuerung, den<br />
die legendäre Bordeaux-Appellation seit einiger Zeit durchlebt. Seine Schilderung des in jeder Hinsicht<br />
eindrucksvollen Faustino-Ablegers Bodegas Campillo in der Rioja Alavesa wiederum rundet<br />
das Porträt des Haupthauses im vorigen Heft ab.<br />
Anderswo in Spaniens Norden nimmt Stefan Pegatzky nun eine andere Größe von Weltrang<br />
unter die Lupe. Seit 150 Jahren trägt die Familie Torres im Penedès mit immer neuen Ideen Entscheidendes<br />
zum internationalen Ansehen des spanischen Weins bei – ihr Triumph bei der Wein-<br />
Olympiade 1979 war ein Schlüsselmoment für die gesamte Szene. Tatsächlich zieht Torres so weite<br />
Kreise, dass mit dem Blick auf fünf prägende Generationen, den Kampf gegen die Lasten des Klimawandels<br />
und das Gut Jean Leon samt seinem schillernden Gründer längst noch nicht alles erzählt<br />
ist: Fortsetzung folgt.<br />
Wie sich die Weinszene eines Landes in überschaubarer Zeit komplett umkrempeln kann,<br />
dafür ist auch unsere Heimat ein markantes Beispiel. Als vor einem halben Jahrhundert ein junger<br />
Engländer namens Hugh Johnson erstmals seinen »World Atlas of Wine« verfasste, ließ er aufhorchen,<br />
weil er Deutschland gleich an zweiter Stelle nach Frankreich nannte, die Rieslinge von<br />
Rhein und Mosel für ihre Subtilität rühmte und ihre wichtigsten Anbaugebiete in detaillierten<br />
Karten ausbreitete. Eine Wahrheit galt ihm freilich als unumstößlich: Deutsche Weine sind süß!<br />
Seither hat sich ereignet, was unser Autor Daniel Deckers in seinem historischen Panorama das<br />
»deutsche Weinwunder« nennt, und Johnson hat daran als kritischer Beobachter und Begleiter<br />
einen unschätzbaren Anteil. Wer weiß, wann und wie hiesige Winzer ohne sein frühes Lob das<br />
Selbstvertrauen für den Umbruch gefunden hätten, dessen Folgen wir heute genießen. Dann gäbe<br />
es womöglich weder die trockenen Rieslinge von Hans Oliver Spanier, mit dem sich Kristine Bäder<br />
für uns getroffen hat, noch das Heft, das Sie gerade in Händen halten.<br />
Vielleicht steht ein Umbruch dieses Ranges jetzt ja auch in der Provence an. Was dort auf<br />
Château Galoupet passiert, betrachten wir jedenfalls als eines der spannendsten Projekte unserer<br />
Zeit. Die junge Gutsmanagerin Jessica Julmy entwirft im Auftrag von LVMH einen radikalen Neuanfang,<br />
für den sie unter dem Aspekt von Niveau und Nachhaltigkeit jedes Detail überdenkt. So<br />
sollen Weine fürs ganze Jahr entstehen, die nicht bloß auf der Terrasse mit Blick aufs sommerliche<br />
Mittelmeer Vergnügen bereiten; das bringt hoffentlich auch die Macher der gängigen Industrie-Rosés<br />
ins Grübeln. Selbst ein gänzlich neues Flaschenmodell aus recyceltem Kunststoff wird da erprobt:<br />
leicht, rechteckig, stapelbar und so schlank, dass es durch einen Briefschlitz passt. In Letzterem<br />
lässt uns Nicole Miedings verheißungsvoller Bericht keinen Vorteil erkennen – wer, bitteschön, soll<br />
sich bei der versprochenen Qualität denn die Flaschen einzeln schicken lassen?<br />
Ihre Chefredaktion<br />
EDITORIAL <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 9
<strong>FINE</strong>AUTOREN<br />
KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rheinhessen freut sie sich über die positive Entwicklung ihrer<br />
Heimatregion, wo sie ein eigenes kleines Weinprojekt pflegt. Eine besondere Beziehung hat die studierte<br />
Germanistin und ehemalige Chefredakteurin des <strong>FINE</strong> <strong>Weinmagazin</strong>s zu den Weinen aus Portugal.<br />
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politikredakteur<br />
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« über Gott und die Welt zur Feder greift. An der Hochschule Geisenheim<br />
lehrt er Geschichte des Weinbaus und -handels. In seinem Buch »Wein. Geschichte und Genuss« beleuchtet er<br />
durch mehr als 3000 Jahre die Rolle dieses unschätzbaren Kulturguts als Spiegel der Zeitläufte.<br />
JÜRGEN DOLLASE hat sich schon als Rockmusiker und Maler verdingt, als Kritiker der kulinarischen Landschaft<br />
ist er heute eine feste Instanz. Viel beachtet sind seine Bücher über die Kunst des Speisens: Bei Tre Torri<br />
erschien zuletzt seine »Geschmacksschule«, das visionäre Kochbuch »Pur, präzise, sinnlich« widmet sich der<br />
Zukunft des Essens.<br />
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und gelernte Sommelière schreibt für die »Frankfurter Allgemeine<br />
Sonntagszeitung«, die Magazine »Efflee« und »Slow Food« sowie Bücher übers Essen und Trinken.<br />
Ihr Buch »China – Die Küche des Herrn Wu« (erschienen bei Tre Torri) liefert tiefe Einblicke in die vielfältige<br />
Kochkunst der Chinesen.<br />
SIGI HISS Tausende Tastings, und noch immer ist das Verkosten seine große Leidenschaft – sei es in internationalen<br />
Jurys, im Auftrag renommierter Weinpublikationen oder für Weingüter. Für alles außer Spirituosen<br />
ist er zu begeistern, seine besondere Liebe gilt gereiften Weinen.<br />
UWE KAUSS In Weinkellern kennt er sich aus: Der Autor und Journalist schreibt seit 20 Jahren über Wein,<br />
etwa für die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung«, das <strong>Weinmagazin</strong> »Enos«, »wein.pur«, das »Genuss-<br />
Magazin« in Wien sowie das Internetportal »wein-plus.eu«. Daneben hat er 16 Sach- und Kindersachbücher,<br />
einen Roman und zwei Theaterstücke publiziert.<br />
NICOLE MIEDING hat das Genießen in Schwaben gelernt, wo man sich durch die Leidenschaft für handgemachte<br />
Nudeln und Soßen kulinarisch nah an Italien fühlt. Ihre journalistische Karriere begann im Feuilleton,<br />
bis die Liebe zu gutem Essen, Wein und Reisen auch publizistisch die Oberhand gewann. Sie war mehr als zwei<br />
Jahrzehnte in wechselnden Rollen bei der »Rhein-Zeitung« tätig, zuletzt als Chefreporterin.<br />
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah, wie sich<br />
die Metropole von einer Bier- zur Weinstadt wandelte. Er schreibt regelmäßig über Wein und Genuss, steuerte<br />
zur Tre-Torri-Reihe »Beef!« den Band »Raw. Meisterstücke für Männer« bei und bereicherte die »Gourmet<br />
Edition – Kochlegenden« um Titel zu Hans Haas, Harald Wohlfahrt und Marc Haeberlin.<br />
STUART PIGOTT Seit der 1960 in London geborene studierte Kunsthistoriker und Maler im Wein – dem<br />
deutschen zumal – sein Lebensthema fand, hat er sich mit seiner unkonventionellen Betrachtungsweise in den Rang<br />
der weltweit geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.<br />
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und lebt seit 20 Jahren in Hamburg, wo er über die Dinge<br />
schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde Persönlichkeiten,<br />
überraschende Erlebnisse und unbekannte Genüsse.<br />
MICHAEL SCHMIDT Der »deutsche Engländer«, wie ihn die britische Weinszene nennt, schreibt für die<br />
»Purple Pages« der Weinpäpstin Jancis Robinson über deutschen Wein. Bei »Sotheby’s Wine Encyclopedia« und<br />
dem »World Atlas of Wine« von Hugh Johnson und Jancis Robinson ist er als Berater für das Kapitel Deutschland<br />
zuständig.<br />
DIRK WÜRTZ war Kellermeister und Betriebsleiter in den Rheingauer Weingütern Robert Weil und Balthasar<br />
Ress. 2018 wechselte der Pfälzer wieder einmal das Rheinufer, um geschäftsführender Gesellschafter des Weinguts<br />
St. Antony in Nierstein (Rheinhessen) zu werden. In der Beteiligungsgesellschaft Tocos verantwortet der<br />
Tausendsassa zudem die Sparte Wein, er zählt zu den Weinbloggern der ersten Stunde und hat die europaweit<br />
größte Weincommunity »Hauptsache Wein« auf Facebook initiiert.<br />
VERLEGER UND HERAUSGEBER<br />
Ralf Frenzel<br />
r.frenzel@fine-magazines.de<br />
CHEFREDAKTION<br />
info@fine-magazines.de<br />
ART DIRECTOR<br />
Guido Bittner<br />
TEXTREDAKTION<br />
Boris Hohmeyer,<br />
Katharina Harde-Tinnefeld<br />
AUTOREN DIESER AUSGABE<br />
Kristine Bäder, Daniel Deckers,<br />
Jürgen Dollase, Ursula Heinzelmann,<br />
Sigi Hiss, Uwe Kauss, Nicole Mieding,<br />
Stefan Pegatzky, Stuart Pigott,<br />
Rainer Schäfer, Michael Schmidt<br />
FOTOGRAFEN<br />
Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes<br />
Grau, Alex Habermehl, Christof Herdt,<br />
Arne Landwehr<br />
GRÜNDUNGSCHEFREDAKTEUR<br />
Thomas Schröder (2008–2020)<br />
VERLAG<br />
Tre Torri Verlag GmbH<br />
Sonnenberger Straße 43<br />
65191 Wiesbaden<br />
www.tretorri.de<br />
Geschäftsführer: Ralf Frenzel<br />
ANZEIGEN<br />
Judith Völkel<br />
+49 611-57 99.0<br />
j.voelkel@fine-magazines.de<br />
ABONNEMENT<br />
<strong>FINE</strong> <strong>Das</strong> <strong>Weinmagazin</strong> erscheint<br />
vierteljährlich zum Einzelheft-Preis<br />
von € 15,– (D), € 16,90 (A), € 18,50 (I)<br />
CHF 30,– (CH), € 17,90 (Benelux)<br />
Auskunft und Bestellungen<br />
unter Telefon +49 611-57 99.0<br />
oder per E-Mail an abo@tretorri.de<br />
DRUCK<br />
X-PRESS Grafik & Druck GmbH, Berlin<br />
VERTRIEB<br />
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH<br />
www.dpv.de<br />
Titelfoto: Château Figeac, GUIDO BITTNER<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht<br />
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der<br />
Verlag haftet nicht für unverlangt eingereichte<br />
Manuskripte, Dateien, Datenträger und Bilder.<br />
Alle in diesem Magazin veröffentlichten Artikel<br />
sind urheberrechtlich geschützt.<br />
10 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> IMPRESSUM
DIE <strong>FINE</strong>-<br />
VERKOSTUNGEN<br />
Referenztabelle des 100-Punkte-Systems von <strong>FINE</strong> zum britischen 20-Punkte-System<br />
50 60 70 80 85 90 96 100<br />
0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />
<strong>Das</strong> <strong>FINE</strong>-Verfahren<br />
• Wir glauben, dass der Geschmack zwar subjektiv ist, dass wir als<br />
erfahrene Verkoster und in kontrollierten Umgebungen aber dennoch<br />
gut begründete und klar formulierte Urteile über Wein geben können.<br />
• Als aufgeklärte Connaisseurs wissen wir, dass Punktebewertungen<br />
nicht objektiv sind, also keine reale »Substanz« im Wein bezeichnen.<br />
Sie sind aber auch nicht völlig subjektiv. In der <strong>FINE</strong> sind sie immer<br />
Ausdruck einer Wechselbeziehung von Wein und Verkoster. Deshalb<br />
veröffentlichen wir immer den Namen des jeweiligen Verkosters. Als<br />
neuer Leser werden Sie nach ein paar Heften die jeweiligen Unterschiede<br />
und Vorlieben unseres Teams einzuschätzen wissen.<br />
• <strong>FINE</strong> ist keine akademische Publikation, sondern will Freude am<br />
Weingenuss vermitteln. Deshalb fließen auch emotionale Elemente<br />
und stilistische Vorlieben mit ein, zudem schätzen wir den gelungenen<br />
sprachlichen Ausdruck. Besonders erkennen wir Weine an, die versuchen,<br />
ihren Ursprung zum Ausdruck zu bringen und naturnah oder<br />
gar biologisch erzeugt werden. Weltanschauliche Scheuklappen sind<br />
uns allerdings fremd. Auch deswegen verkosten wir, wenn die Situation<br />
es erlaubt, vorzugsweise blind.<br />
• Unsere Bewertungen sind nicht absolut, sondern spiegeln den Kontext<br />
einer jeden Verkostungssituation wider. Wenn wir in einer Vertikale<br />
von Château Petrus einen kleinen Jahrgang mit 92 Punkten und in einer<br />
anderen Situation einen Merlot aus der Maremma mit der gleichen<br />
Punktzahl bewerten, dann heißt das nicht, dass diese Werte gleichwertig<br />
sind. Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass Scoring<br />
und schriftlicher Kommentar nur gemeinsam ein Ganzes bilden.<br />
• Um die subjektive Sicht eines Einzeltesters zu ergänzen, bemühen wir<br />
uns, wenn es irgend geht, um das Urteil eines Verkostungspanels. Bei<br />
diesem Urteil wird bei jedem Wein die jeweils höchste und niedrigste<br />
Note gestrichen und ein Durchschnittswert gebildet. Dieses Urteil<br />
wird als Vergleichsergebnis des <strong>FINE</strong>-Panels (FP) notiert.<br />
• Wir erkennen an, dass sowohl der Wein als auch der Verkoster<br />
»lebendig« sind. Weine können von Flasche zu Flasche und von<br />
Woche zu Woche variieren. Verkoster haben unterschiedliche Tagesformen,<br />
Stärken oder Schwächen. Immer geht es uns um den Augenblick<br />
des Verkostens; Einschätzungen zum Potenzial fließen lediglich<br />
in den Begleittext ein, nicht in die Bewertung selbst.<br />
• Auch in <strong>FINE</strong> werden Sie wenige Weine mit einem niedrigen Scoring<br />
finden. <strong>Das</strong> hat nichts mit der Nivellierung von Grundsätzen zu tun,<br />
sondern weil wir um Ihre kostbare Zeit wissen und der Auffassung<br />
sind, dass jeder Wein, der in <strong>FINE</strong> vorgestellt wird, es auch wert sein<br />
muss. <strong>Das</strong> kann bei einem hinreißenden Müller-Thurgau aus Baden<br />
ebenso der Fall sein wie bei einem Amphorenwein aus Georgien.<br />
<strong>Das</strong> <strong>FINE</strong>-Punktesystem<br />
Mit Ausnahme von sehr alten Schatzkammerweinen, deren Zustand von<br />
Flasche zu Flasche variieren kann, werden alle von <strong>FINE</strong> verkosteten<br />
Weine nach Punkten bewertet. Diese Bewertung folgt der 100-Punkte-<br />
Skala. Ziel ist es, dem Leser ein tieferes Verständnis von der Qualität<br />
der durch <strong>FINE</strong> evaluierten Weine zu vermitteln sowie die Trinkbarkeit<br />
der Weine zu bewerten.<br />
Maßgeblich für die Punktezahl ist unser Eindruck vom Wein am<br />
Tag der Verkostung. <strong>FINE</strong> vergibt keine zusätzlichen Punkte für das<br />
zukünftige Potenzial des Weins. Eine Anmerkung darüber wird in den<br />
Verkostungsnotizen abgegeben. Wein wird blind, halb-blind und offen<br />
verkostet. Die entsprechende Methode findet sich in den Anmerkungen<br />
zur Verkostung.<br />
Wir konzentrieren uns auf die Beschreibung des Charakters und<br />
der Essenz des Weins: Säure, Frucht, Tannin, Struktur, Tiefe und Länge.<br />
Neben der Komplexität ist vor allem die Balance das entscheidende<br />
Kriterium für seine Qualität.<br />
Aufschlüsselung unserer Punkte<br />
100 Punkte Vollkommenheit. Ein perfekter Wein, der alle Sinne<br />
erfüllt, vollendet in allen Aspekten der Qualität – ein<br />
unschätzbares Geschenk der Natur.<br />
99–97 Punkte Ein beinahe perfektes Erlebnis. Der Wein und seine<br />
Geschichte sind einzigartig: unvergesslich makellose<br />
Harmonie, Komplexität und außergewöhnliche<br />
Persönlichkeit.<br />
96–94 Punkte Ein überragender Wein von höchstem Qualitätsanspruch<br />
und herausragender Ausgewogenheit.<br />
93–91 Punkte Ein exzellenter Wein, der einen verfeinerten Stil, eine<br />
ausgewogene Struktur und eine nuancierte Finesse<br />
aufweist.<br />
90–88 Punkte Ein guter Wein, nahezu exzellent. Harmonisch,<br />
lässt aber die Komplexität und den Charakter eines<br />
exzellenten Weines vermissen.<br />
87–80 Punkte Durchschnittlicher Wein mit weniger Charakter,<br />
Intensität, Struktur und Eleganz.<br />
79–70 Punkte Ein bescheidener und einfacher Wein, dem Leben<br />
und Harmonie fehlen.<br />
69–50 Punkte Ein beinahe untrinkbarer, leerer Wein.<br />
CHARTA<br />
<strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 11
MIT DEM UFO<br />
AUFS<br />
DER REBELLISCHE BRITE JONATHAN MALTUS HAT<br />
SICH AUS DER SANDIGEN EBENE VON SAINT-ÉMILION<br />
BUCHSTÄBLICH EMPORGEARBEITET: MIT SEINEM<br />
SPEKTAKULÄREN CHÂTEAU LE DÔME, ENTWORFEN<br />
VON SIR NORMAN FOSTER, RESIDIERT DER EINSTIGE<br />
GARAGENWINZER INMITTEN VON ALTEM WEINADEL<br />
Von RAINER SCHÄFER<br />
Fotos JOHANNES GRAU<br />
24 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> BORDEAUX
KALKPLATEAU<br />
Gerade abends, wenn die Dunkelheit sich über Saint-Émilion senkt und auf die<br />
Lichter von Le Dôme triff, entstehen besondere optische Reize. Dann, so hört<br />
man in der kleinen Stadt im Bordelais immer wieder, wirke das Château wie ein<br />
Ufo, das in der Ebene von Mazerat gelandet sei. Erst im Tageslicht lassen sich die<br />
Ausmaße und die raffnierten Details dieser außergewöhnlichen Konstruktion<br />
erfassen, die von keinem Geringeren als Sir Norman Foster entworfen wurde. Der<br />
Stararchitekt, dem auch der Berliner Reichstag seine Kuppel verdankt, ist bestens<br />
bekannt in Bordeaux, seit er den Keller von Château Margaux umgestaltet hat.<br />
Mitten in der Landschaft steht das kreisförmige Château<br />
Le Dôme mit dem gewölbten, 40 Meter breiten Holzdach<br />
und den Terrakottaziegeln, die das Äußere verkleiden.<br />
Zwei Rampen – eine führt von außen, eine im Inneren<br />
nach oben – ermöglichen es, verschiedene Phasen der Weinproduktion<br />
zu beobachten. Zwei Jahre dauerte der Bau des<br />
Weinguts, der schon im Frühjahr hätte beendet sein sollen,<br />
aber durch die Pandemie verzögert wurde.<br />
Le Dôme bezeichnet den Höhepunkt in der Karriere<br />
von Jonathan Maltus, der als Autodidakt und Garagenwinzer<br />
begonnen hat und sich mit diesem Château nach vielen Hindernissen<br />
und Umwegen endgültig in der Beletage der Appellation<br />
Saint-Émilion etabliert. In der Lobby hängt ein großformatiges<br />
Porträt des Hausherrn, auf dem er wie ein Supermann des<br />
Weins inszeniert wird, mit viel Glanz, Glitzer und optischen<br />
Effekten. Dann kommt der Selfmademan selber herein, der<br />
auch im wirklichen Leben eine gute Figur abgibt im dunklen<br />
Anzug mit Einstecktuch.<br />
Der in Nigeria geborene Brite brachte eine lange Odyssee<br />
durch verschiedene Länder hinter sich, bevor er in Saint-Émilion<br />
sesshaft wurde. Es ist die bewegte Geschichte eines unkonventionellen<br />
Abenteurers, der sich den Zugang in erlesene Kreise<br />
erarbeitet hat, die ihm normalerweise verschlossen geblieben<br />
wären. »Ganz ehrlich«, sagt Maltus, der sich als »Vigneron &<br />
Winemaker« bezeichnet, »es war für mich lange undenkbar,<br />
dass ich mal in diesem Weingut mit dieser vornehmen Nachbarschaft<br />
sitzen würde.«<br />
BORDEAUX<br />
<strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 25
Sieht so die Zukunft des Weinbaus aus?<br />
Zumindest drängt sich bei dem Château<br />
mit offenem Gärkeller und Rundum-<br />
Balkon das Schlagwort »futuristisch« auf<br />
Seine Jugend, erzählt Jonathan Maltus, war noch von<br />
der Politik der britischen Kolonialzeit bestimmt: Seine<br />
Eltern lernten sich in Indien kennen und siedelten dann<br />
nach Nigeria über, wo sie für eine englische Bank arbeiteten. Ihr<br />
Sohn wurde 1955 in der damaligen britischen Kolonie geboren,<br />
die erst 1960 ihre Unabhängigkeit erlangte. Als Kind wurde er<br />
auf ein Internat in England geschickt, seine Eltern hat er »nur<br />
zwei Mal im Jahr gesehen«.<br />
Nach dem Studium gründete Maltus ein bald florierendes<br />
Ingenieurbüro für Petrochemie. Er war ständig auf Achse,<br />
arbeitete in den Niederlanden, Monaco, Nigeria, England und<br />
Belgien. »Ich bin nicht sehr britisch«, sagt der viel gereiste<br />
Kosmopolit, der seine Gesellschaft 1992 verkaufte; da war er<br />
gerade einmal 36 Jahre alt. Kurz zuvor hatte er geheiratet und<br />
mietete zunächst für ein Jahr ein Haus in Cahors – »ich wusste<br />
noch nicht so recht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte«.<br />
»Ich wollte nicht leben<br />
wie ein englischer Gentleman«<br />
Auf einer Dinnerparty lernte er einen australischen Winzer<br />
kennen, »der ziemlich schüchtern war und auf seinem Wein<br />
sitzen blieb«. Die beiden schlossen sich zusammen: Maltus<br />
verkaufte den Wein, der Winzer wies ihn dafür 18 Monate<br />
lang in die Praxis der Weinbereitung ein. Danach stand für den<br />
eloquenten und schlagfertigen Geschäftsmann fest: »Ich wollte<br />
nicht leben wie ein englischer Gentleman, ich wollte selbst<br />
Wein machen.« Jonathan Maltus war hin- und hergerissen, ob<br />
er ein Weingut in Cahors übernehmen sollte, »aber Regionen<br />
wie Burgund und Bordeaux standen viel höher im Kurs«. Da<br />
er keine Schwäche für Pinot Noir habe, sei nur das Bordelais<br />
übrig geblieben. <strong>Das</strong> linke Ufer war zu teuer, in Außenbereiche<br />
wie die Côtes de Blaye wollte er nicht, »so kam ich nach Saint-<br />
Émilion ans rechte Ufer«.<br />
1994 kaufte Jonathan Maltus das renovierungsbedürftige<br />
Château Teyssier in Vignonet im südlichen Teil der Appellation<br />
mit fünfeinhalb Hektar Reben. Er investierte in Weinberge und<br />
Keller, war sich jedoch bewusst, dass er auf den sandigen Böden<br />
der Ebene keine preisgekrönten Grands Crus erzeugen konnte:<br />
»Ich wollte anständige Weine machen, die man kaufen konnte,<br />
ohne dafür eine Bank sprengen zu müssen.«<br />
Aber der Start als Winzer verlief mühsam: »Alle Châteaux<br />
hatten 400 Jahre Tradition, alle kannten sich, nur ich war außen<br />
vor.« Seine Kinder gingen im Städtchen Saint-Émilion zur<br />
Schule, wo sich die anderen Eltern morgens mit Küsschen links<br />
und rechts begrüßten, »bloß ich bekam keine ab«. Als Maltus<br />
seinen Kellermeister fragte, woran das liege, antwortete der:<br />
»Du bist im falschen Teil von Saint-Émilion, darum gehörst<br />
du nicht dazu.« Nur wer auf dem Kalkplateau und an den<br />
Hängen unterhalb der Stadt begütert ist, zählt zur Kaste der<br />
Châteaux, die als Premier Grand Cru Classé und Grand Cru<br />
26 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> BORDEAUX
Classé eingestuft sind. Maltus begriff, dass er auch »Weinberge<br />
im richtigen Teil von Saint-Émilion« erwerben musste, um als<br />
Winzer anerkannt zu werden.<br />
So zögerte er nicht, als sich 1996 die Gelegenheit bot, dreieinhalb<br />
Hektar Reben von den Brüdern Gouteyron zu übernehmen,<br />
die Vieux Château Mazerat im Mazerat-Tal führten.<br />
Damit befand er sich endlich in bester Gesellschaft: Eine Seite<br />
der Parzelle grenzt an Weinberge von Château Canon, die andere<br />
an das Areal von Château Angélus. Die Rebstöcke stehen auf<br />
kalkhaltigem Lehm mit Sand und auch einem Anteil Eisen.<br />
»Ich musste mein Haus in Chelsea verkaufen, um das Stück<br />
Land zu bekommen«, fügt Maltus lakonisch an.<br />
Ein vermeintlicher Fehlkauf<br />
erwies sich als Glücksfall<br />
Die Freude über den »big deal« wurde schnell getrübt: Der<br />
Brite war überzeugt, einen Weinberg mit Merlot gekauft zu<br />
haben – es war Winter, und die Reben trugen keine Blätter,<br />
an denen sie leichter zu erkennen gewesen wären. Erst nach<br />
sechs Wochen stellte er fest, dass er hauptsächlich Cabernet<br />
Franc erstanden hatte; nur ein kleiner Teil des Weinbergs ist<br />
mit Merlot-Reben bepflanzt. »Ich dachte erst, ich hätte es völlig<br />
vermasselt «, erzählt Maltus, der mit kraftvollen und holzwürzigen<br />
Weinen den amerikanischen Markt erobern wollte:<br />
»Merlot wäre für diesen Weintyp prädestiniert gewesen, aber<br />
ich hatte nun eine ganze Menge Cabernet.«<br />
Zur selben Zeit formierten sich in Saint-Émilion die<br />
»Garagisten«, die nur winzige Parzellen bewirtschafteten und<br />
Wein in so geringen Mengen erzeugten, dass sie dafür nicht<br />
mehr Platz als den einer Garage brauchten. Niedrige Erträge,<br />
kleine Produktion, viel Kraft und viel neues Holz, so lautete<br />
die Formel für die sogenannten Garagenweine, die gerade in<br />
den USA Begehrlichkeiten weckten und vom einflussreichsten<br />
Kritiker Robert Parker Bestnoten bekamen. An die Spitze der<br />
Bewegung setzte sich Jean-Luc Thunevin mit seinem Château<br />
Valandraud; Stéphane Derenoncourt und Jonthan Maltus waren<br />
mittendrin. Auch Jacques Thienpont wurde zu der Bewegung<br />
gezählt, der mit Le Pin den ersten Garagenwein in Bordeaux<br />
aufgelegt hatte. »Ich habe ihn bewundert«, gesteht Maltus,<br />
»er war den anderen um zehn Jahre voraus.«<br />
Saint-Émilion galt plötzlich als einer der aufregendsten Orte<br />
der Weinwelt – und Maltus war der Winzer, der den größten<br />
Jonathan Maltus<br />
ist als Winzer<br />
Autodidakt. Ehe<br />
er diese Passion<br />
entdeckte, war<br />
er als Ingenieur<br />
im Dienste der<br />
Ölindustrie durch<br />
die Welt gereist<br />
BORDEAUX<br />
<strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 27
GLÜCKSKIND<br />
UND VISIONÄR<br />
VOR DREI JAHRZEHNTEN BEKAM HANS OLIVER SPANIER<br />
EIN KOSTBARES GESCHENK: EIN STEILES STÜCK LAND<br />
AM FRAUENBERG IM ZELLERTAL. AUCH DANK DIESER<br />
LAGE IST ER HEUTE MIT DEN RHEINHESSISCHEN GÜTERN<br />
BATTENFELD-SPANIER UND KÜHLING-GILLOT GANZ<br />
VORN DABEI, WENN ES GILT, TROCKENE RIESLINGE AUF<br />
DIE GROSSEN WEINKARTEN DER WELT ZU BRINGEN<br />
Von KRISTINE BÄDER<br />
Fotos RUI CAMILO<br />
38 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> RHEINHESSEN
RHEINHESSEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 39
Ein Gespräch mit Hans Oliver Spanier dreht sich selten nur um Wein, um Lagen, Böden,<br />
Weinstile. Es passiert schnell, dass man über ganz andere Inhalte spricht, über den Fleiß,<br />
der notwendig ist, um Erfolg zu haben, über »Borniertheit« – ein Wort, das er oft und gern<br />
verwendet –, die große Betriebe innerhalb einer Generation ihre Existenzberechtigung<br />
kostet, über Mangel an Leistungsbereitschaft, die man im Sport beobachtet und die in<br />
der Gesellschaft immer mehr verloren zu gehen scheint. Und doch landet man über diese<br />
kleinen Ausflüge immer wieder bei dem Thema, das seit mehr als 30 Jahren Spaniers Leben<br />
bestimmt. Kaum ein deutscher Winzer kann ähnlich druckreif über Wein sprechen, mit<br />
ausdrucksstarken Bildern und mächtigen Worten, wie der Mann aus dem rheinhessischen<br />
Hohen-Sülzen, der dabei in Momenten der Kritik immer haarscharf an der Grenze zur<br />
Provokation vorbeigeht.<br />
Nach einem herausfordernden Jahr, in dem<br />
das Wetter den Winzern alles abverlangte,<br />
wenn sie gesunde und aromatische Trauben<br />
ernten wollten, ist Hans Oliver Spanier optimistisch.<br />
Der Herbst spendet den Reben noch ein paar versöhnliche<br />
Sonnentage. »Wenn das Wetter nun noch<br />
ein wenig mitspielt«, meint Spanier, »wird das doch<br />
ein guter Jahrgang. Die Säurewerte sind top.« Smart<br />
in dunklen Hosen, weißem Hemd und enger Weste<br />
kommt er im Elektrocaddy angefahren und wird<br />
dem Ruf gerecht, der ihm und seiner Frau Carolin<br />
vom Weingut Kühling-Gillot vorauseilt: zwei Güter,<br />
die für große Weine stehen, und ein Winzer-Ehepaar,<br />
das bewusst Lifestyle verkörpert.<br />
Am Rand des malerischen Dorfes im südlichen<br />
Rheinhessen steht der dunkelgrau gestrichene große<br />
Keller an der Straße wie eine Trutzburg, die neugierige<br />
Blicke der Vorbeifahrenden abhält. »<strong>Das</strong><br />
Areal haben wir 20<strong>04</strong> gekauft«, erzählt Spanier, »da<br />
stand hier nur eine Scheune.« Der Gang durch den<br />
40 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> RHEINHESSEN
über die Jahre immer weiter vergrößerten Keller<br />
wirkt unspektakulär: schlicht und funktional, fast<br />
ein wenig steril, der Rotweinbereich noch gähnend<br />
leer. »<strong>Das</strong> bleibt auch überschaubar«, sagt Spanier,<br />
»grundsätzlich produzieren wir eben mehr Riesling.<br />
Spätburgunder gibt es nur als Ortswein aus<br />
Ersten Lagen und als GG, viel mehr soll das gar nicht<br />
werden.« Seine Vorstellung von dieser Rebsorte<br />
ist präzise und orientiert sich an der Spitze. »Spätburgunder<br />
braucht große Lagen, und da sind die<br />
Herkünfte bei uns eben rar«, sagt Spanier, für den<br />
Burgunder Tiefe haben und fleischig sein müssen.<br />
Schon als Kind war dem späteren Selfmademan<br />
klar, dass er mal in die Landwirtschaft wollte:<br />
»Ich habe das geliebt, mit dem Opa draußen zu sein,<br />
den Geruch des Traktors, des Bodens, das habe ich<br />
genossen.« Trotzdem sahen die Eltern nach der<br />
Hauptschule für den Sohn Betriebswirtschaft vor<br />
und schickten ihn zur Handelsschule. »Im ersten<br />
Zeugnis kam mein großes Erwachen«, erinnert er<br />
sich, »nur Vieren, Fünfen, Sechsen. Am nächsten<br />
Morgen bin ich zwar mit dem Mofa losgefahren, aber<br />
nicht mehr in der Schule angekommen.«<br />
Klare Ansage: »Ich brauche eine<br />
Lehrstelle als Winzer. Jetzt!«<br />
Stattdessen wurde er direkt bei der Landwirtschaftskammer<br />
in Alzey vorstellig mit den Worten: »Ich<br />
brauche eine Lehrstelle als Winzer. Jetzt!« Zwei<br />
Anrufe und einen Besuch im künftigen Lehrbetrieb<br />
später machte er sich mit einem unterschriebenen<br />
Ausbildungsvertrag auf den Heimweg, um den Eltern<br />
zu erklären, dass es mit der Betriebswirtschaft nichts<br />
werden würde. »<strong>Das</strong> war damals eine gewagte Entscheidung«,<br />
erkennt er im Rückblick, »Rheinhessen<br />
war 1985 im Tal der Depression, ohne Fantasie, ohne<br />
Vision.« Aber als Radfahrer hatte er gelernt zu beißen,<br />
dranzubleiben, Grenzen auszuloten. Den Gedanken<br />
an eine Karriere als Profisportler hatte er immerhin<br />
auch einmal.<br />
Vier Dinge waren für den Winzer Hans Oliver<br />
Spanier von Beginn an klar – dass er Riesling<br />
machen wollte, dass der bio sein musste, dass Herkunft<br />
wichtig war und dass die Weine trocken sein<br />
sollten: »Wenn man international von großen Rieslingen<br />
reden will, so wie von großen Burgundern,<br />
dann müssen die auch trocken sein, da gibt es keinen<br />
Kompromiss.« Unter drei Gramm Restzucker lässt<br />
er seine Weine gären. Die Großen Gewächse, alle<br />
spontan vergoren, lagern deshalb in den gebrauchten<br />
Stückfässern im Keller, »das ist eine ganz andere<br />
Spontanvergärung als im Edelstahl«.<br />
Gerade das Thema Herkunft schien damals weit<br />
weg: »Die Welt wollte davon nichts wissen und<br />
Deutschland schon mal gar nicht.« 1990 bot ihm<br />
ein Winzer den Weinberg in der Lage Frauenberg<br />
im Zellertal als Geschenk an. »Die Lage ist steil, mit<br />
Terrassen und Treppen, das war kompliziert, das<br />
wollte damals niemand haben.« Spanier zögerte<br />
dennoch nicht lang. Der Winzer nahm ihm das<br />
RHEINHESSEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 41
EINE KARRIERE<br />
WIE IM FILM<br />
68 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> KATALONIEN
Seit 2010 führt Mireia Torres<br />
Maczassek Regie beim Weingut<br />
Jean Leon. Sie knüpft an die<br />
Domänen- und Lagenphilosophie<br />
des Gründers an und macht sein<br />
Erbe zukunftssicher<br />
DIE QUALITÄTSREVOLUTION DES SPANISCHEN WEINBAUS BEGANN MIT<br />
EINEM EMIGRANTEN, DER IN HOLLYWOOD DURCH EIN ITALIENISCHES<br />
RESTAURANT BERÜHMT WURDE UND IN KATALONIEN DIE ERSTEN WEINE<br />
AUS FRANZÖSISCHEN REBSORTEN KELTERTE: DIE GESCHICHTE VON<br />
JEAN LEON, DESSEN GUT SEIT 1994 DER FAMILIE TORRES GEHÖRT, ZÄHLT<br />
ZU DEN SPEKTAKULÄRSTEN ÜBERHAUPT IN DER WELT DES WEINS<br />
Von STEFAN PEGATZKY<br />
Fotos JOHANNES GRAU<br />
KATALONIEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 69
<strong>Das</strong> Weingut Jean Leon verströmt mehr als nur einen Hauch von Kalifornien: ein<br />
Besucherzentrum, das mit seiner bungalowartigen Architektur und dem gewellten<br />
Dach an das berühmte »Wave House« von 1955 in Palm Desert erinnert, ein<br />
Mercedes Cabrio mit Nummernschild aus dem »Golden State« in der Auffahrt,<br />
Regiestühle mit Filmklappen im Innern neben lebensgroßen Aufstellern von<br />
Frank Sinatra, Paul Newman und Marilyn Monroe. Zugleich hat das Anwesen<br />
mit seiner kleinen Kunstgalerie, den historischen Vitrinen und dem Shop am<br />
Ausgang etwas von einem Museum. »Jean Leon: a Man, a Time, a Wine«, lautet<br />
das Leitmotiv der Inszenierung, und es macht klar: Nur wer den Menschen Jean<br />
Leon und dessen Zeit versteht, versteht auch Jean Leon, den Wein.<br />
Rückblende, ein Abend im Sommer 19<strong>55.</strong> In der »Villa<br />
Capri«, einem der angesagtesten Restaurants von Los<br />
Angeles, sprachen – so erzählt es jedenfalls Martí Gironell<br />
in der preisgekrönten dokumentarischen Romanbiografie »Stars<br />
in His Eyes« – die drei Freunde Jean, Jimmy und Ronnie über<br />
ihre Träume. Jimmy, mit 24 der jüngste von ihnen, stand vor<br />
den Dreharbeiten seines dritten Films, wollte aber mit dem zwei<br />
Jahre älteren Jean in Kürze auch ein gemeinsames Restaurant<br />
aufmachen. Der wiederum sprach schon davon, eines Tages<br />
seinen eigenen Wein zu produzieren. Für Ronnie, mit 44 Jahren<br />
der Senior der drei und ein landesweit bekannter Fernsehmoderator,<br />
war beides bereits ausgemacht: »Klare Sache, Jean!<br />
Für dich der große Wein, für Jimmy eine erfolgreiche Karriere<br />
und für mich … Mensch, vielleicht werde ich einmal Präsident<br />
der Vereinigten Staaten … Aber eins verspreche ich dir, Jean:<br />
Wenn unsere Träume wahr werden, stoßen wir auf unseren<br />
Erfolg mit deinem Wein an.« Wenige Wochen später sollte<br />
James Dean am Steuer seines Porsche bei einem Unfall sterben,<br />
aber am 20. Januar 1981 hielt Ronald Reagan sein Versprechen,<br />
als er zum Abendessen seiner Amtseinführung im Weißen Haus<br />
1980er Chardonnay und 1975er Cabernet Sauvignon von Jean<br />
Leon servieren ließ.<br />
Vom Tellerwäscher zum Millionär:<br />
Hier stimmt das Klischee wirklich<br />
Diese Ehrung machte Jean Leon endgültig zur Verkörperung<br />
des amerikanischen Traums. Denn vor seiner Zeit als »König<br />
von Beverly Hills«, wie Sebastián Moreno seine Leon-Biografie<br />
betitelt hat, als Weingutsbesitzer und einer der meistgefeierten<br />
Gastronomen der Welt, war er buchstäblich den Weg vom<br />
Tellerwäscher zum Millionär gegangen.<br />
Ángel Ceferino Carrión Madrazo, wie Jean Leon ursprünglich<br />
hieß, war mit seiner elfköpfigen Familie 1941 nach einem<br />
Großbrand aus dem nordspanischen Santander nach Barcelona<br />
gezogen; noch im selben Jahr verlor er seinen Vater und den<br />
älteren Bruder. Sechs Jahre später verließ der 19-Jährige das<br />
graue, perspektivlose Spanien des Diktators Franco, ohne der<br />
Familie Lebewohl zu sagen, und machte sich zu Fuß über die<br />
Pyrenäen nach Frankreich auf. Nach zahlreichen Versuchen,<br />
Amerika zu erreichen, gelang ihm 1949 von Le Havre aus die<br />
Überfahrt. In New York half er zunächst im Lokal eines Onkels<br />
in der Bronx aus, erwarb eine Taxifahrer-Lizenz (unter deren<br />
Nummer 3055 heute die Basisweine von Jean Leon vermarktet<br />
werden) und nahm den Namen Justo Ramón Léon an. Fasziniert<br />
vom Kino – und wohl auch als Flucht vor dem drohenden Wehrdienst<br />
– kaufte er sich im Dezember 1949 ein One-Way-Ticket<br />
und setzte sich in den Bus nach Los Angeles.<br />
Die folgenden Jahre, von 1950 bis 1962, tragen die Züge<br />
eines modernen Märchens, durchzogen von Motiven eines<br />
Film noir. Dabei stand am Beginn dieses Abschnitts zunächst<br />
ein Scheitern: das als Schauspieler. Immerhin wurde der junge<br />
Mann, nun unter dem Namen Jean Leon, Teil einer Clique,<br />
deren Mitglieder alle zu Stars werden sollten – Natalie Wood,<br />
Dennis Hopper und vor allem James Dean, bald sein engster<br />
Freund. Zur gleichen Zeit ergatterte er einen Kellnerjob im<br />
Hollywood-Hotspot »Villa Capri«, der seinem Idol Frank Sinatra<br />
70 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> KATALONIEN
gehörte – wie er das schaffe, darüber gibt es, wie über manche<br />
Episoden im Leben von Jean Leon, unterschiedliche Versionen.<br />
Sicher ist, dass er im November 1954 Sinatra und der Baseball-<br />
Legende Joe DiMaggio ein falsches Alibi gab, um sie vor einer<br />
Gefängnis strafe zu bewahren. Von da an gehörte Leon zum<br />
inneren Kreis von Frank Sinatra, um den sich Stars, Politiker<br />
und Mafiosi scharten wie die sprichwörtlichen Motten ums Licht.<br />
Zu Sinatras nicht geringem Verdruss machte sich Jean Leon<br />
trotz des Unfalltodes seines Freundes James Dean selbstständig.<br />
Am 1. April 1956 eröffnete er das Restaurant »La Scala« am<br />
Santa Monica Boulevard in Beverly Hills, nahe der Luxusmeile<br />
Rodeo Drive – mit feinem Gespür für den Zeitgeist, denn in<br />
diesen Jahren sollte sich das gesellschaftliche Leben der Filmfabrik<br />
von ihrem historischen Zentrum um den Hollywood<br />
Boulevard Richtung Westen verlagern. Auch die vom (aus<br />
Galicien stammenden) Küchenchef Emilio Nuñez mit Hingabe<br />
gepflegte italienische Küche traf den Nerv der Zeit: Es<br />
war das erste Restaurant in Los Angeles mit hausgemachten<br />
Nudeln, das Olivenöl stammte aus Ligurien, der Büffelmozzarella<br />
wurde mit Scandinavian Air eingeflogen. Die italienische<br />
Regierung sollte das Restaurant später als »besten Botschafter<br />
der italienischen Küche in den USA« auszeichnen.<br />
privaten, absolut diskreten Rückzugsort mit Fotografieverbot.<br />
Kein Wunder, dass John F. Kennedy das Lokal als Basis für<br />
seine Aufenthalte in Los Angeles nutzte und fünf weitere US-<br />
Präsidenten im »La Scala« dinierten. Längst war Jean Leon<br />
selbst berühmt und galt als »Star der Stars«. Doch trotz der<br />
unzähligen Anekdoten um ihn: Schweigen war sein wichtigstes<br />
Kapital. Erst 2002 sollte etwa enthüllt werden, dass Leon am<br />
späten Abend des 4. August 1962 das Essen für Marilyn Monroe<br />
gebracht und sie in ihrer Todesnacht mit Robert Kennedy<br />
angetroffen hatte.<br />
Mit der Monroe starb zugleich das klassische Hollywood –<br />
und wieder hatte Jean Leon das Bedürfnis, etwas Neues anzufangen.<br />
1962 lud ihn seine enge Freundin Elizabeth Taylor zu den<br />
letzten Dreharbeiten für »Cleopatra« in der römischen Cinecittà<br />
ein. Leon nutzte die Europareise nicht nur, um Liz Taylor<br />
zu treffen und seiner Frau, die wie fast alle in seiner Umgebung<br />
glaubte, er sei Franzose, seine spanische Herkunft zu gestehen,<br />
Bei Leon gab’s Tony-Curtis-Wurst<br />
und Dean-Martin-Hähnchen<br />
Seinen enormen Erfolg verdankte das »La Scala« aber nicht<br />
nur dem Essen. Vom Tag seiner Gründung an war es ein In-<br />
Lokal von Hollywood mit Stammgästen wie Warren Beatty, Paul<br />
Newman, Marlon Brando oder Zsa Zsa Gabor, nach denen Jean<br />
Leon viele Gerichte auf seiner Karte benannte, etwa »Pollo<br />
à la Dean Martin« oder »Italian Sausage Tony Curtis«. In<br />
einer Zeit, zu der Restaurantbesitzer Bestechungsgeld von<br />
Journalisten erhielten, wenn sie ihnen Insidergeschichten über<br />
Hollywoodstars lieferten, schuf Jean Leon für diese einen halb<br />
KATALONIEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 71
WIE GROSS SIND<br />
DIE GROSSEN<br />
RESERVEN?<br />
DER ÖSTERREICHISCHE SEKTVERBAND SIEHT SICH AUF<br />
AUGENHÖHE MIT DER CHAMPAGNE. WIR WOLLTEN WISSEN,<br />
OB SICH DIE WINZER DORT SCHON SORGEN MÜSSEN<br />
Von SIGI HISS<br />
98 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> TASTING<br />
Fotos GUIDO BITTNER
Schaumweine aus nicht klassischen Regionen<br />
drängen zunehmend in die erste Reihe und<br />
machen den Leitbildern der Champagne, der<br />
Franciacorta oder des Penedès Konkurrenz – zwar<br />
noch behutsam, aber immerhin. In Österreich gibt<br />
es seit 2015 mit der Einführung einer dreistufigen<br />
Qualitätspyramide für Sekte ernsthafte Ansätze, der<br />
175 Jahre alten Schaumweintradition sinnvolle und<br />
logische Rahmenbedingungen für einen Aufstieg<br />
in die erste Riege an die Hand zu geben. Passende<br />
Terroirs und das grundlegende Fachwissen sind vorhanden,<br />
es fehlt allerdings an Tradition und entsprechend<br />
an Erfahrung. Noch viel zu oft läuft die<br />
Sektproduktion in den Weingütern nebenbei mit und<br />
wird nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit und<br />
Konsequenz verfolgt wie der Ausbau von Stillweinen.<br />
Unter dem Label »Österreichischer Sekt<br />
mit geschützter Ursprungsbezeichnung«, kurz<br />
»Sekt g.U.«, sind die maßgeblichen Stellschrauben<br />
für die Qualität definiert, etwa Hefelager, Dosage,<br />
der früheste Zeitpunkt der Vermarktung und die<br />
Menge an Saft, die aus den Trauben gepresst wird.<br />
Sekte der Basiskategorie Klassik müssen mindestens<br />
neun Monate auf der Hefe lagern und dürfen erst<br />
zwölf Monate nach der Ernte verkauft werden. Alle<br />
Dosagen und Herstellungsweisen sind erlaubt, also<br />
neben der traditionellen Flaschengärung auch das<br />
Transvasier-Verfahren (Trennen von der Hefe durch<br />
Filtration) sowie die Charmat-Methode (Tankgärung).<br />
Auch Jahrgangssekte darf es in dieser Kategorie<br />
geben, allerdings keine engere Herkunftsbezeichnung.<br />
Die Vorgaben für die zweite Stufe unter der<br />
Bezeichnung Reserve fallen deutlich strenger aus:<br />
Handlese, Ganztraubenpressung mit maximal 60 Prozent<br />
Saftausbeute, traditionelle Flaschengärung,<br />
18 Monate Hefelager und 24 Monate Sperrfrist bis<br />
zum Verkauf sollen einen deutlichen Qualitätsunterschied<br />
zum Einstiegssegment definieren. Zudem<br />
TASTING <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 99
JÜRGEN DOLLASE<br />
HIER SCHENKT<br />
DER CHEF<br />
SELBST AUS<br />
JÜRGEN DOLLASE ISST BEI FRANCESCO PUGLIESE<br />
IM »ALTEN HAFERKASTEN« IN NEU-ISENBURG<br />
Fotos GUIDO BITTNER<br />
Wenn wir für diese Kolumne ein Lokal<br />
besuchen, das in keinem Restaurantführer<br />
verzeichnet ist, haben wir unsere Gründe.<br />
Es gibt sie eben noch, diese Adressen, die in ihrer<br />
Region keineswegs Geheimtipps sind, sondern sich<br />
»einer großen Popularität erfreuen« und trotzdem<br />
durchs Bewertungsraster der Guides fallen. Der<br />
Grund ist deren bekannte Unsicherheit bei der<br />
Beurteilung regionaler Küchen (und einer ganzen<br />
Reihe von Länderküchen). Gerade dann, wenn<br />
diese Küchen sich ein hohes Maß an Authentizität<br />
bewahrt haben und sich kaum an aktuellen Feinschmeckermoden<br />
orientieren, wird ihre Qualität oft<br />
nicht sinnvoll eingeordnet. Dabei haben die Weinfreunde<br />
die Zusammenhänge längst erkannt und<br />
gehen oft ihre eigenen Wege. Es gibt eine ganze Reihe<br />
von Restaurants mit großartigen Weinsammlungen,<br />
in denen die Gastronomen entsprechend denken<br />
und handeln und dabei selten so formell organisiert<br />
sind, wie dies bei vielen Spitzenrestaurants der Fall<br />
ist. Soll es entspannt zugehen, ist die Kombination<br />
von guten Weinen und einem Essen, das eine ähnliche<br />
emotionale Ladung wie der Wein hat, für viele<br />
Gäste unübertroffen. In dieser Folge sind wir daher im<br />
»Alten Haferkasten« in Neu-Isenburg bei Frankfurt,<br />
einem italienischen Restaurant, das 1960 eröffnet<br />
wurde und seit 1986 im Besitz der selben Familie ist.<br />
Der amtierende Chef des »Alten Haferkasten«,<br />
FRANCESCO PUGLIESE, ist in Personalunion<br />
Inhaber, Chefkoch und Sommelier. In der Praxis<br />
jongliert er souverän zwischen dem Empfang seiner<br />
vielen Stammgäste, der Küche und der Weinberatung<br />
unterwegs. Unabhängig vom Weinangebot des Hauses<br />
lohnt es sich hier immer, nach weiteren Spezialitäten<br />
und Qualitäten zu fragen, denn der Keller des Hauses<br />
bietet eine Menge Möglichkeiten. Der 1977 geborene<br />
Koch ist im Restaurant seines Vaters Saverio groß<br />
geworden. Mit zwölf Jahren kochte er seine ersten<br />
Spaghetti Vongole, fuhr mit zum Fischmarkt und in<br />
die alte Frankfurter Großmarkthalle. Mit 14 Jahren<br />
stand seine Berufswahl fest, er begann Kochbücher<br />
und Rezepte zu studieren. Nach dem Abitur machte<br />
Pugliese längere Praktika im Restaurant »Weidemann«<br />
in Frankfurt und im »Hostal de La Gavina«<br />
in S’Agarò in Katalonien. Weil im elterlichen Betrieb<br />
Personalmangel herrschte (und übrigens trotz der<br />
Zusage für eine Stelle in der Brigade von Ferran<br />
Adriàs »El Bulli«), kehrte er im Jahr 2001 in den<br />
»Alten Haferkasten« zurück, absolvierte dort seine<br />
Ausbildung und übernahm 2005 die Küchenleitung.<br />
Seit 2007 ist er Inhaber des Restaurants, das auch<br />
dadurch auffällt, dass hier das Team in Küche und<br />
Service schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet.<br />
Der Wein ist die Passion des Hausherrn. Auf der Karte<br />
stehen neben italienischen auch große französische<br />
Weine im Mittelpunkt, zudem pflegt der Wirt enge<br />
Verbindungen zu einigen deutschen Erzeugern.<br />
114 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> WEIN & SPEISEN
WEIN & SPEISEN<br />
WEIN & SPEISEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 115
JÜRGEN DOLLASE<br />
Getrüffeltes Rindercarpaccio mit Rührei<br />
Dieses Carpaccio ist keines der üblichen. Oft<br />
wird dieses Gericht von Olivenöl und Pinienkernen<br />
dominiert, während man das zu dünn aufgeschnittene<br />
Fleisch meist gar nicht mehr schmeckt.<br />
Francesco Pugliese hat sein Carpaccio purifiziert, um<br />
einen wirksamen Dreiklang – Fleisch, Ei, Trüffel –<br />
zu erreichen. Für die richtige Balance sorgen eine<br />
gute Menge gut wirksamer Trüffelscheiben und<br />
ein mild gewürztes Rührei, das nicht zu fest ist. <strong>Das</strong><br />
Ergebnis bringt einen glasklaren und durchgehend<br />
stabilen Akkord.<br />
WEIN 1 Ein 2019er Chardonnay Il Marzocco,<br />
Toscana vom Weingut Avignonesi in Valiano di<br />
Montepulciano. Der Wein wurde mit einer Temperatur<br />
von 13 Grad bei einer Raumtemperatur von<br />
23 Grad serviert. Im »Alten Haferkasten« werden<br />
vor allem die komplexeren Weißweine kühl, aber<br />
nicht kalt kredenzt. Dieser Klassiker, den Francesco<br />
Puglieses Vater schon vor 30 Jahren zum Carpaccio<br />
eingesetzt hat, besitzt die typische Nase vieler guter<br />
italienischer Weißweine mit einem kompakten,<br />
weinigen Spektrum ohne spezifische Fruchtnoten.<br />
Am Gaumen schmeckt er elegant, mittig, mit später<br />
leicht herben Kräuternoten. Zum Carpaccio hat man<br />
schon in der Nase das Gefühl, dass Wein und Essen<br />
zusammengehören. Der Wein wird geradezu samtig,<br />
hat eine milde Ansprache, verzahnt sich dann elegant<br />
und ist im Nachhall etwas länger als das Essen.<br />
WEIN 2 Ein 2019er Antinori Cervaro della<br />
Sala Bianco vom Castello della Sala, Orvieto/<br />
Umbrien. Der Wein wurde mit einer Temperatur<br />
von 14 Grad serviert. Er besteht aus rund 90 Prozent<br />
Chardonnay und 10 Prozent Grechetto. Dieser große<br />
italienische Weißwein hat eine sofort begeisternde,<br />
sehr »burgundische« Nase. Am Gaumen zeigt sich<br />
sehr viel Substanz mit einem mächtigen Körper, einer<br />
gegenüber der Nase stärker eingebundenen Holznote<br />
und einer eleganten, stabilen Länge. Im Glas<br />
ist er schnell präsent, wirkt nach fünf Minuten deutlich<br />
leichter und entwickelt nach einer Viertelstunde<br />
große Perfektion. Auch der Cervaro scheint ein wenig<br />
wie das Gericht zu duften. Weil er sehr kräftig ist,<br />
sollte man ihn zügig nach einem Bissen trinken,<br />
dann ergibt sich eine intensive Verzahnung mit den<br />
Aromen des Essens und es ereignen sich viele kleine,<br />
aber gut wahrnehmbare Reaktionen, bevor sich der<br />
Wein im Nachhall wieder klar durchsetzt.<br />
Die Empfehlung besteht aus zwei »sehr<br />
italienischen« Weißweinen, die im Vergleich<br />
zu fruchtbetonteren Weinen deutlich weniger,<br />
kompakter und vielfältiger wirken. Im Vergleich<br />
zum großartigen Cervaro wirkt der Avignonesi-<br />
Chardonnay etwas blasser, zeigt seinen Wert aber<br />
in der selbstverständlichen Eleganz und natürlich<br />
auch im gemäßigteren Preis. Den Cervaro muss<br />
man in seiner Intensität und explosiven Wirksamkeit<br />
annehmen, wirken lassen und genau verfolgen,<br />
um sein komplettes Potenzial zu erfassen. Eine sehr<br />
gute Empfehlung, die nicht zuletzt dadurch gewinnt,<br />
dass sie äußerst präzise zum Essen passt.<br />
116 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> WEIN & SPEISEN
Wolfsbarsch mit Spinat, Pilzen und Salbei<br />
Serviert wird ein Wolfsbarschfilet mit leicht krosser<br />
Haut auf einem Sockel von Spinat, dazu eine leicht<br />
aufgeschäumte helle Sauce mit Spuren vom Olivenöl<br />
aus der Garung, auf dem Filet thronen Pilze und leicht<br />
kross frittierte Salbeiblätter. Der Geschmack ist – wie<br />
immer im »Alten Haferkasten« – »italienischer«, als<br />
diese Kombination aus der Hand eines deutschen<br />
Kochs schmecken würde. Der Grund liegt in der<br />
unforcierten Würze und damit einer klareren Wirkung<br />
der Produkte, in der sicheren Arbeit mit Olivenölen<br />
und einer sehr selbstverständlich wirkenden<br />
sensorischen Struktur, die immer mit guten, süffg<br />
schmeckenden Proportionen einhergeht. Die Sauce<br />
etwa hat weniger Säure als in vielen französischen<br />
Fassungen, und das, was man vom Olivenöl schmeckt,<br />
bringt eine angenehme, nie grob wirkende Bodenständigkeit.<br />
WEIN 1 Ein 2019er Sauvignon Blanc fumé<br />
vom Weingut Oliver Zeter, Neustadt-Haardt/Pfalz.<br />
Der Wein wurde mit einer Temperatur von 10 Grad<br />
serviert. In der Nase zeigt sich in Sekundenschnelle<br />
eine gewaltige Frucht, die wie die Essenz aller<br />
Sauvignon-Noten wirkt. Am Gaumen konzentriert<br />
sich die Kraft ganz auffällig auf ein sofort hervorstechendes<br />
würziges Register, das ein wenig wie Kiwi<br />
plus herzhaft-vegetabiler Ergänzungen schmeckt.<br />
Die Nase verändert sich auch nach längerer Zeit im<br />
Glas nur unwesentlich. Mit dem Essen wird der Wein<br />
mehr »zum Italiener«, also deutlich mittiger. Mit<br />
mehr Spinat und Sauce zeigt sich eine große Säure<br />
im Sinne einer angereicherten, komplexen Säure, die<br />
nicht als Folge einer Reduktion der anderen Noten,<br />
sondern quasi zusätzlich entsteht. Der gesamte Eindruck<br />
ist sehr expressiv.<br />
WEIN & SPEISEN<br />
WEIN 2 Ein 2019er Chardonnay DOC Venezia<br />
Castello di Roncade Bianco dell’Arnasa vom Weingut<br />
Barone Vincenzo Ciani Bassetti in Roncade/Treviso.<br />
Der Wein wurde mit einer Temperatur von 4 Grad<br />
serviert. Die Nase wirkt sofort sehr ungewöhnlich<br />
und individuell. Es gibt leicht süßliche Noten, die<br />
in ein mildes, gemüsiges Fach übergehen, dazu<br />
exotische, aber kaum identifizierbare Fruchtnoten.<br />
Am Gaumen ergibt sich schnell eine klare, in dieser<br />
Form sehr überraschende Honignote, die im Verlauf<br />
von weinigen Aromen und einem Hauch von<br />
geschmortem Gemüse unterlegt wird. Die Reaktion<br />
ist vollkommen anders als beim Sauvignon Blanc<br />
von Zeter. Die Honignote bleibt wirksam und sorgt<br />
wesentlich für ein komplett anderes Register der<br />
Reaktionen. Für einige Sekunden färbt der Wein das<br />
ganze Essen ein, bevor er dann trockener reagiert und<br />
diesem Akkord eine eher weinige Grundierung gibt.<br />
Beide Empfehlungen sind gut und bringen echte<br />
Mitspieler, die nicht einfach nur passen, sondern<br />
klare Reaktionen und Bewegung am Gaumen verursachen.<br />
Der Sauvignon Blanc ist eine dominante,<br />
stets präsente Wahl, ein Wein, der immer auch<br />
ein beträchtliches Stück weit bei sich bleibt. Der<br />
Chardonnay, der für seine Preislage mit viel<br />
Individualität überrascht, ist im Charakter deutlich,<br />
aber in der Intensität eher in der Rolle des Mitspielers,<br />
der, auch ohne ein großer Wein zu sein, eine<br />
Menge differenzierter Ereignisse produziert. Diese<br />
Reaktionen zeigen – anders als beim Sauvignon<br />
Blanc – je nach Akkord beim Essen deutlich unterschiedliche<br />
Nuancen.<br />
WEIN & SPEISEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 117
<strong>FINE</strong> DAS WEINMAGAZIN 1|2022 erscheint<br />
im März 2022<br />
... voraussichtlich mit diesen Themen: BORDEAUX Château Lafleur in Pomerol und<br />
Château Tertre Roteboeuf in Saint-Émilion BURGUND Die fünf Chablis-Güter<br />
Vincent Dauvissat, Jean-Paul & Benoît Droin, William Fèvre, Long-Depaquit und François<br />
Raveneau KATALONIEN Mehr von der Familie Torres VERKOSTUNGEN Deutsche<br />
Pinots Noirs von 2008 sowie gereiftes Fruchtiges und Edelsüßes von Adelsgütern WEIN<br />
UND SPEISEN Jürgen Dollase bei Thomas Kellermann in den »Egerner Höfen« am<br />
Tegernsee CHAMPAGNER Die vierte Folge unserer Serie DAS GROSSE DUTZEND<br />
Monteverro in der Maremma Toscana WEIN UND ZEIT Wie das deutsche Weinwunder<br />
weiterging KOLUMNEN von Ursula Heinzelmann, Stuart Pigott sowie den<br />
Kombattanten Uwe Kauss und Dirk Würtz<br />
144 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong>
DAS MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS<br />
Viermal im Jahr richtet <strong>FINE</strong> <strong>Das</strong> <strong>Weinmagazin</strong> einen faszinierenden Blick auf die<br />
großen Weine der Welt – mit wissenswerten Infor mationen, fesselnden Reportagen,<br />
spannen den Porträts, exklu siven Verkostungen und vielem mehr, geschrieben und<br />
recherchiert von sachkundigen, sprachmächtigen Autoren, bebildert mit ausdrucksstarker,<br />
lebendiger Fotografie, präsentiert in groß zügiger, prächtiger Auf machung:<br />
ein unverzichtbares Lesevergnügen für Weinliebhaber, Sammler und Genießer.<br />
<strong>FINE</strong> DAS WEINMAGAZIN IST ERHÄLTLICH IM AUSGEWÄHLTEN BUCH- UND<br />
ZEITSCHRIFTENHANDEL IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ.<br />
WERDEN SIE JETZT ABONNENT VON <strong>FINE</strong> DAS WEINMAGAZIN<br />
oder ver schenken Sie ein Abonnement. Mit dem Stichwort »<strong>FINE</strong> 55«<br />
erhalten Sie als Danke schön die Sonderausgaben »Next Generation« und<br />
»New Generation«.<br />
Selbstverständlich können Sie auch einzelne <strong>Ausgabe</strong>n nachbestellen oder gleich<br />
das Sammel paket mit vierundfünfzig Heften plus der zwei Sonder ausgaben<br />
»Next Generation« und »New Generation« zum Gesamtpreis von € 560,–<br />
zzgl. Versand kosten ordern.<br />
ABONNEMENTS: WWW.<strong>FINE</strong>-MAGAZINES.DE ODER PER E-MAIL: ABO@<strong>FINE</strong>-MAGAZINES.DE<br />
JAHRESABONNEMENT FÜR VIER AUSGABEN DEUTSCHLAND EURO 60,– / ÖSTERREICH EURO 70,– / SCHWEIZ CHF 130,–<br />
MEHR INFORMATIONEN ÜBER <strong>FINE</strong> DAS WEINMAGAZIN: <strong>FINE</strong>-MAGAZINES.DE<br />
<strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 145
<strong>FINE</strong>ABGANG<br />
BESINNUNG<br />
UND NEUANFANG<br />
Nun ist es an der Zeit: Gehen Sie in den Keller oder zum Klimaschrank,<br />
und holen Sie die beste Flasche heraus, die Sie finden. Ob die nun aus<br />
Bordeaux stammt oder aus Burgund, aus dem Rheingau oder von der<br />
Mosel, aus Piemont oder aus dem Napa Valley, darauf kommt es nicht an – die<br />
Hauptsache ist, sie jetzt mit den Liebsten zu teilen, die Sie haben. Nehmen Sie<br />
also am besten gleich zwei Flaschen mit.<br />
<strong>Das</strong> nämlich macht Wein ganz besonders kostbar, neben all dem andern, das<br />
wir an ihm so schätzen: Ein guter Wein kann inmitten von Wirrwarr und Chaos<br />
eine Insel der Besinnung schaffen, und eine solche Insel, einen Ort zum Durchatmen,<br />
brauchen wir am Ende dieses schwierigen Jahres wahrscheinlich alle.<br />
Was danach kommt, ist aber ebenso wichtig, denn dieser Augenblick von<br />
Genuss und Erholung ist kein reiner Selbstzweck. Im Idealfall entspringt aus<br />
ihm ein wunderbares Gefühl von Leichtigkeit beim Blick in die Zukunft, der Mut<br />
zu dringend fälligen Entscheidungen, zur Eigenverantwortung. Was immer im<br />
neuen Jahr auf uns zukommen mag, wir müssen es anpacken – die nächste große<br />
Flasche, die wir öffnen und teilen, soll ein Champagner sein!<br />
Ihr Ralf Frenzel<br />
Herausgeber und Verleger<br />
146 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> ABGANG
G O U R M E T R E S T A U R A N T
Setzen Sie ein ästhetisches Statement.<br />
Geräte von Gaggenau: jedes für sich ein Meisterwerk, zusammen ein Kunstwerk.<br />
Der Unterschied heißt Gaggenau.<br />
gaggenau.com