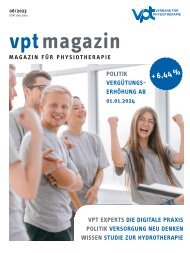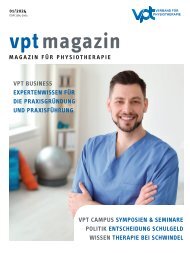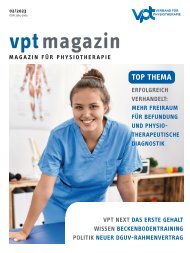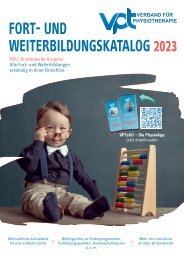VPTMAGAZIN_02_2022
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
14<br />
REPORT<br />
Warum mehr Autonomie in<br />
der Therapiewahl sich auch<br />
wirtschaftlich auszahlt<br />
Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Physiotherapeut*innen und Ärzt*innen: Wie<br />
das gelingt, zeigt ein Beispiel aus der Schweiz, das Mut macht: Am Kantonsspital Winterthur sind<br />
die Physiotherapeut*innen nicht den Ärzt*innen unterstellt, sondern sie handeln fachlich und<br />
wirtschaftlich eigenverantwortlich. David Gisi, Leiter des Instituts für Therapien und Reha bilitation,<br />
verrät, wie es dazu kam und welche Vorteile diese Aufgabenteilung bietet.<br />
Foto: J. Hofmann,<br />
Kantonsspital<br />
Winterthur<br />
David Gisi ist Physiotherapeut und Master in<br />
Managed Health Care. Er leitet das Institut für<br />
Institut für Therapien und Rehabilitation am<br />
Kantonsspital Winterthur.<br />
Die Physiotherapeut*innen am Institut für Therapien und Rehabilitation<br />
des Kantonsspitals Winterthur behandeln stationär<br />
und ambulant. Ein Beispiel für die neue Aufgabenteilung:<br />
Bei einer Patientin mit unspezifischen Rückenschmerzen übernimmt<br />
ein Physiotherapeut anstelle des Rheumatologen/Orthopäden<br />
den Erstkontakt. Anfangs war das – bedingt durch die sinkende<br />
Ärzt*innenzahl – aus der Not geboren. Doch nach einigen<br />
Jahren zeigen sich viele Vorteile, so David Gisi: „Wir haben mehr<br />
Zeit für Patient*innen und begleiten sie über den gesamten Therapieprozess.<br />
Wir erreichen eine genauso gute Versorgungsqualität.<br />
Physiotherapeut*innen schätzen bei Rücken erkrankungen<br />
sehr kompetent die klinische Problematik ein. Durchschnittlich<br />
wissen etwa Hausärzt*innen weniger über den Bewegungsapparat<br />
als wir.“ Das Plus an Verantwortung wirkt sich positiv auf die<br />
Mitarbeitermotivation aus: „Diese Aufgaben und neuen Rollen<br />
machen unseren Beruf attraktiver.“ Die neue Aufgabenteilung<br />
entlastet die Klinik aber nicht nur fachlich, sondern auch ökonomisch,<br />
da die Vergütung der Physiotherapeut*innen derzeit geringer<br />
als jene der Ärzt*innen ist.<br />
Anfang eines Strukturwandels<br />
Natürlich war es nicht einfach, tradierte Strukturen und gewohnte<br />
Hierarchiemuster aufzubrechen und eine neue Kultur im klinischen<br />
Alltag zu etablieren, blickt Gisi zurück. Klinikmanagement,<br />
Ärzteschaft und Therapeut*innenteam mussten sich der Diskussion<br />
stellen. Letztlich gelang es, weil die Idee, die Rollen neu zu<br />
verteilen, Unterstützung von der ganzen Klinik fand. Manchmal<br />
ist auch Fingerspitzengefühl gefragt: „Wir hatten den Konflikt,<br />
dass wir den Assistenzärzt*innen interessante Aufgaben wegnehmen.<br />
Das muss noch weiter evaluiert und eventuell neu justiert<br />
werden, damit wir keine Akzeptanzprobleme bekommen.“<br />
Wirtschaftliches Potenzial entdecken und nutzen<br />
Um auszuloten, wie die neue Rollenverteilung der Klinik beim<br />
Sparen hilft, wird das wirtschaftliche Potenzial verschiedener<br />
Therapien analysiert und die Maßnahmen werden ständig angepasst.<br />
Gisi: „Wir haben Bereiche stark reduziert, die nicht<br />
rentabel sind, etwa aufwendige einzeltherapeutische Maßnahmen.<br />
Rentabel sind ambulante Reha-Angebote, die wir interprofessionell<br />
erbringen. Hier arbeiten wir als Physio therapeut*innen<br />
mit Fachärzt*innen, Ergotherapeut*innen und Ernäh<br />
rungswissenschaftler*innen Hand in Hand. Eine physiotherapeutisch<br />
geleitete Rehabilitation ist heute Kernelement<br />
der 12-wöchigen ambulanten Reha nach Myokardinfarkt:<br />
Physiotherapie ist heute eine zentrale Therapie. Patient*innen<br />
Patient*innen verbringen rund 70 Prozent der Zeit mit Physiotherapeut*innen<br />
und die restliche Reha gestaltet sich quasi<br />
um die Physiotherapie herum.“<br />
Neue wirtschaftlich erfolgreiche Handlungsfelder<br />
Neben der Behandlung bzw. Reha bei muskuloskelletalen Befunden<br />
sind die sogenannten Non-communicable Diseases (NCD)<br />
ein wichtiges Betätigungsfeld am Institut für Therapien und Rehabilitation<br />
des Kantonsspitals Winterthur. NCD sind nicht ansteckende<br />
Krankheiten wie COPD, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,<br />
Krebserkrankungen und Diabetes. David Gisi erklärt: „Bei<br />
diesen Patient*innen gibt es eine hohe Evidenz für die ambulante<br />
Reha. Wir konnten uns schnell einen Platz in diesem unterversorgten<br />
Bereich sichern und mit Kostenträgern sogar Tarife aushandeln.<br />
80 bis 100 Prozent der Patient*innen kommen damit<br />
nun zu uns. Dank unserer NCD-Strategie konnten wir uns wirtschaftlich<br />
gut stabilisieren.“<br />
<strong>02</strong>|22 <strong>VPTMAGAZIN</strong>