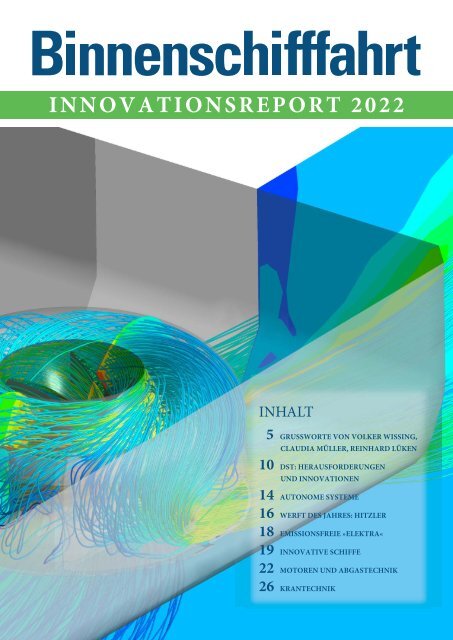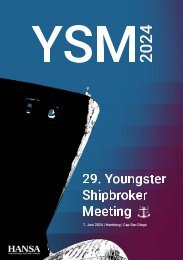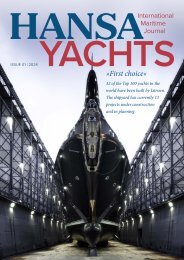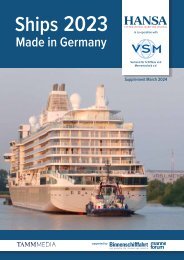Innovationsreport Binnenschifffahrt 2022
GRUSSWORTE VON VOLKER WISSING, CLAUDIA MÜLLER, REINHARD LÜKEN | DST: Herausforderungen und Innovationen | AUTONOME SYSTEME | WERFT DES JAHRES: Hitzler | EMISSIONSFREIE »ELEKTRA« | INNOVATIVE SCHIFFE | MOTOREN UND ABGASTECHNIK | KRANTECHNIK
GRUSSWORTE VON VOLKER WISSING, CLAUDIA MÜLLER, REINHARD LÜKEN | DST: Herausforderungen und Innovationen | AUTONOME SYSTEME | WERFT DES JAHRES: Hitzler | EMISSIONSFREIE »ELEKTRA« | INNOVATIVE SCHIFFE | MOTOREN UND ABGASTECHNIK | KRANTECHNIK
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
INHALT<br />
5 GRUSSWORTE VON VOLKER WISSING,<br />
CLAUDIA MÜLLER, REINHARD LÜKEN<br />
10 DST: HERAUSFORDERUNGEN<br />
UND INNOVATIONEN<br />
14 AUTONOME SYSTEME<br />
16 WERFT DES JAHRES: HITZLER<br />
18 EMISSIONSFREIE »ELEKTRA«<br />
19 INNOVATIVE SCHIFFE<br />
22 MOTOREN UND ABGASTECHNIK<br />
26 KRANTECHNIK
Der führende Versicherer der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
www.allianz-esa.de<br />
2<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>
EDITORIAL<br />
INNOVATIONSREPORT<br />
DIESEL<br />
<strong>2022</strong><br />
SAUBER, LEISE<br />
ZUKUNFTSFÄHIG<br />
Krischan Förster<br />
Chefredakteur<br />
Mutige Köpfe gefragt<br />
Wir freuen uns, Ihnen die erste Aus -<br />
gabe unseres »<strong>Innovationsreport</strong>« präsentieren<br />
zu können. Künftig wollen<br />
wir einmal im Jahr einen besonderen<br />
Fokus auf neue Ideen, Technologien<br />
und Geschäftsmodelle legen und<br />
besondere Projekte zeigen.<br />
Die <strong>Binnenschifffahrt</strong> steht ohne<br />
Zweifel vor schwierigen Zeiten. Der<br />
Klimawandel, Vorgaben zur Emissionsreduzierung<br />
und der wachsende<br />
Personalmangel sind nur einige<br />
Herausforderungen, die es zu meistern<br />
gilt. Gleichzeitig heißt es, mit den<br />
gesetzten Rahmenbedingungen bestmöglich<br />
umzugehen. Das betrifft<br />
vornehmlich die Engstellen im System<br />
Wasserstraße, an Brücken, Schleusen<br />
oder Flüssen und Kanälen.<br />
Es braucht mutige, kreative Köpfe,<br />
um Lösungen für technische und<br />
logistische Probleme zu finden. Sie gibt<br />
es im Lande, wie unsere Berichte zeigen.<br />
Es geht um neue Schiffsdesigns,<br />
Kraftstoffe, Antriebskonzepte, digitale<br />
Innovationen und neu gedachte multimodale<br />
Logistik konzepte.<br />
Noch aber stehen viele Entwicklungen<br />
erst an der Schwelle zu einem<br />
funktionierenden und vor allem wirtschaftlichen<br />
Betrieb in der Praxis –<br />
von der Brennstoffzelle bis hin zu einer<br />
automatisierten Schifffahrt. Auch der<br />
intelligente Datenaustausch zwischen<br />
allen Akteuren in der Transportkette<br />
hat noch viel Potenzial.<br />
Eines ist klar: Die <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
ist als Verkehrsträger unverzichtbar<br />
– für die Industrie, für die<br />
gewollte Verkehrsverlagerung, für die<br />
Energie wende. Sie braucht dafür die<br />
größtmögliche Unterstützung der<br />
politisch Handelnden, um sich diesen<br />
Herausforderungen stellen zu können.<br />
Sie muss aber natürlich auch<br />
eigene Kräfte mobilisieren, um sich<br />
jetzt zu erneuern und weiterzuentwickeln.<br />
Unser <strong>Innovationsreport</strong> soll nicht<br />
nur die besten Beispiele aus der Praxis<br />
zeigen, sondern auch Mut machen und<br />
Wege aufzeigen, wie es voran gehen<br />
kann. In diesem Sinne wünsche ich<br />
viel Spaß beim Lesen<br />
Seit 30 Jahren<br />
Ihr zuverlässiger<br />
Partner für<br />
Rußpartikelfilter,<br />
SCR-Systeme und<br />
Schalldämpfer<br />
Besuchen Sie uns:<br />
Personenschiffe<br />
Frachtschiffe<br />
SMM:<br />
Halle A4<br />
Stand 230<br />
STL:<br />
Stand<br />
198<br />
Behördenschiffe<br />
Titelfoto: © Schottel<br />
Aktuelle Informationen unter www.binnenschifffahrt-online.de<br />
TEHAG GmbH<br />
Gutenbergstraße 42<br />
D-47443 Moers<br />
Telefon +49 2841 887850<br />
info@tehag.de<br />
www.tehag.com<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
3
Driving Sustainability<br />
Mit unseren innovativen Schiffskonzepten steuern wir auf die <strong>Binnenschifffahrt</strong> der<br />
Zukunft zu – tiefgangoptimiert sowie auf den Kraftstoff und das Transportgut von<br />
morgen vorbereitet. Für eine nachhaltige Verkehrsverlagerung!<br />
Follow us<br />
www.hgkshipping.de
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
Volker Wissing<br />
Bundesminister für Digitales und Verkehr<br />
© BMDV<br />
»Wir wollen den Anteil der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
am gesamten Güterverkehr weiter erhöhen«<br />
Die Zukunft der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
hat viele Facetten. Eine ist grünweiß<br />
lackiert, ausgestattet mit innovativer<br />
Technik, emissionsfrei unterwegs<br />
und wird derzeit in der Region Berlin-Brandenburg<br />
erprobt. Es ist die<br />
»Elektra« – das weltweit erste Schubboot,<br />
bei dem ein batterieelektrischer mit einem<br />
Brennstoffzellenantrieb kombiniert<br />
wird. Eine echte Pionierleistung.<br />
Das Bundesverkehrsministerium unterstützt<br />
dieses Leuchtturmprojekt.<br />
Denn klar ist: Damit die Wasserstraßen<br />
ihren Klimavorteil ausspielen können,<br />
müssen die Schiffe auf ihnen klimafreundlich<br />
angetrieben werden. Diese<br />
Umstellung ist eine Herausforderung für<br />
das Gewerbe. Wir haben deshalb ein<br />
Programm entwickelt, mit dem wir Investitionen<br />
in neue emissionsärmere Systeme<br />
oder Nullemissionsantriebe fördern.<br />
Bis Mitte Juni <strong>2022</strong> konnten so bereits<br />
41 Neubauten und Bestandsschiffe<br />
aus- und umgerüstet werden. Sie stoßen<br />
jetzt weniger Kohlendioxid und Luftschadstoffe<br />
aus.<br />
Trotz der positiven Tendenz ist das Potenzial<br />
der <strong>Binnenschifffahrt</strong> für mehr<br />
Klima- und Umweltschutz weiter hoch.<br />
So können zum Beispiel auf den Wasserstraßen<br />
noch deutlich mehr Güter befördert<br />
werden, etwa Container-, Großoder<br />
Schwerlasttransporte. Je mehr davon<br />
von der Straße auf das Wasser verlagert<br />
werden, umso weniger Lkw sind<br />
unterwegs. Das reduziert Staus, Lärm<br />
und Emissionen. Wir wollen deshalb den<br />
Anteil der <strong>Binnenschifffahrt</strong> am gesamten<br />
Güterverkehr weiter erhöhen.<br />
Um die Verlagerung voranzutreiben,<br />
fördern wir Investitionen in Neu- und<br />
Ausbau von Umschlaganlagen des Kombinierten<br />
Verkehrs. Diese Förderung entwickeln<br />
wir derzeit weiter: Verstärkt werden<br />
wir künftig Maßnahmen der Digitalisierung<br />
und Automatisierung unterstützen,<br />
die das Umschlagen effizienter,<br />
sicherer und zuverlässiger machen.<br />
Sicherheit und Zuverlässigkeit erwarten<br />
die Binnenschiffer auch von den<br />
technischen Bauwerken. Bundesweit<br />
sind viele davon, insbesondere Schleusen<br />
und Wehre, in die Jahre gekommen und<br />
müssen saniert werden. Hierauf liegt unsere<br />
Priorität, damit sie auch künftig ihre<br />
Aufgaben erfüllen können.<br />
Ob bei Innovationen, Antrieben oder<br />
Infrastruktur: Wir unterstützen die <strong>Binnenschifffahrt</strong>,<br />
wo wir können. Denn sie<br />
soll auch weiter ein Garant sein für Exporterfolge,<br />
Wachstum und Beschäftigung<br />
und vor allem für eine klimafreundliche<br />
Logistik.<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
5
HITZLER WERFT<br />
innovativ seit 1885<br />
• Entwicklung von Prototypen<br />
• Elektrifizierung von Binnenschiffen<br />
und Fahrgastschiffen<br />
• Austausch von Hinterschiffen<br />
• Neubau von Schiffen bis<br />
130 m Länge und 4000 tdw.<br />
• 2 überdachte Helgen<br />
je 130 m x 18 m<br />
• Versorgungsschiffe,<br />
Eisbrecher, Binnenschiffe,<br />
Fähren, Schlepper, Tanker,<br />
CTVs u.ä.<br />
• 2 Slipanlagen mit einer<br />
Länge von 135 m bzw. 85 m<br />
• Konstruktion mit CADMATIC<br />
und AutoCAD<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
info@hitzler-werft.de | 04153-5880 | www.hitzler-werft.de
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
Claudia Müller<br />
Koordinatorin der Bundesregierung<br />
für die maritime Wirtschaft und Tourismus<br />
© BMWK<br />
»Das Binnenschiff – effizientes Kraftpaket<br />
im multimodalen Verkehr«<br />
Auf den rund 7.400 km Bundeswasserstraßen<br />
verkehrten im Jahr<br />
2020 knapp 2.000 Güterbinnenschiffe,<br />
die zusammen eine Ladung von 188<br />
Mio. t transportierten. Diese Ladungsmenge<br />
entspricht mehr als 16 Mio.<br />
Schwerlast-Lkw oder fast 4500 Schwertransporten<br />
zusätzlich pro Tag auf deutschen<br />
Straßen.<br />
Eine enorme Menge, die zeigt, welchen<br />
großen Stellenwert das Binnenschiff<br />
beim Transport von Waren und Gütern<br />
einnimmt.<br />
Ein modernes Binnenschiff ersetzt etwa<br />
150 Lkw und ist damit ein hocheffizientes<br />
und schon heute vergleichbar<br />
klimafreundliches Transportmittel. Gerade<br />
in der Betrachtung der gesamten<br />
Lieferkette kann der effiziente Transport<br />
mit dem Binnenschiff seine wichtige Rolle<br />
entfalten. Je länger beim Transport einer<br />
Ware der Anteil, der mit dem Binnenschiff<br />
zurückgelegt worden ist – im<br />
Gegensatz zum Transport mit dem Lkw –<br />
desto positiver wird dies im gesamten<br />
CO 2<br />
-Fußabdruck. Gleichzeitig ist der<br />
Energieeinsatz je transportierter Einheit<br />
mit Abstand am niedrigsten – mit nur einem<br />
Drittel gegenüber jenem des Lkw.<br />
Das schlägt sich auch positiv nieder bei<br />
Abgasemissionen je transportierter Einheit<br />
sowie für bei den Folgen durch mögliche<br />
externe Kosten, also Klimagase,<br />
Luftschadstoffe, Lärm oder Unfälle. Effizienzvorteile,<br />
die heute schon deutlich<br />
für das Binnenschiff als Transportmittel<br />
sprechen. Gleichzeitig machen auch der<br />
Klimawandel und Kostensteigerungen<br />
für Treibstoffe effiziente Transporte notwendig.<br />
Das Binnenschiff dient zum Transport<br />
diverser Güter, vor allem aber zur Versorgung<br />
mit Rohstoffen. Dies war besonders<br />
im heißen und trockenen Sommer 2018<br />
spürbar, als der Transportweg über den<br />
Rhein eingeschränkt war. Die Versorgung<br />
von Raffinerien war nicht mehr<br />
möglich. Neben der Relevanz der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
hat dies auch gezeigt, dass<br />
wir eine gute Infrastruktur benötigen, die<br />
im Zusammenspiel mit den Fahrzeugen<br />
auch resilient und anpassungsfähig für<br />
mögliche Klimaveränderungen sein<br />
muss. Niedrigwasserepisoden stellen zudem<br />
neue Herausforderungen an das<br />
Binnenschiff dar. Die Bundesregierung<br />
hat deshalb ein Förderprogramm Nachhaltige<br />
Modernisierung von Binnenschiffen<br />
aufgelegt, mit dem auch angepasste<br />
Rumpfformen gefördert werden können.<br />
Weiterer Modernisierungsbedarf besteht<br />
bei den Antrieben. Die Abkehr von<br />
fossilen Kraftstoffen, hin zu übergangsweise<br />
verflüssigtem Erdgas (LNG), Wasserstoff<br />
(Brennstoffzelle), oder synthetischen<br />
Kraftstoffen, um weitere Erfolge<br />
bei der Senkung der CO 2 -Emissionen<br />
zu erreichen und auch um den<br />
Vorgaben aus dem »Fit for 55«-Paket der<br />
EU-Kommission umzusetzen, sind weitere<br />
notwendige Schritte. Hierfür braucht<br />
es weitere Anstrengungen hinsichtlich<br />
der Verfügbarkeit der Kraftstoffe und der<br />
Marktakzeptanz alternativer Antriebe.<br />
Die Bundesregierung unterstützt diese<br />
Entwicklungen durch Förderung von<br />
Forschung und Entwicklung.<br />
Mit den aktuell in Bau befindlichen<br />
Schiffstyp »E-Spatz« mit Elektromotoren<br />
geht auch der Bund mit gutem Bespiel<br />
voran. Auch Entwicklungen wie das<br />
durch das Bundesverkehrsministerium<br />
geförderte hybrid-elektrisch angetriebene<br />
Schubboot »Elektra«, zeigen<br />
das Innovationspotenzial des wichtigen<br />
Transportmittels Binnenschiff und weisen<br />
den Weg in Richtung Zukunft.<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
7
Schützen Sie die Umwelt und erhöhen<br />
Sie gleichzeitig Ihre Flexibilität mit dem<br />
REINTJES Hybridsystem.<br />
Wenn Sie hierzu<br />
mehr erfahren möchten,<br />
besuchen Sie uns auf der<br />
SMM in Halle A4 Stand 211.<br />
www.reintjes-gears.de
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
Reinhard Lüken<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V.<br />
© VSM<br />
»Die Möglichkeiten der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
sind durch Straße und Schiene<br />
nicht zu ersetzen«<br />
Dürre in Deutschland – ein Thema<br />
das inzwischen mit großer Regelmäßigkeit<br />
in den Wetternachrichten thematisiert<br />
wird. Doch nicht nur Landund<br />
Forstwirtschaft leiden. Das extreme<br />
Niedrigwassers 2018 setzte die <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
wochenlang lahm und mit ihr<br />
große Industriebetriebe entlang den<br />
Wasserstraßen. Die wirtschaftlichen<br />
Schäden gingen in die Milliarden. Schnell<br />
wurde deutlich: Die Möglichkeiten der<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> sind durch Straße und<br />
Schiene nicht zu ersetzen.<br />
Neben dem entscheidenden Beitrag<br />
der Frachtschifffahrt für die Verkehrsinfrastruktur<br />
Deutschlands darf auch die<br />
Fahrgastschifffahrt nicht unterschätzt<br />
werden. Millionen Mitbürger nutzen sie<br />
tagtäglich als Teil des ÖPNV oder als<br />
Touristen für ihre Erholung und Freizeit.<br />
Der Güterverkehr in Deutschland verzeichnet<br />
seit Jahrzehnten ein kontinuierliches<br />
Wachstum. Leider aber<br />
konnte die <strong>Binnenschifffahrt</strong> ihren Anteil<br />
an der gesamten Beförderungsleistung<br />
(Modal Split) nicht erhöhen, im Gegenteil.<br />
Dabei könnte der wassergebundene<br />
Verkehr am leichtesten und günstigsten<br />
expandieren. Das wäre auch für die Umwelt<br />
gut, denn die Physik ermöglicht dem<br />
Schiff die energieeffizienteste Bewegung.<br />
So bewegen wir uns nicht nur nicht auf<br />
die ehrgeizigen Pläne des »Green Deal«<br />
zu, sondern immer weiter weg. Dabei haben<br />
theoretisch alle Beteiligten erkannt,<br />
dass die Transformation des Verkehrsbereichs<br />
ohne die <strong>Binnenschifffahrt</strong> scheitern<br />
wird. Damit die <strong>Binnenschifffahrt</strong> ihre<br />
Aufgaben auch künftig erfüllen kann,<br />
gilt es zwingend; die aktuellen Herausforderungen<br />
zeitnah zu bewältigen: Dem<br />
Arbeitskräftemangel die Automation entgegensetzen,<br />
den Klimaschutzanforderungen<br />
durch alternative Kraftstoffe<br />
und Antriebe begegnen, die Effizienz<br />
durch Digitalisierung erhöhen und<br />
sich intelligent auf den Klimawandel einstellen<br />
durch neue schiffbauliche Wege.<br />
Ohne staatliche Förderung, zeitnahe<br />
technische Vorschriftenentwicklung und<br />
geeignete Rahmenbedingungen, werden<br />
diese Herausforderungen aber nicht zu<br />
stemmen sein.<br />
Die aktuelle Regierungspolitik packt<br />
viele Themen entschlossen an. Es bleiben<br />
aber auch noch unerledigte Hausaufgaben.<br />
Die Förderung der <strong>Binnenschifffahrt</strong>,<br />
um die beschriebenen technischen<br />
Herausforderungen zu bewältigen, hat<br />
sich stetig erhöht. Hersteller bieten vielfältigste<br />
technische Lösungen und arbeiten<br />
kontinuierlich weiter an der Technik<br />
für die <strong>Binnenschifffahrt</strong> für morgen.<br />
Unterstützt werden unter anderem zahlreiche<br />
Forschungsprojekte im Bereich<br />
Automation. Wichtig ist, die Förderprogramme<br />
möglichst praxisnah zu gestalten,<br />
damit Investitionen auch tatsächlich<br />
ausgelöst werden.<br />
Aber auch modernste Schiffe sind auf<br />
geeignete Wasserstraßen angewiesen. Zu<br />
dem absehbaren Finanzierungsloch bei<br />
der Erneuerung und Ertüchtigung des<br />
Wasserstraßennetzes darf es nicht kommen.<br />
Die Infrastrukturprojekte verzögern<br />
sich weiter und weiter und dies<br />
gefährdet die strategischen Ziele der Verkehrswende.<br />
Wie bei der Schiene gilt:<br />
Wenn Schleusen, Schiffshebewerke und<br />
Wasserstraßen nicht in der Lage sind,<br />
moderne Schiffe aufzunehmen, können<br />
diese schlicht nicht fahren, noch nicht<br />
einmal im Schritttempo wie ein Lkw bei<br />
Stau oder über Schlaglöcher!<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
9
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | BINNENSCHIFFFAHRT DER ZUKUNFT<br />
Herausforderungen und Innovationen<br />
© DST<br />
Neue Designs sind gefragt: Schiffsumströmung eines kleinen, neu am<br />
DST konzipierten Containerschiffes im Versuchskanal in Duisburg<br />
Die <strong>Binnenschifffahrt</strong> steht durch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserstraßen,<br />
die geforderte Umstellung auf klimaneutrale Antriebe und den drohenden Fachkräftemangel<br />
vor großen Herausforderungen. Diesen muss sie mit innovativen Entwicklungen begegnen<br />
Das vorrangige Ziel jeder Schiffsentwicklung<br />
ist stets die Verbesserung<br />
der Wirtschaftlichkeit des Schiffstrans -<br />
ports – allerdings unter bestimmten<br />
Randbedingungen. Dazu gehören beispielsweise<br />
die zu transportierenden Güterarten<br />
und -mengen, die Gewässerbedingungen,<br />
Schleusenabmessungen und<br />
Besatzungsvorschriften.<br />
In den letzten Jahrzehnten waren diese<br />
Randbedingungen relativ konstant und<br />
führten zu immer größeren Schiffseinheiten.<br />
Mit der größeren Verdrängung<br />
sinkt der spezifische Leistungsbedarf.<br />
Gleichzeitig kann ein größerer Propeller<br />
installiert werden, dessen Wirkungsgrad<br />
mit dem Durchmesser zunimmt. Der<br />
Wirkungsgrad des Dieselmotors konnte<br />
in Laufe der Jahre ebenfalls verbessert<br />
werden. So wurde das moderne Binnenschiff<br />
zum energieeffizientesten Verkehrsträger.<br />
Für die seltenen Niedrigwasserperioden<br />
wurden Ergänzungen<br />
wie der Flextunnel erfunden, die auch<br />
den Betrieb bei mäßigem Niedrigwasser<br />
erlauben.<br />
In nur wenigen Jahren sind allerdings<br />
viele Herausforderungen, unter anderem<br />
durch stark veränderte Randbedingungen,<br />
aufgetaucht, die neue Entwicklungen<br />
erzwingen.<br />
Die Klimaprognosen lassen ausge -<br />
dehnte und häufigere Niedrigwasserperioden<br />
in den nicht staugeregelten Flüssen<br />
erwarten. Hiervon ist ganz besonders die<br />
Rheinschifffahrt betroffen, weswegen<br />
auch bereits im Jahr 2018 Entwicklungen<br />
für flachgehende Binnenschiffe angestoßen<br />
wurden. Wegen des im flachen<br />
Wasser begrenzten Tiefgangs müssen die<br />
Länge und Breite des Schiffes maximiert<br />
werden, um eine ausreichende, wirtschaftlich<br />
vertretbare Tragfähigkeit zu erreichen.<br />
Gleichzeitig wird durch die geringe<br />
Wassertiefe die Geschwindigkeit<br />
begrenzt.<br />
Leistungsbedarf ist entscheidend<br />
Diese Grenze ist grundlegend strömungstechnisch<br />
begründet und kann<br />
durch keine konstruktive Maßnahme<br />
überwunden werden: Ab einer Tiefen-<br />
Froudezahl von 0,7 steigt der Leistungsbedarf<br />
stark an, und das Schiff erfährt einen<br />
starken Absunk und eine starke Vertrimmung,<br />
die zur Grundberührung führen<br />
kann. So ist zum Beispiel bei einer<br />
Wassertiefe von 1,8 m die Schiffsgeschwindigkeit<br />
auf 10,5 km/h begrenzt.<br />
Bei einem kleinen Tiefgang muss auch<br />
der Propellerdurchmesser entsprechend<br />
verkleinert werden. Um die erforderliche<br />
Antriebsleistung in das Wasser übertragen<br />
zu können, werden dann zwei oder<br />
mehr Propeller notwendig. Um den Wirkungsgrad<br />
möglichst hoch zu halten, werden<br />
diese in Tunneln angeordnet. Hier<br />
besteht die Gefahr, dass bei Stoppmanövern<br />
die Propeller von achtern Luft<br />
ansaugen. Um dies zu verhindern, ist eine<br />
entsprechende Gestaltung des Hinterschiffs<br />
vorzunehmen oder eine Bugstrahlanlage<br />
vorzusehen, die bei Stoppma -<br />
növern ausreichend Schub erzeugt.<br />
Es sind auch weitere Konzepte denkbar,<br />
wie zum Beispiel externe Zusatzantriebe<br />
mit kleinen Propellern, die bei<br />
Bedarf – ähnlich einem Außenbordmotor<br />
– am Heck angebracht werden und<br />
bei extremem Niedrigwasser als Antrieb<br />
dienen.<br />
Eine weitere Alternative mit ebenfalls<br />
sehr hohem Wirkungsgrad und uneingeschränkter<br />
Flachwassertauglichkeit ist<br />
das Schaufelrad bzw., in der modifizierten<br />
Form, die Blattkette. Während die geringe<br />
Drehzahl des Schaufelrads und die<br />
Momentstöße in Kombination mit dem<br />
Dieselmotor zu Schwierigkeiten führen,<br />
ist ein elektrischer Antrieb hierfür ohne<br />
weiteres geeignet.<br />
Damit bei reduziertem Tiefgang und<br />
entsprechend reduzierter Verdrängung<br />
ausreichend Ladung transportiert werden<br />
kann, ist es nötig, das Strukturgewicht<br />
zu minimieren. Dies kann durch<br />
eine Verringerung der Seitenhöhe und<br />
andere Materialien erreicht werden. An-<br />
10<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>
BINNENSCHIFFFAHRT DER ZUKUNFT | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
dererseits kann durch eine größere Seitenhöhe<br />
die Festigkeit erhöht werden<br />
und die Materialstärke gesenkt werden.<br />
In jedem Fall steigen die Anforderungen<br />
an eine detaillierte Konstruktion, in der<br />
die Strukturmaterialien, eventuell auch<br />
leichte Sandwichmaterialien mit Metallschäumen<br />
oder hochbelastbare faserverstärkte<br />
Kunststoffe, entsprechend den lokalen<br />
Belastungen sorgfältig ausgewählt<br />
und dimensioniert werden müssen.<br />
Allerdings muss wie bei der jeder Optimierung<br />
ein Kompromiss gefunden werden:<br />
Das Schiff, das für die Fahrt im<br />
Niedrigwasser optimiert ist, kann im<br />
Tiefwasser nicht viel Ladung tragen. Das<br />
Schiff, das die zulässigen Hauptabmes -<br />
sungen auf den Rhein ausreizt und somit<br />
auch bei geringem Tiefgang genug Tragfähigkeit<br />
hat, kann die Nebenflüsse und<br />
Kanäle nicht mehr befahren. Der wirtschaftliche<br />
Ansatz muss daher lauten, ein<br />
Schiff zu entwickeln, das bei Niedrigwasser<br />
fahren kann – und so das Binnenschiff<br />
zu einem verlässlichen Verkehrsträger<br />
macht –, das aber gleichzeitig auch<br />
bei höheren Wasserständen mehr Ladung<br />
transportieren kann und so insgesamt<br />
rentabel zu betreiben ist.<br />
Eine weitere Gewichtsreduzierung<br />
kann durch eine Optimierung für spezielle<br />
Ladung erreicht werden. So wird<br />
zum Beispiel beim Containertransport<br />
die Last nur über die Containerecken<br />
übertragen, der Laderaumboden muss<br />
also nicht für eine Entladung mit einem<br />
Greifbagger ausgelegt werden. Hier muss<br />
der Schiffsbetreiber kalkulieren, inwieweit<br />
operative Einschränkungen und höhere<br />
Kosten durch ausgedehnte Einsatzzeiten<br />
kompensiert werden können.<br />
Die nächste Herausforderung ist die<br />
Luftbelastung. Vor wenigen Jahren galt<br />
es, die NOx- und Feinstaub-Emissionen<br />
deutlich zu reduzieren. Die NRMM-Verordnung<br />
entpuppte sich als eine große<br />
Herausforderung für die Branche, weil<br />
sich große Dieselmotoren für die neuen<br />
Abgasgrenzwerte kaum im Markt finden<br />
ließen.<br />
Inzwischen besteht aber die neue Zielvorgabe<br />
darin, die Treibhausgasemissionen<br />
bis 2035 um 35 % gegenüber 2015<br />
zu reduzieren und bis 2050 weitgehend<br />
zu eliminieren. Dies ist mit Dieselmotoren<br />
jedoch kaum zu erreichen: Mit<br />
E- oder Bio-Fuels (einschließlich Abgasnachbehandlung)<br />
kann zwar eine global<br />
neutrale Klimabilanz erreicht werden, die<br />
Kosten hierfür sind allerdings sehr hoch<br />
und ausreichende Treibstoffmengen (absehbar)<br />
nicht verfügbar.<br />
Eine relativ kleine Branche wie die <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
muss sich daher die Entwicklungen<br />
aus anderen Verkehrs- und<br />
Industriebereichen zunutze machen. Es<br />
ist abzusehen, dass der Elektromotor<br />
zum Standardantrieb wird. Er hat einen<br />
sehr hohen Entwicklungsstand erreicht<br />
und ist in allen erforderlichen Größenordnungen<br />
verfügbar. Der Wirkungsgrad<br />
ist sehr hoch, er lässt sich in einem weiten<br />
Drehzahlbereich sehr gut regeln und ist<br />
zudem wartungsarm. Zum Erreichen der<br />
Klimaziele stellt sich also die Frage, wie<br />
Die Zukunft sicher gestalten,<br />
mit dem Blick nach vorne!<br />
Unsere Kompetenz. Unsere Verantwortung.<br />
Autonome Schifffahrt<br />
Alles unter Kontrolle für die<br />
optimale Route<br />
Smart Maintenance<br />
Wartungen effizient<br />
gestalten und Verfügbarkeit<br />
messen<br />
Energiemanagement<br />
Redundant, sicher und<br />
umweltfreundlich<br />
OpenBridge, MTP<br />
Standards für mehr<br />
Sicherheit und reibungslose<br />
Inbetriebnahme<br />
www.bachmann.info<br />
TY<br />
T<br />
O<br />
PE APPROV<br />
ED PRODUCT<br />
Wir sind wieder dabei und<br />
freuen uns auf Ihren Besuch<br />
SMM Hamburg | 06.-09. September <strong>2022</strong><br />
Hamburg, Deutschland | Stand: B6.305<br />
DNV.COM/AF<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
11
INNOVATIONSREPORT<br />
© DST<br />
Für die künftig häufiger drohenden Niedrigwasser-Phasen, hier der Rhein im Jahr 2018, werden flachgehende, optimierte Schiffe gebraucht<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
die elektrische Leistung für den Motor und den Bordbetrieb bereitgestellt<br />
werden kann. Als Übergangslösung bieten sich Dieselgeneratoren<br />
an, die in einem modularen Konzept später durch<br />
klimaneutrale Alternativen ersetzt werden. Mit Batterien lassen<br />
sich große Energiemenge speichern, auf absehbare Zeit aber nur<br />
zu erheblichen Kosten.<br />
Bei kurzen Fahrstrecken (zum Beispiel auf Fähren oder Tagesausflugsschiffe)<br />
ist dies eine denkbare Variante. Bei längeren<br />
Fahrstrecken müsste unterwegs die Batterie neu aufgeladen oder<br />
getauscht werden. Dies ist vor allem bei einem Betrieb mit Ruhepausen<br />
denkbar, wenn zuvor die erheblichen Investitionen an<br />
den Liegestellen und in den Häfen für Landstrom-Anlagen erfolgt<br />
sein sollte. Denkbar ist es auch, eine Batterie als Teilantrieb<br />
zu verwenden, die zum Beispiel für die Talfahrt oder eine zeitlich<br />
begrenzte Kanalfahrt die erforderliche Leistung bereitstellt.<br />
Brennstoffzelle als Technologie der Zukunft<br />
Darüber hinaus bietet sich die Brennstoffzelle an, die aus Wasserstoff<br />
und Luftsauerstoff elektrochemisch Energie erzeugt. Der<br />
Wasserstoff kann entweder als Reinstoff an Bord gelagert werden<br />
(flüssig, gasförmig oder als Metallhydrid) oder von anderen<br />
Treibstoffen in einem sogenannten Reformer abgespalten werden.<br />
Die gravimetrische Energiedichte von flüssigem Wasserstoff<br />
(einschließlich Tanksystem) liegt allerdings nur bei einem Drittel<br />
im Vergleich zum Diesel, aber immerhin 16 mal höher als bei<br />
Batterien. Die Energiedichte von Ammoniak ist wiederum um<br />
25 % höher als die von flüssigem Wasserstoff, die von Methanol<br />
sogar um 50 % höher. Allerdings wird beim Reformieren CO2 abgeschieden<br />
– somit kommt nur »grünes« Methanol in Frage.<br />
Brennstoffzellenantriebe für Schiffe befinden sich gerade erst<br />
im Prototypen- bzw. Vorserien-Stadium. Sie haben jedoch ohne<br />
Zweifel das Potenzial, die vorherrschende Energiequelle der Zu-<br />
12<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>
BINNENSCHIFFFAHRT DER ZUKUNFT | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
kunft zu werden. Sie bieten nach jetzigem<br />
Forschungsstand die einzige Alternative,<br />
um Binnenschiffe über lange Strecken<br />
ohne Unterbrechung fahren lassen zu<br />
können. Auch hierfür fehlen noch die erforderliche<br />
Infrastruktur und Logistik für<br />
die Treibstoffversorgung entlang der<br />
Wasserstraßen.<br />
Bei der Konzeptionierung der Energieversorgung<br />
muss künftig jede denkbare<br />
Möglichkeit mit einbezogen werden. So<br />
können Solarzellen auf Lukendeckeln eine<br />
deutliche Energiemenge bereitstellen.<br />
Auch ist eine Folie mit flexiblen Solarzellen<br />
denkbar, die in an einem Gestell<br />
über geladene Container gerollt wird.<br />
Genauso wie in vielen anderen Branchen<br />
droht auch der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
ein gravierender Fachkräftemangel. Eine<br />
technische Antwort darauf kann eine zunehmende<br />
Automatisierung sein, um<br />
Aufgaben an Bord vom Menschen auf<br />
Maschinen zu übertragen. Zudem liegt<br />
darin ein Potenzial, die Kosten zu senken<br />
und die Sicherheit zu erhöhen. Die prominenteste<br />
Aufgabe ist dabei die Steuerung<br />
des Schiffs. Die Entwicklung hierzu<br />
verläuft in Stufen.<br />
Angefangen von bereits verfügbaren<br />
Assistenzsystemen, die den Schiffsführer<br />
unterstützen (Bahnführungsassistent,<br />
Brückenanfahrwarnung usw.) kann die<br />
Komplexität der Systeme schrittweise erhöht<br />
werden, bis sie in der Lage sind, das<br />
Schiff vollständig autonom zu steuern.<br />
Ein Zwischenschritt ist das ferngesteuerte<br />
Fahren aus einem Steuerstand an Land<br />
mit Hilfe von fortgeschrittenen Assistenzsystemen.<br />
Ein Schiffsführer kann<br />
künftig durchaus mehr als ein Schiff steuern.<br />
Ein optimierter Betrieb trägt ebenfalls<br />
dazu bei, energiesparender und wirtschaftlicher<br />
zu fahren.<br />
Neben der Schiffsführung können aber<br />
auch alle anderen Aufgaben an Bord automatisiert<br />
werden. Dazu müssen zum<br />
einen entsprechende technische Einrichtungen<br />
an Bord installiert werden, zum<br />
anderen wird es aber auch nötig sein, Arbeitsabläufe<br />
neu zu organisieren und verbleibende,<br />
nicht automatisierbare Aufgaben<br />
durch landgestütztes Personal ausführen<br />
zu lassen. Erste Ansätze hierzu<br />
finden sich heute schon an Bord, zum<br />
Beispiel bei der Fernüberwachung der<br />
Antriebsmotoren und der sogenannten<br />
»Predictive Maintenance« (Wartungsplanung)<br />
für die Bordsysteme.<br />
Insgesamt wird durch die steigenden<br />
Anforderungen die Schiffsentwicklung<br />
deutlich aufwändiger. Viele Aspekte müssen<br />
künftig noch im Detail untersucht<br />
werden, um alle Optimierungspotenziale<br />
nutzen zu können. Denn klimaneutrale<br />
Antriebe sind wesentlich komplexer aufgebaut<br />
als der heute verbreitete klassische<br />
Dieselmotor. Und auch der Schiffsbetrieb<br />
wird sich mit den Automatisierungsfunktionen<br />
wandeln. Nicht zuletzt müssen bei<br />
allen Entwicklungen auch die Nachrüstungsmöglichkeiten<br />
der Bestandsflotte<br />
bedacht werden.<br />
Autor: Rupert Henn<br />
DST – Entwicklungszentrum für<br />
S chiffstechnik und Transportsysteme<br />
Duisburg<br />
Strömung am Hinterschiff eines klassischen Binnenschiffs im flachen Wasser, das von zwei Hilfsantrieben bewegt wird<br />
© DST<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
13
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | AUTONOME SYSTEME<br />
Die Arbeit des Schiffsführers erleichtern<br />
Systeme zur autonomen Navigation, Überwachung und Flottenmanagement erleichtern die<br />
Arbeit von Binnenschiffern und machen sie sicherer, zudem leisten sie einen Beitrag zur<br />
Emissionsreduzierung – wie Produkte von Argonics, die auf Bachmann-Lösungen basieren<br />
© Bachmann electronic<br />
Nach diesem Prinzip »Teile und herrsche«<br />
– werden in der Informatik<br />
komplexe und zunächst unbeherrschbar<br />
scheinende Aufgaben in der Regel in hierarchische<br />
Ebenen unterteilt. Jede Ebene<br />
spaltet sich wiederum in einzelne Module<br />
auf, welche voneinander entkoppelte,<br />
übersichtliche Aufgaben bewältigen.<br />
Durch die Vernetzung der einzelnen Module<br />
sind der Austausch von Informationen<br />
und die wechselseitige Interaktion<br />
möglich. »Mit diesem Vorgehen haben<br />
wir verschiedene Produkte erschaffen,<br />
die den Alltag in der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
erleichtern«, erzählt Alexander Lutz,<br />
Gründer und Geschäftsführer der Argonics<br />
GmbH. Natürlich braucht es auch<br />
die entsprechenden Hardware-Komponenten,<br />
um unsere Konzepte in ein<br />
reales System umzusetzen, so Lutz. Dafür<br />
verwendet Argonics das M1-Automatisierungssystem<br />
von Bachmann<br />
electronic. »Dessen Modularität sowie<br />
die vielfältigen Möglichkeiten zur Vernetzung<br />
haben uns überzeugt«, so Alexander<br />
Lutz weiter.<br />
Weniger Treibstoff und Verschleiß<br />
Zur Navigation der Schiffe stehen verschiedene<br />
Module wie argoPropControl,<br />
argo-Pilot und argoCruiseControl zur<br />
Verfügung. Das Modul argoPropControl<br />
sorgt auf unterster Ebene dafür, dass die<br />
Antriebseinheiten die Vorgaben des<br />
Schiffsführers über Ruderwinkel und<br />
Maschinendrehzahl umsetzen. »Dabei<br />
werden hardwareseitig für jede Antriebseinheit<br />
separate Steuerungs- und Ein-/<br />
Ausgangsmodule verbaut, um ein<br />
Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten«,<br />
erklärt Lutz.<br />
Auf der nächsten Ebene läuft mit dem<br />
Modul argoPilot ein Wendegeschwindigkeitsregler,<br />
der die Drehgeschwindigkeit<br />
des Schiffes um seine Hochachse regelt.<br />
ArgoCruiseControl sorgt zusätzlich dafür,<br />
dass alle Antriebsmotoren stets gleich<br />
belastet werden. »So wird Treibstoff gespart<br />
und der Verschleiß vermindert«,<br />
macht Alexander Lutz deutlich. Die beiden<br />
Module liefern Sollwerte an das Modul<br />
argoPropControl. Dies geschieht ohne<br />
zusätzliche Hardware. Die Module<br />
werden Lutz zufolge »einfach miteinander<br />
vernetzt«.<br />
Mit argoTrackPilot wurde erstmalig in<br />
der <strong>Binnenschifffahrt</strong> ein System zur automatischen<br />
Führung von Schiffen entlang<br />
vorgegebener Sollbahnen entwickelt.<br />
Dieses bei Argonics verfügbare<br />
Modul der höchsten Navigationsebene<br />
greift wiederum auf die Funktionalität<br />
von Modulen untergelagerter Ebenen zurück.<br />
In diesem Falle erfolgt die Vorgabe<br />
der Solldrehgeschwindigkeit an Wendegeschwindigkeitsregler<br />
wie das Modul argoPilot,<br />
das wiederum Ruderwinkelvorgaben<br />
an argoPropControl liefert. Alle<br />
14 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>
AUTONOME SYSTEME | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
Module zur Navigation des Schiffes benötigen<br />
Zugriff auf die Hardware des Antriebs<br />
und auf verschiedene Sensoren wie<br />
das globale Satellitennavigationssystem<br />
GNSS oder den Wende- und Ruderwinkelanzeiger.<br />
Dies geschieht über Kommunikationsmodule,<br />
die jeweils spezielle<br />
Protokolle wie 1939 oder NMEA umsetzen.<br />
Diese lassen sich leicht im M1-Automatisierungssystem<br />
realisieren oder sind<br />
bereits integriert.<br />
Viele Unterstützungsoptionen<br />
»Reederei können durch die<br />
Analyse der gespeicherten Daten<br />
frühzeitig Probleme erkennen<br />
und Wartungsarbeiten in die<br />
Wege leiten«<br />
Alexander Lutz<br />
© Argonics<br />
Verschiedene Überwachungsmodule<br />
greifen ebenfalls auf die Variablen der<br />
Navigations- und Kommunikationsmodule<br />
zu. Mit argoMultiDisplay werden<br />
alle für die Schiffsführung relevanten Daten<br />
auf Touch-Bildschirmen dargestellt.<br />
Die Visualisierung wird speziell nach<br />
Vorgaben der Kunden realisiert, da eine<br />
Vielzahl an konfigurierbaren Instrumenten<br />
zur Verfügung steht. Eine Alarmierung<br />
des Schiffsführers über kritische<br />
Zustände erfolgt ebenfalls über die Anzeige<br />
von argoMultiDisplay.<br />
Das argoDataPortal, das der Reederei<br />
den Zugriff auf alle relevanten Daten ihrer<br />
Schiffe ermöglicht, basiert auf der Visualisierungslösung<br />
atvise von Bachmann.<br />
Ȇber eine sichere Verbindung<br />
werden diese von den Schiffen an eine<br />
landseitige Datenbank übermittelt«, erklärt<br />
Alexander Lutz. Bei einer Unterbrechung<br />
der Verbindung werden alle<br />
Daten auf den Schiffen lokal zwischengespeichert.<br />
»Die technisch Verantwortlichen<br />
der Reederei können durch die<br />
Analyse der gespeicherten Daten frühzeitig<br />
Probleme erkennen und Wartungsarbeiten<br />
in die Wege leiten«, schildert<br />
Lutz die Vorteile des Portals. »Mit Hilfe<br />
von argoDataPortal lassen sich auch die<br />
Fahrweise der Schiffsführer beurteilen<br />
und über einen Rückkanal auch Vorgaben<br />
der Reederei an die Schiffe übermitteln.«<br />
Genügt der Reederei die Darstellung von<br />
Positions- und Geschwindigkeitsdaten,<br />
wird das Produkt argoTracker eingesetzt.<br />
»ArgoTracker sendet hierfür die Informationen<br />
eines GNSS-Empfängers zyklisch<br />
an einen Webserver, auf den die Reederei<br />
Zugriff hat«, erklärt Alexander Lutz. Weitere<br />
optionale Funktionen bieten die Module<br />
argoTracks (Leitlinienservice), argo-<br />
LaneWarning (Kollisionswarnung) auf<br />
Basis des Automatic Identification System<br />
(AIS), argoTargetPilot (Folgefahrt von<br />
AIS-Zielen) und der argoHapticTiller<br />
(Tiller mit haptischem Feedback). »Mit<br />
Hilfe der modernen Steuerungsarchitektur<br />
von Bachmann electronic<br />
können wir Module für alle Bereiche der<br />
Navigation, der Überwachung und des<br />
Flottenmanagements von Binnenschiffen<br />
umsetzen und erleichtern so gemeinsam<br />
die tägliche Arbeit des Schiffsführers«,<br />
fasst Alexander Lutz abschließend zusammen.<br />
Weitere Projekte geplant<br />
Um auch zukünftig wegweisende Lösungen<br />
für die <strong>Binnenschifffahrt</strong> anbieten zu<br />
können, arbeitet die Argonics GmbH an<br />
verschiedenen Forschungsprojekten wie<br />
die sich mit Platooning, automatischem<br />
Schleusen sowie der Fernsteuerung von<br />
Binnenschiffen befassen.<br />
<br />
Argonics<br />
Die Argonics GmbH wurde 2014<br />
in Stuttgart gegründet. Sie ging<br />
aus der Unternehmung »3G Navigation«<br />
der Existenzgründergesellschaft<br />
TTI GmbH der Universität<br />
Stuttgart hervor. Bei Argonics<br />
entstehen Produkte für die<br />
Navigation und Überwachung<br />
von Schiffen.<br />
© Argonics<br />
Mit dem argoDataPortal lassen sich einzelne Binnenschiffe sowie gesamte Flotten überwachen<br />
Bachmann electronic<br />
Bachmann electronic mit Sitz im<br />
österreichischen Feldkirch ist auf<br />
die Automatisierung, Netzmessung<br />
und -schutz, Visualisierung<br />
und Zustandsüberwachung von<br />
Maschinen und Anlagen spezialisiert.<br />
Seit über 50 Jahren werden<br />
dort Lösungen für die Energiebranche,<br />
Industrie sowie für maritime<br />
Anwendungen gefertigt.<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
15
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | WERFT DES JAHRES<br />
Aus Tradition innovativ<br />
Innovativ war die Hitzler Werft schon immer. Seit ihrer Gründung im Jahr 1885 in<br />
L auenburg an der Elbe sind dort über 800 Schiffe diversen Typs gebaut worden, darunter<br />
seegehende Tanker, Forschungsschiffe, Bohrinselversorger, Schlepper und Eisbrecher<br />
Seit weit mehr als 130 Jahren entstehen auf der Hitzler Werft an der Elbe neue Schiffe. Auch das Reparaturgeschäft gehört zum Portfolio<br />
© Wroblewski<br />
Anfang 2021 hat Kai Klimenko gemeinsam<br />
mit seinem Vater Marek die traditionsreiche<br />
Hitzler Werft übernommen.<br />
Nach Jahrzehnten im Familienbesitz<br />
wurde die Werft mangels Nachfolger an<br />
das Vater-Sohn-Gespann verkauft. Seitdem<br />
weht ein frischer Wind durch die<br />
Lauenburger Schiffbauhallen. Geschäftsführer<br />
Kai Klimenko sprach mit der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
über aktuelle Projekte und<br />
darüber, wie die Hitzler Werft den derzeitigen<br />
Herausforderungen, wie zum Beispiel<br />
der Dekarbonisierung und Emissionsreduzierung,<br />
begegnet.<br />
Haben gemeinsam die Werft im März 2021 übernommen: Marek Klimenko (li.) und Sohn Kai<br />
© Hitzler<br />
Der Bau innovativer Schiffstypen scheint<br />
in der DNA der Hitzler Werft zu liegen –<br />
an welchen Schiffsprojekten beziehungsweise<br />
Konzepten arbeiten Sie gegenwärtig?<br />
Kai Klimenko: Die Hitzler Werft ist seit<br />
ihrer Gründung sehr innovativ. Das belegen<br />
unter anderem die zahlreichen Patente,<br />
über die wir verfügen und die Erfindungen,<br />
die auf unserer Werft im Laufe<br />
der Zeit gemacht wurden. So sind zum<br />
Beispiel Komponenten wie das Hitzler-<br />
Ruder, das Hitzler-Steuerhaus oder<br />
Stampfanlagen bei uns entwickelt und<br />
gebaut worden. Aber auch komplett neue<br />
Schiffstypen wie der Hitzler-Versorger,<br />
ein für die Versorgung von Ölbohrplattformen<br />
konzipiertes Schiff.<br />
Derzeit schließt sich mit dem »Wallaby<br />
Boat«, ein Projekt, an dem wir aktuell arbeiten<br />
und das in unserer großen Werfthalle<br />
langsam Gestalt annimmt, der Kreis<br />
zu den Offshore-Versorgern von damals.<br />
Dieser Neubau eines Offshore-Crew-<br />
Transfer-Vessels basiert auf einem innovativen<br />
Konzept mit federgelagerten<br />
Kufen, die den Seegang ausgleichen. Damit<br />
können auch Menschen, die unter<br />
16 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>
WERFT DES JAHRES | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
© Wroblewski<br />
©Wallaby Boats<br />
Derzeit entsteht ein Offshore-Windpark-Versorger auf der Werft, er wird die Umweltstandards Tier 3, Blauer Engel und Hybrid Power plus erfüllen<br />
Seekrankheit leiden, bei schwierigen<br />
Wetterverhältnissen auf dem Schiff arbeiten.<br />
Es bietet zudem mehr Sicherheit,<br />
vor allem im Hinblick auf einen sicheren<br />
Überstieg auf die Windplattform.<br />
Außerdem arbeiten wir momentan an<br />
mehreren Projekten zur Elektrifizierung<br />
von bestehenden Schiffen sowie auch von<br />
kompletten Neubauten. Vorhaben, die<br />
ebenfalls zu einer sauberen Schifffahrt<br />
beitragen sollen und mit denen wir uns<br />
aktuell beschäftigen, sind die Entwicklung<br />
von Methanol-Antrieben für Binnenschiffe<br />
sowie die von Brennstoffzellentechnik.<br />
Dabei arbeiten wir sowohl<br />
für öffentliche als auch private Auftraggeber.<br />
Ein weiteres Thema für uns sind<br />
Schiffe mit Hybrid-Antrieben.<br />
Welche Voraussetzungen bringt Ihre<br />
Werft mit, um die verschiedenen Schiffstypen<br />
bauen zu können?<br />
Klimenko: Wir verfügen über Neubaukapazitäten<br />
auf zwei Helgen à 130 m x<br />
18 m. Unser werfteigenes Konstruktionsbüro<br />
ermöglicht zudem die Entwicklung<br />
diverser Schiffstypen, auch mit sehr<br />
komplexen Strukturen. Nicht zuletzt<br />
können wir auf jahrzehntelange Erfahrung<br />
zurückgreifen, auch aus Projekten,<br />
die wir für fremde Werften realisiert<br />
haben.<br />
Egal ob Binnen- oder Seeschifffahrt, hier<br />
wie dort müssen Emissionen eingespart<br />
werden. Welche Antriebskonzepte beziehungsweise<br />
energiesparende Lösungen<br />
bieten Sie Ihren Kunden?<br />
Klimenko: Wir haben zum Beispiel diesel-elektrische<br />
Antriebe im Portfolio, die<br />
bereits für eine spätere Umrüstung auf<br />
komplett emissionsfreie Antriebe vorbereitet<br />
sind – bei denen später der Austausch<br />
des Dieselgenerators beispielsweise<br />
gegen Brennstoffzelle erfolgen<br />
kann. Wir bieten außerdem methanolelektrische<br />
oder batterie-elektrische Antriebe.<br />
Eine weitere Stellschraube, um Emissionen<br />
zu sparen, ist die Optimierung von<br />
Schiffslinien, die zu geringeren Brennstoffverbräuchen<br />
führt. Die Schiffslinienoptimierung<br />
ist gerade in der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
im Hinblick auf Niedrigwasserphasen<br />
ein wichtiger Punkt. Hier<br />
bieten wir den Reedern und Partikulieren<br />
ein »Rundum-Sorglos«-Paket mit einem<br />
komplett neuen Hinterschiff an.<br />
Derzeit gibt eine Vielzahl an potenziellen<br />
Kraftstoffen beziehungsweise an alternativen<br />
Antriebskonzepten. Glauben Sie,<br />
dass diese Vielfalt dauerhaft bleiben wird<br />
oder wird sich langfristig eine Lösung<br />
durchsetzen?<br />
Klimenko: Vielfalt in der Form wie jetzt<br />
führt zu Schwierigkeiten in der Beschaffung<br />
der Kraftstoffe, aktuell ist es<br />
ein großes Thema bei LNG, welches gerade<br />
in der <strong>Binnenschifffahrt</strong> nur bedingt<br />
verwendet werden kann. Ich denke, es<br />
wird eine Reduzierung in Hinblick auf<br />
die Anzahl der Kraftstoffe geben, aber<br />
keinen »Universalkraftstoff« wie es der<br />
Diesel war. Bei Antriebskonzepten wird<br />
die Vielfalt jedoch bleiben und sogar<br />
Hitzler Werft, Lauenburg<br />
noch größer werden, je nach Anforderung<br />
des Schiffes und des Einsatzgebietes.<br />
Bei vielen Ihrer Projekte holen Sie Industriepartner<br />
mit an Bord, wie wichtig sind<br />
solche Partnerschaften aus Ihrer Sicht?<br />
Klimenko: Partnerschaften sind generell<br />
wichtig, zum einen um voneinander zu<br />
lernen, zum anderem, um sich ständig<br />
weiter zu entwickeln. Die Schifffahrt ist<br />
inzwischen zu kompliziert geworden, um<br />
ein Schiff von A-Z komplett auf der Werft<br />
bauen zu können. Partnerschaften garantieren<br />
für jedes Aufgabengebiet Spezialisten,<br />
die den Kunden maximalen Erfolg<br />
bringen. Genauso, wie man sich bei den<br />
Motoren auf Spezialisten verlässt, anstatt<br />
sie selbst zu fertigen, blicken wir beispielsweise<br />
in der E-Technik oder Nautik<br />
auf teilweise jahrelange Partnerschaften<br />
zurück.<br />
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welches<br />
Schiff würden Sie gern auf der Hitzler-Werft<br />
bauen?<br />
Wir sind dafür bekannt, Prototypen zu<br />
bauen. Die Herausforderung der Entwicklung<br />
eines neuen Schiffstyps als Beginn<br />
einer neuen Serie wäre für uns daher<br />
am reizvollsten.<br />
• Die Werft wird 1885 von Johann<br />
Georg Hitzler gegründet und befindet<br />
sich bis 2021 im Familienbesitz.<br />
• Am 1. März geht die Werft in die<br />
Hände von Marek und Kai Klimenko.<br />
Marek Klimenko war bis dato über 30<br />
Jahre Werft-Mitarbeiter, zuletzt als<br />
Konstruktionsleiter tätig.<br />
• Der Fokus der Hitzler Werft liegt sowohl<br />
auf dem Reparaturgeschäft als<br />
auch auf Neubauten.<br />
• Die Werft verfügt über zwei Helgen<br />
von 130 m x 18 m sowie Slipanlagen<br />
von 135 m und 85 m Länge.<br />
• Rund 50 Mitarbeiter sind derzeit im<br />
Unternehmen beschäftigt, mit externen<br />
Beschäftigten arbeiten insgesamt<br />
knapp 120 Personen auf der<br />
Werft.<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
17
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | ZUKUNFTSWEISENDER SCHIFFBAU<br />
Pionierin mit Batterie und Brennstoffzelle<br />
Schon vor ihrer Taufe, die im Mai in Berlin stattfand, machte die »Elektra« als weltweit<br />
erstes Schubboot mit Brennstoffzellen und Batterien an Bord Schlagzeilen. Sie ist die<br />
Pionierin, die den Weg für eine emissionsfreie <strong>Binnenschifffahrt</strong> bereitet<br />
© Förster<br />
© Förster<br />
Damit die »Elektra« emissionsfrei über die Elbe fahren kann, wird sie mit Wasserstoff (oben rechts) und Akku-Strom (unten rechts) versorgt<br />
© EST Floattech<br />
Zwei Jahre lang wurde sie bei der Barthel<br />
Werft in Derben an der Elbe gebaut.<br />
Ebenso lange nimmt die Erprobung<br />
dieses Pionierschiffes in Anspruch.<br />
Die »Elektra« wurde mit dem Anspruch<br />
gebaut, komplett emissionsfreie<br />
Schubfahrten auf der Langstrecke möglich<br />
zu machen. Als Primär-Energiequellen<br />
stehen an Deck hinter dem<br />
Steuerhaus drei Brennstoffzellen-Module<br />
mit einer Leistung von jeweils 100 kW<br />
zur Verfügung. Sie beziehen den zur<br />
Stromerzeugung mittels Elektrolyse nötigen<br />
Wasserstoff aus direkt dahinter platzierten<br />
Tankcontainern. Sechs der sogenannten<br />
H2-MEGC-Speicherbehälter<br />
können je 125 kg gasförmigen Wasserstoff<br />
bei einem Druck von 500 bar aufnehmen.<br />
Das Brennstoffzellensystem soll<br />
künftig die Grundlast der zwei je 210 kW<br />
leistenden Elektromotoren abdecken, die<br />
die Schottel-Ruderpropeller antreiben.<br />
Die zweite »grüne« Komponente sind<br />
die unter Deck eingebauten Lithium-<br />
Ionen-Akkus von EST Floattech mit insgesamt<br />
2,5 MW, die sowohl für den Antrieb<br />
als auch für das Bordnetz zur Verfügung<br />
gestellt werden. Das entspricht einer<br />
Batteriekapazität von 60 Mittelklasse-<br />
Elektroautos.<br />
Als drittes liefert schließlich eine Photovoltaikanlage<br />
mit 2,1 kWp auf dem<br />
Dach des Steuerhauses zusätzlich Strom<br />
aus Sonnenenergie. Mehr als 3.000 m Kabel<br />
verteilt auf 20 m Schiffslänge verteilen<br />
Energie und Daten auf dem 130 t<br />
schweren Schubboot. Die Abwärme der<br />
Brennstoffzellen wird über eine Sole-<br />
Wärmepumpe genutzt, um die Wohnräume<br />
zu heizen.<br />
Die Reichweite als Schubverband soll<br />
bei 400 km liegen. Bis zu 1.400 t an Ladung<br />
sollen einmal von Berlin aus bis<br />
nach Hamburg transportiert werden<br />
können, als Anker-Kunde hat Siemens<br />
bereits Bedarf angemeldet. Insgesamt<br />
können Verbände mit bis 150 m Länge<br />
gefahren werden.<br />
Die Versorgung mit Wasserstoff erfolgt<br />
künftig im Westhafen bei der BEHALA<br />
und im Hafen Lüneburg. Während der<br />
Liegezeiten bezieht die »Elektra« Landstrom<br />
und lädt ihre Batterien auf. Da es<br />
bislang keine Standards für die Ladeleistung<br />
gibt, wurden auf dem Schubboot eine<br />
ganze Reihe von Wechselstrom- und<br />
Gleichstrom-Anschlüssen geschaffen,<br />
um für alle Fälle gerüstet zu sein.<br />
Mit dem Industrie- und Gewerbepark<br />
Mittelelbe/H2 Green Power & Logistics<br />
hat die TU Berlin einen Liefervertrag zur<br />
Befüllung und zum Transport der Tanksysteme<br />
(Multiple Energy Gas Container<br />
– MEGC) mit grünem Wasserstoff bis<br />
zum Ende der Projektlaufzeit Ende 2024<br />
abgeschlossen. Diese MEGC können mit<br />
dem bordeigenen Kran getauscht werden.<br />
Die Gesamtkosten für den Bau des<br />
Schiffes belaufen sich auf und<br />
14,6 Mio. €. Die Crew wird von der HGK<br />
Shipping gestellt. Sie war von Anfang an<br />
als Projektpartner mit an Bord. <br />
18 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>
ZUKUNFTSWEISENDER SCHIFFBAU | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
Arbeitsboote werden elektrisch<br />
Mit der Kiellegung für den ersten »E-Spatz« auf der Schiffswerft Bolle in Neuderben wurde<br />
eine neue Generation von WSV-Arbeitsschiffen geboren. Im Gegensatz zu seinen<br />
Vorgängern wird dieses Boot nicht mit einem Diesel, sondern elektrisch angetrieben<br />
Kiellegung des Schiffes auf der Bolle-Werft<br />
© WSV<br />
Animation der »E-Spatz«<br />
Im Zuge der Dekarbonisierung und Emissionsreduzierung rüstet<br />
die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes<br />
(WSV) ihre Schiffe mit umweltfreundlichen Antrieben aus. So<br />
zum Beispiel auch die Arbeitsschiffe vom Typ »Spatz«, die bisher<br />
mit konventionellen Dieselmotoren fuhren. Mit der im Sommer<br />
erfolgten Kiellegung des ersten »Elektrospatzes« ging eine neue<br />
Generation dieses Schiffstyps an den Start.<br />
Bei dem »E-Spatz« handelt es sich um ein multifunktionales<br />
Arbeitsschiff, das auf den Flüssen und Kanälen des Westdeutschen<br />
Kanalnetzes eingesetzt wird. Der Neubau wird eine<br />
Länge von 16,90 m und eine Breite von 4,50 m aufweisen.<br />
Anders als der dieselbetriebene Vorgänger wird der »E-Spatz«<br />
ausschließlich mit zwei Elektromotoren a 80 kW angetrieben.<br />
Das Antriebssystem liefern Jastram, Kadlec & Brödlin und Tesvolt.<br />
Ihre Kooperationen hatten die drei Unternehmen auf der<br />
STL 2021 in Kalkar bekannt gegeben. Das umweltfreundliche<br />
Antriebskonzept wird aus Batterien der Firma Tesvolt, einem<br />
Elektromotor von Danfoss und einem Ruderpropeller von Jastram<br />
bestehen. Die Batterien sollen über Nacht laden, wenn das<br />
Schiff am Anleger liegt.<br />
»E-Spatz« als Prototyp<br />
Die Technik des E-Spatzes ist laut WSV exakt auf die Bedingungen<br />
im Einsatzgebiet zugeschnitten, auf die Schleusenabmessungen,<br />
Brückendurchfahrtshöhen, Wasserstände und<br />
Strömungen. Das Schiff soll unter anderem in der Verkehrssicherung<br />
und Verkehrsüberwachung eingesetzt sowie bei Peilarbeiten.<br />
Der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung zufolge<br />
sind mehr als 130 Arbeitsschiffe dieses Typs auf den Bundeswasserstraßen<br />
im Einsatz.<br />
Nach Fertigstellung des »E-Spatz«-Piloten, die zum Jahreswechsel<br />
vorgesehen ist, und der Erprobung sollen in den kommenden<br />
Jahren weitere Arbeitsschiffe mit emissionsarmen Antrieben<br />
ausgestattet werden.<br />
<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
19
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | ZUKUNFTSWEISENDER SCHIFFBAU<br />
EMS »Berg«– preisgekrönt und sauber<br />
Die Bayerische Seen-Schifffahrt hat mit ihrem Fahrgastschiff EMS »Berg« in Innovationen<br />
und Umweltfreundlichkeit investiert. Jetzt zählt sie zu den größten rein mit Batterien<br />
angetriebene Schiff auf einem deutschen Binnengewässer<br />
Mit einer Batterieladung kann die EMS »Berg« bis zu zehn Stunden über den Starnberger See fahren<br />
Eigentlich sollte der Neubau für die<br />
Bayerische Seen-Schifffahrt ein konventionelles<br />
Schiff werden. So war es<br />
auch noch gedacht, als der Auftrag bei<br />
der Lux-Werft in Mondorf platziert wurde.<br />
Doch dann kam es zum Umdenken:<br />
Warum nicht Elektro- statt Dieselmotoren?<br />
Im Ergebnis entstand die EMS<br />
»Berg«, das größte rein mit Batterien angetriebene<br />
Schiff auf einem deutschen<br />
Binnengewässer. Für diesen mutigen und<br />
technologisch vorbildhaften Ansatz hat<br />
die Reederei den Innovationspreis <strong>Binnenschifffahrt</strong>,<br />
gestiftet von der Allianz<br />
Esa, erhalten.<br />
Die für 300 Personen zugelassene EMS<br />
»Berg« ist mit 35 m Länge und 8,20 m<br />
Breite bei einem Tiefgang von 1,25 m das<br />
derzeit größte vollelektrisch betriebene<br />
Schiff in Deutschland. Mit ihren zwei<br />
Elektromotoren und einer Batterieleistung<br />
von 1.600 kWh fährt sie absolut klimaneutral<br />
und lautlos über den Starnberger See.<br />
Für die EMS »Berg« lieferte die Werft<br />
nach rund 25.000 Arbeitsstunden neben<br />
dem Schiff auch die vollständige Ladetechnologie<br />
einschließlich eines speziellen<br />
Elektroanschlusses an der Backbordseite.<br />
Die Ladetechnik an Bord wird<br />
über einen Spezial-Drehstromstecker mit<br />
© Förster<br />
dem Landanschluss verbunden und versorgt<br />
die in zwei getrennten Räumen unter<br />
Deck untergebrachten Lithium-<br />
Ionen-Akkus mit 2 x 400 VAC (2 x<br />
80 kW). Die Batterien sind für rund<br />
6.000 bis 8.000 Ladezyklen ausgelegt und<br />
sollen rund 30 Jahre halten.<br />
Das Bordnetz mit 700 V Gleichstrom basiert<br />
auf einem Hochvolt-Stromkreis mit<br />
hohen Sicherheitsstandards und speziellen<br />
Schützen, die jeweils redundant ausgeführt<br />
sind. Am ertüchtigten Schiffsanleger im<br />
Hafen Starnberg liefern die Stadtwerke umweltfreundlichem<br />
Öko-Drehstrom, um die<br />
Batterien über Nacht aufzuladen.<br />
Mit einer vollen Batterieladung von<br />
1.600 kWh kann die »Berg« bis zu zehn<br />
Stunden lang über den 21 km langen<br />
Starnberger See kreuzen – das reicht, um<br />
den täglichen Fahrplan im Südteil des<br />
Sees zu bedienen. Das Schiff erreicht dabei<br />
eine Höchstgeschwindigkeit von<br />
22 km/h.<br />
Für den Vortrieb sorgen zwei elektrische<br />
STP-100 Twin Propeller von<br />
Schottel mit je 200 kW Leistung, die in<br />
getrennten Hauptantriebsräumen im<br />
Achterschiff untergebracht sind, dazu<br />
kommt ein STT-60-Bugstrahler als Manövrierhilfe<br />
und Hilfsantrieb mit 75 kW<br />
Leistung. Eine Wärmepumpe mit Klimasatz<br />
dient zum Heizen und Kühlen von<br />
Innenräumen und Steuerhaus.<br />
Die Investition für das Schiff belief sich<br />
auf rund 5,3 Mio. €.<br />
<br />
Motorenraum mit Elektro-Motoren<br />
Lithium-Ionen-Akkus<br />
Liegeplatz mit Stromversorgung<br />
20 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>
ZUKUNFTSWEISENDER SCHIFFBAU | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
Autonomes Elektro-Wassertaxi für Kiel<br />
Hoch im Norden, auf der Kieler Gebr. Friedrich Schiffswerft, entsteht ein Prototyp eines<br />
ÖPNV-Fahrzeugs der Zukunft – das autonome Wassertaxi »Wavelab«. Angetrieben wird<br />
der Katamaran von emissionsfreien Elektromotoren<br />
© Gebrüder Friedrich/Fachhochschule Kiel<br />
© Torqeedo<br />
So soll das neue Wassertaxi aussehen, das auf der Kieler Förde zum Einsatz kommt<br />
Deep Blue Motor von Torqeedo<br />
Das neue, elektrisch fahrende Boot soll in der schleswig-holsteinischen<br />
Landeshauptstadt künftig als Wassertaxi auf der<br />
Kieler Förde verkehren. Das Elektroschiff mit der Bezeichnung<br />
»Wavelab« wird zunächst als Forschungsplattform für die Initiative<br />
»Clean Autonomous Public Transport Network« (CAPTN)<br />
in Kiel dienen.<br />
Herzstück dieses Vorhabens sind autonome emissionsarme<br />
Personenfähren. Das Teilprojekt CAPTN »Förde Areal« erhielt<br />
eine Förderung des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur<br />
von rund 6,1 Mio. € für den Bau des Versuchsträgers,<br />
die Errichtung der notwendigen Infrastruktur und die Programmierung<br />
der Systeme für die ersten autonomen Fahrversuche.<br />
Die Verantwortung für die Umsetzung und Koordination<br />
des Projektes trägt die Forschungs- und Entwicklungszentrum<br />
Fachhochschule Kiel GmbH. Kooperationspartner sind die<br />
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), die Fachhochschule<br />
(FH) Kiel sowie die ADDIX GmbH, Raytheon Anschütz<br />
GmbH und Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.<br />
Als Katamaran unterwegs<br />
Die Forschungsplattform in Form eines Katamarans wird aus Aluminium<br />
bestehen, ca. 20 m lang und acht Meter breit sein. In einem<br />
rund zehn Quadratmeter großen Deckshaus sind die Brücke<br />
und die Arbeitsplätze für Wissenschaftler untergebracht. Die dahinterliegende<br />
Freifläche soll ausreichend Platz für eine flexible<br />
Gestaltung der Forschungsprojekte bieten. Ein umlaufender Sensorrahmen<br />
oberhalb des Decks ermöglicht die Installation der<br />
Sensorik für autonome Fahrversuche und diverse Spezialkameras<br />
für eine Rundumsicht. Angetrieben wird der Forschungskatamaran<br />
von zwei Elektro-Motoren, die aus Batterien gespeist<br />
werden. In den Rümpfen befinden sich außerdem zwei Versuchsräume<br />
mit großzügigen Möglichkeiten zur Datenspeicherung und<br />
-verarbeitung.<br />
Im Rahmen des Vorhabens wurde Torqeedo ausgewählt, um das<br />
vollständig integrierte elektrische Antriebssystem zu liefern. Das<br />
Paket umfasst zwei 50-kWDeep Blue Motoren mit lenkbarem Ruderpropeller<br />
und sechs Deep Blue Lithium-Ionen-Batterien mit einer<br />
Gesamtkapazität von 240 kWh. Vier Power 24–3500-Batterien<br />
versorgen das 24-V-Bordnetz. Das Antriebssystem wird durch ein<br />
22 kW-Schnellladegerät, einen DC/DC-Wandler und einen DC/<br />
AC-Wandler vervollständigt.<br />
Für die Steuerung und Überwachung des Schiffs in Echtzeit<br />
von einer landgestützten Leitstelle ist das ebenfalls in Kiel ansässige<br />
Unternehmen Raytheon Anschütz verantwortlich. Es entwickelt<br />
den sicheren und leistungsfähigen Datenaustausch – zum<br />
Beispiel, wenn es um Kollisionsvermeidung, Manövrieren oder<br />
Andocken angeht – zwischen den Schiffen des digitalen Testfelds<br />
sowie zwischen den Schiffen und der Leitstelle an Land.<br />
Seine ersten (teil)autonomen Fahrversuche soll das Wassertaxi<br />
in Kooperation mit der Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe<br />
und Marinewaffen der Bundeswehr, Maritime Technologie und<br />
Forschung (WTD71) absolvieren. Die Wasserfläche des Marinearsenals<br />
in Kiel ist gut für die Erprobung autonomer Fahrversuche<br />
geeignet. Sie ist für die zivile Schifffahrt gesperrt, durch eine Mole<br />
geschützt und verfügt über einen Anschluss an die Kieler Förde.<br />
Die Erprobungsphase wird nach der geplanten Übergabe von<br />
»Wavelab« Ende <strong>2022</strong> erfolgen.<br />
<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
21
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | ABGASNACHBEHANDLUNG & ANTRIEBSTECHNIK<br />
Schubboote mit sauberem Abgasstrom<br />
Für eine deutliche Verringerung der meisten Schadstoffe sorgen Abgasreinigungsanlagen<br />
wie die von Tehag. Der Spezialanbieter hat zwei Werksschiffe von ThyssenKrupp Steel in<br />
Duisburg mit Partikelfiltern und SCR-Anlagen ausgerüstet<br />
Die »Thyssen 1« im Werkshafen-Verkehr von ThyssenKrupp Steel<br />
Im Werkshafen von ThyssenKrupp Steel rangieren seit Sommer<br />
2021 zwei neuartige Leichter: die »Thyssen 1« und das Schwesterschiff<br />
»Thyssen 2«. Unter Deck der diesel-elektrisch betriebenen<br />
Schubschiffe arbeiten zwei überaus kräftige Motoren<br />
von Caterpillar, um Leichter mit jeweils bis zu 2.700 t Erz, Kohle<br />
oder Koks zwischen Rhein und den Hafenbecken in Schwelgern<br />
und Duisburg-Walsum zu bugsieren – insgesamt sind es 23 Mio. t<br />
im Jahr. Bei einem Tiefgang von nur 1,7 m bei 30 % Beladung<br />
können die beiden neuen Einheiten auch bei Niedrigwasser noch<br />
operieren. Der Abgas-Spezialist Tehag hat dafür die größten bis<br />
dato auf einem Binnenschiff verbauten Filter- und SCR-Anlagen<br />
geliefert.<br />
Im Zuge der Flotten-Modernisierung ersetzte der Duisburger<br />
Stahlkonzern zwei ältere Rhein-Schubboote. Die beiden Schubeinheiten<br />
sind je 27,7 m lang und 10,6 m breit. Jeweils vier Generatorensets<br />
bringen ihre Leistung zu zwei Voith-Schneider-<br />
Propellern mit je 780 kW. Es befinden sich also jeweils auch vier<br />
kombinierte Abgasreinigungsanlagen an Bord.<br />
Das Partikelfilter-System arbeitet nach dem sogenannten Wall-<br />
Flow Prinzip, bei dem das Abgas durch wechselseitig verschlossene<br />
Filterkanäle geführt wird. Die Kanalwände haben dabei eine<br />
definierte Porenstruktur, so dass Gasphase über den Nachbarkanal<br />
entweichen kann, während nahezu sämtliche Feststoffe aus<br />
dem Abgas gefiltert werden. Die Filtermodule wurden zusätzlich<br />
mit einer katalytischen Beschichtung versehen, wodurch auch die<br />
gasförmigen Schadstoffe Kohlenmonoxid (CO) und Kohlenwasserstoffe<br />
(HC) nachhaltig reduziert werden. Den Filtersystemen<br />
nachgeschaltet wurde je ein SCR-System, das durch das<br />
Reaktionsmittel Harnstoff (Adblue) die Stickoxidemissionen<br />
(NOx) in einem speziellen Katalysator reduziert.<br />
Um für Wartungsarbeiten an Gewicht zu sparen, sind zwei Filter-Module<br />
AWF 1700 mit jeweils 25 kg gewählt worden. Die Filtersubstrate<br />
sind für eine höhere Wirkung zusätzlich katalytisch<br />
beschichtet, danach kommt die SCR-Anlage. Das soll den potenziellen<br />
Schadstoffausstoß so weit, wie es heute technisch möglich<br />
ist, senken. Rußpartikel werden um 90 % reduziert, CO und<br />
HC (Kohlenwasserstoffe) über die Katalyse dem Hersteller zufolge<br />
»teilweise bis zur Nachweisgrenze« verringert. Die Emission<br />
von NOx wird in den Spitzen zu mehr als 90 % verhindert.<br />
Damit schaffen die Schiffe, abgesehen von CO2, bei allen vier<br />
wichtigen Schadstoffgruppen im Diesel-Abgasstrom die maximale<br />
Reduktion. Die Betriebsdauer gibt der Hersteller mit rund<br />
4.000 bis 6.000 Stunden an. Dann müssten die Tehag-Anlagen<br />
zwei- bis dreimal gewartet werden. Beim SCR ist es in der Regel<br />
nur eine technische Überprüfung, die Filter müssten dagegen<br />
trotz ihrer aktiven Regeneration ausgebaut und von Ölasche befreit<br />
werden.<br />
<br />
© ThyssenKrupp Steel<br />
Maschinenraum der »Thyssen 2«<br />
Aufbau- und Funktionsschema eines SCR-Systems aus dem Hause Tehag<br />
© Tehag<br />
22 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>
WÄRTSILÄ<br />
Motor mit Zertifizierung nach Stufe V<br />
©Wärtsilä<br />
Der schnelllaufende »Wärtsilä 14«<br />
Der finnische Hersteller Wärtsilä hat die<br />
Motoren-Zertifizierung für die EU-Stufe<br />
V erhalten. Der »Wärtsilä 14« erfüllt damit<br />
die NRMM-Norm für Binnenschiffe. Die<br />
Zertifizierung gilt für die Gesamtlösung<br />
einschließlich des Wärtsilä 14-Motors<br />
und des Abgasnachbehandlungssystems.<br />
Die ersten Lieferungen des neu zertifizierten<br />
Motors »Wärtsilä 14« sind für<br />
zwei neue Passagierfähren, die von der<br />
Shiptec AG für das Schweizer Unternehmen<br />
General Navigation Company<br />
(CGN) gebaut werden, bestimmt. Die<br />
Fähren werden zwischen der Schweiz<br />
und Frankreich über den Genfer See verkehren.<br />
Das erste Schiff soll voraussichtlich<br />
im Dezember <strong>2022</strong> in Betrieb gehen.<br />
Die 2020 in Kraft getretene Stufe V-Gesetzgebung<br />
verschärft die Beschränkungen<br />
für Non-Road-Motoren<br />
(NRMM) und setzt strengere Grenzwerte<br />
für Emissionen, insbesondere für Partikel<br />
(PM) und Stickoxide (NOx). Die Zertifizierung<br />
nach Stufe V ist für alle Motoren<br />
erforderlich, die in der europäischen <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
zum Einsatz kommen. Die<br />
Flotte zählt insgesamt 17.500 Schiffe.<br />
Der schnelllaufende »Wärtsilä 14« ist<br />
in 12– und 16-Zylinder-Konfigurationen<br />
und mit einem Leistungsspektrum von<br />
749–1340 kWm für den mechanischen<br />
Antrieb und von 675–1155 kWe für<br />
Hilfsaggregate und diesel-elektrische Anwendungen<br />
erhältlich. Angeschlossen ist<br />
das NOx-Reduktionssystems (NOR) von<br />
Wärtsilä, das die Technologie der selektiven<br />
katalytischen Reduktion (SCR) und<br />
einen Dieselpartikelfilter (DPF) nutzt.<br />
Messungen des TÜV Nord haben<br />
nachgewiesen, dass das System alle erforderlichen<br />
Leistungs- und Funktionsmerkmale<br />
erfüllt. Die endgültige Typgenehmigung<br />
wurde von der GDWS erteilt.<br />
<br />
NORIS | AUGUST STORM<br />
Partnerschaft für Refit-Projekte<br />
Moderne Steuerungssysteme für ältere<br />
Motoren können den Schiffsbetrieb deutlich<br />
effizienter machen – vor diesem Hintergrund<br />
haben der Motoren-Dienstleister<br />
und der Automationsspezialist ihre Expertise<br />
gebündelt. Das neue Service-Angebot<br />
richtet sich auch an die <strong>Binnenschifffahrt</strong>.<br />
Mit seinem ausgedehnten Netzwerk an<br />
Technikern will Storm im Verbund mit<br />
Noris künftig verstärkt den Bereich des<br />
Retrofits abdecken.<br />
Die Noris Group aus Nürnberg kann<br />
neben komplexen Automatisierungssystemen<br />
auch die komplette Messkette<br />
liefern: von der Sensorik über die Signalverarbeitung<br />
bis hin zur Visualisierung,<br />
sprich das Brücken-Design für ein einheitliches<br />
»Look and Feel« im Steuerhaus.<br />
Als sogenannter OEM (Original<br />
Equipment Manufacturer) ist Noris bereits<br />
Zulieferer bei vielen Motoren-Herstellern<br />
oder Hauptlieferanten. <br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
23
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | ABGASNACHBEHANDLUNG & ANTRIEBSTECHNIK<br />
FISCHER ABGASTECHNIK<br />
Mit Abgas-Behandlung zu weniger Schadstoffen<br />
Im Zuge der Klimadebatte werden Emissionen<br />
immer strenger reglementiert,<br />
auch in der <strong>Binnenschifffahrt</strong>. Um die<br />
heutigen und künftigen Grenzwerte, bei-<br />
Dieselpartikelfilter<br />
© Fischer Abgastechnik<br />
spielsweise für NOx oder Rußpartikel einzuhalten,<br />
gibt es die Möglichkeit der Abgasnachbehandlung<br />
Ein Unternehmen, das auf solche Systeme<br />
spezialisiert ist, ist Fischer Abgastechnik<br />
mit Sitz in Emsdetten. Das Produkt-<br />
und Leistungsportfolio beinhaltet<br />
diverse Systeme zur Abgasnachbehandlung<br />
und zur sogenannten Entstickung.<br />
Dazu gehören beispielsweise Rußpartikelfilter,<br />
Katalysatoren und Thermomanagementsysteme,<br />
wie das im eigenen<br />
Haus entwickelte Brennersystem HeliosFFB<br />
für Motorengrößen bis 1.000 kW.<br />
DeNOx-Entstickungssysteme vervollständigen<br />
die Bandbreite der Möglichkeiten,<br />
um eine spezifische Lösung zusammenzustellen<br />
zu können.<br />
Fischer Abgastechnik verfügt über eigene<br />
Konstruktions-, CFD- und FEM-<br />
Abteilung und unterstützt sowohl die<br />
Entwicklung als auch die Vorbereitung<br />
der Anlagen. Die »EU-Stage V«-ready<br />
und »IMO Tier III«-Systeme werden hier<br />
für Motoren von 19–10.000 kW nach<br />
Kundenanforderungen entwickelt. Jedes<br />
Brenner- und SCR-System wird vorab am<br />
firmeneigenen Teststand aufgebaut.<br />
In Praxis bewährt<br />
Der Abgasspezialist kann bereits eine<br />
lange Referenzliste vorweisen. Eines der<br />
jüngeren Projekte mit Fischer-Lösungen<br />
an Bord ist das »Barefoot Boat« von Til<br />
Schweiger. Auch bei der Nachrüstung des<br />
Frachters »Philipskercke II« war das Unternehmen<br />
dabei und lieferte Rußfilter<br />
und einen SCR-Katalysator zu. Ein weiteres<br />
Referenzobjekt ist das Schubschiff<br />
»Maranta«, das nun die seegängigen<br />
IMO-III-Grenzwerte oder die marinisierte<br />
CCR II- beziehungsweise die EU-<br />
Stufe-V einhält.<br />
<br />
KOEDOOD<br />
EU-Stufe-V-Zertifikat für Mitsubishi-Motoren<br />
Die Koedood Marine Group hat die EU-<br />
Stufe-V-Zertifizierung der Mitsubishi SR-<br />
Motorenfamilie und des Mitsubishi S12A2<br />
für Anwendungen in der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />
erhalten. Alle Motoren sind mit dem<br />
von Koedood entwickelten »Koedood Engine<br />
Emission System« ausgestattet, das<br />
den größten Teil des Stickstoffs und der<br />
Partikel aus den Abgasen entfernt und für<br />
einen saubereren und effizienteren Motorbetrieb<br />
sorgt.<br />
Das EU-Stufe-V-Zertifikat für die Mitsubishi<br />
SR-(470–1.250 kW) und die Mitsubishi<br />
S12A2-Motoren wird im Namen<br />
der Koedood Marine Group entwickelt,<br />
so dass Koedood für beide Motortypen<br />
als Hersteller des Motors anerkannt wird.<br />
Neben einem wesentlich saubereren Abgas<br />
konnten die Motoren so verändert<br />
werden, dass sie 5 % sparsamer laufen als<br />
die ZKR-2-Variante, heißt es von Koedood.<br />
Dies geschah mit der Genehmigung<br />
von Mitsubishi Turbocharger and<br />
Engine Europe B.V. und unter Beibehaltung<br />
der vollen Herstellergarantie.<br />
Die nach EU-Stufe V zertifizierten Motoren<br />
werden unter dem Markennamen<br />
KEES (Koedood Engine Emission Systems)<br />
vermarktet. Das zertifizierte Motoremissionssystem<br />
eignet sich den Angaben<br />
zufolge perfekt für die Lastprofile<br />
der <strong>Binnenschifffahrt</strong>, wo die Motoren<br />
oft lange Zeiträume mit geringer Belastung<br />
ausgesetzt sind, was die Funktion eines<br />
Emissionssystems beeinträchtigen<br />
kann. Beim Betrieb mit geringer Last,<br />
zum Beispiel auf Kanälen, bleibt die Abgastemperatur<br />
hoch genug für einen optimalen<br />
Betrieb des SCR-Katalysators<br />
und des Partikelfilters (DPF), was zu geringeren<br />
Wartungs- und Verbrauchskosten<br />
führt.<br />
<br />
Ist von 470 bis 1.250 kW erhältlich<br />
© Koedood<br />
DANFOSS | VOLVO PENTA<br />
E-Mobilität-Partner<br />
Die maritimen Zulieferer Volvo Penta<br />
und Danfoss Editron haben ein Partnerschaftsabkommen<br />
geschlossen. Das Ziel<br />
ist, gemeinsam »die Entwicklung der<br />
Elektromobilität in der Schifffahrt auf<br />
die nächste Stufe heben«.<br />
Im Rahmen der Partnerschaft wollen<br />
die beiden Unternehmen »die nächsten<br />
Schritte bei nachhaltigen Energielösungen<br />
gehen«. In einer Mitteilung<br />
zur Partnerschaft heißt es, man wolle daran<br />
arbeiten, die eigenen Angebote zu<br />
optimieren.<br />
Durch die Zusammenarbeit bei Forschungs-<br />
und Entwicklungsaktivitäten<br />
wolle man schnell zuverlässige und effiziente<br />
Elektrifizierungspakete für einen<br />
breiteren Teil des kommerziellen Schifffahrtsmarktes<br />
anbieten. Der Ansatz umfasst<br />
Entwurf, Installation, Inbetriebnahme<br />
und After-Sales-Service.<br />
Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden<br />
Unternehmen Danfoss Editron und<br />
Volvo Penta zusammenarbeiten. So gab<br />
es Kooperationen etwa bei einem der<br />
ersten Crew-Transfer-Vessel mit Hybrid-<br />
Antrieb in Großbritannien sowie bei autonomen<br />
Erkundungseinheiten für das<br />
Meeresroboterunternehmen Ocean Infinity.<br />
<br />
24 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>
ABGASNACHBEHANDLUNG & ANTRIEBSTECHNIK | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
MAN ENGINES<br />
Emissionsarme Gasmotoren für die Parsifal-Flotte<br />
Bei der niederländischen Werft Concordia<br />
Damen hat das Energieunternehmen Shell<br />
rund 40 Doppelhüllentanker bestellt. Die<br />
LNG-Antriebstechnik liefert dafür der<br />
deutsche Hersteller MAN Engines aus<br />
Nürnberg. Bis Ende 2024 will Concordia<br />
Damen die 40 neuen Binnenschiffe vom<br />
Typ Parsifal bauen und abliefern. Der<br />
erste Tanker, die »Blue Marjan«, wurde<br />
bereits am 24 Dezember 2021 an Shell<br />
übergeben. Die weiteren Schwesterschiffe<br />
sollen monatlich folgen.<br />
Die Schiffsserie basiert auf dem »Parsifal«-Design<br />
von Damen. Die 110 m langen<br />
und 11,45 m breiten Doppelhüllentanker<br />
kommen bei einer Tragfähigkeit<br />
von 2.800 t gegenüber herkömmlichen<br />
Typen mit einem deutlich verringerten<br />
Tiefgang von 3,25 m aus. Damit sollen sie<br />
selbst bei Niedrigwasser noch den Rhein<br />
und andere europäische Wasserstraßen<br />
befahren können. Insgesamt passen in<br />
die acht Tanks gut 3.000 m3 bei einem<br />
maximalen Tiefgang von 5,05 m.<br />
Gas-elektrisches Antriebssystem<br />
MAN Engines liefert seine Gasmotoren<br />
vom Typ MAN E3262. Diese wurden ursprünglich<br />
für den stationären Einsatz<br />
konzipiert und nun als Antrieb für die<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> adaptiert. Die Zwölf-<br />
Zylinder-Motoren werden in Aggregate<br />
Mit ihrem Gasantrieb werden die Schiffe besonders emissionsarm sein<br />
des niederländischen Partners MAN Rollo<br />
eingebaut. Jeweils zwei dieser Gasmotoren,<br />
die zusammen eine Leistung<br />
von 990 ekW erbringen, bilden in Kombination<br />
mit elektrischen Generatoren<br />
das gas-elektrische Antriebssystem für<br />
die emissionsarmen Tanker. Die Gasmotoren<br />
werden mit LNG betrieben. Das<br />
Flüssigerdgas wird zunächst in Klimaanlagenverdampfern<br />
in den gasförmigen<br />
Zustand zurückverwandelt, damit es als<br />
Kraftstoff in den MAN-Gasmotoren eingesetzt<br />
werden kann. Für das Parsifal-<br />
Projekt liefert MAN Engines einen zertifizierten<br />
Gasmotor und eine Motorsteuerung,<br />
die nach den neuesten EU-<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong>s-Emissionsvorschriften<br />
der Stufe V zugelassen sind. Die<br />
Steuerung für die Motoren kommt von<br />
dem Unternehmen Heinzmann mit Sitz<br />
im baden-württembergischen Schönau.<br />
Die Steuerung wurde den Angaben zufolge<br />
an die Besonderheiten der Anwendung<br />
angepasst und abgestimmt, so<br />
dass die Emissionsgrenzwerte »zuverlässig<br />
und nachhaltig eingehalten und die<br />
strengen Betriebsvorgaben erfüllt werden<br />
können«.<br />
<br />
© Concordia Damen<br />
Dein Partner für<br />
Bunker-Service<br />
Betriebs- und Schmierstoffe für den<br />
sicheren Betrieb Deiner Flotte.<br />
Infos unter:<br />
Tel. +49 40 53798470<br />
hoyer-marine.de<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
25
INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | UMSCHLAGTECHNIK<br />
SENNEBOGEN<br />
Freibeweglicher Elektrobagger mit Akkus<br />
Arbeitet noch weiter, auch wenn er an der Steckdose hängt, der Umschlagbagger 817<br />
Das auf Umschlaggerät spezialisierte Unternehmen<br />
Sennebogen hat mit dem »817<br />
Electro Battery« ein neues Maschinenkonzept<br />
entwickelt, nämlich einen Elektro-<br />
Umschlagbagger mit Akkutechnik.<br />
Der akkugestützte Elektro-<br />
Umschlagbagger 817 Electro Battery ist<br />
der erste der frei beweglichen Akkumodelle,<br />
mit denen Sennebogen seine Elektro-Baureihe<br />
ergänzt. Dank einem »Dualem<br />
Power Management« bieten diese neben<br />
der »absoluten« Bewegungsfreiheit<br />
weiterhin auch alle Vorteile kabelgebundener<br />
Elektrobagger, so der Hersteller.<br />
Mit dem neuen, mobilen Elektro-<br />
Umschlagbagger mit Akkutechnik lässt<br />
sich noch weiterarbeiten, wenn er gerade<br />
zum Nachladen am Stromnetz angeschlossen<br />
ist. Im Netzbetrieb sorgt das<br />
Duale Power Management dafür, dass<br />
die Stromversorgung des Netzes für die<br />
Arbeitsbewegungen genutzt wird, während<br />
gleichzeitig die überschüssig eingespeiste<br />
Leistung die Batterien wiederauflädt,<br />
sodass die Maschine anschließend<br />
erneut autark arbeiten kann. Bei angenommenen<br />
2.000 Betriebsstunden<br />
jährlich und einer Energiegewinnung<br />
aus erneuerbaren Energieträgern spart<br />
der Akkubagger laut Sennebogen so im<br />
Schnitt 31.800 kg CO 2 pro Jahr im Vergleich<br />
zu seinen dieselbetriebenen Pendants.<br />
Die Option der Ausstattung mit<br />
Akku ist zukünftig für die gesamte Elektro-Baureihe<br />
des 817 bis zum 825 verfügbar.<br />
<br />
© Sennebogen<br />
LIEBHERR<br />
Digitale und vernetzte Hafenmobilkrane sparen Emissionen<br />
Neuer LHM Hafenmobilkran<br />
© Liebherr<br />
Liebherr macht seine LHM Produkt-<br />
Serie fit für die Zukunft. Mit seinem neuen<br />
Hafenmobilkran führt der Hersteller<br />
technische Entwicklungen und Updates<br />
ein. Die entscheidende Neuerung ist die<br />
Implementierung der Kransteuerung<br />
»Master V«. Diese bildet laut Hersteller<br />
im Zusammenspiel mit einer noch »effizienteren«<br />
Software-Architektur die Basis,<br />
um zukünftige Assistenz- und Teilautomatisierungssysteme<br />
langfristig in<br />
den Kran zu integrieren. Insgesamt wird<br />
der Kran wesentlich digitaler, vernetzter<br />
und smarter. Die Position des Abstützsystems<br />
wird nun per Sensor überwacht<br />
und damit Teil der internen Datenverarbeitung.<br />
Der Einsatz einer neuen Abstützbasis<br />
im Feld erfordert lediglich ein<br />
Software-Update durch Liebherr und soll<br />
so mehr Flexibilität bieten. Ein weiterer<br />
Vorteil ist laut Liebherr der variable Einsatz<br />
von digitalen IP-Kameras zur besseren<br />
Überwachung des Kraninnenraums<br />
sowie der äußeren Kranumgebung.<br />
Die neue Kransteuerung wird<br />
von einem unabhängigen Stromkreislauf<br />
versorgt. Dadurch kann der Kran ohne<br />
aktivierte Kranzündung, ununterbrochen<br />
von Kameras überwacht und effizient<br />
geschützt werden.<br />
Das Liebherr-Hybridsystem Pactronic<br />
2.0 steht für die zweite Generation eines<br />
hydraulischen Antriebssystems mittels<br />
Hybridtechnologie. Ein Akkumulator<br />
dient als Energiespeicher und unterstützt<br />
bei Bedarf durch Lieferung zusätzlicher,<br />
zwischengespeicherter Kraft. Die zweite<br />
Generation der Pactronic bietet dem Betreiber,<br />
je nach Arbeitssituation, die Wahl<br />
zwischen dem Boost- und Green-Modus.<br />
Im Boost-Modus wirkt die Pactronic<br />
als »signifikanter« Leistungsverstärker.<br />
Die Hubgeschwindigkeiten werden deutlich<br />
gesteigert – ohne Zuhilfenahme eines<br />
größeren oder gar zusätzlichen Hauptaggregats<br />
für mehr Leistung. Dadurch<br />
wird die Effizienz des Kranes deutlich gesteiger,<br />
so Liebherr. Der LHM mit einer<br />
Pactronic 2.0 hat eine verringerte Umschlagszeit<br />
und erreicht die gleichen Leistungsparameter<br />
wie ein vergleichbares<br />
Gerät mit zwei Hauptaggregaten.<br />
Mit dem Green-Modus sollen Kraftstoff<br />
oder Strom gespart und die<br />
CO 2 -Emissionen reduziert werden. Im<br />
Hubbetrieb unterstützt die Pactronic 2.0<br />
das Hauptaggregat so weit, dass weniger<br />
Leistung durch den Hauptantrieb benötigt<br />
wird, trotz gleichbleibender Hubgeschwindigkeiten.<br />
Im Resultat laut Hersteller<br />
sinken der Treibstoff- oder Stromverbrauch<br />
sowie die Emissionen. <br />
26 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>
IMPRESSUM | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />
Sonderpublikation <strong>Innovationsreport</strong> <strong>2022</strong><br />
Redaktion: Krischan Förster, Anna Wroblewski<br />
Anzeigen: Florian Visser<br />
Tel. +49 (0)40-70 70 80-311<br />
Layout: Sylke Hasse<br />
Schiffahrts-Verlag »Hansa« GmbH & Co. KG<br />
Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg | Germany<br />
redaktion@binnenschifffahrt-online.de<br />
Tel. +49 (0)40-70 70 80-02<br />
Inserentenverzeichnis | Index of Advertisers<br />
Allianz Esa EuroShip GmbH ................................ U2<br />
Bachmann electronic GmbH .................................. 11<br />
HGK Shipping GmbH ............................................... 4<br />
Hitzler Werft GmbH .................................................. 6<br />
Hoyer Marine GmbH .............................................. 25<br />
Kadlec & Brödlin GmbH ........................................ 12<br />
REINTJES GmbH ...................................................... 8<br />
SLL Handelsvertretung e.K. ............................ Beilage<br />
TEHAG GmbH ........................................................... 3<br />
TERBERG Spezialfahrzeuge GmbH ..................... U4<br />
TORQEEDO GmbH ............................................... 27<br />
Volvo Penta Central Europe GmbH ...................... 23<br />
Time to go electric.<br />
We provide everything you need to go electric<br />
with fully integrated systems from 0.5 to 200 kW<br />
of power, from working boats to ferries.<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />
www.torqeedo.com 27
WE ENABLE AUTOMATED,<br />
SUSTAINABLE LOGISTICS.<br />
TOGETHER.<br />
terbergspezialfahrzeuge.de<br />
fernride.com