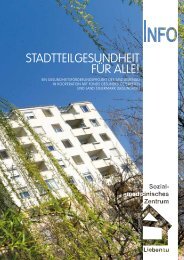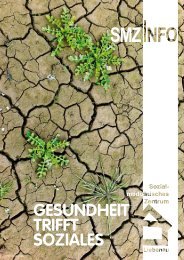SMZ Liebenau Info Nov_2004
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>SMZ</strong><br />
INFO<br />
GESUNDHEITSWESEN IM UMBRUCH<br />
Sozialmedizinisches<br />
Zentrum<br />
: THEMEN<br />
* Das österreichische Gesundheitswesen auf Reformkurs *<br />
* Resolution Mobile Pflegedienste − Interview mit Stadträtin<br />
Tatjana Kaltenbeck-Michl *<br />
* Auswirkungen der Gesundheitsreform in Deutschland *<br />
* Gesundheitssystem: Deformierung oder Reformierung? *<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong><br />
<strong>Liebenau</strong>
INHALT<br />
DAS <strong>SMZ</strong>-TEAM STELLT SICH VOR 01<br />
ERFOLGE UNSERER KAMPAGNE:<br />
KEINE AUSSCHREIBUNG DER MOBILEN PFLEGEDIENSTE 02<br />
PRIVATISIERUNG DER PFLEGE, KEIN ENDE IN SICHT 03<br />
GESUNDHEITSSYSTEM: DEFORMIERUNG ODER REFORMIERUNG 04<br />
DER VIOXX-SKANDAL 05<br />
DAS ÖSTERREICHISCHE GESUNDHEITSWESEN AUF REFORMKURS 06<br />
HASTE MAL 10 EURO FÜR´N DOKTOR? 07<br />
PFLEGEHEIMKOSTEN UND FINANZIERUNG 08<br />
AUSDRUCKSSTARKE EINDRÜCKE IN TON 10<br />
BEIM REDN KUMMAN D’LEIT ZAMM 11<br />
TURNUS-ÄRZTINNEN UND - ÄRZTE IN DER PRAXISGEMEINSCHAFT 12<br />
KEINE ZERSCHLAGUNG DER SOZIALVERSICHERUNG 14<br />
K A L E N D A R I U M 16<br />
IMPRESSUM<br />
HERAUSGEBER<br />
<strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong><br />
<strong>Liebenau</strong>er Hauptstraße 102-104a, 8041 Graz T (0316) 471766-13 F (0316) 462340-19 E smz@smz.at<br />
REDAKTION Dr. Rainer Possert, Mag. Barbara Gruber<br />
FOTOS <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong> LAYOUT + SATZ CUBA, Graz DRUCK Dorrong, Graz AUFLAGE 1.300 Stk.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong>
DAS <strong>SMZ</strong>-TEAM STELLT SICH VOR<br />
Krista MITTELBACH<br />
Seit <strong>Nov</strong>ember 2001 bin ich als Assistentin<br />
in der Praxisgemeinschaft tätig –<br />
vorher war ich hier bereits bis 1995 im<br />
Labor und als medizinisch-technische<br />
Assistentin beschäftigt. In der Zwischenzeit<br />
arbeitete ich in einem medizinischen<br />
Institut an einem Projekt zur<br />
Reduktion der Schlaganfallhäufi gkeit<br />
in der Steiermark mit.<br />
An meiner Arbeit in der Ordination<br />
fasziniert mich der vielfältige Aufgabenbereich<br />
und der Umgang mit den<br />
PatientInnen.<br />
Auch in der Freizeit liebe ich die Abwechslung:<br />
Da meine beiden Kinder<br />
bereits erwachsen sind, habe ich mich<br />
neuen Hobbies zugewandt: Ich betreibe<br />
Sport (tanzen, wandern, Tennis<br />
spielen), liebe aber auch die Musik,<br />
lese gerne und treffe mich häufi g mit<br />
Freunden.<br />
Mit dem <strong>SMZ</strong> bin ich seit Anfang an berufl ich<br />
und privat verbunden: Ursprünglich Lehrerin,<br />
habe ich schon kurz nach der Gründung der<br />
Praxisgemeinschaft als Sprechstundenhilfe mitgearbeitet<br />
und Geburtsvorbereitungskurse angeboten.<br />
Seit meiner Ausbildung zur Familientherapeutin<br />
arbeite ich als Beraterin und Psychotherapeutin<br />
in der Familienberatungsstelle. Meine<br />
private Verbindung zum <strong>SMZ</strong> heißt Gustav<br />
Mittelbach, er ist einer der Gründer-Ärzte und<br />
ich bin mit ihm seit mehr als 25 Jahren – noch<br />
immer gerne! – verheiratet. Im Rückblick habe<br />
ich aus unseren ersten gemeinsamen Jahren<br />
die langen Diskussionen in Erinnerung. Ich<br />
konnte miterleben, wie sich aus medizin-kritischen<br />
Ideen die Praxisgemeinschaft und das<br />
<strong>SMZ</strong> herauskristallisierte und war in der Planungs-<br />
und Umsetzungsphase als Zuhörerin<br />
und Kritikerin aktiv dabei. Mein zweites berufl i-<br />
ches Betätigungsfeld habe ich seit 1997 in der<br />
Kinder-& Jugendanwaltschaft Steiermark, wo<br />
ich durch Projekt- und Vernetzungsarbeit und<br />
beraterische Funktionen sehr gefordert bin. Die<br />
Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie<br />
(zwei erwachsene Töchter, die schon eigene<br />
Wege gehen und einen knapp 14-jährigen<br />
Sohn), im Austausch mit guten Freunden, laufen<br />
auf den Hügeln rund um Stattegg und liebe<br />
es, gute Bücher zu lesen oder hin und wieder<br />
„Feste für alle Sinne“ zu gestalten.<br />
Erika LANG<br />
MitarbeiterInnen des<br />
<strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong><br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong><br />
01
ERFOLGE UNSERER KAMPAGNE:<br />
KEINE AUSSCHREIBUNG DER MOBILEN PFLEGEDIENSTE<br />
Unser offener Brief, Ihre Unterschriften und die Berichte in den Medien zeigten<br />
Erfolg: Die Dienste der Hauskrankenpflege, Alten- Pflege- und Heimhilfe werden<br />
nicht ausgeschrieben. Die Betreuung bleibt mit kleinen Änderungen in der bis-<br />
herigen Form erhalten.<br />
KAMPAGNE<br />
Die Kampagne<br />
Ein offener Brief an die zuständige Stadträtin<br />
Kaltenbeck-Michl sollte verhindern, dass durch<br />
die Ausschreibung der Mobilen Pfl egedienste gut<br />
funktionierende Versorgungsstrukturen zerstört<br />
werden. Befürchtungen waren u. a. der Verlust von<br />
Arbeitsplätzen, Verringerung der Pfl egequalität sowie<br />
Gewinndenken auf Kosten der PatientInnen.<br />
Die UnterstützerInnen<br />
Unser Faxgerät lief heiß, mehr als 300 Menschen<br />
unterzeichneten die Resolution „Keine Ausschreibung<br />
der mobilen Pfl egedienste“, darunter<br />
zahlreiche ExpertInnen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich.<br />
Viele Menschen teilten uns ihre<br />
Bestürzung über das Vorhaben mit, die mobilen<br />
Pfl egedienste dem Wettbewerb auszusetzen. Sie<br />
berichteten über ihre positiven Erfahrungen mit<br />
den Pfl egediensten und die Entlastung, die sie bei<br />
der Betreuung eines Angehörigen bedeuteten.<br />
Die Erfolge<br />
Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl versprach,<br />
Alternativen zur Ausschreibung prüfen zu lassen.<br />
Durch eine geänderte Form der Betreuungsverträge<br />
konnte diese Lösung auch gefunden werden.<br />
Wir baten Frau Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-<br />
Michl um ihre Stellungnahme zur Situation der<br />
Mobilen Pfl egedienste:<br />
INTERVIEW MIT STADTRÄTIN TATJANA KALTENBECK-MICHL<br />
„Mobile Dienste stärker als bisher ausbauen!“<br />
<strong>SMZ</strong>: Frau Stadträtin, Sie sind – wie Sie auch<br />
selbst betonen – eine Gegnerin der Liberalisierung<br />
im Gesundheits- und Sozialwesen. Die Ausschreibung<br />
der Mobilen Pfl egedienste wurde nun<br />
abgewendet, welche Alternative konnte die Stadt<br />
Graz dazu fi nden?<br />
KALTENBECK-MICHL: Ja, ich bin eine Gegnerin<br />
der Liberalisierung im Gesundheits- und Sozialwesen!<br />
Weil ich nicht will, dass soziale Dienstleistungen<br />
zu einem neuen Geschäftszweig für<br />
die weltweit großen Konzerne werden. Soziale<br />
Dienstleistungen dürfen nicht Waren am freien<br />
Markt werden! Denn dann sind sie nicht mehr für<br />
alle zugänglich, die sie brauchen!<br />
Zur Alternative: In guten Gesprächen mit allen<br />
Trägern mobiler Dienste konnten wir über den<br />
Sommer ein Modell entwickeln, das von der Stadt<br />
Wien bereits „kopiert“ wird!<br />
Neue rechtliche Rahmenbedingung: Nicht mehr<br />
die Trägerorganisationen sind – wie bisher – die<br />
Adressaten der Fördermittel, sondern die KlientInnen.<br />
Die Stadt Graz steigt also ab nächstem Jahr<br />
auf die so genannte „Subjektförderung“ um.<br />
Die Abrechnung bleibt für KlientInnen und Vereine<br />
wie auch für das Sozialamt gleich einfach wie bisher:<br />
Die KlientInnen unterschreiben, dass weiterhin<br />
der betreuende Verein für sie abrechnen darf.<br />
Wer aber lieber selbst verrechnen möchte, kann<br />
dies natürlich gern tun.<br />
Und auch die so genannte „Gebietsaufteilung“ wird<br />
gleich bleiben: Die Trägerorganisationen zeichnen<br />
jeweils für bestimmte Stadtbezirke hauptverantwortlich;<br />
die KlientInnen können aber natürlich<br />
– wie schon bisher – auch auf einen anderen Verein<br />
zurückgreifen, wenn sie dies wünschen.<br />
Die Stadt Graz hat aufgrund der Neu-Organisation<br />
der mobilen Dienste für die Zeit ab 1.1.2005 auch<br />
neue Förderrichtlinien entwickelt; diese lehnen<br />
sich in weiten Teilen an jene des Landes Steiermark<br />
an und anerkennen daher auch nur genau<br />
jene Trägerorganisationen, die auch das Land<br />
Steiermark mit seinen Richtlinien anerkennt.<br />
<strong>SMZ</strong>: Was bedeutet diese Neuorganisation Ihrer<br />
Meinung nach für die PatientInnen und die Organisationen,<br />
die mobile Pfl egedienste anbieten?<br />
KALTENBECK-MICHL: Diese Neuregelung der<br />
Förderrichtlinien bringt m.E. nur Vorteile für alle<br />
Beteiligten: Die KlientInnen verfügen wie bisher<br />
über die freie Trägerwahl; und sie können ab sofort<br />
selbst abrechnen, müssen aber nicht. Wenn<br />
sie mit dem bisherigen System zufrieden waren –<br />
und davon gehe ich aus! – dann ändert sich für die<br />
KlientInnen gar nichts. Und das ist für die meisten<br />
älteren Menschen das Wichtigste: Sie waren und<br />
sind mit ihrer Betreuung hochzufrieden!<br />
Auch die Vereine können zufrieden sein: Sie betreuen<br />
weiterhin ihr angestammtes Gebiet; und<br />
sie müssen nicht fürchten, bei Nicht-Gewinnen<br />
der (nun verhinderten) Ausschreibung als Verein<br />
die Existenzgrundlage zu verlieren.<br />
Und nicht zuletzt ist diese Regelung auch für die<br />
Stadt Graz ein Vorteil: Wir alle wissen, dass die<br />
Preise aufgrund der Ausschreibung für nächstes<br />
Jahr niedrig gehalten würden. Im Jahr 1 nach<br />
einer solchen Ausschreibung würde es aber für<br />
02<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong>
INTERVIEW MIT STADTRÄTIN TATJANA KALTENBECK-MICHL<br />
den Ausschreibungsgewinner keinerlei Konkurrenz,<br />
zumindest nicht mehr im Raum Graz, geben<br />
– und dieser Verein würde ab dann den Preis<br />
diktieren. Es käme, wie so oft bei Ausschreibungen,<br />
die angeblich den Wettbewerb anregen, zur<br />
Monopolisierung und damit zu einer wesentlichen<br />
Verteuerung für die öffentliche Hand und somit für<br />
alle Steuerzahlenden.<br />
<strong>SMZ</strong>: Wie sehen Sie die Funktion und den Stellenwert<br />
der Mobilen Pfl egedienste?<br />
KALTENBECK-MICHL: Die BetreuerInnen der<br />
mobilen Dienste verrichten Tag für Tag großartige<br />
Arbeit für ältere, hilfsbedürftige Menschen, die<br />
zwar nicht (mehr) den ganzen Tag über unbetreut<br />
bleiben, aber über weite Strecken (noch) gut allein<br />
leben können.<br />
Wir alle wissen: Mobile Dienste leisten auch wertvolle<br />
Entlastung für die zu Hause betreuenden<br />
Angehörigen und helfen, die stationäre und damit<br />
wesentlich kostenintensivere Betreuung älterer<br />
Menschen in Alters- bzw. Pfl egeheimen hinauszuschieben<br />
oder gar zu verhindern.<br />
Wenn wir wollen, dass unsere älteren MitbürgerInnen<br />
in Würde und selbstbestimmt alt werden<br />
können, wenn wir wollen, dass alte Menschen daheim<br />
wohnen, solange es möglich ist, und wenn<br />
wir wollen, dass ihre Angehörigen – meist sind es<br />
Frauen, die pfl egen! – nicht selbst krank und verbraucht<br />
werden durch Betreuung und Pfl ege rund<br />
um die Uhr, dann müssen wir gerade solche Einrichtungen<br />
wie auch die mobilen Dienste stärker<br />
als bisher ausbauen! Das ist eine meiner wesentlichen<br />
politischen Strategien im Sozialbereich!<br />
<strong>SMZ</strong>: Die Mobilen Pfl egedienste tragen dazu<br />
bei, dass SeniorInnen ihren Lebensabend trotz<br />
gesundheitlicher Einschränkungen im eigenen<br />
Haushalt verbringen können. Umso mehr verwundert<br />
es, dass die Förderungen der Stadt Graz<br />
für Alten- und Pfl egeheime in den letzten Jahren<br />
vervielfacht wurden, während die mobilen Pfl egedienste<br />
ins Hintertreffen gerieten?<br />
KALTENBECK-MICHL: Bei den Zuzahlungen der<br />
Stadt Graz zu den Alten- und Pfl egeheimen bzw.<br />
für BewohnerInnen solcher Heime handelt es sich<br />
nicht um Förderungen, sondern um gesetzliche<br />
Pfl ichtleistungen; diese Leistung ergibt sich aus<br />
dem § 13 Sozialhilfegesetzes des Landes Steiermark.<br />
Wie viel die Stadt Graz aufzuwenden hat, ist in<br />
der so genannten Tarifregelung durch Verordnung<br />
des Landes reglementiert („Tagsatzobergrenzen-<br />
Verordnung“).<br />
Wer beschließt, seinen Lebensabend in einem<br />
Heim zu verbringen, wer in ein Heim gehen muss,<br />
weil er oder sie allein nicht mehr leben kann, weil<br />
auch die Unterstützung durch mobile Dienste zu<br />
wenig ist, um gut allein leben zu können, hat bei<br />
zu geringem eigenen Einkommen oder Vermögen<br />
Anspruch auf diese gesetzliche Leistung.<br />
Die durchaus starken Erhöhungen für die Zuzahlungen<br />
entsprechen der demographischen Entwicklung:<br />
Immer mehr Menschen werden immer<br />
älter, und immer weniger ältere Menschen können<br />
– aus vielerlei Gründen – nicht mehr auf familiäre<br />
oder nachbarschaftliche Hilfe zurückgreifen,<br />
wenn sie nicht mehr allein den Alltag bewältigen<br />
können.<br />
PRIVATISIERUNG DER PFLEGE, KEIN ENDE IN SICHT.<br />
Anfang Mai haben wir uns in einem offenen Brief,<br />
der von über dreihundert Personen und Vertre-<br />
terInnen zahlreicher sozialer Einrichtungen terschrieben wurde, an die Öffentlichkeit und die<br />
zuständige Stadträtin Kaltenbeck gewandt, um die<br />
un-<br />
Ausschreibung der sozialen Dienste im Sinne des<br />
„neoliberalen“ Wettbewerbes zu verhindern.<br />
Dies ist nunmehr gelungen, und damit konnten<br />
Kündigungen von ca. 200 MitarbeiterInnen bei<br />
den Grazer sozialen Diensten verhindert werden.<br />
Die ersten Unterzeichner der Resolution kamen<br />
aus dem Bezirk, die „Starthilfe“ des ÖGB Sozialkreises,<br />
des Steirischen Seniorenbundes und Seniorenrings<br />
<strong>Liebenau</strong> war von großer Bedeutung<br />
für diesen Erfolg, an den viele gar nicht erst geglaubt<br />
haben.<br />
Also: Solidarität, jenes Fremdwort, das ein Großteil<br />
der AHS-Schüler bereits nicht mehr kennt,<br />
funktioniert noch. Das <strong>SMZ</strong> und die anderen Einrichtungen<br />
sind vorläufi g von großem Druck befreit.<br />
Die Suppe ist jedoch Dank des „Spar- und<br />
soziale Einschnitte machen müssen-Budgets“<br />
noch nicht gegessen.<br />
Denn die Zuteilung der Förderungsmittel erfolgt<br />
in Zukunft nach der Altersstruktur der Bezirke, die<br />
durch das Vorhandensein von großen Pfl egeheimen<br />
verfälscht wird, d. h.: <strong>Liebenau</strong> erhält weniger<br />
Geld zugeteilt, da einerseits die Alterstruktur jünger<br />
ist, andererseits nur ein kleines Pfl egeheim im<br />
Bezirk vorhanden ist.<br />
Darüber hinaus werden durch die Umstellung des<br />
Landes von Personalförderung (pro Dienstposten)<br />
auf Stundenförderung nur mehr „produktive“ d. h.<br />
rein handwerklich-pfl egerische Einheiten als Maßstab<br />
genommen, so genannte „Overheadkosten“<br />
(z.B. für Infrastruktur, Teambesprechungen, Qualitätssicherung)<br />
müssen heruntergefahren werden.<br />
Der Zug der Hauskrankenpfl ege fährt in Richtung<br />
Mittelverknappung, während Pfl egeheime nach<br />
wie vor ein profi tables Geschäftsfeld für private<br />
Investoren darstellen, mit der Möglichkeit zum gesetzlich<br />
gedeckten Zugriff auf das Einkommen und<br />
das Vermögen der PatientInnen und der direkten<br />
und indirekten (Pfl egegeld) Co-Finanzierung aus<br />
den öffentlichen Budgets (siehe Interview mit<br />
Stadträtin Kaltenbeck-Michl).<br />
Während z. B. Dänemark einen Rückbau der stationären<br />
Pfl ege in Richtung Hauskrankenpfl ege<br />
und andere Pfl egeformen vorantreibt, England<br />
eine Pfl egeversicherung, die in Österreich erst gar<br />
nicht existiert, an die Erbschaftssteuer koppelt,<br />
besteht die österreichische Politik offenbar darin,<br />
den bestehenden Zustand zum Vorteil der Pfl e-<br />
geheimbetreiber und Nachteil der PatientInnen<br />
aufrecht zu erhalten.<br />
Dr. Rainer Possert<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong><br />
03
GESUNDHEITSSYSTEM: DE- ODER RE FORMIERUNG?<br />
Wird das Gesundheitssystem reformiert oder eher deformiert?<br />
Dieser Frage gingen am Montag, den 18. Oktober<br />
<strong>2004</strong>, vier namhafte Referenten anlässlich der<br />
32. Forumsveranstaltung des <strong>SMZ</strong> nach. Über 70<br />
Personen folgten unserer Einladung und zeigten<br />
in einer spannenden Diskussion, dass durchaus<br />
Interesse an der Erhaltung unseres gegenwärtigen<br />
Gesundheitssystems besteht.<br />
In seinem Eingangsstatement hielt der steirische<br />
Gesundheitslandesrat Mag. Wolfgang Erlitz ein<br />
Plädoyer für das österreichische Gesundheitssystem:<br />
Es sei eines der besten der Welt und lang<br />
nicht so teuer wie behauptet. Im internationalen<br />
Vergleich läge Österreich an sechstbester Stelle.<br />
Unvergleichlich teurer seien Systeme wie das der<br />
USA, wo der private Finanzierungsanteil 55% betrage.<br />
„Lösungen über Selbstbehalte sind kontraproduktiv,<br />
vom solidarischen System können wir<br />
uns nicht wegbewegen“, so Erlitz.<br />
Einig waren sich die Podiumsteilnehmer, dass Gesundheit<br />
zu den genuinen Aufgaben des Staates<br />
gehöre und nicht dem freien Spiel der Kräfte unterworfen<br />
sein dürfe: „Geld lenkt zwar“, so Erlitz,<br />
„im Gesundheitswesen jedoch meist falsch.“<br />
Dr. Jörg Pruckner, Obmann der Kurie der niedergelassenen<br />
Ärzte in Steiermark und Österreich,<br />
beklagte, dass im Zuge der Reformierungsdiskussion<br />
der „Patient in all den Papieren nicht<br />
vorkommt“. Auch aus dem Publikum wurde die<br />
Forderung laut, endlich einmal die Sicht der PatientInnen<br />
zu berücksichtigen und diese mitbestimmen<br />
zu lassen. Für eine Effi zienzsteigerung<br />
des gegenwärtigen Systems forderte Pruckner,<br />
Ambulanzen abzubauen und viel mehr Leistungen<br />
dem niedergelassenen Bereich zu überanworten.<br />
Auch die Organisationsstruktur im niedergelassenen<br />
Bereich gehöre erweitert und Gruppenpraxen<br />
sollten endlich zugelassen werden.<br />
Der Obmann des <strong>SMZ</strong>, Dr. Rainer Possert, verwies<br />
darauf, dass die Praxisgemeinschaft des<br />
<strong>SMZ</strong> seit 20 Jahren erfolgreich den richtigen Weg<br />
vorzeige.<br />
Dr. Markus Narath, Verfasser des Journals für Gesundheitsökonomie,<br />
warnte vor dem internationalen<br />
Zwang, ständig reformieren zu müssen. Wenn<br />
schon Reform, dann solle man sich damit Zeit lassen<br />
und gründlich überlegen, was denn zu reformieren<br />
sei und welche Evidenz dafür vorliege.<br />
DI Kurt Völkl vom Management der Controllinggruppe<br />
des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger<br />
bemängelte ebenfalls die Art, wie<br />
in Österreich „reformiert“ werde: „Man sollte auf<br />
Nachhaltigkeit Bedacht nehmen und nicht auf<br />
punktuelle Intervention“, so Völkl. „Wir brauchen<br />
eine nachhaltige Effi zienzsteigerung und vor allem<br />
Gesundheitsziele.“<br />
Landesrat Erlitz sprach sich ebenfalls dafür aus,<br />
„Gesundheitsziele im Land selbst zu defi nieren“.<br />
In diesem Zusammenhang plant er eine Gesundheitskonferenz,<br />
deren Ergebnisse für die Politik<br />
bindend sein müssten.<br />
Einigkeit herrschte auch über die in Österreich<br />
zu wenig beachtete Gesundheitsförderung. Völkl<br />
meinte dazu: „Es geht immer nur um die Erhaltung,<br />
nie um die Förderung der Gesundheit“. Und<br />
Erlitz gestand: „Bei der Frage der Gesundheitsförderung<br />
werde ich emotional“. Man müsse bereits<br />
in Schulen gesundheitsfördernde Maßnahmen im<br />
Lehrplan verankern, um den Rückstand Österreichs<br />
in diesem Bereich aufholen zu können.<br />
Am Podium wie im Publikum tauchte immer wieder<br />
die Forderung nach einer Vereinheitlichung und<br />
Vernetzung der verschiedenen Finanztöpfe und<br />
Systeme im Gesundheitsbereich auf. Die geplanten<br />
Gesundheitsagenturen wurden aber von allen<br />
TeilnehmerInnen als zu wenig durchdacht und zu<br />
kostenintensiv abgelehnt. Das endgültige „Aus“<br />
für die Agenturen wurde übrigens einen Tag nach<br />
unserer Veranstaltung in den Medien bekannt.<br />
Dr. Inge Zelinka-Roitner<br />
04<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong>
DER VIOXX-SKANDAL<br />
Drei Jahre nach dem Skandal um das<br />
Cholesterin senkende Mittel Lipobay<br />
ist jetzt erneut ein Medikament wegen<br />
gefährlicher Nebenwirkungen in die<br />
Schlagzeilen geraten: VIOXX<br />
Jetzt wurde das Schmerz- und Rheumamittel Vioxx<br />
des US-Pharma-Konzerns Merck & Co. vom<br />
Markt genommen, das wir in unserer Praxisgemeinschaft<br />
den PatientInnen nie als Erstverordnung<br />
verschrieben haben, und oft genug lange<br />
Gespräche führten, um sie zum Absetzen des<br />
Medikamentes zu bewegen, wenn es von Klinik-<br />
ÄrztInnen verordnet wurde.<br />
Das Medikament (Wirkstoff Rofecoxib) wurde<br />
nach der Zulassung 1999 als neues „Super-Rheumamittel“<br />
in der Werbung gefeiert, weil es weniger<br />
Nebenwirkungen auf Magen und Darm habe, als<br />
herkömmliche Schmerzmittel.<br />
Doch bereits 2000 und 2001 meldeten die Autor-<br />
Innen des deutschen „Arzneitelegramms“ Zweifel<br />
am Nutzen dieses neuen Medikamentes an: Bei<br />
wesentlich höheren Kosten trete die versprochene<br />
bessere Magenverträglichkeit und Schmerzfreiheit<br />
nicht ein, es käme im Vergleich zu bewährten Substanzen<br />
zu Blutdruckerhöhung und Herzschwäche,<br />
dafür gäbe es mehr Herzinfarkte, Herzstillstände<br />
und Schlaganfälle. Außerdem würden, so das „Arzneitelegramm“<br />
bei der Einnahme „Vioxx“, gegenüber<br />
z.B. der Substanz „Seractil“ oder „Voltaren“<br />
nur 50% der Schmerz stillenden Wirkung auftreten,<br />
bei akuten Schmerzen sei überhaupt keine<br />
Wirkung feststellbar.<br />
Dies alles war der Fachwelt bereits im Jahr 2000<br />
bekannt, es wurde auch darauf hingewiesen, dass<br />
in den wissenschaftlichen Studien, die zur Zulassung<br />
als Medikament in den USA führten, wesentliche<br />
Daten vorenthalten worden sind.<br />
Jetzt „will die europäisch Arzneibehörde auch<br />
ähnliche Mittel überprüfen“ heißt es sogar in der<br />
„Bild-Zeitung“ – dazu hätte jene Behörde bereits<br />
in den letzten fünf Jahren Zeit gehabt! Denn allein<br />
in Deutschland konnte das Pharma-Unternehmen<br />
in den Jahren 2001 und 2002 120! Millionen € Umsätze<br />
machen- das ist eine Verteuerung gegenüber<br />
bewährten und nebenwirkungsärmeren Medikamenten<br />
um sage und schreibe 88%.<br />
Auch in Österreich ist die Situation um nichts besser:<br />
18.000 PatientInnen sind von der Rücknahme<br />
des Medikamentes betroffen. Das Gesundheitsministerium<br />
beschwichtigt allerdings: es „könne“, obwohl<br />
ja schon bewiesen, kardiovaskuläre (Herz-/<br />
Kreislauf-)Krankheiten bewirken, außerdem sei nur<br />
ein einziger Todesfall gemeldet worden, der „möglicherweise“<br />
in Zusammenhang mit dem Mittel stehe.<br />
Allein diese Reaktion auf den neuen Skandal der<br />
chemisch-pharmazeutischen Industrie zeigt, dass<br />
die Bundesministerin ihren Ministerkollegen als Interessenvertretung<br />
der Industrie um nichts nachsteht<br />
– nach dem Motto: „nicht die Bevölkerung beunruhigen“,<br />
sonst könnten genau jene Umsatzsteigerungen<br />
rückläufi g werden, die in den letzten<br />
Jahren die Kassen der Pharmaindustrie gefüllt<br />
und die Krankenkassen mit ins „Defi zit“ getrieben<br />
haben.<br />
Dr. Rainer Possert<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong><br />
05
GESUNDHEITSWESEN AUF REFORMKURS<br />
Hans Sallmutter, Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten<br />
(GPA), warnte in einer Veranstaltung des <strong>SMZ</strong><br />
eindringlich davor, das solidarische Prinzip zugunsten neoliberaler<br />
Gesinnung aufzugeben.<br />
Durch Privatisierung teurer<br />
„Das Gesundheitssystem wird schlecht geredet<br />
und ausgehöhlt, weil es ein großer, interessanter<br />
Markt ist!“ kritisierte Sallmutter die Reformbestrebungen<br />
der Regierung. Im Moment verdiene<br />
niemand am Budget der Sozialversicherung, die<br />
Beiträge kämen direkt den Versicherten zugute.<br />
Doch Anbieter privater Versicherungen zeigen<br />
bereits jetzt großes Interesse am Topf der Sozialversicherung.<br />
Durch die Einschätzung, „das kann sich in Zukunft<br />
nicht mehr ausgehen“, werde die Bevölkerung<br />
verunsichert, und ein immer größer werdender<br />
Anteil setze deshalb auf private Vorsorge.<br />
Doch Sallmutter bezweifelt, dass ein privatisiertes<br />
Gesundheitssystem dem bisherigen System das<br />
Wasser reichen kann: „Wie kann ein privates System,<br />
das Nebenkosten wie Werbung usw. zu tragen<br />
hat und gewinnorientiert arbeitet, die Qualität<br />
des Systems zum gleichen Preis gewährleisten?“<br />
Alkohol und Zigaretten zur<br />
Sanierung des Systems<br />
Für Sallmutter steht außer Zweifel: Die Qualität<br />
des bisherigen solidarischen Systems ist einmalig<br />
und darf unter keinen Umständen leichtfertig auf´s<br />
Spiel gesetzt werden. Schon jetzt gibt es genug<br />
Menschen, die sich überlegen müssen, ob sie sich<br />
einen Arztbesuch leisten können. Weitere Selbstbehalte<br />
sind für ihn aus diesem Grund undenkbar,<br />
würden sie doch wieder die unteren Einkommensschichten<br />
am stärksten treffen.<br />
Wenn Geld für das Gesundheitssystem lukriert<br />
werden müsse, könnte dies seiner Meinung nach<br />
durch die Verwendung von Erträgen aus Kosten<br />
verursachenden Bereichen (Erhöhung von Tabak-,<br />
Alkohol-, Mineralölsteuer) sowie durch die Einführung<br />
wertschöpfungsbezogener Komponenten<br />
geschehen.<br />
Gefahr der Gesundheitsagenturen<br />
Die für nächstes Jahr geplante Einführung der<br />
Gesundheitsagenturen lehnt Sallmutter ab: Entscheidungen<br />
über die Vergabe der Mittel werden<br />
nicht mehr von VertreterInnen der Versicherten<br />
entschieden, sondern an die Landesgesundheits-<br />
Agenturen ausgelagert.<br />
Sallmutter sieht dabei die Gefahr, dass Länder das<br />
Geld für die Finanzierung der Krankenhäuser und<br />
damit für die Sanierung ihres Budgets verwenden.<br />
Positiv an den Gesundheitsagenturen sei die starke<br />
Verhandlungsmacht gegenüber PartnerInnen,<br />
die durch eine Bündelung entstehe.<br />
„Elementarstes“ der Gesellschaft sichern<br />
„Menschen sind mehr als ein Kostenfaktor“ war<br />
Sallmutters Tenor, „alle Entscheidungen müssen<br />
FÜR die Menschen getroffen werden! Wir sind so<br />
reich wie noch nie, nur für die Gesundheit ist zu<br />
wenig Geld da!“ plädierte er, das Gesundheitssystem<br />
als „Heiligstes, Elementarstes“ einer solidarischen<br />
Gesellschaft in der bisherigen Qualität<br />
zu erhalten.<br />
Mag. Barbara Gruber<br />
06<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong>
HASTE MAL 10 EURO FÜR´N DOKTOR?<br />
Auswirkungen der Gesundheitsreform in Deutschland<br />
„Eine Patientin will nicht<br />
mehr in unsere Ordination<br />
kommen, weil sie<br />
glaubt, dass sie auch<br />
bei uns 10 Euro Praxisgebühr<br />
bezahlen muss,<br />
wie sie es im deutschen<br />
Fernsehen gesehen hat“,<br />
erzählt uns eine Kollegin<br />
letzte Woche.<br />
Die Auswirkungen der Gesundheitsreform in<br />
Deutschland scheint weite Kreise zu ziehen,<br />
sogar via Satellitenfernsehen in österreichische<br />
Wohnzimmer.<br />
Eintrittskarte für´s Wartezimmer<br />
Doch welche Konsequenzen für die PatientInnen<br />
in Deutschland hat das Gesetz zur „Modernisierung“<br />
des Gesundheitswesens?<br />
Kurz zur <strong>Info</strong>rmation: Neben erhöhten Zuzahlungen<br />
zu Arzneimitteln, Leistungseinschränkungen<br />
und dem Wegfall von Zahlungsbefreiungen haben<br />
vor allem die eingeführten Praxisgebühren zu<br />
Verunsicherung geführt: Seit Jahresbeginn zahlt<br />
jeder Patient bei der erstmaligen Inanspruchnahme<br />
eines Arztes oder Zahnarztes zehn Euro pro<br />
Quartal – Ausnahmen gelten nur für Kinder und<br />
Jugendliche unter 18 Jahren, sowie für Impfungen<br />
und Vorsorgeuntersuchungen.<br />
Diese Maßnahme sollte einerseits Geld bringen,<br />
andererseits einen so genannten „Steuerungseffekt“<br />
bewirken: die BürgerInnen sollen nur dann<br />
zum Arzt gehen, wenn es wirklich nötig ist.<br />
Arztbesuch als Luxusware<br />
Wann ein Arztbesuch als notwendig erachtet wird,<br />
ist jedoch auch vom sozialen Status abhängig, wie<br />
erste Zahlen zeigen:<br />
Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin (kvberlin.de)<br />
veröffentlicht Zahlen über das zweite Quartal des<br />
Jahres <strong>2004</strong>, wonach Arztbesuche gegenüber<br />
dem Vergleichsquartal im Jahr 2003 um 6,9 %<br />
zurückgegangen sind. Auffallend hoch sind die<br />
Rückgänge jedoch in jenen Bezirken mit einkommensschwachen<br />
und ausländischen BewohnerInnen.<br />
Dass Menschen mit einem niedrigeren Einkommen<br />
eher auf einen Arztbesuch verzichten, zeigen<br />
auch die Ergebnisse des „WIdO – Wissenschaftliches<br />
Institut der AOK“, das die Zeitschrift Mabuse<br />
(9/10_<strong>2004</strong>) veröffentlicht:<br />
19 Prozent der 3000 Befragten mit einem Haushalts-Nettoeinkommen<br />
von weniger als 1.000 €<br />
hatten im ersten Quartal <strong>2004</strong> bewusst auf einen<br />
Arztbesuch verzichtet, während bei Menschen,<br />
die über ein Haushaltseinkommen von mehr als<br />
3000 € verfügen, nur 8 Prozent weniger zum Arzt<br />
gingen.<br />
Prof. Rolf Rosenbrock, Gesundheitswissenschaftler<br />
am Wissenschaftszentrum Berlin, warnte<br />
bereits im Februar in einem Interview mit der<br />
deutschen Ärztezeitung vor einer Verstärkung der<br />
Unterschiede zwischen Arm und Reich. Er verwies<br />
auf die Erfahrungen in Schweden, wo bereits in<br />
den 90-er Jahren Forschungsergebnisse zeigten,<br />
dass sozial Benachteiligte nach Erhöhung<br />
der Praxisgebühren deutlich seltener einen Arzt<br />
aufsuchten.<br />
Chronisch krank – chronisch arm?<br />
Seit Jahren gibt es die gesicherte Erkenntnis,<br />
dass Armut, Gesundheit und Krankheit sich gegenseitig<br />
beeinfl ussen. Sozial benachteiligte Menschen<br />
sind öfter krank und haben eine geringere<br />
Lebenserwartung, Krankheitsfälle ziehen vielfach<br />
fi nanzielle Einbußen nach sich.<br />
Die Gesundheitsreform in Deutschland sorgt dafür,<br />
dass sich diese Dynamik noch verstärken wird<br />
und sich viele Menschen ihre Gesundheitsversorgung,<br />
geschweige denn Gesundheitsvorsorge,<br />
einfach nicht mehr leisten können.<br />
Auch in Österreich ist eine „Modernisierung des<br />
Gesundheitswesens“ – sprich eine Gesundheitsreform<br />
– geplant. Bleibt nur zu hoffen, dass den<br />
zuständigen PolitikerInnen hin und wieder ein<br />
ruhiges Fernsehstündchen bleibt, in dem sie die<br />
Berichte über die Auswirkungen der Reform in<br />
unserem Nachbarstaat genauso interessiert und<br />
beunruhigt verfolgen wie österreichische PatientInnen.<br />
Mag. Barbara Gruber<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong><br />
07
PFLEGEHEIMKOSTEN UND FINANZIERUNG<br />
Wenn sich Menschen überlegen, die Versorgung durch ein Heim<br />
in Anspruch zu nehmen, weil die Pflege zu Hause nicht mehr<br />
möglich ist, tauchen natürlich Fragen zur Finanzierung auf.<br />
Frau Elfriede Marschnig, Leiterin des Sozialhilfereferats<br />
der BH Voitsberg, hat uns dankenswerter<br />
Weise <strong>Info</strong>rmationen zu Kosten und Finanzierung<br />
von Heimplätzen zur Verfügung gestellt.<br />
Heimkosten<br />
Grundsätzlich gilt, dass die Kosten aus dem eigenen<br />
Einkommen getragen werden. Zur Bezahlung<br />
wird das Einkommen (in den meisten Fällen ist das<br />
die Pension), das Pfl egegeld und das so genannte<br />
„sofort verwertbare Vermögen“ herangezogen.<br />
„Sofort verwertbares Vermögen“ kann z. B. ein<br />
Sparbuch sein. Dieses Geld muss bis auf einen<br />
Betrag von € 2.500 für die Bezahlung der Heimkosten<br />
herangezogen werden.<br />
Die Heimkosten setzen sich aus einer „Grundkomponente“<br />
und einer „Pfl egekomponente“ zusammen.<br />
Die „Grundkomponente“ enthält die Kosten für<br />
die Unterbringung und Verpfl egung. Unter der<br />
„Pfl egekomponente“ versteht man die Kosten für<br />
Pfl ege und Betreuung.<br />
Je nach Kategorie des Heimes liegt die Grundkomponente<br />
zwischen € 38,14 und € 44,30/ Tag,<br />
die täglichen Kosten für den Pfl egeaufwand richten<br />
sich nach dem Pfl egegeld und liegen derzeit<br />
zwischen € 4,85 (Stufe 1) und € 51,05 (Stufe 7).<br />
Anteil der Pension und „Taschengeld“<br />
Den BewohnerInnen bleiben in jedem Fall 20%<br />
der Pension, sowie der 13. und 14. Pensionsbezug.<br />
Außerdem steht vom Pfl egegeld (egal welche<br />
Stufe bezogen wird) ein Betrag von € 41,35 als<br />
persönliches Taschengeld zur Verfügung.<br />
Zuzahlung durch den Sozialhilfeträger<br />
Wenn das Einkommen und das vorhandene<br />
Vermögen nicht ausreichen, um die Heimkosten<br />
abzudecken, kann beim zuständigen Wohnsitzgemeindeamt<br />
oder dem Magistrat ein „Antrag<br />
auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfs durch<br />
Übernahme der Heimkosten“ gestellt werden.<br />
Damit der Sozialhilfeträger die anfallenden Kosten<br />
übernimmt, müssen wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit<br />
und Pfl egeheimbedürftigkeit nachgewiesen<br />
werden.<br />
Oft besteht die Befürchtung, dass Eigentumswohnungen,<br />
Grundstücke usw. verkauft werden<br />
müssen, um Heimkosten abdecken zu können.<br />
Grundsätzlich sind Liegenschaften ein nicht sofort<br />
verwertbares Vermögen und sind ein Haftungskapital<br />
für Forderungen des Sozialhilfeträgers. Dies<br />
wird im Rahmen des Aufwandersatzes (siehe<br />
unten) berücksichtigt (= grundbücherliche Sicherstellung).<br />
Aufwandersatz<br />
o<br />
Der Sozialhilfeverband prüft im „Aufwand-Ersatzverfahren“<br />
anhand der gesetzlichen Bestimmungen<br />
die Möglichkeiten, wer für die vorläufi g<br />
entstandenen Kosten zum Aufwandersatz herangezogen<br />
werden kann:<br />
o Der/die HilfeempfängerIn (HeimbewohnerIn)<br />
selbst<br />
Eltern, Kinder und EhegattInnen, soweit<br />
sie nach bürgerlichem Recht verpfl ichtet<br />
sind, für den/die EmpfängerIn der Sozialhilfe<br />
Unterhaltsleistungen zu erbringen.<br />
o Dritte, soweit die HilfeempfängerIn<br />
(HeimbewohnerIn) ihnen gegenüber vertragliche<br />
Rechtsansprüche oder Forderungen<br />
haben (zum Beispiel Ausgedinge<br />
Leistung aus Übergabeverträgen)<br />
o<br />
Erben, soweit der Nachlass ausreicht.<br />
08<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong>
Das fi nanzielle Ausmaß des „Aufwandersatzes“<br />
von unterhaltspfl ichtigen Angehörigen (im Sinne<br />
des Stmk. Sozialhilfegesetzes) richtet sich prozentuell<br />
nach der Höhe des Einkommens, wobei<br />
Kosten für Wohnversorgung, wie Miete, allgemeine<br />
Betriebskosten und Darlehensrückzahlung für<br />
Wohnraumschaffung berücksichtigt werden.<br />
Bei Ehegatten richtet sich der Aufwandersatz nach<br />
dem bürgerlichen Recht der geltenden Unterhaltsverpfl<br />
ichtung.<br />
Das Vermögen der unterhaltspfl ichtigen Angehörigen<br />
wird nicht angetastet.<br />
Verschenktes oder verkauftes Vermögen<br />
Wenn Vermögen (zum Beispiel eine Wohnung)<br />
aufgrund eines bevorstehenden Umzugs in ein<br />
Heim vom zukünftigen Heimbewohner verschenkt<br />
oder unter dem Wert verkauft wird (um dadurch<br />
z.B. eine Eintragung mit den Forderungen des Sozialhilfeträgers<br />
in das Grundbuch zu verhindern)<br />
besteht die Möglichkeit, dass der Sozialhilfeträger<br />
dieses Rechtsgeschäft anfi cht.<br />
In diesen Fällen ist der Wert der Schenkung zu<br />
ersetzen bzw. ist das Rechtsgeschäft rückabzuwickeln.<br />
Wenn der Verdacht einer betrügerischen<br />
Handlung vorliegt, wird Strafanzeige erstattet.<br />
Es gibt aufgrund der von uns eingeholten Auskünfte<br />
keine fi xe Regelung, wie lange zurück<br />
Geschenke, usw. rückgängig gemacht werden<br />
können. Wichtig erscheint, dass die Rückgabe<br />
gefordert werden kann, wenn zum Zeitpunkt der<br />
Schenkung offensichtlich war, dass ein Heimaufenthalt<br />
in Zukunft notwendig sein wird.<br />
Die Erben<br />
Verbleibt eine offene Forderung für den Sozialhilfeträger<br />
nach Durchführung des Kostenersatzverfahrens,<br />
wird dies im Rahmen des Nachlassverfahrens<br />
bei Gericht angemeldet. Im Zuge<br />
dieses Verfahrens wird die Forderung des Sozialhilfeträgers<br />
(nach Abzug der Todesfallskosten)<br />
bei der Aufteilung des Nachlasses berücksichtigt.<br />
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der Heimaufenthalt<br />
aufgrund der angeführten Kostenregelung<br />
leistbar ist. Die zwangsweise Einbringung von Ersatzansprüchen<br />
darf nur soweit erfolgen, als dadurch<br />
der Lebensbedarf des Ersatzpfl ichtigen und<br />
seiner Angehörigen nicht gefährdet ist (Sozialhilfe-<br />
Richtsatz).<br />
Zur Vorgehensweise bei einem Heimaufenthalt:<br />
Setzen Sie sich mit dem Heim ihrer Wahl bezüglich<br />
der Kosten genau auseinander, achten Sie<br />
auch auf Kosten, die auf den ersten Blick nicht offensichtlich<br />
sind. Vielfach kommt es vor, dass z. B.<br />
für Diätkost, Reinigung der Wäsche oder andere<br />
Dienstleistungen Extrakosten anfallen.<br />
Für eine bevorstehende Heimunterbringung: Sprechen<br />
Sie mit der Heimleitung und beantragen Sie<br />
beim zuständigen Wohnsitz-Gemeindeamt „Hilfe<br />
zur Sicherung des Lebensbedarfes durch Übernahme<br />
der Heimkosten“ nach dem Stmk. Sozialhilfegesetz.<br />
DSA Heike Gremsl<br />
Heike GREMSL, Dipl. Sozialarbeiterin, erreichen Sie im <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong><br />
unter (0316) 42 81 61 bzw. unter 0664/343 83 81<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong><br />
09
AUSDRUCKSSTARKE EINDRÜCKE IN TON<br />
Die dritte Staffel<br />
Das <strong>SMZ</strong> bietet Menschen mit<br />
Suchtproblemen unter anderem<br />
die Möglichkeit der Drogenersatzbehandlung<br />
(Substitutionsbehandlung).<br />
Neben der ärztlichen Betreuung<br />
spielt die psychosoziale<br />
Begleitung der Betroffenen eine<br />
zentrale Rolle in der Behandlung.<br />
Neben Beratung und regelmäßigen<br />
Gruppentreffen ist der Keramikworkshop,<br />
bei dem die Teilnehmer-<br />
Innen ihre kreativen Potentiale finden<br />
und weiterentwickeln, zu einem<br />
regelmäßigen Angebot geworden.<br />
Das Ergebnis unseres heurigen Keramikworkshops<br />
(17.7. – 7.8.<strong>2004</strong>)<br />
kann sich sehen lassen: Schüsseln,<br />
Schalen, Kerzenhalter, ein Schmetterling<br />
und eine Teekanne – gefertigt in<br />
nur vier Nachmittagen.<br />
Die Stücke wurden mit einfachen<br />
Aufbautechniken hergestellt und mit<br />
lebensmittelechten Effektglasuren aufgewertet.<br />
Obwohl sich mittlerweile ein fi xer Kern<br />
von TeilnehmerInnen gebildet hat,<br />
sind NeueinsteigerInnen auch bei den<br />
nächsten Kursen herzlich willkommen.<br />
Vorkenntnisse oder künstlerische Voraussetzungen<br />
sind nicht erforderlich –<br />
bei unserem Keramikworkshop steht<br />
die Neugierde am Experimentieren<br />
mit Form und Farbe im Vordergrund!<br />
Ilonka Benedek<br />
Ilonka Benedek leitet seit einigen Jahren Keramikworkshops und ist nun als Kreativtherapeutin<br />
bei „Walkabout – Therapiestation für Drogenkranke“ tätig.<br />
10<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong>
„BEIM REDN KUMMAN D’LEIT ZAMM“<br />
– die Kluft zwischen Jung und Alt verringern<br />
Im Projekt „Gemeinsam statt einsam“<br />
besuchen SchülerInnen des Vollinternats<br />
des BG/BORG <strong>Liebenau</strong> (ehemals<br />
HIB) alte Menschen im Bezirk. Die<br />
SchülerInnen werden dabei von ihrer<br />
Professorin, Frau Mag. Schöninger und<br />
der Leiterin der Sozialen Dienste, Frau<br />
DGKS Ortner, begleitet. Am Ende des<br />
letzten Schuljahres reflektierten die<br />
Schülerinnen und ihre Professorin ihre<br />
Erfahrungen.<br />
„<br />
„Beim Redn kumman d’Leit zamm“ – die Kluft zwischen Jung und Alt verringern<br />
Dieses alte Sprichwort bewahrheitet sich, wenn<br />
man Bilanz über vier Jahre Teilnahme am Projekt<br />
„Gemeinsam statt einsam“ zieht.<br />
Zu Beginn meiner „Projektkarriere“ war ich neu<br />
an der Schule (5 S) bzw. im Internat und sehr<br />
gespannt darauf, welche Aufgabe, welche Umstände<br />
und vor allem wer mich in diesem Projekt<br />
erwartet. Auf die „wer“-Frage bekam ich „eine<br />
sehr liebenswerte, positiv denkende Frau!“ zur<br />
Antwort.<br />
An meiner Aufgabe, der Betreuung und Begleitung<br />
eines alten Menschen in seinem Lebensabend,<br />
hatte ich all die Jahre hindurch große<br />
Freude, und die Umstände, die mir während<br />
meiner Aufgabe begegneten, forderten mich<br />
immer wieder aufs Neue heraus.<br />
„Gemeinsam statt einsam“ bietet die Chance,<br />
die Kluft zwischen Jung und Alt zu verringern,<br />
da gegenseitig Vorurteile abgebaut werden und<br />
beide Seiten voneinander lernen können. Mit viel<br />
Offenheit und etwas Glück baut sich eine freundschaftliche<br />
Beziehung auf, und man gewinnt einen<br />
wertvollen Menschen, der das Leben prägt,<br />
so wie das in meinem Fall Frau Reichelt getan hat.<br />
Lisa NARNHOFER, 8 S des BG/BORG <strong>Liebenau</strong><br />
Mein Name ist Sara ZACH, ich besuche die 4 B<br />
und lebe schon drei Jahre im Vollinternat. Seit<br />
acht Monaten nehme ich an diesem Projekt teil<br />
und besuche regelmäßig eine 87jährige Frau.<br />
Ich habe in dieser Zeit sehr viel über Frau P. erfahren,<br />
z. B. dass sie nach dem Tod ihres Mannes<br />
schon 10 Jahre alleine lebt und kaum Kontakte<br />
zu Verwandten und anderen Menschen<br />
hat. Nur zwei Mal die Woche kam eine Nachbarin,<br />
um ihr im Haushalt zu helfen. Aber seit Frau<br />
P. diese Frau wegen Verdacht auf Diebstahl<br />
beschuldigt und die Polizei gerufen hat, kommt<br />
auch die Nachbarin nicht mehr zu ihr. Ich wurde<br />
von der Nachbarin darüber informiert und war<br />
sehr verunsichert.<br />
Sollte ich Frau P. weiterhin besuchen? Meine<br />
Mutter riet mir ab. Über die leitende Diplomkrankenschwester<br />
des Sozialmedizinischen Zentrums<br />
(<strong>SMZ</strong>) Frau Ortner und Prof. Schöninger,<br />
die das Projekt im Internat betreut, erfuhr ich,<br />
dass der Diebstahl sich als Irrtum herausgestellt<br />
hat.<br />
Frau P. litt nur an einem Verfolgungswahn, der<br />
medizinisch behandelt wurde, sodass es ihr jetzt<br />
wieder gut geht. Ich besuche sie regelmäßig,<br />
und jedes Mal freut sie sich über mein Kommen.<br />
Die Zeit bei ihr vergeht immer sehr schnell und<br />
mir machen die Besuche großen Spaß.<br />
Sarah ZACH 4 B des BG/BORG <strong>Liebenau</strong><br />
Auch in diesem Schuljahr haben sich wieder<br />
SchülerInnen des Vollinternats bereit erklärt,<br />
soziale Dienste zu leisten, sodass die Zusammenarbeit<br />
mit dem Sozialmedizinischen Zentrum<br />
Graz-<strong>Liebenau</strong> weitergeführt werden kann. In<br />
einem Feedback am 24. Mai erhielt ich sehr viele<br />
positive Rückmeldungen und die Projektteilnehmer<br />
erklärten auch ihre Bereitschaft, nächstes<br />
Jahr weiter mitmachen zu wollen. Daneben<br />
wurde auch bei anderen InternatsschülerInnen<br />
das Interesse geweckt und so blicke ich froh<br />
einer Fortsetzung von „Gemeinsam satt einsam“<br />
im Schuljahr <strong>2004</strong>/05 entgegen.<br />
Zuletzt ein Anreiz für alle, die sich eine Teilnahme<br />
am Projekt überlegen: In diesem Schuljahr erhalten<br />
treue Projektteilnehmer ein Zusatzzeugnis<br />
von der Schule und eine Praktikumsbestätigung<br />
für soziale Dienste vom <strong>SMZ</strong>-<strong>Liebenau</strong>.<br />
Mag. Elisabeth Schöninger<br />
Wir möchten uns sehr herzlich bei allen<br />
teilnehmenden SchülerInnen und ihrer Professorin,<br />
Frau Mag. Elisabeth Schöninger, bedanken,<br />
die das Projekt „Gemeinsam statt einsam“<br />
durch ihr Engagement zu einem gelungenen<br />
Austausch zwischen den Generationen machen.<br />
“<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong><br />
11
TURNUS-ÄRZTINNEN UND -ÄRZTE<br />
IN DER PRAXISGEMEINSCHAFT<br />
Seit knapp drei Jahren arbeiten nicht nur Rainer<br />
Possert und ich für unsere <strong>Liebenau</strong>er Patient-<br />
Innen – seit damals ist unsere Praxisgemeinschaft<br />
auch eine Lehrpraxis. Wir Ärzte sind vom<br />
Gesundheitsministerium anerkannt und berechtigt,<br />
promovierte Ärztinnen und Ärzte im Rahmen<br />
ihrer dreijährigen Ausbildungszeit zum selbstständigen<br />
Allgemeinmediziner (= Turnus) auszubilden.<br />
Dr. Eva Brunegger, die derzeitige Turnusärztin,<br />
ist bereits der/die sechste Arzt/Ärztin, die 6 Monate<br />
Arbeit auf diese Weise für ihren sonst ausschließlich<br />
im Krankenhaus zu absolvierenden<br />
Turnus angerechnet bekommt.<br />
Für Turnusärzte ist eine Arbeitsmöglichkeit in<br />
einer Arztpraxis, die medizinische Basisversorgung<br />
leistet, uneingeschränkt positiv.<br />
Lernen sie doch hier wesentliche Aspekte des<br />
ärztlichen Umgangs mit Menschen kennen, die<br />
das Spital unmöglich leisten kann:<br />
• Erster Kontakt mit Gesundheitsstörungen<br />
aller Art, die weit über das<br />
Spektrum einer Spitalsabteilung oder<br />
Spezialambulanz hinausgehen<br />
• Kennenlernen der in der Normalbevölkerung<br />
häufi gsten Erkrankungen (Infekte,<br />
Verletzungen, Unpässlichkeiten,<br />
aber auch Notfälle....), hinter denen<br />
aber auch beginnende ernste Erkrankungen<br />
stecken können<br />
• Einblick in die bürokratische Verwaltung<br />
der ambulanten Medizin, erste<br />
Versuche, ärztliche Verantwortung<br />
zu übernehmen bei Hausbesuchen,<br />
Blutabnahmen, kleineren Eingriffen<br />
• Kenntnisse über das dichte Netz der<br />
niedergelassenen Ärzte, deren unterschiedliche<br />
Qualität und Spezialisierung,<br />
die vielen paramedizinischen<br />
Heil-, Pfl ege- und Hilfsberufe mit ihren<br />
wichtigen auch von den Patienten sehr<br />
geschätzten Funktionen<br />
• Die große Bedeutung der Auswahl der<br />
richtigen und gezielten Untersuchungstechniken<br />
der Gerätemedizin und die<br />
Verhütung unnötiger oder schädlicher<br />
Abklärungen<br />
• Die zwei Grundsäulen der ärztlichen<br />
Tätigkeit: eine einfühlende und klare<br />
Gesprächsführung (ein genaues Hinund<br />
Zuhören und auch zwischen den<br />
Zeilen lesen, ein Ernstnehmen der Anliegen<br />
und Aufträge der PatientInnen<br />
als Grundvoraussetzung für eine gute<br />
Arzt-PatientIn-Beziehung) und eine genaue<br />
und vollständige körperliche Untersuchungstechnik<br />
und Befunderhebung<br />
als Grundlage für das ärztliche<br />
Management<br />
12<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong>
Für uns ist diese Lehrpraxistätigkeit einerseits<br />
eine Anerkennung für unsere bereits 20jährige<br />
Berufserfahrung, aber auch eine Herausforderung,<br />
unsere kritische Position dem Gesundheitsbetrieb<br />
und der Gesundheitspolitik gegenüber<br />
Jüngeren weiterzugeben – und andererseits<br />
eine Bürde, für unsere Patientinnen und<br />
Patienten kann es auch eine Belastung sein.<br />
Bekommen Ärzte im Spital ganz selbstverständlich<br />
ihren Gehalt aus den für die Ausbildung<br />
verantwortlichen öffentlichen Töpfen, so müssen<br />
wir den durchaus nicht üppigen Gehalt eines Turnusarztes<br />
meist aus der eigenen Tasche zahlen<br />
(der dafür vorgesehene Topf im Ministerium ist in<br />
den letzten Jahren systematisch ausgetrocknet<br />
worden!).<br />
Die zusätzlichen Besprechungszeiten können<br />
eine sinnvolle Refl exion der eigenen Arbeit sein,<br />
fehlen aber auch für die Patientenversorgung<br />
oder können zu zusätzlichen Wartezeiten führen.<br />
Einzelnen Patienten kann es auch durchaus<br />
nicht recht sein, von einem anderen Arzt als dem<br />
jeweiligen Praxisinhaber untersucht zu werden<br />
oder mit 2 Ärzten im Untersuchungszimmer konfrontiert<br />
zu sein (2 Personen können aber auch<br />
mehr hören und sehen als eine!).<br />
Daher möchten wir hier eine Klarstellung Ihrer<br />
Rechte im Umgang mit der Lehrpraxis treffen:<br />
• Selbstverständlich ist es für Sie als<br />
unser Patient oder unsere Patientin jederzeit<br />
möglich, einen Arztkontakt ohne<br />
Turnusärztin zu wählen – Sie werden<br />
auch immer wieder danach gefragt<br />
• Sollten Sie zunächst von unserem Turnusarzt<br />
untersucht werden, können Sie<br />
selbstverständlich einen Kontakt zu uns<br />
anschließen<br />
• Jede Arbeit von Turnusärzten wird von<br />
uns genau beobachtet, kritisch besprochen<br />
und supervidiert<br />
• Behandlungen und Untersuchungen dürfen<br />
nur mit unserem Einverständnis<br />
durchgeführt werden<br />
• Sollten Turnusärzte selbständig Hausbesuche<br />
durchführen dürfen, dann nur<br />
mit ständiger telefonischer Rücksprache<br />
und Kontakt mit uns Ärzten.<br />
Die zusätzliche Arbeit als Ausbildungspraxis<br />
sollte insgesamt eine Verbesserung der Qualität<br />
unserer Arbeit sein und das Verständnis jüngerer<br />
Ärzte für die Erfordernisse der niedergelassenen<br />
Ärzte fördern. Wir hoffen, dass wir auch mit<br />
Ihrem Verständnis für diese Aufgabe rechnen<br />
können.<br />
Dr. Gustav Mittelbach<br />
AUSSTELLUNGSEMPFEHLUNG<br />
NS-EUTHANASIE IN DER STEIERMARK<br />
Wiedergefundene Lebensgeschichten von Grazer Opfern der Rassenhygiene<br />
09.10.<strong>2004</strong> – 28.01.2005 Mo – Fr 10 – 16 Uhr, Zeitgeschichtelabor, Elisabethstraße 27, Graz<br />
Ein Projekt des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie in Kooperation mit dem<br />
Zeitgeschichtelabor (Idee: Günter Eisenhut, Wolfgang Freidl – Gestaltung Stefan Riesenfellner)<br />
• Medizin – Nationalsozialismus – Euthanasie<br />
Die 1.177 bisher namentlich erfassbaren Opfer der Aktion T4 stehen stellvertretend für die<br />
mehr als 2000 Steirerinnen und Steirer die in der NS-Zeit verfolgt, zwangssterilisiert oder<br />
ermordet wurden<br />
• Ideologische Grundlage der Rassenhygiene<br />
• Menschen mit Behinderung: damals und heute<br />
• Höhezüchtungsphantasien heute<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong><br />
13
KEINE ZERSCHLAGUNG DER SOZIALVERSICHERUNG<br />
Hans Sallmutter wies in seinem Vortrag im <strong>SMZ</strong> (siehe S. 6 ) auf die Gefahren hin, die<br />
durch eine mögliche Zerstörung des solidarischen Systems drohe. Mit seiner Sorge um<br />
das bewährte solidarische Prinzip steht er nicht alleine da – die Bestrebungen der Regierung,<br />
neue Selbstbehalte einzuführen und das Gesundheitssystem zu privatisieren,<br />
ließen viele warnende Stimmen laut werden.<br />
Die Plattform „Keine Zerschlagung der Sozialversicherung“ ist eine dieser Stimmen.<br />
Der bereits seit 2001 bestehende Zusammenschluss hat es sich zum Ziel gesetzt,<br />
die Sozialversicherung in der bestehenden Form zu erhalten. Das <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong><br />
unterstützt die Anliegen dieser Plattform und bittet auch Sie um die Unterstützung<br />
durch Unterschriften oder die Weitergabe der <strong>Info</strong>rmationen an Interessierte.<br />
JA ZUR SOZIALVERSICHERUNG<br />
GASTBEITRAG DER PLATTFORM: KEINE ZERSCHLAGUNG DER SOZIALVERSICHERUNG<br />
Durch die gesetzliche Sozialversicherung ist<br />
jeder Österreicher, jede Österreicherin, ob Arbeiter,<br />
Angestellter, Bauer, Selbständiger, ob<br />
Kind oder Jugendlicher, ob erwerbslos oder<br />
in Pension, versichert – insgesamt 8 Millionen<br />
Menschen. Keiner fällt heraus! Die Beiträge<br />
dafür bringen die arbeitenden Menschen selbst<br />
auf. Das Budget der Sozialversicherung beträgt<br />
rund 36,4 Milliarden Euro oder 500 Milliarden<br />
Schilling (500.000.000.000 !) und fl ießt zu 97%<br />
(knapp 3 Prozent Verwaltungsaufwand) zurück<br />
in Leistungen für die Versicherten. Profi t wird in<br />
der SV – absichtlich und im Interesse der Versicherten<br />
- keiner gemacht. Die SV ist der größte<br />
Non-Profi t-Bereich Österreichs. Ihr Budget ist<br />
das zweitgrößte nach dem des Bundes.<br />
Seit Jahren heißt es nun: „Gesundheit muss uns<br />
mehr wert sein“ oder „Krankheit wird zu teuer“.<br />
Hinter solchen Sprüchen steckt die Absicht der<br />
Privatversicherer (Banken, Versicherungen)<br />
und des wachsenden Marktes der privaten Gesundheitsanbieter<br />
(Kliniken usw.), mit unserer<br />
Gesundheit bzw. Krankheit mehr Geld zu machen.<br />
Der Markt dafür ist aber begrenzt, weil<br />
die arbeitenden Menschen ja nicht unendlich<br />
viel Geld haben. Deshalb soll jetzt auf das Geld<br />
der Versicherten, eben auf die derzeit nicht gewinnorientiert<br />
verwendeten 36,4 Milliarden Euro<br />
zugegriffen werden.<br />
Das ist aber nicht möglich, solange es die<br />
Sozialversicherung gibt. Deshalb wird in der<br />
Öffentlichkeit ein Bild der Überschuldung und<br />
der Ineffi zienz gezeichnet, um diese leichter zerstören<br />
zu können. Aber noch mehr: Statt mit Hilfe<br />
einer Verbreiterung der Beitragsgrundlage die fi -<br />
nanziellen Probleme der Gebietskrankenkassen<br />
in den Griff zu bekommen, wurden die Kassen<br />
durch den Gesetzgeber in den letzen Jahren sogar<br />
zusätzlich für Staatsbudget (zur Erreichung<br />
des „Nulldefi zits“, Spitalsfi nan-zierung usw.) und<br />
Wirtschaft (z.B. Beitragssenkung für Dienstgeber<br />
usw.) ausgeplündert.<br />
Neben der Miesmacherkampagne, Schikanen<br />
(ungerechtfertigten Sonderprüfungen) und der<br />
fi nanziellen Aushungerung wurde mit der „Strukturreform“<br />
des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger<br />
2001 auch begonnen, die Sozialversicherung<br />
organisatorisch zu demontieren.<br />
Weil der Verfassungsgerichtshof diese „Reform“<br />
aufgehoben hat, soll jetzt mit Hilfe von sogenannten<br />
„Gesundheitsagenturen“ die gesetzliche<br />
Sozialversicherung zerschlagen werden:<br />
Die fi nanziellen Mittel von 36,4 Milliarden Euro<br />
sollen über die Länder zum „privaten Gesundheitsmarkt“<br />
umdirigiert werden. Zum Schaden<br />
der Versicherten: Denn die Privaten bieten ihre<br />
Leistungen viel teurer als die Sozialversicherung<br />
an und haben einen Verwaltungsaufwand von<br />
bis zu 25%.<br />
In der aktuellen Diskussion um die Finanzierung<br />
des Gesundheitssystems wird bewusst<br />
verschwiegen, dass die Medikamentkosten, von<br />
denen Pharmaindustrie und Apotheken profi tieren,<br />
in den letzten 10 Jahren mit einem Plus von<br />
fast 90 Prozent die höchste Steigerung in allen<br />
Ausgabenbereichen verzeichneten. Ebenso,<br />
dass den Gebietskrankenkassen jährlich durch<br />
nicht oder nicht fristgerecht abgeführte Beiträge<br />
seitens der Arbeitgeber hunderte Millionen Euro<br />
entgehen. So sind im Jahr 2003 die Zahlungsrückstände,<br />
d. h. die Arbeitgeberschulden bei<br />
den Gebietskrankenkassen bereits auf 897,2<br />
Millionen Euro (12,35 Milliarden Schilling) angewachsen.<br />
Würden alle Unternehmer ihre Steuern und Sozialversicherungsbeiträge<br />
so pünktlich und genau<br />
abliefern wie die Arbeitnehmer und Pensionisten,<br />
gäbe es einen riesigen Spielraum für Sozialpolitik.<br />
Denn neben den Beitragsrückständen zur<br />
Sozialversicherung schulden die Firmen dem<br />
Staat an Steuern knapp 1,7 Milliarden Euro oder<br />
23,4 Milliarden Schilling (Wirtschaftsblatt, 5. 9.<br />
2003).<br />
NEIN ZU GESUNDHEITSAGENTUREN<br />
14<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong>
GEGENÜBERSTELLUNG<br />
PFLICHTVERSICHERUNG<br />
(GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG)<br />
Gleiche Leistungen für alle Anspruchsberechtigten,<br />
unabhängig von Geschlecht, Alter und Vorerkrankungen.<br />
Kein Riskenausschluss!<br />
VERSICHERUNGSPFLICHT<br />
(PRIVATVERSICHERUNGEN)<br />
Gesundheitszustand, Geschlecht und Alter sind<br />
wesentliche Kriterien für die Prämienhöhe und<br />
den Leistungsumfang. Riskenausschluss!<br />
Beitragsfreie Mitversicherung von Angehörigen<br />
ohne Leistungsbeschränkung.<br />
Prämienzahlung für jede versicherte Person -<br />
auch für nicht berufstätigen Ehepartner und die<br />
Kinder.<br />
Soziale Gerechtigkeit durch lohn-, gehalts- bzw.<br />
pensionsabhängige Krankenversicherungsbeiträge.<br />
Übersichtliche Tarifgestaltung, weil für einen einzigen<br />
Beitrag Anspruch auf alle Gesundheitsleistungen<br />
gegeben ist.<br />
Gesetzlicher Leistungsanspruch: Welche Leistungen<br />
die Krankenkassen zu erbringen haben,<br />
ist gesetzlich geregelt und es besteht größtenteils<br />
ein durchsetzbarer Rechtsanspruch.<br />
Der Beitragssatz wurde seit 1974 nur zweimal<br />
erhöht, und zwar jeweils in Verbindung mit der<br />
Einführung neuer Leistungen.<br />
Für die Patienten – nicht gewinnorientiert!<br />
Versichert ist automatisch, wer bestimmte, im Gesetz<br />
geregelte Bedingungen erfüllt.<br />
Behandlung erfolgt unabhängig vom Ausmaß der<br />
benötigten Leistungen und ohne zeitliche Begrenzung.<br />
Die Verwaltungskosten der Sozialversicherung<br />
betragen 2,5 bis 3 Prozent.<br />
Finanzielle Überforderung einzelner Personengruppen<br />
durch hohe Versicherungsprämien, wie<br />
z.B. schon jetzt durch starke Anhebungen der<br />
Prämien der Pensionisten für private Zusatzversicherungen.<br />
Unübersichtliche Tarifvielfalt aufgrund verschiedener<br />
Tarife für einzelne Leistungen, Sonderbestimmungen,<br />
usw.<br />
Vertragliche Leistungen: Die Leistungsansprüche<br />
werden durch diverse Versicherungsbedingungen<br />
geregelt.<br />
Prämien werden häufi g erhöht.<br />
Für die Aktionäre – gewinnorientiert!<br />
Versichert ist nur derjenige, dessen Antrag von<br />
der jeweiligen Versicherung angenommen wird.<br />
Die Versicherungssumme kann z.B. nicht zur Abdeckung<br />
der Kosten für eine Organtransplantation<br />
ausreichen und die Versicherung kann - wenn zu<br />
viele Leistungen benötigt werden - vom Versicherungsunternehmen<br />
auch wieder gekündigt werden.<br />
Bei den Privatversicherern beträgt der Verwaltungsaufwand<br />
bis zu 25 Prozent!<br />
Deshalb laden wir alle Interessierten zur Mitarbeit ein. Gegen die Macht der Medien können die<br />
vielen Einzelnen, die sich aktiv einschalten und direkt oder indirekt zusammenarbeiten als wirkliches<br />
Massenmedium wirken. Jeder dort wo er lebt und arbeitet. Damit und mit Hilfe der neuen Medien<br />
können wir unseren Einsatz verstärken und vergrößern und entsprechende Wirkung erzielen.<br />
Arbeiten Sie mit im Netzwerk. Gemeinsam statt einsam!<br />
GASTBEITRAG DER PLATTFORM: KEINE ZERSCHLAGUNG DER SOZIALVERSICHERUNG<br />
ÖSK - Plattform „Keine Zerschlagung der Sozialversicherung“<br />
ADRESSE Wurlitzerg. 71/25, 1160 Wien EMAIL proSV@akis.at TEL 0650 / 830 7 830<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong><br />
15
VERANSTALTUNGEN UND TERMINE<br />
OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER <strong>2004</strong><br />
Sozialmedizinisches<br />
Zentrum<br />
<strong>Liebenau</strong><br />
GESUNDHEITSPLATTFORM LIEBENAU: ARBEIT AM „LEITBILD GESUNDES LIEBENAU“<br />
Nächstes Treffen: MONTAG, 15. NOV <strong>2004</strong> 19.00 Uhr<br />
Veranstaltungsraum des <strong>SMZ</strong>, <strong>Liebenau</strong>er Hauptstraße 102<br />
PFLEGE- UND BETREUUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR SENIORINNEN – ALTERNATIVEN ZUM HEIM<br />
Termin wird noch bekanntgegeben!<br />
Vortrag und <strong>Info</strong>rmationsstände für SeniorInnen und deren Angehörige (Seniorenverbund <strong>Liebenau</strong>)<br />
GESUNDHEIT FÜR ALLE?<br />
MONTAG, 29. NOV <strong>2004</strong><br />
19.00 Uhr<br />
Vortrag und Diskussion mit: NR Manfred Lackner, Gesundheitssprecher der SPÖ; Veranstaltungsraum des <strong>SMZ</strong>,<br />
<strong>Liebenau</strong>er Hauptstraße 102; Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe Forum für praktische Sozialmedizin<br />
LAUFENDE ANGEBOTE DES <strong>SMZ</strong><br />
LANGSAM LAUFEN LIEBENAU<br />
Ab 26. OKT wieder Winterlaufzeit! DIENSTAGS<br />
15.00 – 16.00 Uhr<br />
Treffpunkt: Hof des <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong>, <strong>Liebenau</strong>er Hauptstraße 104<br />
BEWEGUNG MIT MUSIK<br />
Jeden ersten FREITAG im Monat<br />
16.00 – 17.30 Uhr<br />
Gemütliches Beisammensein für ältere Menschen; Treffpunkt: Veranstaltungsraum des <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong>, <strong>Liebenau</strong>er<br />
Hauptstraße 102; Auskunft: DGKS Christine Ortner, (0316) 47 17 66<br />
FAMILIEN- UND RECHTSBERATUNG, PSYCHOLOGISCHE BERATUNG<br />
jeden DONNERSTAG<br />
19.00 – 21.00 Uhr<br />
Anonyme und kostenlose Beratung durch Ärzte, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter und Juristen z. B. bei Schwierigkeiten in<br />
der Partnerschaft, Arbeitslosigkeit, Jugendproblemen etc.; <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong>; Anmeldung unter (0316) 46 23 40 (vormittags)<br />
SEXUALBERATUNG IM <strong>SMZ</strong> LIEBENAU<br />
MONTAGS<br />
15.00 – 19.00 Uhr<br />
Beratung bei Sexualstörungen, Sexualität und Gesundheit, Beziehungskonfl ikten, Homosexualität, Sexueller Gewalt,<br />
Sexualaufklärung,... Dr. Ulrike Körbitz, nur nach Terminvereinbarung – auch anonym – unter: (0316) 46 23 40 (<strong>SMZ</strong>)<br />
MEDIATION IM <strong>SMZ</strong> LIEBENAU<br />
DIENSTAGS<br />
14.00 – 19.00 Uhr<br />
Bei familiären Auseinandersetzungen, vor/in/nach einer Scheidung oder Trennung; Dr. phil. Lisa Neubauer/Dr. jur. Wolfgang<br />
Sellitsch, Institut für Mediation & Konfl iktmanagement; nur nach Terminvereinbarung unter: 28 45 85 bzw. 0699/11 22 80 11<br />
16<br />
<strong>SMZ</strong> INFO NOVEMBER <strong>2004</strong>
ANGEBOTE DES <strong>SMZ</strong> LIEBENAU<br />
Sozialmedizinisches<br />
Zentrum<br />
<strong>Liebenau</strong><br />
ALLGEMEIN-MEDIZINISCHE PRAXISGEMEINSCHAFT<br />
Dr. Gustav Mittelbach, Dr. Rainer Possert (alle Kassen)<br />
Hausbesuche, Gesundenuntersuchungen, ärztliche Psychotherapie und Beratung, Behandlung<br />
von Suchterkrankungen, Akupunktur, Sozial-, Arbeits- und Umweltmedizin<br />
Terminvereinbarung unter 46 23 40<br />
SOZIALE DIENSTE<br />
Hilfestellung für kranke, alte und pfl egebedürftige Menschen in deren gewohntem Umfeld durch<br />
diplomierte Gesundheits- und Krankenschwestern, Alten- Pfl ege- und HeimhelferInnen. 47 17 66<br />
oder 0664/25 10 815 e-mail: ortner@smz.at<br />
PHYSIOTHERAPIE<br />
Akutschmerzbehandlung, Bewegungstherapie, Entspannungstechniken, Heilgymnastik<br />
durch diplomierte Physiotherapeutin. Therapieschwerpunkte: Neurologie und Orthopädie.<br />
Hausbesuche im Bezirk möglich. Tel. Anmeldung unter 46 23 40-15<br />
FAMILIENBERATUNG & RECHTSBERATUNG<br />
Anonyme und kostenlose Beratung durch Ärzte, PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen und<br />
JuristInnen. Donnerstag von 19 – 21 Uhr, Anm. unter 46 23 40<br />
PSYCHOTHERAPIE<br />
Gestalt- und Familientherapie, NLP, Systemische Therapie, Einzel- und Gruppentherapie sowie<br />
Kinderpsychotherapie. Teilkostenersatz durch die Krankenkassen. Anmeldung unter 46 23 40<br />
SOZIALE ARBEIT<br />
Beratung in sozialrechtlichen Fragen, Hilfen bei Kontakten zu Behörden, Hilfestellung bei<br />
Wohnungsproblemen, Arbeitslosigkeit,.. Telefonische Kontaktaufnahme unter 42 81 61 oder<br />
0664/34 38 381; e-mail: gremsl@smz.at<br />
GESUNDHEITSFÖRDERUNG<br />
Sozialmedizinische und gesundheitsförderliche Veranstaltungen; Durchführung von Projekten<br />
im Bereich Gesundheitsförderung. Kooperationen im Bezirk und mit anderen Organisationen.<br />
Kontakt unter 47 17 66-13; e-mail: gruber@smz.at<br />
SEXUALBERATUNG<br />
<strong>Info</strong>rmation, Beratung, Psychotherapie zu folgenden Bereichen: Beziehungskonfl ikte,<br />
Sexualprobleme, Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Homosexualität, Verhütungsfragen,<br />
Sexualaufklärung, Schwangerschaftskonfl ikten usw. Anmeldung (auch anonym) unter 46 23 40<br />
MEDIATION<br />
Hilfe bei familiären Auseinandersetzungen, Scheidung und Trennung; Entschärfung von<br />
Konfl ikten; Klärung von Streitpunkten; Unterstützung bei der Entwicklung eigener Lösungen.<br />
Auskunft und Anmeldung unter: 28 45 85 bzw. 0699/11 22 80 11<br />
17
P.b.b. Zulassungsnummer: GZ 02Z034445M; Verlagspostamt 8041 Graz