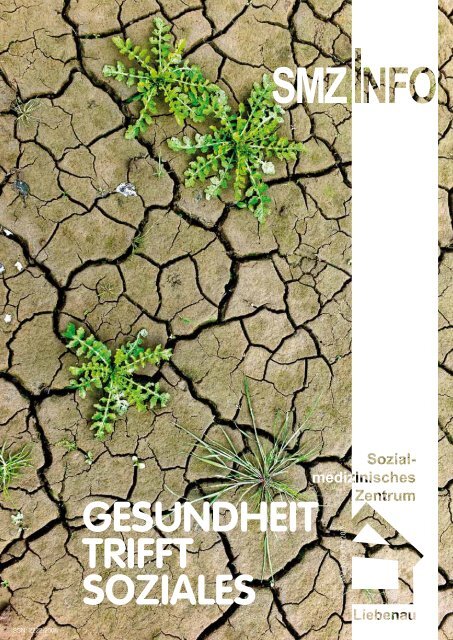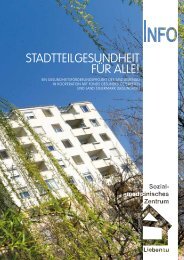Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
GESUNDHEIT<br />
trifft<br />
soziales<br />
<strong>SMZ</strong> INFO juni <strong>2012</strong><br />
ISSN: 2222-2308
in dieser ausgabe<br />
mitarbeiterinnen<br />
des <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong><br />
Dr. Rainer Possert<br />
Arzt für Allgemeinmedizin<br />
Psychotherapeut<br />
editoriaL 01<br />
Dr. Gustav Mittelbach<br />
Arzt für Allgemeinmedizin<br />
Psychotherapeut<br />
Dipl. PT Heilwig<br />
Possert-Lachnit, MSc<br />
Physiotherapeutin<br />
Dr. Inge Zelinka-Roitner<br />
Soziologin<br />
Medizin trifft sozialES<br />
Privatisierung steirischer Spitäler? 02<br />
Physiotherapie:<br />
unverzichtbar in der medizinischen Primärversorgung! 06<br />
Zukunftsmodell Hausarzt? 09<br />
Wie leistbar ist Psychotherapie? 12<br />
Turnus im <strong>SMZ</strong> 14<br />
Erfolgreiche Wege aus der Sucht… 16<br />
Angehörige bezahlen wieder für Pflege 20<br />
DSA Ina Alic<br />
Sozialarbeiterin<br />
Rosa Bruckenberger<br />
Turnusärztin<br />
Gesundheitsförderung<br />
3 Jahre Sta.geS 22<br />
das projekt sta.ges holte viele ab 25<br />
Gesundheit ist Lebensqualität – Feiern auch! 26<br />
Gesunder GarteN 28<br />
Seniorenverbund <strong>Liebenau</strong> 32<br />
Mag. Karin Ettl<br />
Verwaltung<br />
Geschichtsbewusstsein schärfen<br />
Das Vergessen der Vernichtung<br />
ist Teil der Vernichtung selbst 34<br />
Karin Sittinger<br />
Arzthelferin<br />
Das Lager <strong>Liebenau</strong> 36<br />
aktuelles aus dem smz<br />
Birgit Paller, MA<br />
Sozialarbeiterin<br />
Michaela Spari<br />
Assistentin<br />
Dr. Ulrike Körbitz<br />
Psychoanalytikerin<br />
Krista Mittelbach<br />
Psychotherapeutin<br />
DSA Theresa Augustin<br />
Psychotherapeutin<br />
<strong>SMZ</strong> trifft Arbeiterbetriebsrat von Magna PowertraIN 40<br />
Meine persönlicheN ErfahrungEN bei Magna 42<br />
Unsere Mitarbeiterinnen 44<br />
Ein abschied mit weinendem Auge 46<br />
Update aus Afrika 47<br />
„Aufgeschnappt“ 48<br />
angebote des smz liebenau 49<br />
IMPRESSUM<br />
HERAUSGEBER: <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong>, <strong>Liebenau</strong>er Hauptstraße 102-104 a, 8041 Graz<br />
TEL 0699 180 84 375 F (0316) 462340-19<br />
Email smz@smz.at Homepage www.smz.at vereinsregister ZVR: 433702025<br />
REDAKTION: Dr. Rainer Possert, Mag. a Dr. in Inge Zelinka-Roitner<br />
Mitarbeiterinnen dieser Ausgabe: Das Team des <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong><br />
FOTOS: Rainer Possert; <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong><br />
LAYOUT + SATZ CUBA, graz www.cubaliebtdich.at<br />
DRUCK Druckerei Bachernegg GmbH, Kapfenberg AUFLAGE 1.700 Stk.<br />
Dr. Wolfgang Sellitsch<br />
Jurist
Editorial<br />
Seit beinahe drei Jahrzehnten dieselbe Leier<br />
aus den „Leitmedien“: Gesundheitsreform<br />
= Sparen = Spitalsreform = ambulante<br />
Versorgung ausbauen. Nunmehr soll zum<br />
x-ten mal aus den Spitälern „ausgelagert“<br />
werden, nur – im ambulanten Sektor ist<br />
30 Jahre lang nichts passiert, da ist nichts:<br />
Physiotherapie, Psychotherapie, Logopädie<br />
– hohe Selbstbehalte, Menschen mit geringem<br />
Einkommen sind von diesen ambulanten<br />
Leistungen quasi ausgeschlossen – in<br />
Österreich werden bis zu 35% mehr Selbstbehalte<br />
bezahlt als in anderen Ländern.<br />
Hohe Rezeptgebühren, aberwitzige Kosten<br />
für Hörgeräte, Brillen und andere Heilbehelfe<br />
belasten die Budgets der Kranken.<br />
Nicht gespart wird bei den Ausgaben der<br />
Kassen für Medikamente, das wäre ja zum<br />
Schaden der Pharmabranche, niedergelassene<br />
Ärzte werden von den Kassen zu<br />
„ökonomischer Verschreibweise“ angehalten<br />
und „evaluiert“.<br />
Liebe Sozialversicherungsmanager: holt<br />
Euch EinkäuferInnen von Magna-Steyr und<br />
lasst sie mit den Medikamentenlieferanten<br />
verhandeln. Wenn die Einkäufer nicht korrupt<br />
sind, dann werden die Kosten für Medikamente<br />
dramatisch sinken!<br />
Um zu „sparen“, nicht um die Versorgung zu<br />
verbessern, soll Krankenbehandlung ausgelagert<br />
werden. Nur: Am Hausärztesystem<br />
hat sich nichts geändert, ja es wird noch<br />
schlimmer werden. Ca. 70% der Medizinstudenten<br />
wollen im Krankenhaus bleiben,<br />
wer von ihnen geht noch aufs Land? Das<br />
Modell <strong>SMZ</strong> für Zusammenarbeit zwischen<br />
Ärzten und anderen Berufsgruppen in der<br />
primären Gesundheitsversorgung ist eine<br />
einsame Insel geblieben, und selbst da,<br />
wo es hervorragend funktioniert hat, waren<br />
Spar-ExpertInnen am Werk – die von uns<br />
aufgebaute Hauskrankenpflege für Puntigam<br />
und <strong>Liebenau</strong> wurde „ausgelagert“.<br />
Trotzdem, in diesem <strong>Info</strong>: Wieder einmal<br />
Berichte aus unserer Praxis und von unseren<br />
Veranstaltungen.<br />
Zum Weiterlesen:<br />
Zu den Schrecken der Gesundheitsreform<br />
in Deutschland: Zeitonline „Das Ende<br />
der Schweigepflicht“, http://www.zeit.de/<br />
<strong>2012</strong>/21/Klinik-Gesundheitsreform/seite-1<br />
Für Theorie Interessierte: „Zur Subsumption<br />
(Unterordnung) des Gesundheitswesens<br />
unter das Kapital, http://www.labournet.de/<br />
diskussion/wipo/gesund/rakowitz4.html<br />
Rainer Possert<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
01
Medizin trifft soziales<br />
Privatisierung<br />
Privatisierung<br />
steirischer Spitäler?<br />
Aussichten und Auswirkungen<br />
einer möglichen Spitalsreform<br />
Gustav Mittelbach<br />
Die Meldung einer möglichen Privatisierung<br />
des erst 2003 errichteten LKH West (um<br />
73,3 Mill €) in Form einer Übernahme durch<br />
die Barmherzigen Brüder Eggenberg verunsicherte<br />
und überraschte nicht nur die sonst<br />
gut informierten Insider, sondern auch die<br />
betroffene Bevölkerung, hat sie doch neben<br />
dem obligaten Sparprogramm unter Umständen<br />
mit Reduktion der medizinischen<br />
Angebote, Personalreduktion und daraus<br />
folgender Überlastung und Erhöhung der<br />
Patienten-Eigenleistungen zu rechnen –<br />
wie es deutsche Beispiele nahe legen.<br />
Teile der steirischen Öffentlichkeit und auch<br />
der steirischen Politik sind aber bisher in<br />
Sachen Privatisierung sehr wachsam bzw.<br />
zurückhaltend geblieben. Sowohl die geplante<br />
Privatisierung des Managements<br />
der KAGES (steirische Krankenanstaltsgesellschaft),<br />
als auch eine Privatisierung<br />
der Blutbank des LKH Graz, sind vom steirischen<br />
Landtag nach einer längeren auch<br />
öffentlichen Debatte mehrheitlich verhindert<br />
worden.<br />
Die Schließung des Krankenhauses Hörgas<br />
und die schließlich gescheiterte Schließung<br />
der Chirurgie des Krankenhauses in Bad<br />
Aussee können noch als Versuche verstanden<br />
werden, den international sehr hohen<br />
steirischen Bettenschlüssel zu reduzieren,<br />
obwohl Hörgas gerade erst umgebaut wurde.<br />
Aber was passiert wirklich im<br />
Westen von Graz?<br />
Eine dringliche Anfrage der Landtagsabgeordneten<br />
Ingrid Lechner-Sonnek gab Gesundheitslandesrätin<br />
Edlinger-Ploder<br />
in der Landtagssitzung vom 20.3.<strong>2012</strong> die<br />
Möglichkeit, ihre Pläne zu präzisieren:<br />
Ihr Hauptstatement ist überraschend klar:<br />
„…eine Privatisierung der Krankenversorgung<br />
ist nicht geplant…“<br />
und noch deutlicher: „…Privatisierung war<br />
noch nicht einmal ansatzweise in meinen<br />
Gedanken…“ und „…niemand übernimmt<br />
freiwillig in Österreich ein Krankenhaus….<br />
Privatisierung ist falsch!“<br />
Gedanken zur Spitalsreform aus<br />
ihrer Rede 1<br />
• Mit den Ordensspitälern, die derzeit selbst<br />
in den laufenden Betrieb einzahlen, werde<br />
erst eine neue Regelung der Abgangsdeckung<br />
vereinbart, Edlinger-Ploder wolle<br />
die Orden weiterhin im Boot haben.<br />
• Es gehe um eine neue Angebotsplanung<br />
für den Großraum Graz, um eine Redimensionierung<br />
der Betten (kann nur heißen :<br />
Reduktion) und um eine bessere Aufteilung<br />
der Leistungen.<br />
02<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
1<br />
Edlinger-Ploders grundsätzliche Überlegungen zur Notwendigkeit einer Spitalsreform sind im Protokoll der<br />
Landtagssitzung nachzuhören. Laut dem KAGES-Umsetzungsplan seien bis 2020 Einsparungen von 94,3 Mill.€<br />
möglich (dann 22.Mill)… Die KAGES habe seit 2008 die niedrigste Kostensteigerung aller österreichischen<br />
Landesgesellschaften. Aber es gebe in Österreich und auch im Großraum Graz (KAGES und die 14 anderen<br />
privaten Spitäler) zu viele Betten…“
»<br />
Privatisierung<br />
Medizin trifft smz soziales aktuell<br />
Privatisierung ist falsch<br />
• Ein Gesamtversorgungsbedarf sei zu definieren,<br />
eine Spitalskonzentration im Süden<br />
am LSF-Gelände sei e i n e Variante, für<br />
einen Neubau im LSF seien schon 20 Mill.<br />
€ veranschlagt- eine Kosteneinsparung pro<br />
Jahr von 1,3 bis 1,7 Millionen sei erzielbar.<br />
Zusammenfassend verstehe ich<br />
Folgendes:<br />
• Es werden Betten reduziert<br />
(und das heisst dann selbstverständlich<br />
auch Personal abgebaut),<br />
• ein neues Spital im LSF ist geplant,<br />
• die Ordensspitäler wollen mehr Geld für<br />
ihre Spitalsdefizite, müssen aber mehr Versorgungsaufträge<br />
(Bereitschaftsdienste?) für<br />
die Allgemeinbevölkerung akzeptieren,<br />
• eine echte Privatisierung ist nicht geplant<br />
(aber doch ein Spitalstausch BHB-Eggenberg<br />
LKH-West?),<br />
• und das Wichtigste:<br />
Es muss gespart werden (bei gleicher<br />
Qualität? - von der war leider sehr wenig zu<br />
hören !)<br />
Dafür spricht auch: Laut Krone vom 15.<br />
Mai <strong>2012</strong> hat das Land ein Projekt in Auftrag<br />
gegeben, die „Chancen und Risiken<br />
einer Auslagerung aller patientenfernen<br />
Bereiche“ zu untersuchen, eine mögliche<br />
Teilprivatisierung also, von der im Landtag<br />
noch nicht die Rede war!<br />
Ein Blick nach Deutschland zeigt, dass dort<br />
in großem Ausmaß mit der Privatisierung<br />
öffentlicher Spitäler experimentiert wird: 2<br />
Die Gewinne der Privaten Kliniken 3 (bei<br />
einem Anteil von 60% Personal an den Gesamtkosten)<br />
sind aus Sicht der Beschäftigten<br />
vor allem auf deren Kosten entstanden.<br />
Einnahmen könnten kaum beeinflusst<br />
werden, die Renditen laufen über die Verringerung<br />
der Ausgaben.<br />
Die durchschnittlichen Personalkosten/Vollkraft<br />
der Privaten liegen 4,4% niedriger als<br />
in öffentlichen Krankenhäusern.<br />
Die ärztlichen Personalkosten liegen durchschnittlich<br />
über dem Lohn in öffentlichen<br />
Krankenhaus, die Kosten der technischen<br />
Dienste und des Hauspersonals deutlich<br />
niedriger.<br />
Die Personalkosten des Pflegepersonals<br />
liegen bei 85% der PflegerInnen in öffentlichen<br />
KH.<br />
• Jüngste Veröffentlichungen sprechen aber<br />
deutlicher als im Landtag von einer Übernahme<br />
des LKH West durch die Barmherzigen<br />
Brüder, es wird also doch privatisiert!<br />
2<br />
die folgenden Angaben stützen sich auf einen Artikel der Herren Schulten und Böhlke vom wirtschafts- und<br />
sozialwissenschaftlichen Institut der Hans Böcklerstiftung- aus : Zeitschrift Dr.med.Mabuse 186/2010 S 28-31<br />
3<br />
es gibt 4 große Konzerne Rhön-KlinikumAG/Helios-Kliniken-Gruppe, gehört zu Fresenius/Asklepios-Kliniken<br />
GmbH und Sana-Kliniken AG. Die ersten 3 sind die größten Krankenhauskonzerne Europas. Der Rhönkonzern<br />
erwirtschaftet 2009 einen Gewinn von 46 Millionen €. Private Kliniken (deren Anteil sich in Deutschland zwischen<br />
91 und 08 auf 30% verdoppelt hat) sind nicht an die Tarife des öffentlichen Dienstes gebunden, sondern<br />
schließen Hausverträge ab (2007 wurde 86% der nichtärztlichen Beschäftigten in öffentlichen Spitälern nach<br />
öffentlichen Tarif bezahlt, bei den Privaten nur 14%).<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
03
Medizin trifft soziales<br />
Privatisierung<br />
»<br />
Da sich Menschen und Krankheiten nicht<br />
standardisieren lassen, stöSSt diese<br />
Strategie sehr schnell an ihre Grenzen<br />
Eine Sparpolitik, die sich nicht um die Versorgungsqualität<br />
kümmert, hat direkte Auswirkungen<br />
auf die Arbeitsbelastung:<br />
ÄrztInnen müssen in privaten Häusern ¼<br />
mehr Betten, der medizinisch-technische<br />
Dienst 75% mehr und die Vollzeitpflegekraft<br />
20% mehr Betten versorgen als in öffentlichen<br />
Spitälern. 4<br />
In den USA konnte nachgewiesen werden,<br />
dass die Sterblichkeitsrate in privaten, profitorientierten<br />
Krankenhäusern erheblich<br />
h ö h e r lag als in nicht Profitorientierten.<br />
Laut Böhlke „..lag der Fehler des privaten<br />
Managements darin, die Krankenversorgung<br />
mit industriellen Fertigungsprozessen<br />
zu vergleichen. Standardisierungs- und Automatisierungsprozesse<br />
sollen wie in der<br />
Automobilindustrie ablaufen. Da sich Menschen<br />
und Krankheiten aber nicht standardisieren<br />
lassen, stößt diese Strategie sehr<br />
schnell an ihre Grenzen<br />
Angela Spelsberg 5<br />
zur Privatisierung von UniKliniken:<br />
• Renditeerwartungen von 10% müssen<br />
durch Leistungen am Patienten erwirtschaftet<br />
werden. Werden PatientInnen mit<br />
kostenintensiven und langwierigen Krankheiten<br />
(z.B. mit Schlaganfall) gar nicht erst<br />
stationär aufgenommen, weil sie unwirtschaftlich<br />
sind?<br />
• „Die Privatisierungswelle und die Ausrichtung<br />
am Markt… gibt die staatliche Fürsorgepflicht<br />
preis und ordnet den Menschen<br />
(gesund und krank) dem im Markt üblichen<br />
Primat von Wachstum und Wirtschaftlichkeit<br />
unter-… mehr erbrachte Leistungen sind<br />
das Ziel. Dies kann aber nur durch Zunahme<br />
von Krankheit und Leiden in der Bevölkerung….<br />
erreicht werden oder durch die vermehrte<br />
Erbringung unnötiger Leistungen. 6<br />
Praktische Beispiele einer irrationalen Sparpolitik<br />
veranschaulicht das Zeitmagazin<br />
vom 16.5.<strong>2012</strong> im Artikel „Der Alltag in deutschen<br />
Kliniken - Ärzte brechen ihre Schweigepflicht“:<br />
• Schlaganfallpatienten, die nicht speziell<br />
therapiert werden können, weil der Kernspin-<br />
Tomograf nur von 8-14 Uhr arbeitet oder weil<br />
die Patienten nicht zu einer spezialisierten<br />
Einrichtung geliefert werden,<br />
• durch Medikamente verwirrte Patienten,<br />
deren Nebenwirkungen nicht erkannt werden,<br />
• die Notärztin, die für alte PatientInnen kein<br />
Bett bekommt,<br />
• Operationen, die medizinisch unnötig,<br />
aber „wirtschaftlich sinnvoll“ durchgeführt<br />
werden, u.ä.<br />
04<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
4<br />
Böhlke siehe selbe Zeitschrift S. 35-38 Böhlke ist Mitherausgeber von „ Privatisierungen von Krankenhäusern,<br />
Erfahrungen und Perspektiven aus Sicht der Beschäftigten“ VSA-Verlag Hamburg 2009.<br />
Die Privatisierung des Universitäts-Klinikums Gießen und Marburg ab 2006 war weltweit der erste Verkauf<br />
eines Universitätskrankenhauses an einen privaten Konzern (Rhön).<br />
5<br />
ärztliche Leiterin des Tumorzentrums Aachen (Mitglied im Vorstand von Transparency<br />
International Deutschland www.transparancy.de)<br />
6<br />
aus Zeitschrift wie 3) S. 39<br />
7<br />
Ernest Pichlbauer, Arzt und Gesundheitsökonom / www.rezeptblog.at
Privatisierung<br />
Medizin trifft smz soziales aktuell<br />
Ähnliche Beispiele<br />
gibt es aus Österreich 7<br />
Pichlbauer:<br />
„Jedenfalls sind die bei uns geplanten<br />
Reformschritte sehr kritisch zu begleiten,<br />
um fehlgeleitete Entwicklungen wie in<br />
Deutschland zu verhindern.<br />
Besonders wichtig ist bei allen Maßnahmen<br />
darauf zu bestehen, die Qualitätsstandards<br />
der PatientInnenversorgung<br />
nicht zu gefährden…“<br />
Seine grundlegende Reformidee:<br />
“Wenn es darum geht, unnötige Spitalsaufenthalte<br />
zu reduzieren – und nur das kann<br />
das Ziel von Spitalsreformen sein – wird<br />
man nicht umhinkommen, mehr zu besprechen,<br />
als nur den „Bettenabbau“.<br />
Im Grunde gibt es nur eine Chance: Man<br />
muss verhindern, dass Patienten ins Spital<br />
…kommen. Und der einzige Weg ist, Hausärzte<br />
aufzuwerten. Wenn diese weniger zu<br />
Fachärzten oder Ambulanzen überweisen,<br />
und Patienten dort seltener selbst hin gehen<br />
(müssen), weil sie sich vom Hausarzt gut<br />
versorgt fühlen, dann werden automatisch<br />
die Aufnahmen weniger….<br />
Ich schlage daher vor, ...allen Hausärzten<br />
40 Prozent mehr Geld (das additiv nötig<br />
wird) auszubezahlen.<br />
Das kostet erstaunlich wenig – etwa 160<br />
Millionen Euro Österreich weit. So könnten<br />
dann Spitalsreformen (mit einer Milliarde<br />
Einsparungspotential) realistischer werden<br />
und vielleicht löst sich auch der angekündigte<br />
Hausärztemangel.“<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
05
Medizin trifft soziales<br />
Physiotherapie<br />
Physiotherapie:<br />
unverzichtbar in der<br />
medizinischen Primärversorgung!<br />
Heilwig Possert-Lachnit<br />
Jeder fünfte Patient, der eine allgemeinmedizinische<br />
Ordination betritt, hat Kreuzschmerzen.<br />
Etwa ein Drittel aller PatientInnen<br />
hat Probleme mit der Wirbelsäule, den Muskeln,<br />
Gelenken, Bändern. Die Ursachen dafür<br />
sind vielfältig: Überbelastung in der Arbeit oder<br />
Freizeit, beim Sport oder Unfallfolgen. Chronische<br />
Schmerzen gibt es aber auch infolge<br />
von Fehlstellungen und Fehlhaltungen, altersbedingten<br />
Abnützungen, orthopädischen und<br />
neurologischen Erkrankungen.<br />
Es sind also sehr viele PatientInnen, die mit<br />
diesen Problemen zum praktischen Arzt als<br />
Erstanlaufstelle kommen.<br />
Und was passiert dann<br />
üblicherweise?<br />
Zum Einsatz kommen Medikamente und<br />
Spritzen, eventuell eine Krankschreibung,<br />
manchmal eine Überweisung zum Orthopäden<br />
(Wartezeit 1-3 Monate) oder eine<br />
Röntgenzuweisung und in der Folge eine<br />
CT/MR Abklärung, fallweise auch eine<br />
Überweisung zur Physiotherapie in Ambulatorien,<br />
Instituten und Physiotherapiepraxen.<br />
Dort bekommt der Patient nach einer<br />
Wartezeit von weiteren ein bis drei Wochen<br />
einen Termin, wird dann 7x behandelt - oft<br />
von wechselnden TherapeutInnen – und hat<br />
am Ende einen relativ hohen Selbstbehalt<br />
zu zahlen (nur die Ambulatorien sind ohne<br />
Zuzahlung). In dieser Wartezeit ist wertvolle<br />
Zeit vergangen, um Schmerzen von ihrer<br />
Ursache her optimal physiotherapeutisch<br />
zu handeln.<br />
Was ist im <strong>SMZ</strong> anders?<br />
Für uns war selbstverständlich, die Physiotherapie<br />
bereits bei der Gründung des Zentrums<br />
vor 28 Jahren als unverzichtbaren Teil<br />
des therapeutischen Angebots zu betrachten.<br />
Im <strong>SMZ</strong> wird jeden Vormittag im Rahmen<br />
der ärztlichen Praxisgemeinschaft physiotherapeutisch<br />
behandelt. Bei uns bekommt<br />
zum Beispiel ein Patient, der sich infolge<br />
einer Fehlbewegung schmerzverkrümmt<br />
nach einer schlaflosen Nacht in die Ordination<br />
quält, gleich nach der entsprechenden<br />
Diagnosestellung und Medikamentierung<br />
durch den Arzt eine sofortige Behandlung<br />
bei unserer Physiotherapeutin. Notwendige<br />
<strong>Info</strong>rmationen werden an Ort und Stelle weitergegeben,<br />
alle Befunde und der ärztliche<br />
Behandlungsplan sind im selben EDV System<br />
für alle ersichtlich. Möglichkeiten der<br />
Schmerzreduktion werden noch am selben<br />
Tag gezeigt, nebenwirkungsfreie elektrophysikalische<br />
Schmerzbehandlungen ergänzen<br />
oder ersetzen fallweise die Medikation.<br />
Denn: immer mehr Patienten wollen<br />
und viele können aus den verschiedensten<br />
Gründen keine Schmerzmittel nehmen. Bei<br />
Problemen und Unklarheiten gibt es Rücksprachemöglichkeiten<br />
im selben Haus.<br />
Die kurzen <strong>Info</strong>rmationswege, ein gemeinsamer<br />
Behandlungsplan und die flexiblen<br />
Änderungsmöglichkeiten im Laufe der Behandlung<br />
sind eine Besonderheit des <strong>SMZ</strong>.<br />
Um teure Doppelgleisigkeiten zu verhindern<br />
werden Therapieergebnisse und Diagnosen<br />
in der Kartei der Patienten für das Team<br />
sichtbar festgehalten.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
06
Physiotherapie<br />
Medizin trifft smz soziales aktuell<br />
immer mehr Patienten wollen und viele können<br />
aus den verschiedensten Gründen<br />
keine Schmerzmittel nehmen.<br />
»<br />
Die Zufriedenheit der Patienten, die niedrige<br />
Medikamentenverschreibung sowie die<br />
reduzierten Krankenhauseinweisungen haben<br />
uns Recht gegeben!<br />
Voraussetzungen für eine funktionierende<br />
Integration von Physiotherapie<br />
in die Primärversorgung:<br />
• Einführung eines anderen Verrechnungsmodus:<br />
Im Rahmen des kassenärztlichen<br />
Vertrages im <strong>SMZ</strong> können nur<br />
bestimmte physioterapeutische Positionen<br />
für Patienten mittels Krankenschein<br />
verrechnet werden. Für unsere Gemeinschaftspraxis<br />
sind diese gebotenen Leistungen<br />
nicht kostendeckend.<br />
• Abschaffung von zusätzlichen Selbstbehalten<br />
- kostenfreier Zugang zur Physiotherapie!<br />
• Eine unmittelbare und effiziente Kooperation<br />
mit den praktischen Ärzten<br />
• Die Wohnortnähe solcher Angebote:<br />
bei SchmerzpatientInnen besonders<br />
wichtig (Autofahren ist z.B. bei einem<br />
akuten Bandscheibenvorfall manchmal<br />
unmöglich oder steigert die Schmerzsymptomatik).<br />
• Niedrigschwellige Physiotherapie, für<br />
alle Versicherten zugänglich und kostenlos<br />
sein sollte: MigrantInnen mit Sprachproblemen<br />
und Menschen, die sich im<br />
Medizinsystem schlechter zurecht finden,<br />
müssen ebenfalls einen Zugang zur Physiotherapie<br />
haben. Dafür müsste aber<br />
auch die Vergütung anders geregelt und<br />
der Selbstbehalt abgeschafft werden!<br />
• Differenzierte Diagnostik: Geschätzte<br />
60% aller Kreuzschmerzen haben einen<br />
psychosomatischen Hintergrund. Dies<br />
gilt auch für andere Beschwerdebilder.<br />
Dies zu erkennen, mit Arzt und Patienten<br />
zu besprechen, wie hier am besten vorzugehen<br />
ist, ist auch eine der Aufgaben<br />
der Physiotherapie.<br />
• Konstanz der behandelnden Personen:<br />
Die jahrelange „Kenntnis“ des Patienten,<br />
seiner Lebenssituation und seines<br />
sozialen Umfeldes ist eine wertvolle Ressource,<br />
nicht nur für den Hausarzt, sondern<br />
auch in der Physiotherapie.<br />
Im Rahmen der allgemeinmedizinischen Praxis können nur wenige Posten der<br />
Physiotherapie verrechnet werden: z. B. über die GKK € 2,46 für Elektrotherapie,<br />
€ 3,92 für Ultraschall und € 2,64 für Mikrowelle. Diagnosestellung, ergonomische<br />
Beratungen und Übungsprogramme werden zum großen Teil als Gratisleistung<br />
des <strong>SMZ</strong> mit angeboten, da sie von Kassen wie z.B. der GKK nicht honoriert werden.<br />
Die Praxisgemeinschaft subventioniert daher zum Teil die Physiotherapie für<br />
die PatientInnen. Dies mag auch ein wichtiger Grund dafür sein, dass das <strong>SMZ</strong>-<br />
Beispiel der Zusammenarbeit bisher eine Ausnahme geblieben ist.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
07
Medizin trifft soziales<br />
Physiotherapie<br />
Es sind sehr viele Patient/Innen, die mit<br />
Problemen des bewegungsapparats zum<br />
praktischen Arzt als Erstanlaufstelle kommen.<br />
»<br />
08
Zukunftsmodell Hausarzt?<br />
Medizin trifft smz soziales aktuell<br />
Zukunftsmodell<br />
Hausarzt?<br />
Inge Zelinka-Roitner<br />
Der Präsident der steirischen Ärztekammer,<br />
Dr. Wolfgang Routil, war im März eingeladen,<br />
um im <strong>SMZ</strong> zu folgenden Themen<br />
Stellung zu nehmen: Zukunft der Allgemeinmedizin<br />
in der Steiermark, ernsthafte Reformvorhaben<br />
in Bezug auf das „Hausarztmodell“,<br />
Ärzteschwund am Land, Hausärzte<br />
als Gate-Keeper für Spitals- und Fachärzte<br />
sowie integrierte Versorgung am Beispiel<br />
des <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong>.<br />
Hausarzt kein<br />
„Abfallprodukt“<br />
Routil stellte gleich zu Beginn klar, dass in<br />
allen bisherigen Regierungserklärungen<br />
ein Bekenntnis zu einer Aufwertung des<br />
Hausarztes erfolgte, bis dato jedoch noch<br />
nie konkret umgesetzt wurde. Routil: „Der<br />
Hausarzt sollte nicht zum Abfallprodukt<br />
werden, frei nach dem Motto: »wenn sonst<br />
keiner da ist, geh ich halt zum Hausarzt«.“<br />
Mit der Einführung der e-card herrsche eher<br />
der Trend zum „Spitäler-Shopping“: Ambulanzen<br />
würden ohne vorherige Untersuchung<br />
gestürmt.<br />
Integrierte Versorgung<br />
gefordert<br />
Das Hausarztmodell selbst müsse aber<br />
auch umstrukturiert werden, so Routils Forderung<br />
nach mehr Kooperation und Gruppenpraxen.<br />
Problematisch seien hier allerdings<br />
die Verträge mit den Kassen: „Bei uns<br />
gibt es Abschläge, wenn man eine Gruppenpraxis<br />
gründet, in andern Ländern dagegen<br />
finanzielle Anreize!“, so Routil. Eine<br />
integrierte Versorgung sei aber mehr als<br />
der Zusammenschluss von Hausärzten, sie<br />
müsse auch als Drehscheibe für Befunde<br />
mit Speicher- und Verwaltungsaufgaben<br />
fungieren.<br />
Paradigmenwechsel:<br />
weg vom Hausarzt?<br />
Gustav Mittelbach (<strong>SMZ</strong>) kritisierte, dass<br />
„Gesundheitspolitik in der Steiermark immer<br />
Spitalspolitik“ sei. Die Allgemeinmedizin<br />
spiele eine untergeordnete Rolle, was sich<br />
auch daran zeige, dass höchstens 15% der<br />
jungen MedizinstudentInnen AllgemeinmedizinerInnen<br />
werden wollten. Rainer Possert<br />
(<strong>SMZ</strong>) stellte ebenfalls einen Paradigmenwechsel<br />
hin zum facharztbezogenen<br />
System fest. Zudem sei die finanzielle Situation<br />
der Hausärzte in der Stadt um vieles<br />
schlechter als die der Fachärzte und Landärzte.<br />
Possert verwies auf ein Statement<br />
der GKK: „Wir wissen, dass die Leistungen<br />
der Hausärzte in keiner Weise gedeckt<br />
sind!“<br />
Auch Routil bestätigte den „Schwund des<br />
allgemeinmedizinischen Kassenarztes“:<br />
„Die Ärztekammer verzeichnet 5600 Mitglieder<br />
in der Steiermark, davon sind nur<br />
1000 Kassenärzte und von denen 650 Hausärzte<br />
mit Kassenvertrag. Alle anderen sind<br />
Wahlärzte. Die Planstellen für Kassenärzte<br />
sind seit 20 Jahren gleich geblieben, die Patienten<br />
gehen zunehmend zum Wahlarzt!“<br />
Hausarzt noch zeitgemäSS?<br />
In der Diskussion gab Eva Rasky (Institut für<br />
Sozialmedizin, Meduni Graz) zu bedenken,<br />
dass das Hausarztmodell in Österreich veraltet<br />
sei und viele Leistungen, die die Menschen<br />
verlangten, nicht mehr bieten könne.<br />
„Sollte sich nicht auch der Hausarzt an<br />
den Wandel der Zeit anpassen?“ so Rasky.<br />
Und: „auf dem heutigen Niveau kann der<br />
Hausarzt die gewünschten Leistungen nicht<br />
bieten“. Die Ausbildung in diesem Bereich<br />
müsse stark verbessert und z.B. die Professur<br />
für Allgemeinmedizin an der Grazer Uni<br />
wieder etabliert werden.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
09
Zukunftsmodell Hausarzt?<br />
Medizin trifft smz soziales aktuell<br />
Der Hausarzt Michal Wendler kritisierte<br />
ebenfalls, dass es keinen Rahmen für die<br />
Ausbildung von Allgemeinmedizinern gäbe.<br />
Der größte Teil der Ausbildung erfolge noch<br />
immer im Krankenhaus, obwohl die so genannte<br />
„sprechende Medizin“ (Hausarzt,<br />
Psychiater, Kinderarzt) eigene Ausbildungsstätten<br />
brauche. Wendler führte an, dass es<br />
für die Einrichtung einer Lehrpraxis weder<br />
Qualitätskriterien, noch Visitationen oder<br />
ein Mentoren-Programm gäbe. Der Hausarzt<br />
müsse die Ausbildung zum Anleiter sogar<br />
selbst zahlen. Wendler: „Die Ärztekammer<br />
sollte daher vor der eigenen Haustür<br />
kehren, bevor man das Ministerium und die<br />
Kassen bemüht und beschuldigt!“<br />
Rainer Possert betonte die Bedeutung des<br />
Hausarztes für „schwierige“ Patientengruppen:<br />
„Als Hausärzte haben wir eine Versorgungspflicht.<br />
Diese Patienten würden überall<br />
sonst durch den Rost fallen.“<br />
Verweiblichung des<br />
Hausarztes<br />
Die Ärztin Angela Huber bestritt, dass die<br />
Allgemeinmedizin an Bedeutung verloren<br />
habe. Huber: „Man muss jedoch die Verweiblichung<br />
des Medizinberufs berücksichtigen<br />
und bessere Bedingungen für Frauen<br />
schaffen. Wenn man z.B. kleine Kinder hat,<br />
kann man nicht Teilzeit arbeiten, es gibt keine<br />
Job-Sharing-Modelle. Die Ärztekammer<br />
tut in dieser Beziehung nichts.“<br />
ÄK-Präsident Routil spielte den Ball wieder<br />
zurück zu den Krankenkassen und meinte,<br />
diese würden Job-Sharing-Modelle boykottieren,<br />
indem sie dafür Abschläge verlangten.<br />
Medikamentenverordnung<br />
und Pharma-Industrie:<br />
In der Diskussion um die Ökonomisierung<br />
des Gesundheitswesens und die ungleiche<br />
Verteilung von Geldern wies Rasky darauf<br />
hin, dass die Wirksamkeit ökonomischer<br />
Lenkungseffekte im Gesundheitswesen<br />
eine wissenschaftliche Tatsache sei. Markus<br />
Narath (KAGES) verlangte in diesem<br />
Zusammenhang eine bessere Qualitätssicherung<br />
von der Ärztekammer. Narath:<br />
„Wer schaut, dass die Pharma-Industrie<br />
nicht ungerechtfertigt zu viel Geld bekommt?“<br />
Rainer Possert plädierte für eine<br />
ganz rigide Medikamentenverordnung nach<br />
slowenischem Vorbild und wies darauf hin,<br />
dass das <strong>SMZ</strong> liegt bei der Medikamentenverordnung<br />
um 30% unter dem steirischen<br />
Schnitt liege.<br />
Rasky gab noch zu bedenken, dass der international<br />
gute Ruf des österreichischen<br />
Gesundheitssystems allein auf seinem relativ<br />
egalitären Zugangssystem beruhe:<br />
„In Österreich haben wir um 35% höhere<br />
Selbstbehalte als in anderen Ländern.<br />
Österreich schneidet im Vergleich nur deshalb<br />
so gut ab, weil durch das Hausarztsystem<br />
und die Ambulanzen alle Menschen Zugang<br />
zum Gesundheitssystem haben.“<br />
<strong>SMZ</strong> als Vorbild<br />
für Neuorientierung<br />
des Hausarztmodells<br />
Übereinstimmung herrschte bei allen Diskutanten<br />
hinsichtlich der Tatsache, dass<br />
der Hausarzt, der alleine in der Praxis sitzt,<br />
nicht mehr zeitgemäß sei. Es brauche neue<br />
Modelle, Praxisgemeinschaften und Gesundheitszentren<br />
wie das <strong>SMZ</strong>. Im <strong>SMZ</strong><br />
habe auch die psychosomatische Medizin<br />
ihren Platz, was für die Allgemeinmedizin<br />
insgesamt eine große Chance böte.<br />
Gustav Mittelbach: „Alle reden von Kooperation,<br />
aber in der Praxis gibt es überhaupt<br />
keine Verpflichtung dazu. Das <strong>SMZ</strong> ist<br />
mit seiner Kooperation mit der Hauskrankenpflege<br />
an der ökonomischen Realität<br />
gescheitert, die „Overheadkosten“ für Zusammenarbeit,<br />
Fallkonferenzen, Besprechungen<br />
wurden nicht mehr finanziert. Es<br />
gibt offensichtlich kein Interesse daran,<br />
dass Ärzte und Krankenschwestern wirklich<br />
zusammenarbeiten!“<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
11
Medizin trifft soziales<br />
Psychotherapie<br />
Wie leistbar ist<br />
Psychotherapie?<br />
Birgit Paller<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Die Zahl der psychischen Erkrankungen<br />
nimmt zu. Depression, Angstzustände und<br />
Burnout in Zusammenhang mit dem modernen<br />
Arbeitsleben sind nur einige Schlagwörter,<br />
die im Steigen begriffen sind. (vgl.<br />
kleinezeitung.at <strong>2012</strong>) Für die Behandlung<br />
von seelischen Problemen ist Psychotherapie<br />
eine wichtige Hilfestellung. Psychisch<br />
erkrankte Personen, die eine Therapie in<br />
Anspruch nehmen wollen, müssen im Vorhinein<br />
für sich selbst zwei Fragen klären: Wie<br />
viel kostet mich die Therapie und wie lange<br />
muss ich auf einen Termin warten? Die erste<br />
Frage ist für die Betroffenen meist die<br />
Wichtigere. Die Krankenkasse übernimmt<br />
zwar oft einen Teil der Kosten, jedoch für<br />
Mensch mit geringem Einkommen ist dies<br />
zu wenig, und sie können sich die Behandlung<br />
nicht leisten.<br />
Für eine volle Kostenübernahme haben<br />
Personen mit wenig finanziellen Ressourcen<br />
nur zwei Möglichkeiten:<br />
Möglichkeit 1<br />
Die Betroffenen gehen zu Psychotherapeuten,<br />
die dem „Verein für ambulante<br />
psychologischen Psychotherapie<br />
(VAPP)“ oder „Netzwerk Psychotherapie<br />
Steiermark“ angehören.<br />
Laut der Homepage des VAPP haben diese<br />
zwei Vereine einen Vertrag mit der GKK-<br />
Steiermark, mit dem eine für Betroffene kostenlose<br />
ambulante psychotherapeutische<br />
sowie psychosoziale Versorgung gegeben<br />
ist. (vgl. vapp.at). Somit wird auf Krankenschein<br />
die gesamte Therapie bezahlt.<br />
Die Ärzte des <strong>SMZ</strong> sind ausgebildete Therapeuten,<br />
die leider nicht in die Krankenscheinregelung<br />
hineinfallen. Für PatientInnen,<br />
die lieber bei den <strong>SMZ</strong>-Ärzten eine<br />
Therapie machen möchten, heißt das, zu<br />
einem andern Therapeuten wechseln zu<br />
müssen. Im schlimmsten Fall verzichtet der<br />
Patient auf die Therapie, da ein Arztwechsel<br />
für die Person nicht in Frage kommt. Aufgrund<br />
des moralischen Dilemmas des behandelten<br />
Arztes, dieser Person nicht helfen<br />
zu können, weil es für ihn nicht leistbar<br />
war, wurde eine Ausnahmevereinbarung<br />
geschaffen, nämlich, dass der Betroffene<br />
für die Psychotherapiesitzungen weniger<br />
bezahlen muss.<br />
Die Kosten für eine Therapie liegen im<br />
<strong>SMZ</strong> – verglichen mit andern Therapeuten<br />
– aber schon unter dem Durchschnitt.<br />
Für Personen die unbedingt eine Therapie<br />
bei einem der beiden <strong>SMZ</strong>-Ärzte machen<br />
wollen, können nur auf das kulante Entgegenkommen<br />
hoffen oder sie versuchen ihr<br />
„Glück“ in der 2. Möglichkeit.<br />
Möglichkeit 2<br />
Die Betroffenen suchen beim Behindertenreferat<br />
der Stadt Graz um Kostenzuschuss<br />
an. Für dieses Ansuchen müssen sie sich<br />
aber als „behindert“ definieren und zusätzlich<br />
noch eine lange Wartezeit von ca. 6 Monaten<br />
in Kauf nehmen bis sie endlich den<br />
Bescheid bekommen, ob sie den Zuschuss<br />
erhalten. Sich als „behindert“ zu outen, fällt<br />
vielen schwer und wird aus Schamgründen<br />
häufig nicht gemacht.<br />
Die <strong>Info</strong>rmationen über die beiden Möglichkeiten<br />
wurden jeweils von der steirischen<br />
Gebietskrankenkasse und dem Sozialamt<br />
der Stadt Graz telefonisch eingeholt.<br />
Quellen:<br />
Kleinezeitung (<strong>2012</strong>): Steirer liegen bei Invaliditätspension<br />
an der Spitze, http://www.kleinezeitung.at/allgemein/serversuche/index.do?searchText=psychische+<br />
Erkrankungen&von=liraform (25.4.12)<br />
Vapp (<strong>2012</strong>):<br />
http://www.vapp.at/vapp-therapeutinnen/, (26.4.12)<br />
12
»<br />
Psychotherapie<br />
Medizin trifft smz soziales aktuell<br />
zwei Anlaufstellen wären z.B.:<br />
„Verein für ambulante psychologische<br />
Psychotherapie (VAPP)“ oder<br />
„Netzwerk Psychotherapie Steiermark“
Medizin trifft soziales<br />
Turnus im <strong>SMZ</strong><br />
Turnus im <strong>SMZ</strong><br />
Florian Müller<br />
WAS BEDEUTET „TURNUS“?<br />
TURNUS IM <strong>SMZ</strong><br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Unter „Turnus“ versteht man die Ausbildung<br />
zum Allgemeinarzt. Sie beinhaltet insgesamt<br />
36 Ausbildungsmonate auf unterschiedlichen<br />
Stationen (s. Abb.).<br />
Nach dieser 3-jährigen praktischen Ausbildung<br />
folgt eine Theorieprüfung. Damit hat<br />
man das „jus practicandi“ erworben und ist<br />
somit zur selbständigen Berufsausübung<br />
als Arzt für Allgemeinmedizin berechtigt.<br />
Allgemeinmedizin<br />
Chirurgie oder<br />
Chirurgie & Unfallchirurgie<br />
jeweils 2 Monate<br />
Frauenheilkunde und<br />
Geburtshilfe<br />
davon zumindest<br />
2 Monate Geburtshilfe<br />
Haut- und<br />
Geschlechtskrankheiten<br />
Hals- Nasen- und<br />
Ohrenkrankheiten<br />
Innere Medizin<br />
Neurologie oder<br />
Psychiatrie<br />
Kinder- und<br />
Jugendheilkunde<br />
Quelle: Ärztekammer Steiermark<br />
6 Monate<br />
4 Monate<br />
4 Monate<br />
2 Monate<br />
2 Monate<br />
12 Monate<br />
2 Monate<br />
4 Monate<br />
Um meine praktischen Fähigkeiten und die<br />
medizinische Basisausbildung auszubauen<br />
bzw. zu festigen, war es mein erklärtes Ziel,<br />
nach sechs theoriereichen Jahren Medizinstudium<br />
die Turnusausbildung in einer Lehrpraxis<br />
zu beginnen.<br />
Das Fach „Allgemeinmedizin“ interessiert<br />
mich sehr und ich möchte selber irgendwann<br />
selbstständig als Allgemeinarzt im<br />
ländlichen Bereich arbeiten. Aus diesem<br />
Grund ist es mir sehr wichtig, möglichst viel<br />
Erfahrung bei erfahrenen Hausärzten zu<br />
sammeln, und ich bin sehr froh, als Turnusarzt<br />
im <strong>SMZ</strong> mitgearbeitet zu haben.<br />
Das <strong>SMZ</strong> ist nicht nur eine Allgemeinarztpraxis<br />
im herkömmlichen Sinne, sondern<br />
vielmehr eine Institution, die einen großen<br />
Einblick in Familien- und Suchtberatung<br />
sowie in diverse Gesundheitsförderungsprojekte<br />
bietet. Besonders spannend ist<br />
die Patientenvielfalt (von jung bis alt, Menschen<br />
mit unterschiedlichster Herkunft und<br />
Ausbildung, etc.). Ein zusätzlicher positiver<br />
Aspekt ist die Möglichkeit, über die Zeit eine<br />
freundschaftliche Beziehung zu den Patienten,<br />
die ich sowohl in der Ordination als<br />
auch bei Hausbesuchen kennenlernen durfte,<br />
aufzubauen.<br />
Im <strong>SMZ</strong> lerne ich, Patienten - basierend auf<br />
dem biopsychosozialen Gesundheitsmodell<br />
- als gesamten Menschen zu sehen und zu<br />
behandeln. Meine beiden Chefs geben mir<br />
die Gelegenheit als junger Kollege selbstständiges<br />
ärztliches Handeln zu erlernen<br />
und Eigenverantwortung zu übernehmen.<br />
Trotz der großen Entscheidungs- und Handlungsfreiheit<br />
fühle ich mich nie alleingelassen<br />
und überfordert.<br />
14
»<br />
Turnus im <strong>SMZ</strong><br />
Medizin trifft smz soziales aktuell<br />
Im <strong>SMZ</strong> lerne ich, Patienten – basierend auf dem<br />
biopsychosozialen Gesundheitsmodell als gesamten<br />
Menschen zu sehen und zu behandeln.<br />
Anfangs ist die große Herausforderung definitiv,<br />
dass mir die Patienten und deren Vorgeschichten<br />
unbekannt sind und auch keine<br />
„Vorselektionierung“, wie z.B. in der Klinik,<br />
vorhanden ist. Zudem steht in der Ordination<br />
keine umfangreiche Diagnostik, wie im<br />
Krankenhaus zur Verfügung. Somit muss<br />
man mit einer gezielten Anamnese, gründlicher<br />
klinischer Untersuchung und Labor zu<br />
einer Diagnose kommen und eine Therapie<br />
bzw. weitere diagnostische Maßnahmen<br />
einleiten.<br />
Durch Dr. Possert und Dr. Mittelbach lerne<br />
ich, gefährliche Krankheitsverläufe zu erkennen<br />
sowie ein Gefühl zu entwickeln,<br />
akut-behandlungsbedürftige von banalen<br />
Fällen zu unterscheiden. Zudem fördert die<br />
Möglichkeit, dass ich in meinem eigenen<br />
Arztzimmer (vor-) untersuchen, beraten und<br />
auch behandeln kann, nicht nur meine fachliche<br />
Ausbildung, sondern auch meine sozialen<br />
Kompetenzen.<br />
Während der sechs erfahrungsreichen Monaten<br />
habe ich viel Freude für den Arztberuf<br />
entwickelt und ich möchte mich hiermit<br />
beim gesamten <strong>SMZ</strong>-Team, aber auch bei<br />
den vielen lieben Patienten für das Vertrauen<br />
und auch für die herzliche Aufnahme bedanken.<br />
Meine nächste Etappe ist das Marienkrankenhaus<br />
Vorau, wo ich vier Monate<br />
auf der chirurgischen Abteilung tätig bin.<br />
Gut gerüstet und motiviert freue ich mich<br />
auf die nächsten Herausforderungen.<br />
Tätigkeitsprofil<br />
• Allgemeinärztliche Beratung und<br />
Hausbesuche einschließlich Telefonberatung<br />
• Allgemeinärztliche Diagnostik<br />
und Therapie:<br />
- Vorfelddiagnostik<br />
- Anamnese<br />
- Diagnostik samt Einbeziehung des<br />
psychosozialen Umfeldes<br />
- Siebfunktion und Verteilerfunktion<br />
- Grenzen der Kompetenz erkennen und<br />
gezielte Überweisung veranlassen<br />
- Zusammenarbeit mit anderen<br />
Fachärzten<br />
- Abwägen der medizinischen oder<br />
sozialen Notwendigkeit der<br />
Krankenhausbehandlung<br />
- Therapie bzw. symptomorientierte<br />
Soforttherapie<br />
- Patienteninformation, ärztliches<br />
Gespräch, Beratung<br />
• Vorsorgeuntersuchungen<br />
• Gespräche mit Substitutionspatienten<br />
• Telefonate mit Klinik sowie Terminvereinbarung<br />
und Befunde anfordern<br />
• Laborarbeit (Blutabnahme, BZ-Messung etc.)<br />
• Wundversorgung<br />
• Impfungen, Injektionen<br />
<strong>SMZ</strong> INFO dezember 2010<br />
15
Medizin trifft soziales<br />
Fallbeispiel<br />
Erfolgreiche Wege<br />
aus der Sucht…<br />
Interview von Birgit Paller<br />
Das folgende Interview führte unsere Sozialarbeiterin<br />
Birgit Paller mit einem Patienten<br />
von Dr. Possert, der sich von 2008 bis 2010<br />
im <strong>SMZ</strong> in ärztlicher und sozialarbeiterischer<br />
Behandlung befand und sich bereit erklärte,<br />
über seinen persönlich erfolgreichen Weg<br />
aus der Sucht zu berichten, um damit Menschen<br />
in einer ähnlichen Situation eventuell<br />
Auswegmöglichkeiten zu zeigen. Für diese<br />
offene Schilderung möchten wir uns herzlich<br />
bedanken!<br />
Wie lange sind Sie bereits im <strong>SMZ</strong> in Behandlung?<br />
Von 2008 bis Ende 2010 war ich in Substitutionsbehandlung,<br />
es war die 1. und einzige<br />
Substitutionsbehandlung.<br />
Was gab den Anlass eine Substitutionstherapie<br />
zu machen bzw. wieso haben Sie sich genau<br />
für diese Behandlungsform entschieden?<br />
Ich probierte zunächst privat 2 kalte Entzüge,<br />
die ich positiv beenden konnte. Letztendlich<br />
war die Phase der Abstinenz von<br />
begrenzter Dauer und die Abhängigkeit kam<br />
im jeweils gleichem Ausmaß wieder. Ich<br />
spielte immer wieder mit dem Gedanken,<br />
mich in professionelle Behandlung zu begeben.<br />
Das für mich abschreckendste an der<br />
Substitutionsbehandlung war der offizielle<br />
Rahmen – ich wollte meine Abhängigkeit<br />
nicht an die große Glocke hängen, sie nicht<br />
„amtlich“ machen.<br />
Eine stationäre Behandlung ist nicht in Frage<br />
gekommen, da ich meine Abhängigkeit<br />
als nicht sonderlich stark empfunden habe.<br />
Eine stationäre Behandlung hätte nicht nur<br />
eine größere Einschränkungen im Leben<br />
verursacht – sie wäre undenkbar gewesen,<br />
da ich meine Abhängigkeit unter allen Umständen<br />
geheim halten wollte! Bis auf meine<br />
Lebensgefährtin wusste und weiß bis<br />
heute niemand in meinem Umfeld (Familie,<br />
Freunde, Beruf ...) darüber Bescheid.<br />
18<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
»<br />
Ich betrachtete es<br />
wie ein Spiel -<br />
es ist ein bisschen wie pokern.
»<br />
Fallbeispiel<br />
Medizin trifft smz soziales aktuell<br />
Ich arbeite seit über 10 Jahren bei derselbeN Firma –<br />
vor, während und nach meiner Abhängigkeit.<br />
DIe Geheimhaltung hat bis jetzt funktioniert!<br />
Wie lange haben Sie aktiv Drogen konsumiert<br />
und wie kam es zur Abhängigkeit?<br />
Mit 17 hatte ich meinen Erstkonsum mit härteren<br />
Substanzen. Opiate mit 18 Jahren, relativ<br />
lange war mein Konsum überschaubar,<br />
Wochenendkonsum. Die Abhängigkeit<br />
kam erst Jahre später, schleichend.<br />
Zwischendurch bemerkte ich Entzugssymptome:<br />
leichte Schweißausbrüche,<br />
Schlafstörungen, etc. Mit längeren Konsumpausen<br />
konnte ich diese beherrschen,<br />
die Abhängigkeit kontrollieren. Ich betrachtete<br />
es tatsächlich als Spiel - es ist ein bisschen<br />
wie pokern.<br />
Sie gehen jetzt einer Arbeit nach, hatten Sie<br />
auch Arbeit während Sie Drogen genommen<br />
haben?<br />
Ich arbeite seit über 10 Jahren durchgehend<br />
in derselben Firma; vor, während<br />
und nach der Abhängigkeit. Weder mein<br />
Vorgesetzter noch meine Kollegen und Kolleginnen<br />
wussten von meiner Abhängigkeit.<br />
Die Geheimhaltung hat bis heute funktioniert.<br />
Wie war in dieser Zeit auch das Verhältnis zur<br />
Familie und Freunden?<br />
Es ist ein intaktes Verhältnis; auch Familie<br />
und Freunde wussten nichts von meiner<br />
Erkrankung. Meine Lebensgefährtin war<br />
zu der Zeit ebenfalls abhängig und ist auch<br />
heute noch in Behandlung. Selbstverständlich<br />
wusste Sie von Beginn an über meine<br />
Abhängigkeit Bescheid.<br />
Es war sicher schwer es geheim zu halten, da<br />
man oftmals Opiatabhängigkeit durch körperliche<br />
Merkmale sieht, hat niemand z.B. ihre<br />
Mutter Sie auf Ihr Äußeres angesprochen?<br />
Ich glaube nicht, dass sich mein Äußeres<br />
während der Abhängigkeit wesentlich veränderte.<br />
Gelegentlich hat meine Mutter<br />
nachgefragt, ob es mir auch wirklich gut<br />
gehe, wenn ich mal einen „erschöpften“ Eindruck<br />
machte. Als Ausrede behauptete ich,<br />
es sei beruflicher Stress (wobei das manchmal<br />
tatsächlich der Grund dafür war).<br />
Sie hatten einen Rückfall. Wie kam es dazu?<br />
Ich wurde während meiner Behandlung<br />
ausschließlich mit Methadon (orale Einnahme)<br />
substituiert. Zuvor konsumierte ich Medikamente<br />
wie Substitol etc. hauptsächlich<br />
intravenös. Die Umstellung ist nicht zu unterschätzen<br />
und funktioniert nicht von heute<br />
auf morgen – es braucht eine gewisse Anlaufphase,<br />
bis das neue Medikament wirkt,<br />
bis man sich daran gewöhnt hat. Deshalb<br />
hatte ich anfangs gelegentlich Beikonsum,<br />
was ich jedoch persönlich NICHT als Rückfall<br />
werte. Auch mein behandelnder Arzt<br />
hat mir das prophezeit. In der Anfangsphase<br />
musste die Dosis immer wieder erhöht<br />
werden, erst nach 2-3 Monaten konnte ich<br />
mit der Reduktion beginnen. Ich reduzierte<br />
langsam und konstant bis zum erfolgreichen<br />
Behandlungsabschluss.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
17
Medizin trifft soziales<br />
Fallbeispiel<br />
Was braucht es ihrer Meinung nach für<br />
einen Substitutionspatienten um clean zu<br />
werden bzw. zu bleiben?<br />
Da kann ich nur für mich sprechen. Ich hatte<br />
nie Probleme im sozialen Umfeld oder seelische<br />
Erkrankungen und sehe mich nicht<br />
als „typischen“ Patienten. Ich näherte mich<br />
langsam aber konstant der Null, habe mich<br />
nie zu lange auf einem Level „ausgeruht“–<br />
auch nie zu schnell reduziert. Mit Methadon<br />
funktioniert diese Vorgehensweise sehr gut,<br />
ich bestimmte Monat für Monat die Reduktionsdosis<br />
und behandelte mich sozusagen<br />
selbst.<br />
Egal wie gut der Reduktionsvorgang ist,<br />
beim nächsten Rückschlag kommt bei vielen<br />
Abhängigen der Rückfall bzw. der Gedanke<br />
sich einer Substanz zu nähern. Es<br />
gibt Abhängige die wollen gar nicht clean<br />
werden, weil sie ohne Substanz Ihr Leben<br />
nicht meistern können, da sind die Vorraussetzungen<br />
für eine (erfolgreiche) Behandlung<br />
andere.<br />
Möchten Sie noch etwas sagen?<br />
Ich war mit der Behandlung sehr zufrieden<br />
und diesbezüglich ist das <strong>SMZ</strong> eine<br />
tolle und hilfreiche Einrichtung. Ich bin mit<br />
meinem behandelnden Arzt auch persönlich<br />
bestens ausgekommen.<br />
Ich glaube neben dem ehrlichen Willen ist<br />
genügend Zeit die wichtigste Zutat für eine<br />
erfolgreiche Suchtbehandlung. Auch wenn<br />
der Entzug, die Behandlung etwas länger<br />
dauert - man muss sich einfach die Zeit dafür<br />
nehmen.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Die Opiatabhängigkeit ist die am meisten<br />
geächtete Suchtform – ich aber sehe die<br />
Sucht als eine reguläre Krankheit die man<br />
durchaus erfolgreich behandeln kann!<br />
18
Medizin trifft soziales<br />
Pflegeregress<br />
Angehörige bezahlen<br />
wieder für Pflege<br />
Birgit Paller<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Mit 1. November 2008 wurde die Regressforderung<br />
für Familienangehörige in der Sozialhilfe<br />
abgeschafft, steiermarkweit trat sie<br />
jedoch mit 1. Jänner <strong>2012</strong> wieder in Kraft.<br />
In anderen Bundesländern (wie z.B. Oberösterreich)<br />
werden die Angehörigen nicht<br />
zur Kasse gebeten.<br />
Regress bedeutet „angemessene Rückforderung“<br />
und richtet sich an Eltern, deren<br />
Kind bzw. Kinder im Heim leben, bzw. an<br />
alle Kinder, deren Eltern(teile) sich in einem<br />
Pflegeheim befinden. Voraussetzung für<br />
die Zahlungsforderung ist, dass die eigenen<br />
Einkünfte der pflegebedürftigen Person<br />
(Einkommen, Pension, Pflegegeld bzw.<br />
verwertbares Vermögen wie Sparbücher,<br />
Barvermögen, Auto, usw.) für die Deckung<br />
der Heimkosten nicht ausreichen. Für die zu<br />
pflegende Person bleiben insgesamt 7.000<br />
€ „an frei bleibendem Vermögen“ zur privaten<br />
Verfügung übrig.<br />
Ausnahme: Drei-Jahres Frist:<br />
Sollte es innerhalb der letzten drei Jahre zu<br />
Verschenkungen von Häusern oder Sparbüchern<br />
gekommen sein, wird dieses Vermögen<br />
für die Rückforderung herangezogen.<br />
LebensgefährtInnen, Enkelkinder, Großoder<br />
Schwiegereltern sind nicht regresspflichtig.<br />
Für EhegattInnen und eingetragene<br />
LebenspartnerInnen gilt die gesetzliche<br />
Unterhaltspflicht des Allgemeinen<br />
Bürgerlichen Gesetzbuches. Diese wird<br />
vom Gericht festgelegt.<br />
<strong>Info</strong>s zum Pflegeregress<br />
Erst ab einem Nettoeinkommen von 1500 €<br />
sind die Angehörigen 1. Grades verpflichtet,<br />
die Rückforderung an die Sozialhilfeträger<br />
(nach)zuzahlen.<br />
Berechnet wird das monatliche Netto-einkommen<br />
inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld.<br />
Wenn mehrere Kinder unterhaltspflichtig<br />
gegenüber ihren Eltern sind, zahlt jedes einzelne<br />
Kind die von seinem Nettoeinkommen<br />
errechnete Summe. Kein Pflegeregress fällt<br />
für Kinder an, die ohne eigenes Einkommen<br />
sind. Geschwister müssen aber in diesem<br />
Fall nicht die Unterhaltspflicht für sie übernehmen,<br />
die öffentliche Hand gleicht diesen<br />
fehlenden Betrag aus.<br />
Pflegeregress 2007 –<br />
Pflegeregress <strong>2012</strong><br />
Was ist neu?<br />
Im alten Pflegeregressmodell war jedes<br />
Kind für seine Eltern schon ab einem Nettoeinkommen<br />
von 700 € regresspflichtig.<br />
Gleich blieb der Prozentanteil von 4% ab<br />
diesem Mindesteinkommen. Abzugsposten<br />
(z.B. Wohnaufwand, Alimente, ...) wurden<br />
vor dem 1. November 2008 für die<br />
Pflegeregressberechnung herangezogen<br />
und führten bei Zuerkennung zu einem geringeren<br />
Kostenaufwand für die Nachkommen.<br />
Heute werden die Abzugsposten nicht<br />
mehr anerkannt, dafür wurde die Einkommensgrenze<br />
auf 1.499,99 € angehoben<br />
(siehe Tabelle).<br />
Zusätzliche <strong>Info</strong>s<br />
Zuständig für weitere Auskünfte zum Pflegeregress<br />
sind die jeweiligen Bezirkshauptmannschaften<br />
bzw. das Sozialamt Graz<br />
(Referat für Heimkostenzuzahlung) sowie<br />
die Servicestelle des Landes:<br />
Tel 0800/ 201010<br />
(Siehe dazu auch Steirischer Pflegekompass)<br />
20
Pflegeregress<br />
Medizin trifft smz soziales aktuell<br />
Nettoeinkommen in Euro<br />
Regresspflicht<br />
vom Nettoeinkommen<br />
von bis Kind Elternteil<br />
0 1499,99 0% 0%<br />
1500 1599,99 9% 4%<br />
1600 1699,99 9,5% 4,5%<br />
1700 1799,99 10% 5%<br />
1800 1899,99 10,5% 5,5%<br />
1900 1999,99 11% 6%<br />
2000 2099,99 11,5% 6,5%<br />
2100 2199,99 12% 7%<br />
2200 2299,99 12,5% 7,5%<br />
2300 2399,99 13% 8%<br />
2400 2499,99 13,5% 8,5%<br />
2500 2599,99 14% 9%<br />
2600 2699,99 14,5% 9,5%<br />
2700 . 15% 10%<br />
Quellen: der Grazer, Politik Land Steiermark, Steirischer Pflegekompass und Volkshilfe Steiermark.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
21
Gesundheitsförderung<br />
3 Jahre Sta.ges<br />
3 Jahre sta.ges –<br />
ein erfolgreiches<br />
Gesundheitsförderungsprojekt<br />
wurde präsentiert<br />
Inge Zelinka-Roitner<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Das Projekt „sta.ges - Stadtteilgesundheit<br />
für Alle“ wurde vom <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong> im Jahr<br />
2007 konzipiert und von November 2008 bis<br />
Dezember 20011 durchgeführt.<br />
Das <strong>SMZ</strong> leistete mit diesem Projekt Pionierarbeit<br />
im Grazer Stadtraum: erstmals<br />
konzentrierte sich die Gesundheitsförderung<br />
auf einen gesamten, sozial benachteiligten<br />
Stadtteil. Eine breite Front an MultiplikatorInnen<br />
aus den verschiedensten<br />
Bereichen konnte zur Mitarbeit aktiviert<br />
werden: die Jugendzentren vor Ort, Pfarren,<br />
Schulen, Polizeidienststellen, Pflegeeinrichtungen,<br />
Sozialamt, Jugendamt und<br />
Wohnungsamt der Stadt Graz, Sportunion,<br />
Kinderbetreuungsverein WIKI, BezirksvorsteherInnen<br />
und SozialarbeiterInnen trafen<br />
sich zunächst zu einer Stadtteilplattform,<br />
um Ressourcen und Probleme im Gebiet zu<br />
definieren.<br />
Darauf aufbauend wurden Stadtteilfeste<br />
durchgeführt, die Bevölkerung zu ihren Ideen<br />
und Wünschen befragt und schließlich -<br />
auf diesen Ideen aufbauend - Gesundheitsförderungsprojekte<br />
geplant und durchgeführt.<br />
Gefördert wurde das Projekt von Land<br />
Steiermark (Gesundheit) und dem Fonds<br />
Gesundes Österreich (FGÖ).<br />
Bei der Abschlusspräsentation des Projektes<br />
konnte auf anschauliche Weise mittels<br />
Kurzreferaten und einer Posterpräsentation<br />
gezeigt werden, was alles erreicht wurde.<br />
Der Obmann des <strong>SMZ</strong>, Dr. Rainer Possert,<br />
stellte im Rahmen der Begrüßung die<br />
ReferentInnen vor und verwies im Besonderen<br />
auf die Anwesenheit der Leiterin des<br />
Fonds Gesundes Österreich (FGÖ), Mag.<br />
Christa Peinhaupt, die sich im Anschluss<br />
an die Präsentationen von den Erfolgen des<br />
Projektes begeistert zeigte und dieses als<br />
beispielgebend für den neuen Schwerpunkt<br />
des FGÖ „Gesundheitsförderung mit vulnerablen<br />
Gruppen“ bezeichnete.<br />
Als Vertreter der Fachabteilung Gesundheit<br />
des Landes Steiermark referierte zunächst<br />
Dr. Thomas Amegah, MPH, über die Bedeutung<br />
projektbezogener Interventionen<br />
für die steirische Gesundheitsförderung.<br />
Mit seiner einleitenden Definition von Gesundheitsförderung<br />
stellte Amegah klar,<br />
dass diese kein Luxusgut sei, sondern Teil<br />
des alltäglichen Handelns werden müsse:<br />
„Gesundheitsförderung ist nicht der<br />
Schlagobers bei der Torte sondern der<br />
Teig“. Man müsse sämtliche Entscheidungen,<br />
Abläufe und Pläne gesundheitsförderlich<br />
neu gestalten und nicht nur zusätzliche<br />
Aktivitäten in Form von kurzfristigen Projekten<br />
anbieten.<br />
Dr. Inge Zelinka-Roitner (Soziologin in<br />
<strong>SMZ</strong>, verantwortlich für den Bereich Gesundheitsförderung)<br />
berichtete dann über<br />
die Projekterfolge und zeigte, was im Sinne<br />
der Nachhaltigkeit über den zeitlichen Rahmen<br />
des Projektes hinaus Bestand haben<br />
wird.<br />
Eine Projektteilnehmerin, Frau Sigrid<br />
Schönfelder, erzählte über ihre persönlichen<br />
Projekterfahrungen. Sie schilderte<br />
die schwierige Situation in ihrer Wohnanlage<br />
am Trattenweg (Bezirk Jakomini):<br />
„Die neuen BewohnerInnen wurden ohne<br />
Deutschkenntnisse und ohne Kenntnis der<br />
Hausordnung ins Wohngebiet gebracht. Es<br />
kam immer wieder zu Problemen (Nachtruhe,<br />
Mülltrennung, etc). HausmeisterInnen<br />
gab es für die Wohngebiete keine. Durch<br />
sta.ges wurden Veranstaltungen (Deeskalationstreffen<br />
etc.) für alle BewohnerInnen<br />
abgehalten, die sich dieser Thematiken annahmen.<br />
Durch den Einsatz des <strong>SMZ</strong> hat<br />
sich Lage am Trattenweg verbessert, die<br />
Menschen grüßen sich wieder und sprechen<br />
Probleme untereinander an.“<br />
Mag. Rainer Rosegger von der Firma<br />
SCAN berichtete über die Ergebnisse der<br />
22
»<br />
3 Jahre Sta.ges Gesundheitsförderung<br />
Gesundheitsförderung ist nicht der<br />
Schlagobers auf der Torte, sondern der Teig.<br />
externen Evaluation des Projektes. Anhand<br />
von Fragebögen konnten die BewohnerInnen<br />
ihr Feedback zu den einzelnen Projekten<br />
abgeben. Bei der Beurteilung der Wirksamkeit<br />
erzielten der Brunch am Grünanger<br />
und das Walken an der Mur die höchsten<br />
Werte. Die durchgeführte Netzwerkanalyse<br />
zeigte deutlich, dass sich das <strong>SMZ</strong> im Zentrum<br />
der beiden Stadtteile Grünanger und<br />
Schönausiedlung befand und mit den „Stakeholdern“<br />
der beiden Gebiete umfangreiche<br />
Beziehungen unterhielt.<br />
IP4<br />
ST6<br />
IP3<br />
85% der befragten BewohnerInnen gaben<br />
an, dass sie durch das Projekt Menschen<br />
kennengelernt hätten. Das Ziel, soziale<br />
Netzwerke als erste gesundheitsfördernde<br />
Maßnahme zu stärken, wurde somit erreicht.<br />
78% gaben an, das sie sich mit Hilfe<br />
des Projektes über Gesundheit informiert<br />
hätten, ebenfalls 78% fühlten sich nun sicherer<br />
im Wohngebiet. 74% gaben an, dass<br />
das Projekt positive Auswirkungen auf ihre<br />
körperliche Gesundheit habe, 70% meinten,<br />
es habe positive Auswirkungen auf ihr Ernährungsverhalten.<br />
In der Diskussionsrunde mit dem Publikum<br />
zeigte sich Gemeinderat Kurt Hohensinner<br />
äußerst beeindruckt von den Erfolgen<br />
des Projektes und stellte die Frage in den<br />
Raum, ob nicht eine Wiedereinführung des<br />
Hausmeister-Systems zur Beruhigung in<br />
Wohnanlagen beitragen könne.<br />
st7<br />
st3<br />
<strong>SMZ</strong><br />
st5<br />
st4<br />
Die Direktorin der Volksschule Schönau,<br />
Mag. Angela Kaltenböck-Luef, bekundete<br />
öffentlich, dass ihre Arbeit durch das Projekt<br />
wesentlich leichter geworden sei und sich<br />
die Eltern ihrer Schulkinder nun im Wohngebiet<br />
wohler und sicherer fühlten. Sie äußerte<br />
die Befürchtung, dass sich mit Beendigung<br />
des Projektes die Lage im Wohngebiet wieder<br />
verschlechtern würde.<br />
Rainer Possert verwies darauf, dass die Arbeit<br />
des <strong>SMZ</strong> ja weiterhin fortgeführt werde<br />
und so eine Kontinuität der Versorgung und<br />
Betreuung bestehe.<br />
IP2<br />
IP1<br />
st2<br />
st1<br />
st8<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
23
Gesundheitsförderung<br />
3 Jahre Sta.ges<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
24
3 Jahre Sta.ges Gesundheitsförderung<br />
Politik & Praxisführung<br />
Medical Tribune • 44. Jahrgang • Nr. 9 • 29. Februar <strong>2012</strong> 19<br />
Gesundheitsförderung in einem benachteiligten Grazer Stadtteil<br />
Projekt „sta.ges“ holte viele ab<br />
GRAZ – Ein besonderes Anliegen des Sozialmedizinischen Zentrums<br />
<strong>Liebenau</strong> im Süden von Graz ist es seit jeher, auch sogenannten<br />
„vulnerablen Gruppen“ eine möglichst optimale<br />
Gesundheitsversorgung anbieten zu können. Da zum Einzugsgebiet<br />
des Zentrums auch städtische Problemgebiete gehören,<br />
wurde im Jahr 2008 das Stadtteilprojekt „sta.ges – Stadtgesundheit<br />
für Alle!“ initiiert, das vor allem sozial schwache und gesundheitlich<br />
benachteiligte Menschen dazu befähigen sollte, mit<br />
ihren gesundheitlichen und sozialen Risiken umgehen zu lernen.<br />
Im Mittelpunkt stand die Förderung von sozialen Netzwerken.<br />
Das Projektgebiet waren zwei<br />
Siedlungen in den Grazer Bezirken<br />
Jakomini und <strong>Liebenau</strong> (Schönausiedlung<br />
und Grünanger), in denen<br />
Studenten des Instituts für<br />
Soziologie auch eine umfangreiche<br />
Sozialraumanalyse durchführten.<br />
Als Kennzeichen des Gebietes<br />
wurden unter anderem ein<br />
überproportional hoher Anteil an<br />
Gemeindewohnungen, geringes<br />
Wohnungseigentum, hoher Anteil<br />
an Alleinerzieherinnen, geringes<br />
Bildungsniveau und Probleme mit<br />
häuslicher Gewalt und Alkohol erhoben.<br />
Festgestellt wurde auch,<br />
dass es in den beiden Siedlungen,<br />
in denen viele Menschen mit Migrationshintergrund<br />
leben, kaum<br />
gemeinschaftliche Netzwerke gibt.<br />
Ressourcen nutzen<br />
und mitgestalten<br />
Explizit<br />
„Das Fehlen sozialer<br />
Beziehungen ist<br />
ein ebenso hohes<br />
Gesundheitsrisiko wie<br />
Zigarettenkonsum,<br />
hoher Blutdruck,<br />
Übergewicht und<br />
Bewegungsmangel.“<br />
Mag. Dr. Inge Zelinka-Roitner<br />
Brunch mit Blutdruckmessen und Blutzuckermessen sowie Walken an der Mur brachte Menschen in Graz zusammen.<br />
Hintergrund des dreijährigen<br />
Projekts, das vom Fonds Gesundes<br />
Österreich und vom Gesundheitsressort<br />
des Landes Steiermark gefördert<br />
wurde, waren sozialmedizinische<br />
Daten, die zeigen, welch<br />
dramatische Auswirkungen der<br />
sozioökonomische Status eines<br />
Menschen auf seine Gesundheit<br />
hat: Männer aus der niedrigsten<br />
Bildungsgruppe haben eine rund<br />
zehn Jahre kürzere Lebenserwartung,<br />
eine 50 Prozent größere<br />
Wahrscheinlichkeit, an Diabetes<br />
zu erkranken, und ein doppelt<br />
so hohes Schlaganfallrisiko wie die<br />
Durchschnittsbevölkerung. Diese<br />
Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen.<br />
Als einer der wesentlichsten<br />
Risikofaktoren konnten dabei<br />
mangelnde soziale Vernetzungen<br />
identifiziert werden. „Das<br />
Fehlen sozialer Beziehungen ist<br />
ein ebenso hohes Gesundheitsrisiko<br />
wie Zigarettenkonsum, hoher<br />
Blutdruck, Übergewicht und Bewegungsmangel“,<br />
zitiert Mag. Dr.<br />
Inge ZelinkaRoitner, Soziologin<br />
am <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong>, ihren bekannten<br />
Kollegen James House.<br />
„Gerade in benachteiligten Wohngebieten<br />
tragen soziale Netzwerke<br />
mindestens ebenso viel zur Gesundheitsförderung<br />
bei wie die<br />
klassischen Ansätze Bewegung<br />
oder Ernährung.“<br />
Im Motto „... für Alle!“ kommt<br />
schon zum Ausdruck, dass sich die<br />
Initiatoren bewusst gegen zielgruppenspezifische<br />
Projekte entschieden.<br />
Um die Menschen zu erreichen,<br />
wurden Aktivitäten auf zwei<br />
Ebenen gesetzt: Der eine Ansatzpunkt<br />
war, Multiplikatoren, Politiker<br />
und Experten zu mobilisieren,<br />
sie für die Anliegen der Benachteiligten<br />
zu sensibilisieren und ihnen<br />
Erkenntnisse der modernen<br />
Sozialmedizin nahezubringen. Im<br />
Rahmen einer Stadtteilplattform<br />
konnten Jugendzentren, Pfarren,<br />
Schulen, Vereine, Polizeidienststellen,<br />
Ämter und medizinische Einrichtungen<br />
als Projektpartner gewonnen<br />
werden. Die zweite Ebene<br />
galt dem Empowerment der betroffenen<br />
Bevölkerung. Hier war<br />
das Ziel, die direkte Beteiligung der<br />
Menschen an einzelnen Aktivitäten<br />
und Projekten zu fördern und dadurch<br />
verschiedenste Netzwerke<br />
aufzubauen. So wurde ein bisher der<br />
Öffentlichkeit nicht zugängliches<br />
Grundstück mit tatkräftiger Unterstützung<br />
der Anwohner zu einem<br />
„Garten für Alle“ umgestaltet, ein<br />
wöchentlicher Brunch am Grünanger<br />
ins Leben gerufen und ein<br />
Gewinnspiel veranstaltet, in dem<br />
mehr als 100 Teilnehmer ihre Ideen<br />
und Wünsche für den Stadtteil zu<br />
Papier brachten. Bei den regelmäßigen<br />
Stadtteil und Schulfesten<br />
wurde nicht nur gefeiert, sondern<br />
auch das Angebot kostenloser Blutdruck<br />
und Blutzuckermessungen<br />
mit anschließenden Beratungsgesprächen<br />
rege genutzt. Besonders<br />
erfolgreich war auch das Projekt<br />
„Walken an der Mur“, mit dem vor<br />
allem ältere Frauen zu körperlicher<br />
Aktivität motiviert werden konnten.<br />
Schulkinder lernten im Projekt<br />
„Sturz und Fall“ im Rahmen<br />
ihres Turnunterrichts von einem<br />
professionellen JiuJitsuTrainer,<br />
wie man sich selbst verteidigt. In<br />
sogenannten Deeskalationstreffen<br />
konnten Beteilig te und Multiplikatoren<br />
Probleme im Wohngebiet<br />
direkt diskutieren. Themen waren<br />
z.B. Mülltrennung, Kinder und Jugendschutz<br />
oder Nachbarschaftssicherheit.<br />
Beispiele für weitere Aktivitäten<br />
waren ein interkulturelles<br />
Kochprojekt, Musikprojekte, Kreativworkshops<br />
und eine eigene Stadtteilzeitung.<br />
„Die neueste Aktivität dass dadurch das Gemeinschaftsgefühl<br />
und das Wohlbefinden im Jahre begrenzt war, wurde von An-<br />
können. Da das Projekt auf drei<br />
ist das Kindergartenprojekt ,Ganz<br />
früh‘“, ergänzt Dr. ZelinkaRoitner. Wohngebiet deutlich verbessert fang an auch besonderes Augenmerk<br />
auf die Nachhaltigkeit gelegt.<br />
„Hier geht es darum, bei den Eltern, wurde“, so die Soziologin. Zudem<br />
die oft Mig rationshintergrund haben,<br />
ein Bewusstsein für Gesundzinische<br />
Beratungs bzw. Anlauf-<br />
sehr viele Netzwerkpartner gibt“,<br />
gelang es, eine mobile sozialmedi-<br />
„Das Wichtigste ist, dass es jetzt<br />
heitsförderung zu entwickeln.“ stelle im Wohngebiet zu schaffen,<br />
die sehr gut angenommen tisch. „Mittlerweile werden ein-<br />
ist Dr. ZelinkaRoitner optimis<br />
Alles in allem konnten mithilfe<br />
des Projektes „sta.ges“ in den vergangenen<br />
drei Jahren in dem be-<br />
Brunch zeigte sich, dass auch Thewohnern<br />
als laufende Aktivitäten<br />
wurde. Am Beispiel Walken und zelne Projekte von engagierten Benachteiligten<br />
Stadtteil an die 3000 men wie Bewegung und gesunde<br />
Ernährung durch ein Gemein-<br />
<strong>SMZ</strong> in dem Gebiet natürlich wei-<br />
fortgeführt. Außerdem wird das<br />
Kontakte geknüpft werden. „Aus<br />
den Rückmeldungen wissen wir, schaftserlebnis vermittelt werden terhin aktiv bleiben.“ HÖ<br />
Symptomatische Behandlung von:<br />
• Arthrose<br />
• Rheumatoider Arthritis<br />
• Ankylosierender Spondylitis<br />
GRÜNE BOX!<br />
naproxen-hart<br />
& ppi-zart<br />
Endlich effektive Schmerztherapie (Naproxen)<br />
und bewährter Magenschutz (Esomeprazol)<br />
fi x kombiniert!<br />
• 2 x täglich<br />
• 30 Min. vor den Mahlzeiten<br />
• analgetisch, antiphlogistisch<br />
und antipyretisch<br />
20mg Esomeprazol<br />
500mg<br />
Naproxen<br />
Naproxen/Esomeprazol<br />
ID 3350 02/<strong>2012</strong><br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Fotos: <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong><br />
rz_VIM_ins_adlerkuecken_170x216_<strong>2012</strong>.indd 1 17.02.12 10:20<br />
Fachkurzinformation auf Seite 24<br />
25
Gesundheitsförderung<br />
gesuindheit ist Lebensqualität<br />
Gesundheit ist<br />
Lebensqualität –<br />
Feiern auch!<br />
Inge Zelinka-Roitner<br />
Kaum zu glauben: obwohl die Wetterprognosen<br />
auch heuer wieder Regen in <strong>Liebenau</strong><br />
prophezeiten, fand unser alljährliches<br />
Stadtteilfest am Grünanger bereits<br />
zum vierten Mal unter freiem Himmel bei<br />
warmem, sonnigem Wetter statt. Dass unser<br />
Fest zu einer bewährten sommerlichen<br />
Einrichtung geworden ist, zeigen die ständig<br />
steigenden Besucherzahlen: mehr als<br />
150 Menschen genossen das breite Angebot,<br />
das wieder dem Motto gewidmet war,<br />
Gesundheit als umfassendes Konzept zu<br />
verstehen, das vor allem auch Soziales mit<br />
einbezieht und das Wohngebiet als gesundheitsförderliches<br />
Setting begreift. Menschen<br />
unterschiedlichster Herkunft trafen zusammen,<br />
um zu essen, zu spielen, zu plaudern,<br />
Musik zu hören und sich zu informieren.<br />
Um dem Motto „Gesundheit ist Lebensqualität“<br />
gerecht zu werden, durfte natürlich<br />
auch die Musik nicht fehlen: Lothar<br />
Lässer und Sasenko Prolic spielten wieder<br />
aus ihrem bunt gemischten Programm<br />
und konnten einige sogar zum Tanzen motivieren.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Die schon allseits bekannte alkoholfreie<br />
Cocktailbar erfreute sich auch heuer großer<br />
Beliebtheit, gegrillt wurde wieder auf Türkisch<br />
und Österreichisch. Nach einer einleitenden<br />
Vorstellung der SchülerInnen der<br />
Volksschule Schönau stürmten die Kinder<br />
die von WIKI zur Verfügung gestellte Kletterwand<br />
und standen dort bis zum Ende<br />
des Festes Schlange. Aber auch die medizinische<br />
Station mit Ärztin, Physiotherapeutin<br />
und Assistentin war sehr gut besucht:<br />
nach einem Blutdruck- und Blutzuckertest<br />
konnte man sich medizinisch beraten lassen.<br />
Der Kindergarten in der Andersengasse<br />
betreute zum Thema „Spielen mit<br />
Kindern“ eine Station, die den Eltern vermitteln<br />
sollte, wie Spielen zur Entwicklungsförderung<br />
beitragen kann. Gebastelt und gestaltet<br />
wurde mit dem Team von „Lendwirbel“:<br />
Große und Kleine konnten dort kreativ<br />
werden und selbst Taschen nach eigenen<br />
Vorlagen bedrucken.<br />
26
gesuindheit ist Lebensqualität<br />
Gesundheitsförderung<br />
<strong>SMZ</strong> INFO dezember 2010<br />
27
Gesundheitsförderung<br />
Gesunder Garten<br />
Gesunder Garten –<br />
Warum interkulturelle<br />
Nachbarschaftsgärten<br />
gesundheitsfördernd sind<br />
Inge Zelinka-Roitner<br />
Die Blume im Gemeindebau<br />
Sonja Gruber, Soziologin und leidenschaftliche<br />
Gärtnerin, schilderte im Rahmen einer<br />
<strong>SMZ</strong>-Forumsveranstaltung über Gemeinschaftsgärten<br />
im Herbst 2011, wie sie mit<br />
dem Verein „Wirbel“ den ersten gemeinsamen<br />
Garten in einem Wiener Gemeindebau<br />
initiierte. Kooperiert wurde mit der Hausverwaltung<br />
„Wiener Wohnen“, der Garten entstand<br />
in einer Siedlung in Floridsdorf, die in<br />
den 1960er Jahren erbaut worden war und<br />
mit relativ viel Grünraum ausgestattet ist.<br />
Auf der Website des Gemeinschaftsgartens<br />
erfährt man: „Der interkulturelle Nachbarschaftsgarten<br />
Roda-Roda-Gasse verwandelt<br />
das Abstandsgrün eines Wohnbaus in<br />
Wien Floridsdorf in einen vielseitig nutzbaren<br />
Garten. Eine Hälfte des Gartens besteht<br />
aus 25 Beeten für 25 Familien. Aus den 10<br />
bis 15 Quadratmeter großen Parzellen ergibt<br />
sich ein buntes Mosaik unterschiedlicher<br />
Pflanzen. Die Beete liegen an einem<br />
zentralen Weg, der sich in der Mitte zu einem<br />
kleinen Platz mit Wasseranschluss<br />
öffnet. In den individuellen Pflanzstreifen<br />
wachsen Blumen...“<br />
Für den Garten wurde ein eigener Verein<br />
gegründet, es gibt gemeinsam erarbeitete<br />
Gartenregeln und die BenützerInnen bezahlen<br />
einen Mitgliedsbeitrag von € 20,- pro<br />
Jahr. Seit seiner Errichtung im Jahr 2008<br />
wurde der Garten zunächst zweimal pro<br />
Woche durch zwei Personen des Vereins<br />
„Wirbel“ betreut, ab 2010 dann aber in die<br />
Selbstverwaltung der BenützerInnen übergeben.<br />
Die externe Betreuung erfolgte nur<br />
mehr unregelmäßig.<br />
Gemeinsame<br />
Schädlingsbekämpfung<br />
als verbindendes Element<br />
Als GärtnerInnen waren ausschließlich<br />
BewohnerInnen des Gemeindebaus zugelassen,<br />
eine sehr heterogene und multikulturelle<br />
Gruppe. Streit-Themen, die in der<br />
Wohnanlage auftauchten, waren zunächst<br />
auch im Garten präsent. Gruber dazu: „Gemeinsame<br />
Schädlingsbekämpfung war das<br />
verbindende Element. Da gibt es Wissen,<br />
das zu einer Machtumkehr führen kann!“<br />
Wesentliche Aspekte waren für das Betreuungsteam:<br />
• Die Förderung der direkten Kommunikation<br />
untereinander, damit nicht über Vermittler<br />
kommuniziert werden muss<br />
• Nicht nur laute Menschen wahrzunehmen,<br />
sondern auch „die Leisen“ anzuhören<br />
Gruber nennt ein wichtiges Erfolgsrezept<br />
für das Vermeiden unnötiger Konflikte: „Der<br />
02<br />
<strong>SMZ</strong> INFO november 2011
»<br />
Gesunder Garten<br />
Gesundheitsförderung<br />
Die Menschen hatten das Gefühl,<br />
etwas wirklich sinnvolles zu tun!<br />
Garten darf nicht an konfliktbehafteten Orten<br />
in der Siedlung errichtet werden, und<br />
es muss genügend Abstand zu den Wohnungen<br />
vorhanden sein. Außerdem sollte<br />
zumindest ein Drittel der Gartenfläche<br />
Gemeinschaftsfläche sein. Auch Sitzmöglichkeiten<br />
und Schattenspender sind wichtig!“<br />
Hilfreich war, dass die Menschen das<br />
Gefühl hatten, etwas wirklich Sinnvolles zu<br />
tun, da die meisten über sehr wenig Geld<br />
verfügten und das angebaute Gemüse auch<br />
wirklich zur täglichen Ernährung brauchten.<br />
Privates und<br />
Gemeinschaftliches<br />
Konfliktherde ergaben sich aus dem Verhältnis<br />
zwischen Privatem und Gemeinschaftlichem:<br />
Eine Frau brachte z.B. zunächst<br />
einen Sessel mit auf die Gemeinschaftsfläche,<br />
was zunächst allgemeines Wohlwollen<br />
auslöste. Kurz darauf war aber ein Schloss<br />
am Sessel angebracht, wenig später dann<br />
eine versperrte Truhe mit eigenen Gegenständen.<br />
Einige GärtnerInnen versuchten<br />
immer wieder, unbemerkt ihr Beet zu vergrößern.<br />
Auch beim Rasenmähen und der<br />
Müllentsorgung entstehen immer wieder<br />
Konflikte. Wichtig ist allen Beteiligten, das<br />
Gefühl, gerecht behandelt und nicht ausgenutzt<br />
zu werden. Daher war es auch<br />
entscheidend, von Anfang an klarzustellen,<br />
dass auf Gemeinschaftsflächen keine privaten<br />
Ansprüche bestehen.<br />
Gartenkunst im<br />
öffentlichen Raum<br />
Wie aus öffentlichem Gut gemeinschaftlich<br />
gestaltete Flächen werden können, berichtete<br />
Teresa Lukas, ebenfalls Soziologin und<br />
in der Wiener Gebietsbetreuung tätig.<br />
Die Stadtverwaltung hatte BewohnerInnen<br />
der Wolfganggasse in Meidling die Fläche<br />
zwischen Straße und Gehsteig zur Gestaltung<br />
übergeben. Die mittlerweile dreißig<br />
Gartenteile bilden zusammen mit den<br />
Alleebäumen einen großen gemeinsamen<br />
Garten, der nicht mit Nutzpflanzen, sondern<br />
mit Blumen und Sträuchern bepflanzt wurde.<br />
Begleitet wird das Gartenprojekt von der<br />
Gebietsbetreuung Stadterneuerung, der MA<br />
42 (Stadtgartenamt) und dem 12. Bezirk.<br />
Die GärtnerInnen erhielten von KünstlerInnen<br />
Tipps hinsichtlich Farbgestaltung, aber<br />
auch Hinweise, welche Pflanzen welche<br />
Standorte bevorzugen etc. Die Bedingungen:<br />
es dürfen keine Zäune angebracht und<br />
keine Bäume gesetzt werden. So entstand<br />
ein buntes Bild aus sehr verschiedenen<br />
Gärten. Gefeiert wurde mit einem großen<br />
Straßenfest, wofür die Gebietsbetreuung<br />
extra die Straße sperren und alle Autos entfernen<br />
ließ.<br />
Die Rückmeldungen waren durchwegs sehr<br />
positiv, es meldeten sich z.B. auch HausbesitzerInnen,<br />
die meinten, ihre Immobilien<br />
seien durch dieses Projekt aufgewertet worden.<br />
Mittlerweile wurde die Verantwortung<br />
für die „Gärten im Abstandsgrün“ an einen<br />
Verein übergeben.<br />
Garten-Nachbarschaft<br />
Ein weiteres Kooperationsprojekt der Wiener<br />
Gebietsbetreuung mit dem Stadtgartenamt<br />
entstand im „Steinhagegarten“. In dem<br />
öffentlichen Park wurde eine Fläche für eine<br />
private, aber gemeinschaftlich organisierte<br />
Gartennutzung abgezweigt. Die Gebietsbetreuung<br />
entwarf das Konzept, das Gartenamt<br />
finanzierte die Errichtung des Gartens<br />
und legte Beete an. 4000 Haushalte wurden<br />
angeschrieben, ob sie an einem Gartenbeet<br />
interessiert wären, 36 Menschen meldeten<br />
sich daraufhin und 17 Beete wurden letzt-<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
29
Gesundheitsförderung<br />
Gesunder Garten<br />
»<br />
Gemeinschaftsgärten liegen im Trend!<br />
endlich durch eine Verlosung vergeben. 3<br />
Beete gingen an Soziale Einrichtungen Die<br />
Nutzung der Beete ist kostenlos und zunächst<br />
auf zwei Jahre begrenzt.<br />
Die Angst der Kommunalverwaltung und<br />
einiger Anrainer, dass in Gemeinschaftsgären<br />
vieles gestohlen und zerstört würde, hat<br />
sich nicht bewahrheitet, so Teresa Lukas,<br />
der Garten werde von den meisten umliegenden<br />
BewohnerInnen als sehr positiv<br />
wahrgenommen.<br />
Unterstützung der Kommune<br />
In der Diskussion wurde angemerkt, dass<br />
die geschilderten Gartenprojekte offensichtlich<br />
von der Kommune stark unterstützt worden<br />
waren und noch immer die Handschrift<br />
des „roten Wien“ trügen. So gibt es in Wien<br />
z.B. eine eigene Förderstelle für Innenhofbegrünung<br />
sowie riesige „Selbst-Ernte-<br />
Felder“, wo man zu sehr günstigen Bedingungen<br />
zum Teil schon bepflanzte Felder<br />
mieten und ernten kann. Außerdem trägt die<br />
finanzielle Absicherung der Gebietsbetreuung<br />
durch die Stadt Wien zu einer nachhaltigen<br />
Projektentwicklung und Durchführung<br />
in diesem Bereich bei.<br />
Gemeinschaftsgärten<br />
im Trend<br />
Die Bewegung der Gemeinschaftsgärten<br />
kommt ursprünglich aus dem New York der<br />
1970er Jahre. Aber auch in deutschen Städten<br />
wie Berlin gehören solche Gärten schon<br />
länger zum Stadtbild. Die mittlerweile zahlreichen<br />
Wiener Gemeinschaftsgärten kann<br />
man im Netz unter www.gartenpolylog.at<br />
besichtigen. In Graz gibt es unter anderem<br />
den Interkulturellen Landschaftgarten Graz-<br />
West, Kontakt: Ulrike Dietschy,<br />
ulrike.dietschy@aon.at<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
30
Gesunder Garten<br />
Gesundheitsförderung<br />
<strong>SMZ</strong> INFO dezember 2010<br />
05
Gesundheitsförderung<br />
Seniorenverbund <strong>Liebenau</strong><br />
Seniorenverbund <strong>Liebenau</strong><br />
Ina Alic<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Am 2. April hat das <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong> wieder<br />
zu einem SeniorInnen-Treffen geladen.<br />
Nach einer einleitenden Zusammenfassung<br />
über die Entstehung der SeniorInnen-<br />
Plattform und die bisherigen und laufenden<br />
Angebote wurde angeregt über zukünftige<br />
Projekte gesprochen. Die Gestaltung des<br />
neuen SeniorInnen-Folders war ein Thema.<br />
Dabei wurde festgestellt, dass es ein umfangreiches<br />
Veranstaltungsprogramm für<br />
SeniorInnen in <strong>Liebenau</strong> gibt. Aus diesem<br />
Grund können im Folder nur Auszüge angekündigt<br />
werden. Sobald der Folder gedruckt<br />
ist, wird er bei den Pfarren Graz Süd, St.<br />
Paul und St. Christoph sowie bei den Pensionistenverbänden<br />
aufgelegt und verteilt.<br />
In der Diskussion über eine nochmalige<br />
Durchführung des Senioren-Gesundheitstages<br />
im <strong>SMZ</strong> wurde angemerkt, dass es<br />
den Senioren lieber wäre, wenn wieder VertreterInnen<br />
des <strong>SMZ</strong> in die einzelnen Verbände<br />
kommen und dort über bestimmte<br />
Gesundheitshemen informieren. Ein Veranstaltungsteilnehmer<br />
regte auch Themen für<br />
Seniorenveranstaltungen im <strong>SMZ</strong> an:<br />
• Patientenverfügung<br />
• Vererben/Verschenken<br />
• Sturzprophylaxe<br />
• Wohnen im Alter<br />
• Hausärzte/Hausbesuche.<br />
Anschließend wurden die regelmäßigen seniorenrelevanten<br />
Projekte des <strong>SMZ</strong> präsentiert:<br />
Brunch am Grünanger:<br />
Der Brunch in der Außenstelle wird seit 2011<br />
jeden Donnerstag von 9.45 bis 12.00 angeboten<br />
(Unkostenbeitrag von 2.- Euro)<br />
und richtet sich sowohl an ältere Menschen<br />
als auch an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.<br />
Die Zielgruppe der Außenstelle<br />
am Grünanger soll nicht eingeschränkt werden.<br />
Ziel des Brunchs ist es, soziale Netzwerke<br />
zu schaffen und den nachbarschaftlichen<br />
Austausch zu fördern. Ein weiteres<br />
Angebot am Grünanger ist das jährliche<br />
Stadtteilfest, das heuer am Freitag, dem<br />
1.<strong>Jun</strong>i, ab 16.00 Uhr stattfand<br />
Walken:<br />
„Walken im Park“ mit Arzt und Physiotherapeutin<br />
richtet sich an alle interessierten<br />
Personen. Kleine Mobilisierung- und Dehnungsübungen<br />
sind Teil des Walking-Programms.<br />
Die Walkinggruppe startet montags in der<br />
Andersensgasse 32 von 16:00 bis 17:00<br />
sowie donnerstags im <strong>SMZ</strong> (<strong>Liebenau</strong>er<br />
Hauptstraße 104) von 17:00 bis 18:00.<br />
Gemeinsam statt Einsam:<br />
Über 10 Jahre gibt es das Projekt, in dem<br />
zunächst SchülerInnen des BG/BORG <strong>Liebenau</strong><br />
pflegebedürftige SeniorInnen, die<br />
vom <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong> betreut werden, besuchten.<br />
Gespräche und gemeinsame Unternehmungen<br />
bekämpfen nicht nur die Einsamkeit<br />
alter Menschen, sondern schaffen<br />
Verständnis für andere Generationen – und<br />
zwar in beide Richtungen. Seit Herbst 2011<br />
wird das Projekt mit SchülerInnen der HLW<br />
Sozialmanagement durchgeführt.<br />
Die ersten Besuche erfolgen unter Begleitung<br />
der Sozialarbeiterinnen des <strong>SMZ</strong>, koordiniert<br />
wird das Projekt durch die Gesundheitsförderung.<br />
32
Geschichtsbewusstsein schärfen<br />
NS-Symposium<br />
»<br />
Das Vergessen<br />
der Vernichtung ist Teil<br />
der Vernichtung selbst<br />
Inge Zelinka-Roitner<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Mit diesem Zitat von Jean Baudrillard eröffnete<br />
Gustav Mittelbach Anfang November<br />
2011 das Gedenksymposium „Von der NS-<br />
Medizin zur Biopolitik“. Gemeinsam mit der<br />
Medizinischen Universität Graz beschäftigte<br />
sich das <strong>SMZ</strong> mit der Ermordung von Grazer<br />
PatientInnen in der NS-Zeit sowie mit<br />
daraus folgenden aktuellen bioethischen<br />
und gesundheitspolitischen Fragen.<br />
Hochrangige VertreterInnen aus dem Medizin-<br />
und Politikbereich – wie Landesrätin<br />
Dr. Bettina Vollath und der Rektor der Medizinischen<br />
Universität, Josef Smolle – betonten<br />
die Wichtigkeit einer solchen Veranstaltung.<br />
Die Medizin müsse sich – im Sinne<br />
der Psychohygiene – auch mit ihrer dunklen<br />
Geschichte und deren Aufarbeitung beschäftigen.<br />
Smolle bedankte sich ausdrücklich<br />
bei Dr. Mittelbach und Dr. Possert stellvertretend<br />
für das <strong>SMZ</strong>, dass sie ein derart<br />
wichtiges Thema endlich in größerem Format<br />
direkt an der Medizinischen Universität<br />
zur Sprache brachten.<br />
Zur Motivation, ein Gedenksymposium<br />
durchzuführen, erklärte Mittelbach: „In der<br />
Steiermark wurden tausende Menschen unter<br />
dem Deckmantel der Medizin ermordet,<br />
aber es wurde diesbezüglich kein einziger<br />
Prozess geführt.“ Allein der ehemalige Feldhof<br />
(heute LSF) hatte 1500 Opfer zu verzeichnen,<br />
kein Einziger aus diesem Täterkreis<br />
wurde verurteilt.<br />
Gustav Mittelbach und Rainer Possert<br />
schilderten in ihrer Funktion als Lehrbeauftragte<br />
an der Medizinuni ihre Erfahrungen<br />
mit der NS-Thematik: „Die Studenten sind,<br />
was das Thema Medizin in der NS-Zeit betrifft,<br />
sehr wissbegierig und unbefangen.<br />
Allerdings ist erschreckend, wie wenig sie<br />
über dieses Kapitel der Vergangenheit wissen.“<br />
Was erhoffte sich das <strong>SMZ</strong> von der<br />
Veranstaltung? „Wir wollen einerseits den<br />
steirischen Ärzten Mut machen, sich dem<br />
Thema endlich zu stellen. Außerdem entstehen<br />
vielleicht Initiativen wie das Aufstellen<br />
einer Gedenktafel an der Grazer Frauenklinik.“<br />
Um den Eindruck der Tagung auch sinnlich<br />
zu verstärken, spielte Anke Schittenhelm,<br />
Professorin für Violine an der Musikuniversität<br />
Graz, Werke der beiden jüdischen<br />
Komponisten Abel Ehrlich (1915-2003) und<br />
Erwin Schulhoff (1894-1942).<br />
Kindereuthanasie in Graz<br />
Thomas Oelschläger beschäftigte sich in<br />
seinem Vortrag mit der geplanten Ermordung<br />
von Kindern, die als „unwertes Leben“<br />
galten. Die Kinder wurden zunächst<br />
Heilungs- und Therapieversuchen unterzogen,<br />
dahinter standen aber stets Selektionsmechanismen.<br />
Der zweite Vortrag von<br />
Oelschläger widmete sich der Ermordung<br />
von Patienten aus Ostslowenien in der NS-<br />
Zeit. Mit der „Aktion T4“ wurden insgesamt<br />
357 psychiatrische Patienten von einer<br />
ärztlichen Kommission aus der sogenannten<br />
„Untersteiermark“ (Ostslowenien) zur<br />
Vergasung nach Hartheim/ Linz deportiert,<br />
darunter 17 Kinder, das Jüngste gerade<br />
einmal fünf Jahre alt.<br />
Erbkranke und<br />
Ostarbeiterinnen<br />
Im Jänner 1940 wurde die Verordnung zur<br />
„Zwangs-Sterilisation zur Vernichtung erbkranken<br />
Nachwuchses“ erlassen. Gabriele<br />
Czarnowski berichtete in diesem Zusammenhang<br />
von der Praxis der Zwangs-Sterilisationen<br />
und Zwangs-Abtreibungen an der<br />
Grazer Universitäts-Frauenklinik während<br />
der NS-Zeit. Die unfreiwilligen Patientinnen<br />
waren „als erbkrank“ klassifizierte Mädchen<br />
und Zwangsarbeiterinnen. Die Eingriffe waren<br />
meist medizinisch indiziert, eugenische Indikationen<br />
wurden aber auch mit berücksichtigt.<br />
34
NS-Symposium<br />
Geschichtsbewusstsein schärfen<br />
Jede Epoche braucht<br />
Wachsamkeit<br />
Unter diesem Motto kann man die Ausführungen<br />
von Germain Weber, Präsident der<br />
Lebenshilfe Österreich, zusammenfassen.<br />
Weber spannte den historischen Bogen<br />
von den Verbrechen der NS-Medizin hin zu<br />
ethisch bedenklichen medizinischen Vorgansweisen<br />
und der Behandlung von „Behinderten“<br />
bis in die Gegenwart.<br />
„Grauslichkeiten<br />
werden gern verdrängt“<br />
Der Traumaforscher und Psychologe Klaus<br />
Ottomeyer stellte zu Beginn seines Vortrags<br />
fest, dass „die Tendenz bestehe, Grausliches<br />
zu verdrängen.“ Daran sei die immer<br />
noch aktuelle Frage geknüpft: Wie kann es<br />
möglich sein, dass Menschen grausamen<br />
Experimenten und Morden unter dem Deckmantel<br />
der Medizin beiwohnen, ohne etwas<br />
dagegen zu unternehmen?<br />
Einerseits reagierten viele Mitwisser nicht,<br />
da der Arzt Mitglied einer idealisierten Gruppe<br />
war, von der man nicht annahm, dass<br />
sie Mordgelüste hatte, sondern dass sie<br />
aus durchaus rationalen Gründen handelte.<br />
Andererseits gab und gibt es diese unbewusste<br />
menschliche Lust am Töten, wenn<br />
eine gewisse Barriere durchbrochen ist. Es<br />
entstehe ein kollektives Triumphgefühl, ein<br />
Herrenmenschen-Gefühl, so Ottomeyer.<br />
Ärzte als Mörder<br />
Der Psychiater Rainer Danzinger verwies in<br />
seinem Beitrag auf die paradoxe Situation<br />
in der NS-Zeit, dass der Arzt, der ja eigentlich<br />
Leben beschützen und retten sollte,<br />
zum Mörder wurde. Dies gelang nur durch<br />
die gerade von zahlreichen Medizinern internalisierte<br />
Doktrin, dass man zum „Schutz<br />
der Gesundheit des Volkskörpers lebensunwerte<br />
Schädlinge ausmerzen müsse, damit<br />
sie die gesunden nicht ansteckten.“<br />
Eine inhaltliche Zusammenfassung<br />
der Veranstaltung können Sie<br />
unter smz@smz.at anfordern!<br />
<strong>SMZ</strong> INFO dezember 2010<br />
27
Geschichtsbewusstsein schärfen<br />
Das Lager <strong>Liebenau</strong><br />
Das Lager <strong>Liebenau</strong><br />
Inge Zelinka-Roitner<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Überaus großes Interesse bekundete die<br />
Grazer und speziell die <strong>Liebenau</strong>er Bevölkerung<br />
an der Veranstaltung zu den jüdischen<br />
Todesmärschen in der Steiermark, standen<br />
diese doch in enger Verbindung zu einem<br />
dunklen Kapitel der <strong>Liebenau</strong>er Geschichte:<br />
im Jahr 1944 waren ungarische Jüdinnen<br />
und Juden, die man zuvor für den Bau des<br />
sogenannten Südostwalls „verbraucht“ hatte,<br />
nach Graz getrieben worden, wo sie vor<br />
den <strong>Liebenau</strong>er Zwangsarbeiter – Lagern<br />
hausen mussten.<br />
Kritische Auseinandersetzung<br />
mit der Vergangenheit als Basis<br />
für Arbeit mit Menschen<br />
Rainer Possert, Arzt und Obmann des<br />
<strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong>, erklärte zu Beginn die Beweggründe<br />
des <strong>SMZ</strong>, eine derartige Veranstaltung<br />
durchzuführen: „Die Auseinandersetzung<br />
mit den nationalsozialistischen<br />
Verbrechen und insbesondere mit den Ergebnissen<br />
des Nürnberger Ärzteprozesses<br />
standen am Beginn unseres Studiums und<br />
förderten unsere kritische Haltung hinsichtlich<br />
des damaligen Medizinsystems. Außerdem<br />
sind wir seit Beginn unserer ärztlichen<br />
und psychotherapeutischen Tätigkeit mit<br />
den Lebensgeschichten von Tätern und<br />
Opfern konfrontiert - wie z.B. Kriegstraumatisierungen<br />
und Naziverbrechen in der<br />
Familie. Seit 30 Jahren arbeiten wir nun in<br />
<strong>Liebenau</strong>, betreiben hier auch Gesundheitsförderung<br />
und engagieren uns für die Barackensiedlung<br />
am Grünanger. In diesem<br />
Zusammenhang ist es uns wichtig, das Gebiet,<br />
in dem wir tätig sind, auch historisch<br />
näher zu beleuchten und die Hintergründe<br />
zu erforschen.“<br />
Possert zitierte anschließend aus einem<br />
Brief eines israelischen Arztes, der im Zuge<br />
der Veranstaltungsankündigung an das<br />
<strong>SMZ</strong> geschrieben hatte: „[…] eine Studienkollegin<br />
aus alten Zeiten hat mir vor einigen<br />
Tagen die Einladung zum Vortrag von Frau<br />
Dr. Eleonore Lappin-Eppel gesendet. Ich<br />
muss gestehen, dass ich das Blatt bestürzt<br />
und entsetzt gelesen habe. Sie können<br />
sich vielleicht meine Gefühle vorstellen, als<br />
Holocaustüberlebender plötzlich zu erfahren,<br />
dass ich Anfang der sechziger Jahre<br />
während 3 Jahren in einem Hochhaus in der<br />
Kasernstraße gewohnt habe, einige Zehnmeter<br />
vom früheren Lager entfernt, wo meine<br />
Glaubensbrüder in den finsteren Jahren<br />
umgebracht wurden. Und ich habe bis heute<br />
nichts davon gewusst. Graz ist für mich ein<br />
Ort von großer Bedeutung und hat in meiner<br />
beruflichen und persönlichen Geschichte<br />
eine wichtige Rolle gespielt. So bin ich<br />
der Stadt verbunden geblieben, habe noch<br />
mehrere alte Freunde und Kollegen und in<br />
den letzten Jahren pflege ich jeden Sommer<br />
2-3 Wochen bei Freunden in Graz zu<br />
verbringen. Ich bedauere sehr, dem Vortrag<br />
nächste Woche nicht beiwohnen zu können<br />
und wäre sehr dankbar, wenn Sie mir eine<br />
Abschrift des Vortrags senden könnten.“<br />
Verbrechen vor der Haustür<br />
Eleonore Lappin-Eppel, derzeit Mitarbeiterin<br />
der Akademie der Wissenschaften in Wien<br />
und des Centrums für jüdische Studien in<br />
Graz, verfolgte mit ihrem Vortrag die Intention,<br />
die Verbrechen rund um die jüdischen<br />
Zwangsarbeiter in der Steiermark in einen<br />
größeren historischen Kontext zu setzen.<br />
Die Verbrechen um 1944 wurden vielfach<br />
als „Endphasen-Verbrechen“ bezeichnet,<br />
eine Beschreibung, die nach Lappin-Eppel<br />
nicht ganz zutreffend ist: bei Hitlerjugend,<br />
Gendarmerie und Volkssturm kam es wohl<br />
zu Gewaltexzessen, die unter anderen Umständen<br />
vermutlich nicht passiert wären. Die<br />
Waffen-SS jedoch war eine wichtige Tätergruppe,<br />
die als eingeschulte Mordtruppe<br />
bereits seit Jahren aktiv war. Neu an dieser<br />
„Endphase“ war, dass der Nationalsozialismus<br />
mit seinen Verbrechen bis vor die<br />
Haustüre der Menschen in der Steiermark<br />
gekommen war.<br />
Dies bestätigte auch eine anwesende Zeitzeugin:<br />
„Mitten im Murfeld war auch ein<br />
Lager. Ich habe mich mit einem jüdischen<br />
Mädchen befreundet und wir haben oft zu-<br />
36
»<br />
Das Lager <strong>Liebenau</strong><br />
Geschichtsbewusstsein schärfen smz aktuell<br />
Es gab auch Mutige Grazer,<br />
die Juden versteckten und ihnen<br />
damit das leben Retten konnten.<br />
Zu den Hintergründen der <strong>Liebenau</strong>er Lager<br />
erklärte Lappin-Eppel: „Ab Herbst 1944<br />
wurde in Österreich am so genannten Südostwall<br />
gebaut. Neben ZivilistInnen und<br />
der Hitlerjugend arbeiten auch jüdische<br />
Zwangsarbeiter mit. Insgesamt waren ca.<br />
80.000 ungarische Jüdinnen und Juden in<br />
der Zeit von November bis Dezember 1944<br />
als billige Arbeitssklaven für die deutsche<br />
Rüstungsindustrie und für die Gauleitung<br />
in Niederdonau und Steiermark ‚verliehen’<br />
worden, die Hälfte von ihnen wurde bereits<br />
auf dem Weg ins KZ deportiert. Die Vernichtungsmaschinerie<br />
in Auschwitz stand zu<br />
diesem Zeitpunkt allerdings schon still und<br />
so wurde der Arbeitseinsatz von Juden dazu<br />
benützt, sie zu vernichten. Viele der insgesamt<br />
rund 8000 Juden, die zum Arbeitseinsatz<br />
in die Steiermark gebracht worden<br />
waren, waren bereits vor ihren unmenschlich<br />
langen Fußmärschen ohne adäquate<br />
Versorgung und Verpflegung in miserabler<br />
körperlicher Verfassung. Die Unterkünfte<br />
und die Verpflegung am Bau taten dann ihr<br />
Übriges: durch Krankheiten und Hunger geschwächt,<br />
wurden die Juden umso brutaler<br />
behandelt, damit man noch Arbeitskraft aus<br />
ihnen ‚herauspressen’ konnte. Den Wachsammen<br />
gespielt. Ein jüdischer Bub aus<br />
dem Lager wurde von Nachbarn versteckt,<br />
später gefunden und vor meinen Augen<br />
erschossen. Dann wurden alle Juden von<br />
einem LKW abgeholt. Diese Bilder beschäftigen<br />
mich bis heute ständig. Und ich möchte<br />
auch wissen, wer diese Jüdinnen und<br />
Juden waren!“ Lappin-Eppel meinte, sie<br />
könne darüber nur Vermutungen anstellen:<br />
Da laut Angabe der Zeitzeugin auch Frauen<br />
und ein Säugling dabei waren, müsse es<br />
sich um Sommerarbeiter gehandelt haben.<br />
Diese seien im Juli in die Lager gekommen<br />
und hätten etwas mehr Bewegungsfreiheit<br />
gehabt.<br />
Die Murauen waren von Bunkern durchzogen,<br />
in denen die Kinder damals spielten. Es<br />
war jedoch schon den Kindern bekannt, dass<br />
man am Grünanger nicht spielen sollte, da<br />
dort das „große Grauen“ herrsche und man<br />
Menschen erschossen habe.<br />
In der Diskussion wurde darauf hingewiesen,<br />
dass es auch im Süden von Graz Mutige<br />
gegeben habe, die Juden versteckt und<br />
ihnen somit das Leben gerettet hätten: der<br />
Bürgermeister von Thondorf z.B. konnte<br />
viele junge Juden retten, indem er sie als<br />
Internatszöglinge ausgab.<br />
Auf die Frage aus dem Publikum, warum<br />
den Helfern nichts passiert sei, erwiderte<br />
Lappin-Eppel, dass in der Endphase die<br />
HelferInnen nicht mehr bestraft, wohl aber<br />
bedroht worden waren, damit sie die versteckten<br />
Juden preisgaben. Für Prozesse<br />
oder Bestrafungsrituale blieb keine Zeit<br />
mehr.<br />
Jüdische Zwangsarbeit<br />
für den „Südostwall“<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
37
Geschichtsbewusstsein schärfen<br />
Das Lager <strong>Liebenau</strong><br />
»<br />
Jene Juden,<br />
die in besonders schlechtem Zustand waren,<br />
wurden zurückgelassen und ermordet.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
mannschafen sagte man zynischerweise<br />
nicht: ‚tötet die Juden!’, sondern: ‚jüdisches<br />
Leben hat keinen Wert, ihr müsst sie einfach<br />
dazu bringen, zu arbeiten!’“<br />
Die Grazer Morde und<br />
das Lager <strong>Liebenau</strong><br />
Anfang April 1945 erreichten die jüdischen<br />
„Arbeitstransporte“ die Grenze von Graz.<br />
Die Juden wurden auf die so genannten<br />
„Ausländerlager“ Andritz, Wetzelsdorf und<br />
<strong>Liebenau</strong> aufgeteilt. In diesen Lagern waren<br />
zuvor osteuropäische Zivilarbeiter und<br />
Kriegsgefangene interniert gewesen, die zur<br />
Zwangsarbeit in der Grazer Rüstungsindustrie<br />
verpflichtet worden waren. Die Juden<br />
mussten bei kühlem, feuchtem Frühlingswetter<br />
vor den Lagern im Freien übernachten,<br />
wurden jedoch von der Lagerküche verpflegt.<br />
Der Aufenthalt in Graz diente dazu,<br />
neue Transporte zusammenzustellen, die<br />
dann in Richtung Obersteiermark in Marsch<br />
gesetzt wurden. Die „Rast“ in Graz wurde<br />
ebenfalls dazu benützt, Selektionen durchzuführen.<br />
Jene Juden, die in besonders<br />
schlechtem Zustand waren, wurden zurückgelassen<br />
und ermordet. Im Wetzelsdorfer<br />
Lager entdeckte man später die Überreste<br />
von 15 ungarischen Juden, man geht aber<br />
davon aus, dass die Zahl der Opfer wesentlich<br />
höher war.<br />
Bereits im Mai 1947 berichteten mehrere<br />
Zeitungen über die Morde in Graz-<strong>Liebenau</strong>.<br />
Im Mai 1947 schrieben die beiden Grazer<br />
Zeitungen Wahrheit und Österreichische<br />
Volksstimme von 150 Opfern. Bei den Exhumierungen<br />
im Mai wurden 30 Leichen<br />
entdeckt, bis <strong>Jun</strong>i hatte man insgesamt 53<br />
Opfer gefunden, darunter auch die Leichen<br />
von drei Säuglingen. Der Zuständige für die<br />
Grazer Ausländerlager, Nikolaus Pichler,<br />
und der Leiter des Lagers Graz-<strong>Liebenau</strong>,<br />
Alois Frühwirth, hatten bei dem Verfahren<br />
der britischen Militärregierung angegeben,<br />
es hätte Fleckfieberverdacht unter den Gefangenen<br />
gegeben, daher hatte man die<br />
Erschöpften und Kranken erschossen. Es<br />
wurde jedoch im Rahmen des Verfahrens<br />
bekannt, dass das Lager <strong>Liebenau</strong> über<br />
genügend Medikamente verfügte, Pichler<br />
jedoch verboten hatte, diese den Juden zu<br />
verabreichen. Er forderte dagegen den Sanitäter<br />
des Lagers, Hans Fugger, dazu auf,<br />
die Kranken mittels Morphiumspritzen zu liquidieren.<br />
Dieser weigerte sich jedoch und<br />
so wurden die Erschöpften und Ausgehungerten<br />
durch Mordkommandos des Werkschutzes<br />
in mehreren Aktionen erschossen.<br />
Pichler und Frühwirth führten ein Terrorregime<br />
im Lager <strong>Liebenau</strong>: Obwohl die Lagerbaracken<br />
leer standen, mussten die Juden<br />
vor den Lagern übernachten und wurden<br />
bei einem Versuch, Decken aus einer Baracke<br />
zu holen, wegen Plünderung erschossen.<br />
Die tägliche Verpflegung bestand aus<br />
wässriger Suppe und einer Scheibe Brot.<br />
Frühwirth und Pichler wurden im September<br />
1947 wegen Mordes zum Tod durch den<br />
Strang verurteilt.<br />
Die <strong>Liebenau</strong>er Prozesse stießen auf sehr<br />
großes Interesse auf Seiten der Bevölkerung,<br />
vor allem viele Gegner des NS-Regimes<br />
befanden sich im Publikum. Die eigentlichen<br />
Befehlsgeber, die hinter Pichler<br />
und Frühwirth standen, wurden jedoch nie<br />
vor Gericht gestellt!<br />
Wie viele Opfer nun tatsächlich im Lager<br />
<strong>Liebenau</strong> erschossen worden waren, kann<br />
man heute nicht mehr genau nachvollziehen.<br />
Die Briten gingen zwar bei der Exhumierung<br />
sehr sorgfältig vor, es könnte allerdings<br />
sein, dass ihnen die erste Zahl der<br />
Entdeckten bereits für eine Verurteilungen<br />
reichte. Die Grazer Zeitschrift „Wahrheit“<br />
sah sich als Aufdecker-Zeitung der NS-<br />
Verbrechen und schrieb von 150 Opfern in<br />
<strong>Liebenau</strong>, war jedoch in der Angabe ihrer<br />
Zahlen nicht immer ganz seriös.<br />
Auf die Frage aus dem Publikum, ob die<br />
aufklärerischen Zeitungen ebenfalls Quellen<br />
für ihre Zahlenangaben nannten, antwortete<br />
Lappin-Eppel, dass lediglich Menschen<br />
befragt worden waren, die die Massaker<br />
beobachtet hatten. Wahrscheinlich<br />
ist auch, dass die Reporter mit Bestattern<br />
gesprochen hatten.<br />
Gustav Mittelbach wies darauf hin, dass es<br />
ziemlich genaue Zahlen darüber gab, wie<br />
38
viele Juden in Graz angekommen waren<br />
und wie viele Graz wieder verlassen hatten.<br />
Außerdem wollte er noch wissen, was<br />
mit den Gräbern all jener Zwangsarbeitern<br />
passiert war, die zahlenmäßig gleich viele<br />
waren wie die gesamte <strong>Liebenau</strong>er Bevölkerung.<br />
Laut <strong>Info</strong>rmation aus dem Publikum<br />
waren diese alle registriert und am Zentralfriedhof<br />
in Massengräbern begraben worden.<br />
Auch in den Spitälern hatte es eine eigene<br />
„Ostarbeiter-Abteilung“ gegeben.<br />
Die Prozesse<br />
Die Prozesse nach Kriegsende wurden<br />
durch die Tatsache begünstigt, dass aufgrund<br />
der Rückzugsmärsche sehr viele<br />
Menschen auf den Straßen unterwegs waren<br />
und man so zahlreiche Zeugen für die<br />
Morde an Juden finden konnte.<br />
Die britische Militärregierung führte Musterprozesse<br />
durch, wo man zwar die Rechte<br />
der Angeklagten wahrte und Lektionen in<br />
Demokratie erteilte, jedoch wesentlich rigidere<br />
Urteile verhängte als in den österreichischen<br />
Volksgerichten. So wurden z.B.<br />
fünf Kreisleiter zum Tode verurteilt.<br />
Auf die Frage, ob es auch Prozesse gegen<br />
die Waffen-SS-ler gegeben hatte, wies Lappin-Eppel<br />
darauf hin, dass diese auf ihrem<br />
Durchzug durch die Steiermark kaum gesehen<br />
worden waren und man sie ja auch<br />
nicht kannte. Auch die britische Militärregierung<br />
hatte sich nur für die Österreicher interessiert.<br />
Etliche holländische Waffen-SS-ler<br />
konnten dadurch entkommen.<br />
„Kein Klima der<br />
Aufklärung in Österreich“<br />
Rainer Possert wies darauf hin, dass in <strong>Liebenau</strong><br />
bis heute nicht über die Prozesse<br />
und die Leichen gesprochen werde. Wenn<br />
er ältere Patienten dazu befrage, herrsche<br />
Schweigen. Lappin-Eppel bestätigte dies<br />
und verwies auch auf das bemerkenswerte<br />
Schweigen der Retter und Helfer. Die Briten<br />
hätten z.B. auch Überlebende der Zwangsmärsche<br />
befragen wollen, doch diese hatten<br />
versucht, auf dem schnellsten Weg aus<br />
Österreich wegzukommen und in die USA<br />
oder nach Israel auszuwandern. Sie wollten<br />
keine Zeit mehr für Prozesse vergeuden.<br />
Eine Zeitzeugin, die damals in <strong>Liebenau</strong><br />
an der Mur lebte, berichtete, dass auch in<br />
der Dr. Renner-Schule niemals die aktuelle<br />
Geschichte angesprochen worden war. Die<br />
Lehrer waren zum Großteil noch Nazis, die<br />
sie als blondes und blauäugiges Mädchen<br />
wegen ihres „arischen Aussehens“ lobten.<br />
Über die NS-Zeit sei sie erst in England aufgeklärt<br />
worden, wo man ihr nicht glauben<br />
wollte, dass sie von nichts gewusst habe.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
39
smz aktuell<br />
Betriebliche gesundheitsförderung Bei Magna<br />
<strong>SMZ</strong> trifft<br />
Arbeiterbetriebsrat<br />
von Magna Powertrain:<br />
Ina Alic<br />
Das <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong> führt seit 2010 betriebliche<br />
Sozialarbeit bei Magna Powertrain in<br />
Lannach, Ilz und Albersdorf durch. Eine Sozialarbeiterin<br />
des <strong>SMZ</strong> ist wöchentlich zwei<br />
Stunden vor Ort, um MitarbeiterInnen in verschiedensten<br />
Belangen zu beraten.<br />
Am 29. Februar hatten wir die Möglichkeit,<br />
das Werk Magna Powertrain Lannach bei<br />
einer Führung durch den Arbeiterbetriebsrat<br />
Hr. Planinschitsch kennenzulernen.<br />
Der Weg durch die verschiedenen Werkshallen<br />
ist für einen Laien ein sehr beeindruckender.<br />
Mit rutschfesten Schuhen und<br />
Schutzbrille ausgestattet, wagten wir es.<br />
Man kann nur sagen, Technik am höchsten<br />
Stand, aber auch extrem laut und heiß! Man<br />
darf sich auch nur auf bestimmten Wegen,<br />
die speziell gekennzeichnet sind, fortbewegen.<br />
Trotzdem muss man immer auf der<br />
Hut sein, dass nicht ein Staplerfahrer in die<br />
Quere kommt.<br />
Walter Planinschitsch hat uns eindrucksvoll<br />
die unterschiedlichsten Arbeitsabläufe geschildert.<br />
Bei einer so durchaus großen Belastung<br />
der MitarbeiterInnen versteht man,<br />
dass Magna auf betriebliche Gesundheitsförderung<br />
sehr großen Wert legt.<br />
Ein anderer Aspekt für das Wohlbefinden<br />
der Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu sorgen,<br />
was wiederum zur Zufriedenheit und Gesundheit<br />
beiträgt, ist im Fall von Magna<br />
Powertrain Lannach ein einsatzfreudiger,<br />
engagierter Arbeiterbetriebsrat.<br />
Neben Veranstaltungen, die auch in anderen<br />
Unternehmen teilweise zum Standard<br />
gehören dürften, wie jährlich stattfindende<br />
Familienwandertage, Familienausflüge, Abteilungsausflüge,<br />
Lehrlingsausflüge, Sportvereinsveranstaltungen<br />
und natürlich Weihnachtsfeiern,<br />
gibt es für die ArbeiterInnen<br />
auch noch ein ganz anderes Service:<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
+ Zweimal pro Jahr kommt das Finanzamt für Beratungen ins Haus.<br />
+ Einmal pro Woche ist ein Bankberater vor Ort.<br />
+ Verschiedenste Arten von Anträgen erledigt der Betriebsrat<br />
(z.B. Pensionsanträge, Kur-und Pflegefreistellungsanträge, usw.)<br />
+ Beratung und Vereinbarungen zur Elternteilzeit.<br />
+ Schuldnerberatung vor Ort.<br />
+ Hilfestellung bei persönlichen Problemen wie z.B.<br />
Familiäre, gesundheitliche oder sogar Suchtprobleme<br />
+ Erhöhte Pendlerbeihilfe für MitarbeiterInnen wurde ausverhandelt<br />
+ Geschenke (im Jahr 2011 Soft-Shell Jacken) an MitarbeiterInnen<br />
für den besonderen Einsatz in arbeitsintensiven Zeiten.<br />
40
Weiters gibt es für Mitarbeiter (Stammpersonal<br />
und Leihmitarbeiter) ab einer dreimonatigen<br />
Betriebszugehörigkeit verschiedenste<br />
finanzielle Leistungen aus dem Betriebsratsfond<br />
z.B.:<br />
+ Sehbehelf alle 24 Monate<br />
+ Heilmittel/Heilbehelfe<br />
alle 18 Monate<br />
+ Impfung einmal jährlich<br />
(Zecken-und Grippe)<br />
+ Heiratszuwendung<br />
+ Kuraufenthalt/Woche<br />
+ Auszeichnung bei<br />
Lehrabschlussprüfung<br />
+ Studienbeihilfe für Mitarbeiter und<br />
deren Kinder nach Beendigung<br />
des abgeschlossenen Semesters<br />
+ Kinderferienaktion oder Kindererholungszuschuss/Woche<br />
+ Weihnachtsgutscheine für Kinder<br />
+ Grundwehrdienst<br />
+ Gesamte Autobuskosten bei<br />
Veranstaltungen des BR<br />
+ Gutschein bei Dienstjubiläum<br />
Neben betrieblicher Gesundheitsvorsorge<br />
bedingt das Engagement des Betriebsrates<br />
zufriedene Mitarbeiter.<br />
Mit Stolz kann das <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong> darauf<br />
hinweisen, Kooperationspartner von Magna<br />
Powertrain zu sein.
smz aktuell<br />
Erfahrungsbericht<br />
Meine persönlicheN<br />
ErfahrungEN<br />
bei Magna<br />
Birgit Paller<br />
Vorgeschichte<br />
Bereits seit Juli 2010 bietet das <strong>SMZ</strong> betriebliche<br />
Sozialarbeit bei Magna Powertrain<br />
AG & Co KG an. Ich bin seit September des<br />
letzten Jahres als Sozialarbeiterin im <strong>SMZ</strong><br />
tätig und führe daher an den drei Standorten<br />
Lannach, Ilz und Albersdorf jeden Mittwoch<br />
persönliche Beratungen im jeweiligen<br />
Arztzimmer durch. Die Anonymität der KlientInnen<br />
ist dabei oberste Priorität.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Betriebliche Sozialarbeit vor Ort zu leisten<br />
empfinde ich als eine sehr herausfordernde,<br />
interessante und auch ehrenvolle Tätigkeit.<br />
Grundsätzlich ist der Begriff der betrieblichen<br />
Sozialarbeit kein neuer, jedoch steckt<br />
die Umsetzung für die Implementierung<br />
dieses Angebotes noch in den Kinderschuhen.<br />
Das Bewusstsein muss noch stärker<br />
geschaffen werden, Sozialarbeit in einem<br />
Betrieb zu integrieren, um den MitarbeiterInnen<br />
die Möglichkeit zu geben, sich bei beruflichen<br />
und auch privaten Schwierigkeiten<br />
vor Ort Unterstützung zu holen. So kann auf<br />
die Anliegen schnell reagiert und Probleme<br />
früh abgefedert werden. Wie auch Schulsozialarbeit<br />
für SchülerInnen immer stärker<br />
zum Einsatz kommt, sollte auch betriebliche<br />
Sozialarbeit in der Berufswelt greifbar sein.<br />
Meine Eindrücke &<br />
Erfahrungen<br />
Nach meinen nunmehr siebenmonatigen<br />
Erfahrungen kann ich rückblickend sagen,<br />
dass mich die MitarbeiterInnen mit den unterschiedlichsten<br />
Anliegen aufgesucht haben:<br />
Familienberatung, Psychische Probleme,<br />
Finanzielle Angelegenheiten, Sucht,<br />
Sozialrechtliche Fragen, Pflege/Rehabilitation,<br />
Angehörige (inkl. Magna-MitarbeiterInnen)<br />
und Burn-Out.<br />
Vor allem zu den Themen Familie und Burn-<br />
Out wird Rat und Unterstützung benötigt.<br />
In Bezug auf die Arbeit werden besonders<br />
die Belastungen bei der Schichtarbeit,<br />
schlechtes Betriebsklima und Konkurrenz<br />
unter den KollegInnen, steigender Arbeitsdruck<br />
und damit verbundene Gefährdung in<br />
Richtung Burn-Out thematisiert. Bei den gesundheitsbezogenen<br />
Belastungen wird als<br />
häufiges Symptom Schlafstörung genannt.<br />
Burn-Out wird medial auch immer mehr an<br />
die Öffentlichkeit herangetragen. Magna Powertrain<br />
hat gemeinsam mit den Ärzten des<br />
<strong>SMZ</strong> zur Erkennung sowie der Behandlung<br />
der Krankheit Hilfsmaßnahmen gesetzt.<br />
42
Ein Burn-Out-Test in einer Kurz- und Langversion<br />
soll klären, wie gefährdet die Testperson<br />
ist. Getestet werden dabei Belastung<br />
und Ressourcen. Besonders die Erholung –<br />
vor allem im Sinn von „zu Hause abschalten<br />
können“ – wird oftmals von den Mitarbeitern<br />
als schwierig bezeichnet, unabhängig davon,<br />
ob sie an Burn-out leiden oder nicht.<br />
Mit dem nicht „Abschalten können“ wird<br />
auch oftmals der Schlafrhythmus der Betroffenen<br />
gestört, und sie gehen übermüdet in<br />
ihre Arbeit. Trotz solcher Schilderungen der<br />
Mitarbeiter habe ich den Eindruck erhalten,<br />
dass ihnen ihre Arbeit bei Magna wichtig ist.<br />
Eine weitere Erkenntnis habe ich durch die<br />
Beratungen gewonnen: das Beratungssetting,<br />
der geschützte Raum, in dem sie sich<br />
öffnen können, und die Anonymität sind<br />
zentrale Punkte, die den MitarbeiterInnen<br />
wichtig sind. Bezugnehmend auf die Anonymität<br />
ist noch zu sagen, dass die Erstkontakte<br />
vorwiegend telefonisch zustande<br />
kommen.<br />
Ich hoffe, dass unser niederschwelliges Angebot<br />
an medizinischen, therapeutischen<br />
und/oder psychosozialen Hilfestellungen<br />
vor Ort bzw. telefonisch auch in Zukunft<br />
weiter von den Manga MitarbeiterInnen angenommen<br />
wird!<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
43
smz aktuell<br />
unsere<br />
mitarbeiterinnen stellen sich vor<br />
Rosa Bruckenberger<br />
Turnusärztin<br />
INA ALIC<br />
Sozialarbeiterin im <strong>SMZ</strong><br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Ich habe im November 2011 das Medizinstudium<br />
an der Medizinischen Universität<br />
Graz abgeschlossen und bin seit Mitte April<br />
im <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong> als Turnusärztin tätig.<br />
Zwischenzeitlich konnte ich während meiner<br />
ersten Turnusstelle im Rehazentrum<br />
Tobelbad auf den Amputations- und Querschnittsstationen<br />
Erfahrungen sammeln,<br />
welche mich sehr bereicherten.<br />
Durch meine mehrjährige Tätigkeit als Rettungssanitäterin<br />
habe ich einen kleinen Einblick<br />
in das Graz mit all seinen Schattenseiten<br />
– Armut, Sucht usw. – bekommen, denen<br />
man im Alltag nicht so leicht begegnet.<br />
Im <strong>SMZ</strong> wird auch denjenigen Menschen,<br />
die nicht so leicht zu einer adäquaten Versorgung<br />
kommen, durch vielfältige Angebote<br />
geholfen. Ich freue mich sehr, ein Teil<br />
dieser so einzigartigen interdisziplinären<br />
Einrichtung zu sein. Ich bekomme täglich<br />
Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche,<br />
in der allgemeinmedizinischen Praxis, bei<br />
den Hausbesuchen und im Seniorenheim.<br />
Diese Erfahrungen werden sowohl für meine<br />
weitere medizinische Ausbildung, als<br />
auch für mich privat sehr wertvoll sein.<br />
Ich zähle seit Februar <strong>2012</strong> zum kleinen,<br />
aber feinen Team des <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong>. In<br />
dieser Ausgabe des <strong>SMZ</strong> <strong>Info</strong>s darf ich mich<br />
Ihnen nun vorstellen.<br />
Mein Abschluss, damals noch an der Akademie<br />
für soziale Arbeit im <strong>Jun</strong>i 1998, ist<br />
schon einige Zeit her. Im September desselben<br />
Jahres begann ich mit meiner Arbeit als<br />
Sozialarbeiterin in der Justizanstalt Graz-<br />
Jakomini. In dieser Zeit konnte ich wertvolle<br />
Erfahrungen sammeln, die mich in meiner<br />
Arbeit als Sozialarbeiterin geprägt haben<br />
2004 entschloss ich mich, ganz bei meinen<br />
beiden Kindern zuhause zu bleiben. Ich<br />
habe für einige Jahre die Kindererziehung<br />
und das Haushaltsmanagement übernommen.<br />
Nun bin ich voller Tatendrang und freue<br />
mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen,<br />
die das Berufsleben mit sich<br />
bringen.<br />
Falls Sie Fragen haben, Hilfe und Unterstützung<br />
brauchen, bin ich gerne für Sie<br />
da und werde mit Ihnen gemeinsam eine<br />
Lösung suchen.<br />
44
smz <strong>SMZ</strong> aktuell AKTUELL<br />
Michelle Grundmann<br />
Praktikantin<br />
Kerstin Schweighofer<br />
Praktikantin<br />
Ich bin Kerstin Schweighofer, 17 Jahre alt<br />
und spiele in meiner Freizeit gerne Fußball<br />
im SV Strassgang. Ich besuche derzeit die<br />
HLW Sozialmanagement der Caritas. Im<br />
Rahmen des „unterjährigen Praktikums“ in<br />
der dritten Klasse habe ich im <strong>SMZ</strong> <strong>Liebenau</strong><br />
das Projekt „Gemeinsam statt Einsam“<br />
betreut.<br />
In diesem Projekt geht es darum, mit älteren<br />
einsamen Personen im Bezirk etwas zu unternehmen<br />
und ihren Alltag „aufzufrischen“.<br />
Durch die regelmäßigen Besuche lernt man<br />
sich von Mal zu Mal besser kennen und erfährt<br />
vieles über die jeweils andere Generation.<br />
Mir hat das Projekt großen Spaß gemacht<br />
und auch in meiner persönlichen Entwicklung<br />
sehr weiter geholfen. Ich bin nicht<br />
nur selbstständiger, offener und selbstbewusster<br />
geworden, ich habe auch noch viele<br />
neue, interessante Personen kennengelernt<br />
und einiges über die frühere Zeit gelernt.<br />
Und auch die TeilnehmerInnen haben rückgemeldet,<br />
dass ihnen das Projekt sehr gut<br />
gefallen hat, und sie auch nächstes Jahr<br />
gerne wieder dabei seien. Sie sagten, es<br />
wäre gut wieder einen Hauch von Jugend<br />
im Haus zu haben, und dass jemand da ist,<br />
mit dem man sich gut unterhalten kann.<br />
Für meine Zukunft habe ich noch keine<br />
konkreten Pläne. Vorerst steht die Matura<br />
an oberster Stelle. Danach würde mich der<br />
medizinische Bereich interessieren, doch<br />
wo genau es mich hin verschlägt, wird sich<br />
zeigen.<br />
Ich bin 18 Jahre alt und aufgewachsen in<br />
Studenzen, wo ich auch jetzt noch wohne.<br />
Meine Familie ist mir besonders wichtig,<br />
von ihr bekomme ich Rückhalt und gute<br />
Ratschläge, wenn ich vom richtigen Weg<br />
abkomme.<br />
Derzeit besuche ich die Caritas HLW für<br />
Sozialmanagement in Graz, wo ich in die<br />
3.Klasse gehe. Diese Schule hat mir gezeigt,<br />
wie wichtig es ist, dass man für andere<br />
Menschen da ist, denn jeder Mensch<br />
braucht in seinem Leben einmal Hilfe.<br />
Nach meiner Schule möchte ich Psychologie<br />
studieren und danach meine Ausbildung<br />
mit meinem Hobby- den Pferden- kombinieren.<br />
Ich merke es selbst an mir, dass mir<br />
mein Pferd hilft, wenn es mir schlecht geht<br />
und mich wieder aufmuntert. Ich liebe es,<br />
in der Natur zu reiten, ohne jeglichen Lärm<br />
oder andere Gedanken. Den Rest meiner<br />
Freizeit verbringe ich mit Freunden.<br />
Eine meiner guten Eigenschaften ist, dass<br />
sich jeder auf mich verlassen kann. Wenn<br />
ich etwas sage, halte ich mein Wort und<br />
jeder kann zu mir kommen, wenn er Probleme<br />
hat. Es macht mir Freude, Personen<br />
zu helfen und ihnen Ratschläge zu geben.<br />
Ich lege viel Wert auf Pünktlichkeit und<br />
Verlässlichkeit, darum habe ich in meinem<br />
Umfeld nur mit Personen zu tun, die diese<br />
zwei Dinge aufweisen, denn sonst würde<br />
mein Weg nur unnötig erschwert werden.<br />
So wie jeder Mensch, habe ich auch einige<br />
schlechte Eigenschaften. An einer arbeite<br />
ich gerade, nämlich an meiner Geduld.<br />
Überall im Leben braucht man Geduld, nur<br />
meist gebe ich zu schnell auf oder kann es<br />
nicht erwarten. Seitdem ich daran arbeite,<br />
sehe ich schon einige Fortschritte, die ich<br />
gemacht habe.<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
45
smz aktuell<br />
Unsere MitarbeiterInnen...<br />
Ein Abschied mit weinendem Auge!<br />
Im Februar <strong>2012</strong> verließ uns<br />
unsere langjährige Mitarbeiterin,<br />
Diplomsozialarbeiterin<br />
Heike Gremsl, um sich in ihrer näheren<br />
Wohnumgebung in Weiz beruflich niederzulassen.<br />
Als zentraler Bestandteil unseres<br />
Teams wirkte sie durch ihre ruhige,<br />
kompetente Art nicht selten als zentraler<br />
Bestandteil unseres Teams. Heike wurde<br />
nicht nur von den KlientInnen, sondern<br />
auch von allen MultiplikatorInnen (wie z.B.<br />
Vertretern der Apotheken, der Ärzteschaft,<br />
des Wohnungsamtes, des Sozialamtes etc.)<br />
als fachlich äußerst versierte und persönlich<br />
und sozial sehr kompetente Sozialarbeiterin<br />
geschätzt.<br />
Sie betreute nicht nur KlientInnen und organisierte<br />
Gruppentreffen wie „Round Table<br />
Grünanger“, Fallkonferenzen und Apothekertreffen,<br />
sondern erwies sich auch als geschickte<br />
Therapeutin, indem sie als ausgebildete<br />
Tabakentwöhnungsexpertin in<br />
ihren Kursen „Rauchfrei in 6 Wochen“ (in<br />
Kooperation mit VIVID und der GKK Steiermark)<br />
maßgebliche Erfolge erzielen konnte.<br />
Ihr berufliches und soziales Engagement beweist<br />
sie nach wie vor in der Schwangerenberatung<br />
am LKH Graz.<br />
Der Arbeit mit KlientInnen gehört ihre Leidenschaft<br />
und dieser wird sie sich nun auch<br />
in Weiz bei „Rettet das Kind“ widmen. Wir<br />
jedoch werden ihre hohe soziale Kompetenz,<br />
ihre Ruhe und Gelassenheit in allen<br />
Situationen und ihre Fähigkeit, uns immer<br />
wieder zu motivieren, sehr vermissen.<br />
Wir wünschen Dir alles Gute, Heike!<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
46
smz <strong>SMZ</strong> aktuell AKTUELL<br />
Unsere MitarbeiterInnen...<br />
Update aus Afrika!<br />
Petra Steiner<br />
Petra Steiner war Sozialarbeiterin im <strong>SMZ</strong><br />
und befindet sich nun auf Bildungskarenz in<br />
Uganda, wo sie mit ihrem Verein Life Earth<br />
am Aufbau eines Sozialzentrums in Kampala<br />
arbeitet:<br />
„Nachdem wir hier in den letzten Monaten<br />
geschwitzt, geschnauft, geputzt, gemalt,<br />
geflucht und gekämpft haben....<br />
Nach vielen Niederschlägen und Herausforderungen,<br />
Momenten der Verzweiflung und<br />
kurz vor dem Aufgeben, ist es schließlich<br />
und endlich gelungen unser Ziel zu erreichen!<br />
Wir haben ein Café errichtet, einen traumhaften<br />
Garten gestaltet, ein uraltes Haus<br />
renoviert, Elektro- und Wasserleitungen<br />
verlegt, Türen und Wände niedergebrochen<br />
und erneuert, ein Badezimmer errichtet, mit<br />
afrikanischen Künstlern ausgemalt, einen<br />
Baum gefällt und zu Sesseln und Tischen<br />
verarbeitet, ein Personaloutfit, Logo und<br />
Speisekarte entworfen, Personal ausgesucht<br />
und einen tollen Eröffnungsevent geplant!<br />
Unser KBIRA coffee centre konnte am 11.<br />
Februar eröffnet werden! Dazu gab es einen<br />
Grillabend, eine Trommel- und Tanzshow,<br />
einen Craftsmarkt, Cocktails und afrikanischen<br />
DJ Sounds.<br />
Ich habe es geschafft, unserem Konzept<br />
zu folgen und Leute aus sozial benachteiligten<br />
Schichten zu beschäftigen, was zum<br />
Teil eine große Herausforderung darstellte.<br />
Nach einigen Meetings und „sozialarbeiterischen“<br />
Einheiten hab ich mein Personal<br />
moralisch gestärkt und hoffe, dass ich nun<br />
ein gutes Team ausgewählt habe. Mein Personalmix<br />
besteht aus Straßenjugendlichen,<br />
Suchtkranken, allein erziehenden Müttern,<br />
jungen Mädchen, die ihre Eltern verloren<br />
haben, bis hin zu erfahrenen Barkeepern<br />
und geschulten Kellnern.<br />
Mittlerweile kommen immer mehr Leute, um<br />
unser Zentrum kennenzulernen. Wir haben<br />
zwei Abende mit afrikanischer Life Musik und<br />
Lagerfeuer, die viele Besucher anlocken.<br />
Und auch meine <strong>SMZ</strong>-Beraterrolle hab ich<br />
beibehalten – es kommen immer mehr junge<br />
Leute mit Suchtproblematik. Hier steht<br />
diese Problematik unter einem ganz anderen<br />
Stern.<br />
MUJEBALEKO! Auf eine gute Arbeit!<br />
Spenden für das Projekt<br />
Kontonummer: 00510042662<br />
Bankleitzahl: 60000<br />
Verwendungszweck: Uganda
smz aktuell<br />
„Aufgeschnappt“<br />
Andere Länder andere Regeln<br />
Standards in der Substitutionstherapie –<br />
bei uns und in Deutschland:<br />
Wer kennt sie nicht, die Praxen in Österreich,<br />
die 200-500 opiatabhängige Patienten im<br />
Substitutionsprogramm „versorgen“, und<br />
niemand findet etwas dabei, keine Qualitätskontrolle<br />
kritisiert diese Praxis:<br />
In der neuesten Ausgabe der deutschen<br />
Zeitschrift „Suchttherapie 2/<strong>2012</strong> antwortet<br />
der Jurist auf die Frage, wie viele Patienten<br />
ein Substitutionsarzt behandeln dürfe:<br />
„Innerhalb der vertragsärztlichen Behandlung<br />
ist zu beachten, dass es für diese Behandlung<br />
einer Genehmigung durch die kassenärztliche<br />
Vereinigung bedarf. Sie wird in<br />
§10 Abs.4 auf 50 Patienten beschränkt.“<br />
AUFGESCHNAPPT!<br />
Deutsche Ärzteschaft<br />
verurteilt NS-Medizin:<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
Die deutsche Ärzteschaft hat nun erstmals<br />
die Opfer und ihre Nachkommen um Verzeihung<br />
für die Taten gebeten, die deutsche<br />
Mediziner im Nationalsozialismus verübten.<br />
Einstimmig verabschiedeten die Delegierten<br />
des Ärztetages die Nürnberger Erklärung….<br />
Die Erklärung widerspricht der These, dass<br />
die Verbrechen vor allem auf politischen<br />
Druck entstanden:<br />
„Im Gegensatz zu der noch immer verbreiteten<br />
These, ging die Initiative gerade für diese<br />
gravierendsten Menschenrechtsverletzungen<br />
nicht von den politischen Instanzen,<br />
sondern von den Ärzten selbst aus“.<br />
Auch seien das nicht Taten einzelner Ärzte<br />
gewesen, sondern unter Mitwirkung führender<br />
Repräsentanten der Ärzteschaft und<br />
medizinischer Fachgesellschaften verübt<br />
worden. Herausragende Vertreter der universitären<br />
Medizin und renommierter Forschungseinrichtungen<br />
seien ebenfalls beteiligt<br />
gewesen..<br />
„Wir gedenken der noch lebenden und bereits<br />
verstorbenen Opfer, sowie ihrer Nachkommen,<br />
und bitten sie um Verzeihung“.<br />
Der Präsident der Bundesärztekammer<br />
Frank Ulrich Montgomery bezeichnete die<br />
Erklärung und das einstimmige Votum als<br />
„sehr sehr wichtiges Zeichen“ dafür, dass die<br />
Ärzteschaft zu ihrer Verantwortung stehe.<br />
(Süddeutsche Zeitung Nr 119/ S.5 24.5.<strong>2012</strong>)<br />
48
www.smz.at<br />
smz@smz.at<br />
ANGEBOTE<br />
DES <strong>SMZ</strong> LIEBENAU<br />
Allgemein-medizinische Praxisgemeinschaft<br />
Dr. Gustav Mittelbach, Dr. Rainer Possert (alle Kassen)<br />
Hausbesuche, Gesundenuntersuchungen, ärztliche Psychotherapie und Beratung, Behandlung<br />
von Suchterkrankungen, Akupunktur, Sozial-, Arbeits- und Umweltmedizin.<br />
Terminvereinbarung unter 46 23 40<br />
Physiotherapie<br />
Akutschmerzbehandlung, Bewegungstherapie, Entspannungstechniken, Heilgymnastik durch<br />
eine diplomierte Physiotherapeutin. Therapieschwerpunkte: Neurologie und Orthopädie. Hausbesuche<br />
im Bezirk möglich. Tel. Anmeldung unter 46 23 40-15<br />
Familienberatung & Rechtsberatung<br />
Anonyme und kostenlose Beratung durch Ärzte, PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen<br />
und JuristInnen. Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr am Grünanger (Tel.: 0699 180 84 375),<br />
von 19.00 bis 20.00 Uhr im <strong>SMZ</strong>, Tel. Anmeldung unter 46 23 40<br />
Psychotherapie<br />
Gestalt- und Familientherapie, NLP, Systemische Therapie, Einzel- und Gruppentherapie sowie<br />
Kinderpsychotherapie. Teilkostenersatz durch die Krankenkassen. Tel. Anmeldung unter 46 23 40<br />
Soziale Arbeit<br />
Beratung in sozialrechtlichen Fragen, Hilfen bei Kontakten zu Behörden, Hilfestellung bei Wohnungsproblemen,<br />
Arbeitslosigkeit,... Telefonische Kontaktaufnahme unter 42 81 61 oder<br />
0664/34 38 381 / e-mail: paller@smz.at / alic@smz.at<br />
Gesundheitsförderung<br />
Sozialmedizinische und gesundheitsförderliche Veranstaltungen; Durchführung von Projekten<br />
im Bereich Gesundheitsförderung. Kooperationen im Bezirk und mit anderen Organisationen.<br />
Kontakt unter 0699 180 84 375 / e-mail: smz@smz.at, zelinka@smz.at<br />
Sexualberatung<br />
<strong>Info</strong>rmation, Beratung, Psychotherapie zu folgenden Bereichen: Beziehungskonflikte, Sexualprobleme,<br />
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Homosexualität, Verhütungsfragen, Sexualaufklärung,<br />
Schwangerschaftskonflikten usw. Tel. Anmeldung (auch anonym) unter 46 23 40<br />
Walken sie mit uns<br />
WALKEN IM PARK – Nordic Walking Gruppe jeden Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr, Treffpunkt<br />
im Hof des <strong>SMZ</strong>; WALKEN an der Mur – jeden Montag von 16.00 bis 17.00 Uhr, Treffpunkt:<br />
Andersengasse 34. Stöcke zum Probieren können ausgeborgt werden!<br />
<strong>Info</strong>rmationen unter 0699 180 84 375<br />
AuSSenstelle Grünanger<br />
Seit Juli 2009 sind wir auch am Grünanger, Andersengasse 34, für Sie erreichbar.<br />
<strong>Info</strong>rmationen unter 0699 180 84 375<br />
<strong>SMZ</strong> INFO <strong>Jun</strong>i <strong>2012</strong><br />
49
P.b.b. Zulassungsnummer: GZ 02Z034445M / Verlagspostamt 8041 Graz