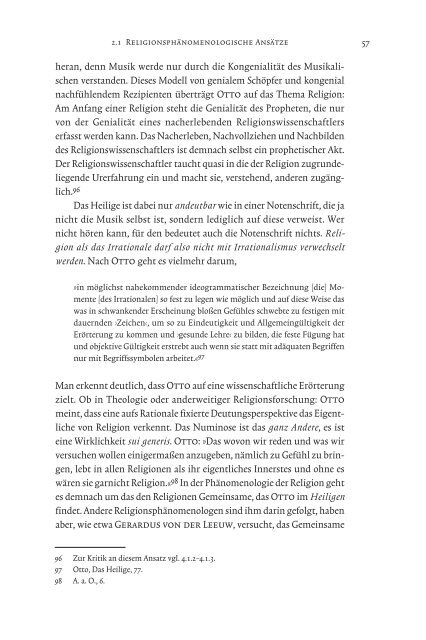Henning Wrogemann: Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie (Leseprobe)
Das Leben in einer pluralistischen Gesellschaft fordert uns dazu heraus, mit Menschen verschiedenster Herkunft und Prägung zu interagieren, wobei Religion und Kultur eine bedeutende Rolle spielen. Dieses Lehrbuch sucht diesen Anforderungen gerecht zu werden. Zunächst werden eine Bandbreite religionswissenschaftlicher Forschungsansätze vorgestellt sowie Grundinformationen zu Judentum, Hinduismus, Buddhismus und Islam geboten. Missionstheologische Übersichten tragen zum Verständnis christlicher Präsenzen in anderen Erdteilen bei. Geltungsansprüche verschiedener Religionen werden beleuchtet und dialogische Interaktionsmuster hinterfragt, um schließlich einen Neuansatz einer Theologie Interreligiöser Beziehungen vorzustellen. Durch die Vermittlung umfassender Kenntnisse über verschiedene Religionen und Kulturen fördert das Lehrbuch unser Verständnis füreinander.
Das Leben in einer pluralistischen Gesellschaft fordert uns dazu heraus, mit Menschen verschiedenster Herkunft und Prägung zu interagieren, wobei Religion und Kultur eine bedeutende Rolle spielen. Dieses Lehrbuch sucht diesen Anforderungen gerecht zu werden. Zunächst werden eine Bandbreite religionswissenschaftlicher Forschungsansätze vorgestellt sowie Grundinformationen zu Judentum, Hinduismus, Buddhismus und Islam geboten. Missionstheologische Übersichten tragen zum Verständnis christlicher Präsenzen in anderen Erdteilen bei. Geltungsansprüche verschiedener Religionen werden beleuchtet und dialogische Interaktionsmuster hinterfragt, um schließlich einen Neuansatz einer Theologie Interreligiöser Beziehungen vorzustellen. Durch die Vermittlung umfassender Kenntnisse über verschiedene Religionen und Kulturen fördert das Lehrbuch unser Verständnis füreinander.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.1 Religionsphänomenologische Ansätze 57<br />
heran, denn Musik werde nur durch die Kongenialität des Musikalischen<br />
verstanden. Dieses Modell von genialem Schöpfer <strong>und</strong> kongenial<br />
nachfühlendem Rezipienten überträgt Otto auf das Thema Religion:<br />
Am Anfang einer Religion steht die Genialität des Propheten, die nur<br />
von der Genialität eines nacherlebenden <strong>Religionswissenschaft</strong>lers<br />
erfasst werden kann. Das Nacherleben, Nachvollziehen <strong>und</strong> Nachbilden<br />
des <strong>Religionswissenschaft</strong>lers ist demnach selbst ein prophetischer Akt.<br />
Der <strong>Religionswissenschaft</strong>ler taucht quasi in die der Religion zugr<strong>und</strong>eliegende<br />
Urerfahrung ein <strong>und</strong> macht sie, verstehend, anderen zugänglich.<br />
96 Das Heilige ist dabei nur andeutbar wie in einer Notenschrift, die ja<br />
nicht die Musik selbst ist, sondern lediglich auf diese verweist. Wer<br />
nicht hören kann, für den bedeutet auch die Notenschrift nichts. Religion<br />
als das Irrationale darf also nicht mit Irrationalismus verwechselt<br />
werden. Nach Otto geht es vielmehr darum,<br />
»in möglichst nahekommender ideogrammatischer Bezeichnung [die] Mo -<br />
mente [des Irrationalen] so fest zu legen wie möglich <strong>und</strong> auf diese Weise das<br />
was in schwankender Erscheinung bloßen Gefühles schwebte zu festigen mit<br />
dauernden ›Zeichen‹, um so zu Eindeutigkeit <strong>und</strong> Allgemeingültigkeit der<br />
Erörterung zu kommen <strong>und</strong> ›ges<strong>und</strong>e Lehre‹ zu bilden, die feste Fügung hat<br />
<strong>und</strong> objektive Gültigkeit erstrebt auch wenn sie statt mit adäquaten Begriffen<br />
nur mit Begriffssymbolen arbeitet.« 97<br />
Man erkennt deutlich, dass Otto auf eine wissenschaftliche Erörterung<br />
zielt. Ob in <strong>Theologie</strong> oder anderweitiger Religionsforschung: Otto<br />
meint, dass eine aufs Rationale fixierte Deutungsperspektive das Eigentliche<br />
von Religion verkennt. Das Numinose ist das ganz Andere, es ist<br />
eine Wirklichkeit sui generis. Otto: »Das wovon wir reden <strong>und</strong> was wir<br />
versuchen wollen einigermaßen anzugeben, nämlich zu Gefühl zu bringen,<br />
lebt in allen Religionen als ihr eigentliches Innerstes <strong>und</strong> ohne es<br />
wären sie garnicht Religion.« 98 In der Phänomenologie der Religion geht<br />
es demnach um das den Religionen Gemeinsame, das Otto im Heiligen<br />
findet. Andere Religionsphänomenologen sind ihm darin gefolgt, haben<br />
aber, wie etwa Gerardus von der Leeuw, versucht, das Gemeinsame<br />
96 Zur Kritik an diesem Ansatz vgl. 4.1.2–4.1.3.<br />
97 Otto, Das Heilige, 77.<br />
98 A. a. O., 6.