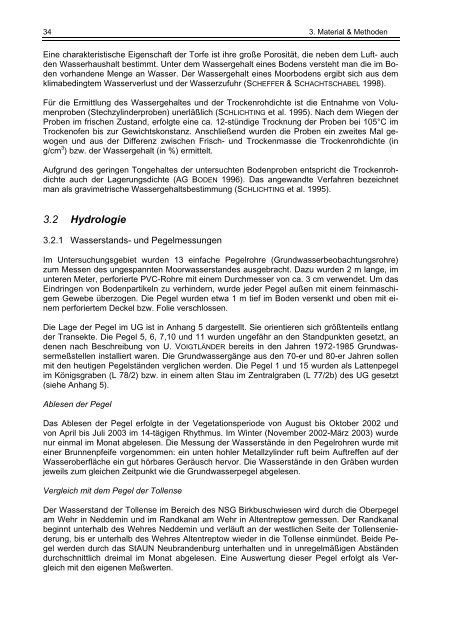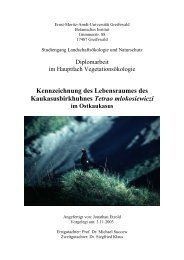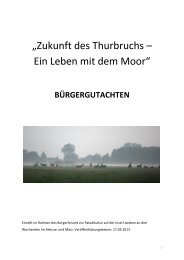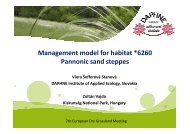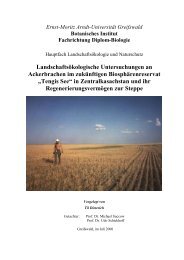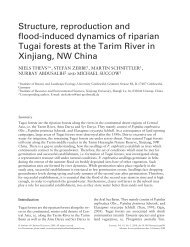Vegetations- und Standortswandel im NSG Birkbuschwiesen bei ...
Vegetations- und Standortswandel im NSG Birkbuschwiesen bei ...
Vegetations- und Standortswandel im NSG Birkbuschwiesen bei ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
34 3. Material & Methoden<br />
Eine charakteristische Eigenschaft der Torfe ist ihre große Porosität, die neben dem Luft- auch<br />
den Wasserhaushalt best<strong>im</strong>mt. Unter dem Wassergehalt eines Bodens versteht man die <strong>im</strong> Boden<br />
vorhandene Menge an Wasser. Der Wassergehalt eines Moorbodens ergibt sich aus dem<br />
kl<strong>im</strong>abedingtem Wasserverlust <strong>und</strong> der Wasserzufuhr (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 1998).<br />
Für die Ermittlung des Wassergehaltes <strong>und</strong> der Trockenrohdichte ist die Entnahme von Volumenproben<br />
(Stechzylinderproben) unerläßlich (SCHLICHTING et al. 1995). Nach dem Wiegen der<br />
Proben <strong>im</strong> frischen Zustand, erfolgte eine ca. 12-stündige Trocknung der Proben <strong>bei</strong> 105°C <strong>im</strong><br />
Trockenofen bis zur Gewichtskonstanz. Anschließend wurden die Proben ein zweites Mal gewogen<br />
<strong>und</strong> aus der Differenz zwischen Frisch- <strong>und</strong> Trockenmasse die Trockenrohdichte (in<br />
g/cm 3 ) bzw. der Wassergehalt (in %) ermittelt.<br />
Aufgr<strong>und</strong> des geringen Tongehaltes der untersuchten Bodenproben entspricht die Trockenrohdichte<br />
auch der Lagerungsdichte (AG BODEN 1996). Das angewandte Verfahren bezeichnet<br />
man als grav<strong>im</strong>etrische Wassergehaltsbest<strong>im</strong>mung (SCHLICHTING et al. 1995).<br />
3.2 Hydrologie<br />
3.2.1 Wasserstands- <strong>und</strong> Pegelmessungen<br />
Im Untersuchungsgebiet wurden 13 einfache Pegelrohre (Gr<strong>und</strong>wasserbeobachtungsrohre)<br />
zum Messen des ungespannten Moorwasserstandes ausgebracht. Dazu wurden 2 m lange, <strong>im</strong><br />
unteren Meter, perforierte PVC-Rohre mit einem Durchmesser von ca. 3 cm verwendet. Um das<br />
Eindringen von Bodenpartikeln zu verhindern, wurde jeder Pegel außen mit einem feinmaschigem<br />
Gewebe überzogen. Die Pegel wurden etwa 1 m tief <strong>im</strong> Boden versenkt <strong>und</strong> oben mit einem<br />
perforiertem Deckel bzw. Folie verschlossen.<br />
Die Lage der Pegel <strong>im</strong> UG ist in Anhang 5 dargestellt. Sie orientieren sich größtenteils entlang<br />
der Transekte. Die Pegel 5, 6, 7,10 <strong>und</strong> 11 wurden ungefähr an den Standpunkten gesetzt, an<br />
denen nach Beschreibung von U. VOIGTLÄNDER bereits in den Jahren 1972-1985 Gr<strong>und</strong>wassermeßstellen<br />
installiert waren. Die Gr<strong>und</strong>wassergänge aus den 70-er <strong>und</strong> 80-er Jahren sollen<br />
mit den heutigen Pegelständen verglichen werden. Die Pegel 1 <strong>und</strong> 15 wurden als Lattenpegel<br />
<strong>im</strong> Königsgraben (L 78/2) bzw. in einem alten Stau <strong>im</strong> Zentralgraben (L 77/2b) des UG gesetzt<br />
(siehe Anhang 5).<br />
Ablesen der Pegel<br />
Das Ablesen der Pegel erfolgte in der <strong>Vegetations</strong>periode von August bis Oktober 2002 <strong>und</strong><br />
von April bis Juli 2003 <strong>im</strong> 14-tägigen Rhythmus. Im Winter (November 2002-März 2003) wurde<br />
nur einmal <strong>im</strong> Monat abgelesen. Die Messung der Wasserstände in den Pegelrohren wurde mit<br />
einer Brunnenpfeife vorgenommen: ein unten hohler Metallzylinder ruft be<strong>im</strong> Auftreffen auf der<br />
Wasseroberfläche ein gut hörbares Geräusch hervor. Die Wasserstände in den Gräben wurden<br />
jeweils zum gleichen Zeitpunkt wie die Gr<strong>und</strong>wasserpegel abgelesen.<br />
Vergleich mit dem Pegel der Tollense<br />
Der Wasserstand der Tollense <strong>im</strong> Bereich des <strong>NSG</strong> <strong>Birkbuschwiesen</strong> wird durch die Oberpegel<br />
am Wehr in Neddemin <strong>und</strong> <strong>im</strong> Randkanal am Wehr in Altentreptow gemessen. Der Randkanal<br />
beginnt unterhalb des Wehres Neddemin <strong>und</strong> verläuft an der westlichen Seite der Tollenseniederung,<br />
bis er unterhalb des Wehres Altentreptow wieder in die Tollense einmündet. Beide Pegel<br />
werden durch das StAUN Neubrandenburg unterhalten <strong>und</strong> in unregelmäßigen Abständen<br />
durchschnittlich dre<strong>im</strong>al <strong>im</strong> Monat abgelesen. Eine Auswertung dieser Pegel erfolgt als Vergleich<br />
mit den eigenen Meßwerten.