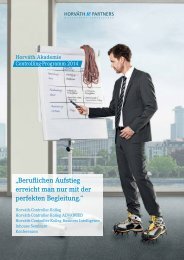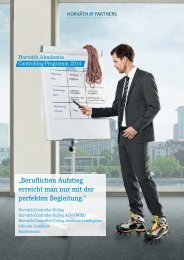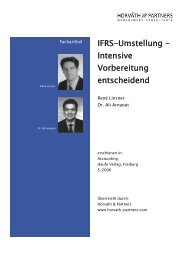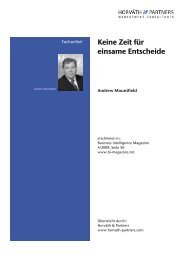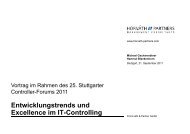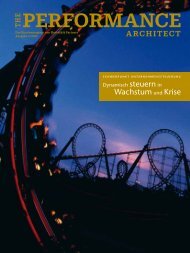performance t h e architect - Horváth & Partners Management ...
performance t h e architect - Horváth & Partners Management ...
performance t h e architect - Horváth & Partners Management ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Titel<br />
8<br />
Neue<br />
Käufertrends<br />
und neue<br />
Technologien<br />
treiben<br />
Unternehmen<br />
immer häufiger<br />
dazu, auch<br />
Kooperationen mit<br />
Wettbewerbern in<br />
Erwägung zu<br />
ziehen<br />
Auch wer vermeintlichen<br />
„Mega-Trends“ eher skeptisch<br />
gegenübersteht, kommt<br />
an der Tatsache kaum vorbei, dass Kooperation<br />
angesagt ist – von Forschung<br />
und Entwicklung über den Einkauf bis<br />
zum Vertrieb; in Form von strategischen<br />
Allianzen, Verbünden oder Netzwerken.<br />
Verschiedene aktuelle Studien<br />
ziehen denn auch das Fazit, aus den<br />
„weichen Organisationskompetenzen“<br />
erwüchsen nachhaltige Wettbewerbsvorteile<br />
– und nennen in diesem Zusammenhang<br />
unter anderem „das Kooperieren<br />
und Schmieden von Allianzen“.<br />
Unternehmen auf dem Kooperationspfad<br />
Hervorstechendes Beispiel für diesen<br />
Trend: die Autobranche. Zwar haben<br />
sich die Pläne von Daimler und BMW, im<br />
Bereich der Entwicklung eng zusammenzuarbeiten,<br />
nicht realisiert. Doch die<br />
im April diesen Jahres zwischen Daimler,<br />
Renault und Nissan vereinbarte strategische<br />
Kooperation setzt Maßstäbe, die<br />
auch für andere Hersteller die Richtung<br />
vorgeben könnten: Das Spektrum reicht<br />
von der Zusammenarbeit im Kompaktwagen-Segment<br />
über die gemeinsame<br />
Entwicklung von Motoren bis zur Kooperation<br />
bei leichten Nutzfahrzeugen<br />
und beim Teile-Einkauf. Doch die Autoindustrie<br />
steht keineswegs allein: Bei<br />
der Deutschen Bahn geht die Konzerntochter<br />
DB Regio auf die kleineren Wettbewerber<br />
im Nahverkehr zu. Und in der<br />
Chemieindustrie prüfen selbst direkte<br />
Wettbewerber die Vorteile einer Zusam-<br />
menarbeit beim Bau und bei der Nutzung<br />
teurer großchemischer Anlagen.<br />
Die Liste der Beispiele ließe sich nahezu<br />
beliebig verlängern.<br />
Konvergenz treibt Zusammenarbeit<br />
Ein besonders interessantes Feld für Kooperationen<br />
tut sich in der Energiewirtschaft<br />
auf. Denn der Energiemarkt wird<br />
aktuell durch ökologische, wirtschaftliche<br />
und technische Treiber grundlegend<br />
verändert: Erderwärmung und Erschöpfung<br />
der fossilen Brennstoffe, weltweit<br />
steigender Energiebedarf sowie ordnungspolitische<br />
Maßnahmen zur Öffnung<br />
des Energiemarktes sind hier nur<br />
einige Stichwörter. Eine der Antworten<br />
auf diese Herausforderungen: der Ausbau<br />
der Elektromobilität (eMobility) über<br />
Innovationen in der Fahrzeug- und Speichertechnik,<br />
den Aufbau einer entsprechenden<br />
Infrastruktur sowie die Entwicklung<br />
innovativer Abrechnungssysteme<br />
für die Nutzer von Elektroautos.<br />
Die traditionellen Grenzen zwischen<br />
Energieversorgern, Telekommunikationsanbietern<br />
und Automobilherstellern lösen<br />
sich dabei zunehmend auf – ein Konvergenzprozess,<br />
in dessen Rahmen neue<br />
Formen der Zusammenarbeit über Branchengrenzen<br />
hinweg entstehen.<br />
Kooperation auf der CEO-Agenda<br />
Trotz mancher innovativer Ansätze ist<br />
die Botschaft vom Nutzen der Kooperation<br />
nicht wirklich neu. Strategen haben<br />
längst erkannt, welches Potenzial sie<br />
birgt. Nicht umsonst steht eines der sieben<br />
„K“ des von <strong>Horváth</strong> & <strong>Partners</strong> ent-<br />
wickelten „7-K-Prinzips“ der Geschäftsmodellinnovation<br />
für Kooperation (siehe<br />
dazu Beitrag auf Seite 10). Dennoch stellt<br />
sich für jedes Unternehmen die Frage,<br />
ob die vorhandenen Potenziale schon<br />
ausreichend genutzt werden – gerade<br />
auch beim Aufbau flexibler Kostenstrukturen,<br />
die nach der Krise wichtiger<br />
sind denn je. Ob die Wertschöpfungstiefe<br />
angepasst werden soll, indem man<br />
Non-core-Prozesse auf kostengünstigere<br />
Partner auslagert, oder ob es schlicht<br />
darum geht, sich Kosten zu teilen – wie<br />
etwa beim schon erwähnten „Co-Producing“<br />
in der chemischen Industrie: Wer<br />
Kosten senken oder flexibilisieren will,<br />
tut gut daran zu überlegen, wo man noch<br />
kooperieren kann.<br />
Ansatzpunkte für nutzbringende Kooperationen<br />
– nicht nur zur Kostenflexibilisierung<br />
– bieten sich in allen wesentlichen<br />
Unternehmensbereichen:<br />
n Beispiel Einkauf<br />
Hier hat eine Form der kooperativen<br />
Preisfindung ihren Ausgang in der Automobilbranche<br />
genommen: das Open<br />
Book Accounting (OBA). Bei diesem<br />
legen Zulieferer dem Abnehmer ihre<br />
Kosten offen; gemeinsam sucht man<br />
nach Möglichkeiten, sie zu senken.<br />
Beim japanischen Autohersteller Nissan<br />
etwa legen 80 Prozent der Zulieferer<br />
Kosteninformationen offen. Gemeinschaftlich<br />
wird das Ziel verfolgt,<br />
Preistreiber aufzuspüren; wichtige Zulieferer<br />
schult Nissan sogar, um niedrigere<br />
Kosten entlang der gesamten<br />
Wertschöpfungskette zu erreichen.<br />
n Beispiel Vertrieb<br />
Auch im Vertrieb finden sich zahlreiche<br />
Anknüpfungspunkte für Kooperationen<br />
– sowohl horizontaler als<br />
auch vertikaler Art. So unterhalten beispielsweise<br />
die Unternehmen Mars<br />
und Fressnapf gemeinsame Läger bzw.<br />
Zwischenläger; im Handel sind Vertriebskooperationen<br />
in Form eines Verbundes<br />
selbstständiger Einzelhändler<br />
oder sogar Großhändler bereits weit<br />
verbreitet.<br />
n Beispiel Supply Chain <strong>Management</strong><br />
Hier ist insbesondere die zunehmende<br />
Bedeutung der komplex organisierten<br />
Kooperationsnetzwerke (Supply Chain<br />
Networks) zu nennen, die sich auf die<br />
gesamte Lieferkette – also auf interne<br />
und externe Organisationseinheiten –<br />
erstrecken können (mehr dazu in der<br />
Rubrik „Fokus“).<br />
FuE –nie war Zusammenarbeit nötiger<br />
Neue Käufertrends und neue Technologien<br />
treiben Unternehmen immer häufiger<br />
dazu, auch Kooperationen mit<br />
Wettbewerbern in Erwägung zu ziehen –<br />
gerade im Bereich FuE. Ein Beispiel ist<br />
die geplante „Wholesale Applications<br />
Community“: Führende Telekommunikationsanbieter<br />
und Hersteller von Mobiltelefonen<br />
wie Samsung und Sony<br />
Ericsson, Vodafone und Deutsche Telekom<br />
wollen eine „Open Global Alliance“<br />
bilden, um gemeinsam gegen Apples<br />
Marktführerschaft bei mobiler Software<br />
anzugehen. Ein weiterer Trend besteht<br />
darin, die eigenen Kunden als „Prosumenten“<br />
in die Wertschöpfungskette einzubeziehen.<br />
Der Vorteil liegt auf der<br />
Hand: Über Kooperationen mit Kunden<br />
werden deren Bedürfnisse frühzeitig erkannt,<br />
es lassen sich maßgeschneiderte<br />
Produkte entwickeln. So wird schon im<br />
Innovationsprozess der spätere Markterfolg<br />
gesichert.<br />
Auch bei Internationalisierungsbestrebungen<br />
können regionale Spezifika<br />
und Bedürfnisse durch Einbeziehen internationaler<br />
Partner in Innovationskooperationen<br />
besser erkannt werden.<br />
Und schließlich wird der Verbund mit<br />
Zulieferunternehmen oder die Beteiligung<br />
an Innovationsnetzwerken immer<br />
wichtiger, wenn es darum geht, innovative<br />
Produkte schnell und zielgerichtet<br />
zur Marktreife zu bringen – ein wichtiger<br />
Hebel, um gegen die Konkurrenz aus<br />
asiatischen Niedriglohnländern zu bestehen.<br />
Doch für das professionelle <strong>Management</strong><br />
solcher Netzwerke bedarf es<br />
nicht zuletzt der notwendigen Steuerungskompetenz<br />
(siehe dazu auch die<br />
Rubrik „Wissenschaftsforum“).<br />
„Wer zu spät kommt ...“<br />
Wie weit der Trend zur Zusammenarbeit<br />
auch gehen mag: Unternehmenslenker<br />
und Strategen tun gut daran, dieses<br />
Thema im Blick zu behalten. Zu vielfältig<br />
und attraktiv sind schon jetzt die Beispiele<br />
für den Nutzen von Kooperationen,<br />
als dass ein Unternehmen sich<br />
leisten könnte, hier „zu spät zu kommen“.<br />
Kooperation ist bestimmt kein<br />
Allheilmittel; doch beim Bestreben, die<br />
internationale Wettbewerbsfähigkeit zu<br />
erhalten oder gar auszubauen, wird –<br />
das lässt sich schon heute sagen – die Fähigkeit,<br />
Kooperationen einzugehen, Netzwerke<br />
zu nutzen und kooperative Formen<br />
des Wirtschaftens professionell zu<br />
steuern, immer wichtiger werden.<br />
Titel<br />
9