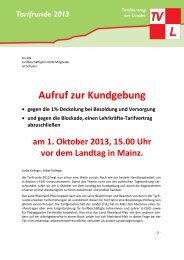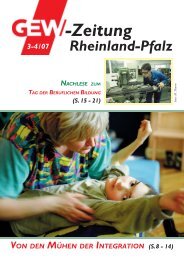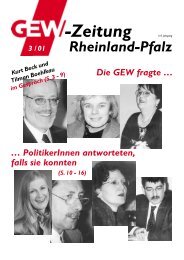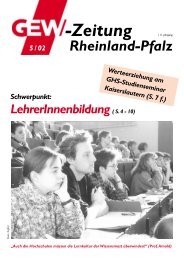Heinz Klippert weist Wege aus der Krise - GEW
Heinz Klippert weist Wege aus der Krise - GEW
Heinz Klippert weist Wege aus der Krise - GEW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schulen<br />
Die Schule von morgen<br />
Schleicher: Lehrpläne verän<strong>der</strong>n und Lehrerbildung reformieren reicht nicht<br />
6<br />
„Der Blick über den Tellerrand ins Ausland tut dem deutschen<br />
Schulsystem gut. Das schlechte Abschneiden <strong>der</strong><br />
Schülerinnen und Schüler bei internationalen Leistungstests<br />
und die hohe Abhängigkeit des Schulerfolgs <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong> von <strong>der</strong> sozialen Herkunft <strong>der</strong> Eltern werden<br />
zunehmend auch von <strong>der</strong> Wirtschaft und in an<strong>der</strong>en<br />
Län<strong>der</strong>n mit Sorge betrachtet“, sagte Marianne Demmer,<br />
stellvertretende Bundesvorsitzende <strong>der</strong> Gewerkschaft<br />
Erziehung und Wissenschaft, zur Eröffnung <strong>der</strong> Frankfurter<br />
<strong>GEW</strong>-Veranstaltung „Schulen in Deutschland -<br />
Schulen mit Zukunft?“. Und wer hat einen besseren<br />
Überblick über die Schulen außerhalb Deutschlands als<br />
Andreas Schleicher, PISA-Koordinator <strong>der</strong> OECD?<br />
In seinem Hauptreferat skizzierte Schleicher zunächst die<br />
Bevölkerungsentwicklung hierzulande. 2030 werde die<br />
Hälfte <strong>der</strong> deutschen Bevölkerung über 65 Jahre sein.<br />
2020 müsste Deutschland jährlich eine Million Einwan<strong>der</strong>er<br />
integrieren, um die jetzige Zahl <strong>der</strong> Erwerbstätigen<br />
zu sichern. „Wie wirksam geht das deutsche Schulsystem<br />
mit diesen Problemen um?“, Wissen werde zur<br />
primären Ressource, „gemeinsam besitzen die Wissensarbeiter<br />
die entscheidenden Produktionsmittel“. Diese<br />
Erkenntnis hätten z.B. Südkorea, Japan und die nordischen<br />
Staaten Finnland und Schweden längst in ihren<br />
Schulen umgesetzt, während die Bundesrepublik noch<br />
immer beim „Weiter - So“ verharre und international<br />
immer stärker zurückfalle. „Erfolgreiche Bildungssysteme“,<br />
so Schleicher, vernetzen die Arbeit ihrer Lehrer“.<br />
Lehrer fühlten sich nicht allein gelassen und strebten eine<br />
Professionalisierung weg vom Einzelkämpfertum an. Die<br />
Schule müsse ein „attraktives Arbeitsumfeld“ bieten. In<br />
Finnland könnten Eltern ihre Kin<strong>der</strong> in jede Schule schikken.<br />
Dort betrage die Leistungsvarianz fünf Prozent, in<br />
Deutschland aber das Zehnfache. Eltern hätten wachsende<br />
Erwartungen an die Schule, die weit über das kognitive<br />
Lernen hin<strong>aus</strong>gingen. Es gelte, den Status quo zu<br />
überwinden. Schulbürokraten und ihre Interessengruppen<br />
wi<strong>der</strong>stünden dem Wandel. Um Qualität und Chancengerechtigkeit<br />
zu sichern, müsse die Investition<br />
steigen und die kritische OECD-Schwelle verlassen. Im<br />
Status quo behalte Schule ihren Charakter als Verwaltungseinheit,<br />
„die Wissen durch traditionellen Unterricht<br />
vermittelt“. Lebensbegleitendes Lernen werde zur Norm.<br />
In einem Szenario, das erfolgreich in die Zukunft geht,<br />
sei Schule ein „soziales Zentrum <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Gesellschaft<br />
ohne soziale Fragmentierung“. Eine systemische<br />
Verän<strong>der</strong>ung weg von <strong>der</strong> Dreigliedrigkeit müsse auch<br />
das Leben in die Schule tragen, wenn Schülerinnen und<br />
Schüler darauf vorbereitet werden sollen, d.h. „wir brauchen<br />
neben <strong>der</strong> Lehrerprofessionalität weitere Professionen<br />
im Raum Schule“. Den Lehrplan zu verän<strong>der</strong>n und<br />
die Lehrer<strong>aus</strong>bildung zu reformieren reicht nach Meinung<br />
des PISA-Koordinators nicht <strong>aus</strong>. Schwache Schulleistungen<br />
dürften nicht toleriert werden, aber entschei-<br />
dend sei es, die Anreize und die Unterstützungssysteme<br />
für Schule zu verstärken. „Ob Zentralismus im Bund o<strong>der</strong><br />
in den Bundeslän<strong>der</strong>n, ist zweitrangig. Die deutsche Bildungspolitik<br />
muss wissen, wohin die Reise geht“, sagte<br />
Schleicher. Trotz des deutschen Bildungssystems gebe es<br />
hierzulande keinen Mangel an Ideen, aber die Frage sei,<br />
wie man die Innovationen systemisch verankern könne,<br />
statt immer nur zu fragmentieren, zu selektieren und die<br />
soziale Ungleichheit zu steigern.<br />
Individuelle För<strong>der</strong>ung im geglie<strong>der</strong>ten<br />
System nicht möglich<br />
In <strong>der</strong> anschließenden Podiumsdiskussion „16 Schulsysteme<br />
- hat das Modell Deutschland Zukunft?“ äußerten<br />
sich alle Teilnehmer sehr skeptisch. Die Kin<strong>der</strong> nicht<br />
beschämen und nicht zurücklassen, for<strong>der</strong>te Alfred Harnischfeger,<br />
Schulleiter <strong>der</strong> IGS Kelsterbach in Hessen.<br />
So könne es nicht weiter gehen. Gen<strong>aus</strong>o wichtig wie<br />
die Vernetzung <strong>der</strong> Schulen, die reformbereit sind und<br />
neue <strong>Wege</strong> gehen, sei die gesellschaftliche und elterliche<br />
Unterstützung <strong>der</strong> Schularbeit, „nicht ständig gegen die<br />
Schule polemisieren“. Gabriele Weindel-Güdemann <strong>aus</strong><br />
dem Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz sprach vom<br />
notwendigen „Vertrauen in die Schule“. Ihr schwebt<br />
Schule als „soziales Zentrum“ vor. Eine „individuelle<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> und Jugendlichen“ ist nach ihrer<br />
Meinung im geglie<strong>der</strong>ten System nicht möglich, eine<br />
Auffassung, die Lothar Späth kürzlich im „Handelsblatt“<br />
vertreten hat: „Gefragt sind massive strukturelle Verän<strong>der</strong>ungen:<br />
weg von einem Bildungssystem, das zu stark<br />
darauf <strong>aus</strong>gerichtet ist, überdurchschnittliche Schüler von<br />
unterdurchschnittlichen zu trennen, hin zu einem System,<br />
das individuelle Schwächen <strong>aus</strong>gleicht und Talente<br />
för<strong>der</strong>t.“<br />
Andreas Schleicher wies darauf hin, dass in erfolgreichen<br />
Schulsystemen ein einzelner Lehrer gar nicht die Möglichkeit<br />
habe, den Schüler eine Klasse wie<strong>der</strong>holen zu<br />
lassen. Sitzenbleiben sei ein mentales deutsches Muster.<br />
Lehrer und Schule müssten Probleme lösen, darin unterstützt<br />
werden und dürften Kin<strong>der</strong> nicht abschieben<br />
o<strong>der</strong> nach unten durchreichen. Wenn in Finnland nicht<br />
relativ schnell eine systemische Verän<strong>der</strong>ung erfolgt wäre,<br />
würde man dort immer noch Gummistiefel herstellen<br />
statt Hightech. In Deutschland dagegen setze man auf<br />
lange Zeiten, um etwas zu verän<strong>der</strong>n.<br />
Marianne Demmer wies in ihrem Plädoyer gegen die<br />
deutsche Selektion darauf hin, dass die Grundschule sehr<br />
heterogen sei, aber nach IGLU im oberen Drittel liege.<br />
„Wir müssen uns an guten Beispielen, etwa <strong>der</strong> skandinavischen<br />
Staaten, orientieren. Dann können wir das<br />
deutsche Schulsystem erfolgreich weiter entwickeln und<br />
den Anschluss an europäische und weltweite Standards<br />
schaffen“, betonte die Gewerkschafterin.<br />
Paul Schwarz<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 5 / 2006