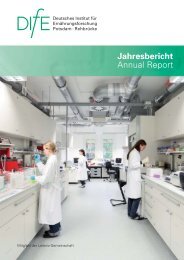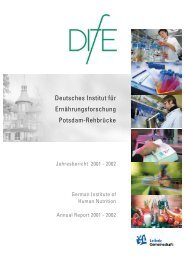BB - DIfE
BB - DIfE
BB - DIfE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10<br />
�3 Cell-surface localization of TAS2R14 in<br />
transfected HEK293 cells. The cell surface<br />
is visualized through indirect immunofluorescence<br />
for plasma membrane<br />
glycoproteins shown in red. Expression of<br />
TAS2R14 modified by an aminoterminal<br />
plasma membrane targeting motif is shown<br />
by green indirect immunofluorescence.<br />
In the overlay of both images, cell surface<br />
localization of the recombinant receptor<br />
appears in yellow. Scale bar, 10 µm.<br />
for it. During the Palaeolithic, a novel<br />
TAS2R16 allele evolved by mutation,<br />
encoding a receptor with a twofold<br />
sensitivity for frequent plant glycosides<br />
in comparison with the ancestral<br />
receptor. The derived allele was positively<br />
selected and became fixed in the<br />
genomes of the ancient population<br />
and, with the migration of humans out<br />
of Africa, spread all over the world. The<br />
only explanation for the worldwide distribution<br />
of the derived allele can be its<br />
conferral of a selective advantage to<br />
palaeolithic humans, most likely by<br />
allowing them to consume a healthier<br />
diet with a lower toxic plant glycoside<br />
content. The ancestral allele occurs<br />
with appreciable frequency only in<br />
Africa along with the distribution of<br />
known anti-malaria alleles (Fig. �4 ). It is<br />
reasonable to assume that reduced<br />
taste sensitivity for toxic cyanogenic glycosides<br />
promotes the sublethal intake<br />
of such compounds, for instance from<br />
manioc, a very common carbohydrate<br />
source in Africa, the resultant chronic<br />
cyanide poisoning leading to sickle cell<br />
anemia, a disease that protects against<br />
malarial infections. Polymorphisms in<br />
the TAS2R38 gene also underscore the<br />
importance of taste in evolution.<br />
Independent mutations in the hominoid<br />
and chimpanzee lineages generated<br />
PTC non-taster alleles. The fixation<br />
of the polymorphisms in the genomes<br />
of both lineages argues for an important<br />
role of the non-taster alleles, which possibly<br />
arose in humans because they<br />
encode receptors for yet unidentified<br />
bitter compounds. In a different context,<br />
we obtained in an association study further<br />
evidence for the impact of gustation<br />
on intake behavior, which showed<br />
that carriers of the ancestral TAS2R16<br />
allele are at increased risk for alcohol<br />
dependence. Together, our data support<br />
the idea that taste receptor genes influence<br />
human nutrition and health.<br />
�4 Geographical distribution of the<br />
ancestral TAS2R16 allele.<br />
�3 Zelloberflächenexpression von TAS2R14 in transfizierten HEK293 Zellen. Die Zelloberfläche<br />
ist durch die indirekte Immunfluoreszenz der Glykokalix in rot dargestellt. Die Expression des mit<br />
einer Zielsteuerungssequenz modifizierten TAS2R14 ist durch indirekte grüne Immunfluoreszenz<br />
nachgewiesen. Die Überlagerung der Fluoreszenzsignale erscheint gelb und zeigt die<br />
Oberflächenexpression des Rezeptors an. Maßstab, 10 µm.<br />
freisetzende Glykoside einen erhöhten<br />
Konsum dieser giftigen Stoffe bewirken<br />
könnte, beispielsweise durch den Verzehr<br />
des in Afrika weitverbreiteten Manioks.<br />
Eine sich daraus entwickelnde chronische<br />
Zyanidvergiftung führt zur Sichelzellanämie<br />
und damit zu einem wirksamen<br />
Schutz vor tödlich verlaufenden Malariainfektionen.<br />
Auch die Polymorphismen<br />
im TAS2R38-Gen unterstreichen die Bedeutung<br />
des Geschmacks für die phylogenetische<br />
Entwicklung. Voneinander<br />
unabhängige Mutationen in der menschlichen<br />
Abstammungslinie und der von<br />
Schimpansen brachten sogenannte PTC-<br />
Nichtschmecker-Allele hervor. Die Fixierung<br />
im Genom beider Arten spricht<br />
für eine wichtige Funktion der Nichtschmecker-Allele,<br />
die im Menschen wahrscheinlich<br />
dadurch zustande kommt,<br />
dass sie Rezeptoren für bislang unbekannte<br />
Bitterstoffe kodieren. Unabhängig<br />
von diesen Ergebnissen weist eine Assoziationsstudie<br />
auf die Bedeutung des<br />
Geschmacks für das Konsumverhalten<br />
hin. Sie zeigt, dass Menschen mit dem<br />
�4 Geographische Häufigkeitsverteilung des Ur-TAS2R16-Allels.<br />
unempfindlichen Ur-TAS2R16-Allel ein<br />
erhöhtes Risiko haben, alkoholabhängig<br />
zu werden. Zusammengefasst unterstützen<br />
unsere Befunde die Vermutung, dass<br />
Geschmacksrezeptorgene unsere Ernährung<br />
und Gesundheit beeinflussen.<br />
Mechanismen der<br />
Süßgeschmackswahrnehmung<br />
Bernd Bufe, Marcel Winnig<br />
Im Gegensatz zum Bittergeschmack wird<br />
der Süßgeschmack durch nur ein Rezeptormolekül<br />
vermittelt. Dieser Rezeptor,<br />
ein Heterodimer aus zwei Polypeptiden,<br />
TAS1R2 und TAS1R3, muss demzufolge<br />
durch die bekannten, strukturell sehr unterschiedlichen<br />
Süßstoffe aktiviert werden<br />
und daher über multiple Bindungsstellen<br />
verfügen. Bei der Untersuchung dieser<br />
Bindungstellen konnten wir zwei Aminosäuren<br />
in der Transmembranregion V<br />
vom TAS1R3 identifizieren, die anscheinend<br />
für die unterschiedliche Wahrnehmung<br />
von Süßstoffen in verschiedenen