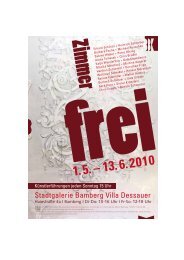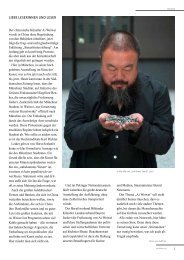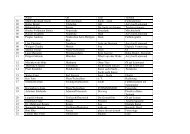1 Ausstellung des BBK Landesverband Bayern München, Balanstr ...
1 Ausstellung des BBK Landesverband Bayern München, Balanstr ...
1 Ausstellung des BBK Landesverband Bayern München, Balanstr ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
die ersten jahre der Professionalität 28<br />
Judith Goldschmid | Margarete Hentze | Gordon Hogan | Peggy Meinfelder | Andreas Mitterer | Emilia Scharfe | Rose Stach<br />
Galerie der Künstler <strong>München</strong>, 22. April bis 15. Mai 2009<br />
Zum 28. Mal zeigt die Galerie der Künstler<br />
Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die<br />
ihre Ausbildung noch nicht länger als 7 Jahre<br />
abgeschlossen haben. Die <strong>Ausstellung</strong> gehört<br />
längst zu einem anerkannten und beachteten<br />
Mittel der künstlerischen Nachwuchsförderung<br />
und ist ein Forum zeitgenössischer Auseinandersetzungen.<br />
Die Auswahl wird nach Kriterien der<br />
künstlerischen Qualität und Individualität<br />
getroffen. Es geht nicht um ein thematisches<br />
Konzept, sondern um zeitgenössische Positionen<br />
<strong>des</strong> künstlerischen Ausdrucks. So wird<br />
auch in diesem Jahr wieder das Spektrum<br />
zwischen Malerei und Zeichnung, Fotografie<br />
und Video, Objekt und Installation abgedeckt<br />
und so eine erfrischende und abwechslungsreiche<br />
Präsentation geschaffen.<br />
In einem Kokon, welcher der Form einer<br />
Matrioschka entspricht, befindet sich eine<br />
Öffnung. Sie ist genau so groß, dass eine erwachsene<br />
Person in die Form hinein steigen<br />
kann und darin Platz findet. Der Besucher<br />
kann sich bei der Künstlerin unter info@<br />
margaretehentze.de anmelden, wenn er sich<br />
dem Wagnis aussetzen möchte, in eine einerseits<br />
klaustrophobisch wirkende, andererseits<br />
schützende Hülle einzutreten. Man darf gespannt<br />
sein, welche Assoziationen an geborgene<br />
oder Angst erregende Erlebnisse erweckt<br />
werden. Margarete Hentze provoziert<br />
in ihren Arbeiten einen Dialog zwischen<br />
Werk und Betrachter und lädt zur direkten<br />
Mitwirkung ein.<br />
Die Straßenschilder in Irland sind in<br />
schwarzen Piktogrammen auf gelbem Hintergrund<br />
gehalten. Gordon Hogan kennt sie<br />
seit seiner Kindheit. Er verändert in der auf<br />
Papierbahnen installierten Reihe „Signs of<br />
an Omnidimensional Being“ die Zeichen<br />
durch schwarzes Gaffa-Tape, fügt neue<br />
Zeichen hinzu und schafft so die eigentliche<br />
Logik hintergehende, poetisierende Umdeutungen.<br />
Ebenso wird in der Installation „Pla-<br />
net Soil“ von 2008 – dem Modell einer baptistischen<br />
Kirche auf einem zwei Meter hohen<br />
Gerüst stehend – der Blickwinkel so verändert,<br />
dass sich neue Sehweisen ergeben.<br />
Schaut man unter die Oberfläche der rein anmutenden<br />
Kirche, zeigt ein Video Hogans<br />
Vorstellung <strong>des</strong> Höllenfeuers.<br />
Peggy Meinfelder beschäftigt die Frage,<br />
wie man seiner eigenen Geschichte, dem tatsächlich<br />
Geschehen und historisch Vermittelten<br />
habhaft werden kann und wie deren<br />
Vermittlung stattfindet. Dies realisiert sie in<br />
der vereinfachten, entsubjektivierten Übertragungstechnik<br />
<strong>des</strong> wissenschaftlichen<br />
Zeichnens, die Abbildungsqualität zu garantieren<br />
scheint. Teilweise erfundene oder<br />
selbst in ihrer Kindheit erhaltene Symbole,<br />
Orden und Abzeichen der ehemaligen DDR<br />
und Sowjetunion werden so in der Arbeit<br />
Abzeichen Punkt für Punkt festgehalten und<br />
erinnert. In der Reihe „shake hands“ nimmt<br />
sie vergangene, populäre Medienbilder zum<br />
Anlass, um deren Authentizität zu hintergehen<br />
und subjektiv umzuschreiben. Die historischen<br />
Zusammenhänge der Archivierung,<br />
wissenschaftlichen Konstruktion und kollektiven<br />
Erinnerung ergeben so ein trügerisches<br />
Geschichtsbild.<br />
Andreas Mitterer versucht in seiner Malerei<br />
komplexe Strukturen, die an Wege oder<br />
Ebenen erinnern bildlich zu fassen. In seinen<br />
raumbezogenen Arbeiten geht es ihm um die<br />
Möglichkeiten <strong>des</strong> Ortes. Bei<strong>des</strong> verknüpft<br />
sich assoziativ. In der Arbeit „Volumen 1 und<br />
2 (Mini-Territorien)“, welche eigens für die<br />
Galerie der Künstler entstand, bilden abstrakte<br />
Linienbilder aus Klebebändern auf<br />
Alu oder Hartfaserplatten in ihren vielschichtigen<br />
Überlagerungen eine vermeintlich<br />
räumliche Struktur. Sie werden in ihrer<br />
räumlichen Fortsetzung in Form von halbtransparenten<br />
Wandsegmenten präsentiert.<br />
Demgegenüber steht, in die Ecke gerückt,<br />
eine Art Bauhütte. Ein Kiosk, welcher Skizzen,<br />
einzelne Einflüsse Mitterers, Neben-<br />
<strong>BBK</strong> <strong>München</strong> und Oberbayern<br />
schauplätze, Collagen und Modelle beinhaltet.<br />
Emilia Scharfe installiert in die Galerie<br />
der Künstler ein Fries aus Zeichnungen. In<br />
der Reihe „L'odyssee de la vie“, die 2008 und<br />
2009 während Scharfes Aufenthalt in Paris<br />
entstand, werden in Fineliner und Gouache<br />
auf französischen Briefumschlägen immer<br />
leicht veränderte Variationen ähnlicher Motive<br />
wiederholt. Sie zeigen eine weibliche,<br />
comicartige Figur, amorphe Formen, die an<br />
Amöben oder Zellen erinnern, eine ähnliche,<br />
gedeckte Farbgebung und eine immer wieder<br />
auftauchende, verbindende Horizontlinie. Eine<br />
große, aufblasbare, „beatmete“ Figur, die<br />
ebenso an ein Motiv der Zeichenserie erinnert,<br />
steht raumgreifend daneben. In der<br />
ständigen Wiederholung und dem Rhythmus<br />
ähnlicher Elemente werden Assoziationen zu<br />
biologischen oder historischen Vorgängen<br />
geweckt.<br />
Die Installation „weg von hier“ von Rose<br />
Stach, welche aus einem Bildschirm und<br />
einem davor gesetzten Spiegeltrichter besteht,<br />
lädt zu einem besonderen Ausblick ein.<br />
Der darin abgespielte Film zeigt weiße Straßenmarkierungen,<br />
welche in einer verwirrenden<br />
Abfolge die eigentliche Bedeutung<br />
der Abgrenzung eines Wegran<strong>des</strong> ins Absurde<br />
umkehren. Der Titel ist Kafkas Erzählung<br />
„Der Aufbruch“ entlehnt. Und auch in „Rotor“<br />
geht es um Verunsicherung und den Verlust<br />
von Orientierung. In der Installation<br />
„Neverland“ versieht Stach weiß-rote Absperrbänder<br />
mit der Aufschrift „borderline<br />
do not cross“ und verteilt sie so im Raum, als<br />
seien sie die Überreste eines Tatorts. Die<br />
Aufschrift aber überträgt die real vorfindbare<br />
auf eine psychische Grenzsituation. Der<br />
Titel verweist auf einen sehnsüchtigen Ausweg:<br />
Die fiktionale Insel Neverland, die als<br />
Ort und Metapher für ewige Kindheit, Ungebundenheit<br />
und damit auch Rebellion steht.<br />
Achim Sauter<br />
im Bilde 2/09 5