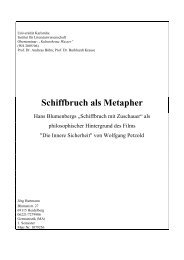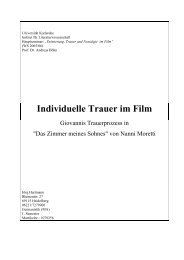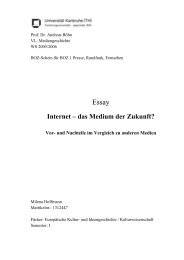Zyklisch-serielle Narration. Johann Wolfgang von Goethes
Zyklisch-serielle Narration. Johann Wolfgang von Goethes
Zyklisch-serielle Narration. Johann Wolfgang von Goethes
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Johann</strong> <strong>Wolfgang</strong> <strong>von</strong> Goethe: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten<br />
‚Märchens’ ist symbolisch und bildhaft; orientalische und christlich-abendländische Symbolik<br />
vermischen sich hier. 23 Zum Erzählstil des ‚Märchens’ schreibt Erich Trunz:<br />
„Mit den ersten Worten sind wir in einer fremden Welt, die beschrieben wird, als sei sie bekannt: der Fluß, der<br />
Fährmann usw.; sie ist so selbstverständlich da wie die Welt eines Traums, wenn wir schlafen. Es gibt Geister,<br />
Menschen, Tiere, Pflanzen und anorganische Gegenstände; sie alle zusammen machen die Welt des Märchens<br />
aus.“ 24<br />
Ein zentrales Motiv des ‚Märchens’ ist die Schlange, welche sich am Ende der Erzählung für die<br />
Allgemeinheit aufopfert und als eine Brücke die zwei zuvor getrennten Ufer eines Flusses<br />
miteinander verbindet. Diese Brücke, mittels derer „[…] die nachbarlichen Ufer erst zu Ländern<br />
belebt und verbunden werden“ (238), wurde in den zeitgenössischen Interpretationen häufig als<br />
eine politische Anspielung auf die beiden durch die Revolutionsereignisse entzweiten<br />
Nachbarländer Frankreich und Deutschland gedeutet. Mit der Beschreibung eines<br />
Weltzustandes, in welchem das gegenseitige Helfen und die uneigennützige Aufopferung des<br />
Einzelnen für die Allgemeinheit eine zentrale Rolle spielen, steht am Schluß des ‚Märchens’ der<br />
Entwurf einer Gesellschaftsutopie: Die anfangs chaotische und desolate Welt des ‚Märchens’<br />
findet durch das Opfer des Einzelnen für die Allgemeinheit zu einer neuen Ordnung.<br />
Mit dem ‚Märchen’ ist in <strong>Goethes</strong> Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten die letzte und<br />
höchste Stufe des Erzählens erreicht. Die Binnenerzählungen führen auf diese Weise weg <strong>von</strong><br />
den aktuellen politischen Themen, über allgemeine Überlegungen zu sittlich-moralischen Fragen<br />
bis hin zu dem Entwurf einer (weitgehend abstrakten) Gesellschaftsutopie. Inwiefern das<br />
Geschichtenerzählen in den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten damit ein Ausweichen vor den<br />
aktuellen Zeitproblemen darstellt oder vielmehr im ‚Märchen’, in der Sprache der Kunst, eine<br />
Antwort auf die politischen Fragestellungen der Zeit gefunden wird, bleibt dem Leser selbst<br />
überlassen. 25<br />
23 So ist beispielsweise in <strong>Goethes</strong> ‚Märchen’ die Schlange nicht wie in der Bibel ein Symbol der Verführung,<br />
sondern ein Symbol der uneigennützigen Aufopferungsbereitschaft. Ein weiteres wichtiges Motiv ist das Licht,<br />
welches hier als das Symbol der Aufklärung gelten kann. Vgl.: Carl Niekerk: Kap. Das Märchen im Kontext der<br />
‚Unterhaltungen’. In: ders.: Bildungskrisen. Die Frage nach dem Subjekt in <strong>Goethes</strong> „Unterhaltungen deutscher<br />
Ausgewanderten“, Tübingen 1995, S. 135 – 152, S. 137f.<br />
24 Erich Trunz: Nachwort zu den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. In: Goethe: Werke, Bd. 6, S. 611 – 623,<br />
S. 620.<br />
25 Bei Erich Trunz heißt es dazu: „Das Geschichten-Erzählen, zu dem die Baronin und der Alte die jungen<br />
Leute hinführen, scheint zunächst ein Ausweichen vor den Zeitproblemen zu sein. Aber in Wirklichkeit ist es nur ein<br />
Ablenken <strong>von</strong> der Oberfläche, den politischen Zänkereien, und ein Hinführen zu den tieferen Fragen der Gesinnung<br />
und Gesittung.“ Ebd., S. 612.<br />
16