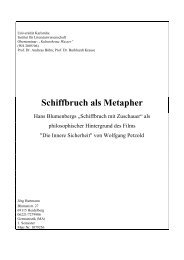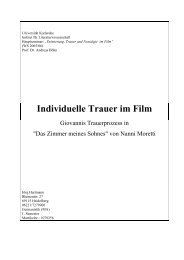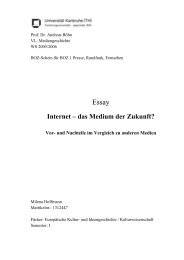Zyklisch-serielle Narration. Johann Wolfgang von Goethes
Zyklisch-serielle Narration. Johann Wolfgang von Goethes
Zyklisch-serielle Narration. Johann Wolfgang von Goethes
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Johann</strong> <strong>Wolfgang</strong> <strong>von</strong> Goethe: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten<br />
3.4 Die potentielle Unendlichkeit des Textes<br />
Eine Besonderheit des zyklisch-<strong>serielle</strong>n Erzählens in <strong>Goethes</strong> Unterhaltungen deutscher<br />
Ausgewanderten ist schließlich auch die offene Form der Rahmenerzählung und damit<br />
einhergehend die potentielle ‚Unendlichkeit’ des Textes. Im Gegensatz zu Erzählzyklen wie dem<br />
Il Decamerone Giovanni di Boccaccios, im welchem die Erzähl-Gesellschaft am zehnten Tag<br />
beschließt, das Landgut, auf welches man sich zurückgezogen hatte zu verlassen und nach<br />
Florenz zurückzukehren (und das gesellschaftliche Erzählen somit räumlich – auf das Landgut –<br />
und zeitlich – auf zehn Tage – begrenzt ist), ist die Rahmenhandlung der Unterhaltungen deutscher<br />
Ausgewanderten nicht abgeschlossen; der gesamte Text bricht mit dem ‚Märchen’ als der letzten<br />
Binnenerzählung ab. Durch diese prinzipielle Offenheit der Rahmenhandlung könnten nun<br />
jedoch beliebig viele weitere Binnenerzählungen an den Text ‚angehängt’ werden, der Text wird<br />
dadurch – zumindest als Möglichkeit – ‚unendlich’.<br />
Auf eine derartige ‚potentielle Unendlichkeit’ des Textes hat bereits Goethe selbst<br />
verwiesen; so schreibt er in einem Brief an Schiller: „‚Das Märchen’. Ich würde die<br />
‚Unterhaltungen’ damit schließen, und es würde vielleicht nicht übel sein, wenn sie durch ein<br />
Produkt der Einbildungskraft gleichsam ins Unendliche ausliefen.“ 38 Der Gedanke des<br />
‚Unendlichen’ bzw. auch des ‚Unvollendeten’ spielt in <strong>Goethes</strong> Dichtung schließlich insgesamt<br />
eine wichtige Rolle: So hat Goethe einerseits zahlreiche Dichtungsfragmente hinterlassen (und<br />
auch der Erzählzyklus Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten ist in diesem Sinne eigentlich ein<br />
‚unvollendetes’ Fragment, dessen geplante Fortsetzung nie ausgeführt wurde); andererseits wird<br />
der Gedanke der ‚Unabgeschlossenheit’ bzw. der ‚Unvollendung’ bei Goethe auch zu einem<br />
zentralen Prinzip des zyklisch-<strong>serielle</strong>n Erzählens. Die Form der Rahmenerzählung spiegelt hier<br />
eine prinzipielle ‚Offenheit’ des Textes wieder und ermöglicht damit auch ein ‚Über-Sich-<br />
Hinausweisen’ des einzelnen Textes. Erhard Marz schreibt dazu:<br />
„Der für den Dichter charakteristische evolutionistische Schaffensprozeß ist – wie seine Vorliebe für die<br />
Zyklustechnik – Ausdruck der tiefen inneren Überzeugung, daß jedes vollendete Einzelne begrenzt ist und sich<br />
letztlich nur als Teil eines umfassenden Unvollendeten begreifen läßt. Um den Gedanken der Unvollendung<br />
konkret Gestalt werden zu lassen, bedient sich Goethe der offenen Form der Rahmenerzählung.“ 39<br />
38 Goethe an Schiller, 17. August 1795. In: Goethe: Werke, Bd. 6, S. 606.<br />
39 Marz: <strong>Goethes</strong> Rahmenerzählungen, S. 11.<br />
24