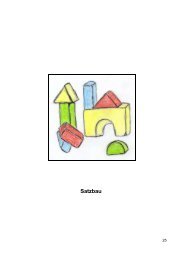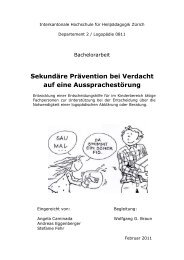Prävalenz-Forschung: Zusammenfassung der Datenlage - HfH ...
Prävalenz-Forschung: Zusammenfassung der Datenlage - HfH ...
Prävalenz-Forschung: Zusammenfassung der Datenlage - HfH ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bedarfsschlüssel Logopädie im Alter von 2 Jahren aufgrund <strong>der</strong> <strong>Prävalenz</strong>einschätzung:<br />
Anzahl Kin<strong>der</strong> pro Jahrgang x 0.15% (Betroffene) x 10 (Beratungsstunden)<br />
Ergebnisse zur <strong>Prävalenz</strong>, Zeitpunkt 36 Monate<br />
Die Frage, wie viele zweijährige Kin<strong>der</strong> als Late-talker in ihrer Entwicklung als gefährdet eingestuft<br />
werden können, wird relativ einheitlich im Sinne von 15% eines Jahrgangs beantwortet.<br />
Demgegenüber wird die Frage, welche Kin<strong>der</strong> ein Jahr später, im Alter von 3 Jahren, aufgeholt<br />
haben, bzw. welche Kin<strong>der</strong> als sprachauffällig o<strong>der</strong> therapiebedürftig eingestuft werden müssen,<br />
sehr kontrovers diskutiert. Die unterschiedlichen Sichtweisen lassen sich zu drei Positionen<br />
zusammenfassen.<br />
Erstens: Eine Reihe von Studien (Übersicht in Suchodoletz (2004, S.161f)) scheinen zu belegen,<br />
dass etwa 50% <strong>der</strong> Late-talker als late-bloomer (Aufholer bzw. „Spätzün<strong>der</strong>“), also Kin<strong>der</strong>, die von<br />
selbst auf den Entwicklungsstand kommen, aufholen ohne dass eine Intervention notwendig wäre.<br />
Hiervon ausgehend, ist eine <strong>Prävalenz</strong> von 7,5% im Alter von 3 Jahren als Minimum ableitbar.<br />
Stellvertretend sind hier die Studien von Bishop/Edmundson (1987), Rescorla 2002 und<br />
Grimm/Doil (2000) zu nennen. Die 50%-Formel als Untergrenze <strong>der</strong> <strong>Prävalenz</strong>einschätzung<br />
scheint nicht wirklich bezweifelt zu werden, wenngleich einige Studien ein noch wesentlich<br />
positiveres Bild des Aufholens zeichnen: Laut <strong>der</strong> Studie von Whitehurst/Firschel (1994) mit 22<br />
Late-talkern holten ca. 85% den Entwicklungsrückstand binnen 1.5 Jahren (bis zum Alter von 3.5<br />
Jahren) auf. Diese Zahl wird von Girolametto et al. (2001) bestätigt.<br />
Zweitens: An<strong>der</strong>e Studien (vgl. Suchodoletz 2004) legen nahe, die 50%-Einschätzung in Richtung<br />
66% zu korrigieren, d.h. dass zwei Drittel <strong>der</strong> Late-talker keine gute Prognose haben bzw. eine<br />
Sprachentwicklungsstörung entwickeln werden und professionelle Begleitung brauchen. Hiervon<br />
ausgehend, ist eine <strong>Prävalenz</strong> von 10% im Alter von 3 Jahren ableitbar. Für eine Zwei-Drittel-<br />
Formel sprechen auch die Ergebnisse von Paul et al. (1997): 40% <strong>der</strong> Late talker normalisieren<br />
sich in ihrer Entwicklung im Alter von 3 Jahren. Ebenso stellten Rescorla et al. (1997) fest, dass<br />
zwei Drittel <strong>der</strong> Late-talker von morpho-syntaktischen Problemen langfristig begleitet werden –<br />
sowohl zum Untersuchungszeitpunkt im 3. als auch im 4. Lebensjahr sind diese noch nachweisbar.<br />
Und, vielleicht noch wichtiger: Wer im 3. Lebensjahr nicht aufgeholt hat, verbessert sich auch bis<br />
zum 4. Lebensjahr nicht. In <strong>der</strong> gleichen Studie werden deutliche pragmatische Auffälligkeiten<br />
beschrieben, die im Alter von 8-9 Jahren beobachtbar sind (z.B. weniger Fragen, seltenere<br />
Antworten) und mit Sprachverständnisdefiziten im Alter von 13 Jahren einhergehen. Conti-<br />
Ramsden et al. (2001) nehmen prognostisch die extremste Position ein: Wer mit 7 Jahren als<br />
sprachentwicklungsgestört erkannt wurde, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% deutliche<br />
Sprachprobleme bis über das Jugendalter hinaus beibehalten. Auch Beitchman et al. (1996)<br />
stützen die These <strong>der</strong> schlechten Prognose durch Abwarten: Die bei 5-jährigen festgestellten<br />
Sprachstörungen (N=1655), die zur <strong>Prävalenz</strong>einschätzung von 12,6% führen, verlieren sich bis<br />
ins Erwachsenenalter nur in 25% <strong>der</strong> Fälle. Laut Hall & Tomblin (1978) klagen 50-60% <strong>der</strong><br />
Erwachsenen mit früher diagnostizierten Sprachstörungen über Sprachprobleme; diese Zahl wird<br />
von Rutter et al. (1992) bei einer Befragung von 24-jährigen bestätigt. Nach Ward (1999) schaffen<br />
lediglich 15% <strong>der</strong> Late-talker (N=122) den Sprung zu den Late-bloomern, falls eine Therapie<br />
ausbleibt. Ward (1999) zeigt zusätzlich einen ganz erheblichen Effekt durch eine frühe Therapie:<br />
Während in <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe mit Therapie nur 5% <strong>der</strong> Probanden mit<br />
Sprachentwicklungsstörungen verblieben, wurden in <strong>der</strong> Kontrollgruppe ohne Therapie 85% als<br />
sprachbeeinträchtigt eingestuft. Auch Weismer et al. (1994) plädieren für eine frühe Therapie, da<br />
bei 3 <strong>der</strong> 4 untersuchten Kin<strong>der</strong> mit einer Gefährdung (Gesamt-N=23) die Probleme fast ganz<br />
aufgehoben werden konnten. Die in den beiden vorangegangenen Abschnitten beispielhaft<br />
genannten Zahlen dokumentieren, dass die Angaben zur <strong>Prävalenz</strong> im Alter von 3 Jahren<br />
insgesamt enorm variieren: Von den ca. 15% Late-talkern des Gesamtjahrgangs <strong>der</strong> Zweijährigen<br />
entwickeln sich 15-80% zu Late-Bloomern. Diese große Spannbreite ist sehr unbefriedigend.<br />
Therapeutische Entscheidungen zwischen sinnvollem Abwarten und gezieltem Intervenieren zu<br />
fällen ist mit diesen Zahlen nahezu unmöglich. In den Metaanalysen von Law et al. (2000) und