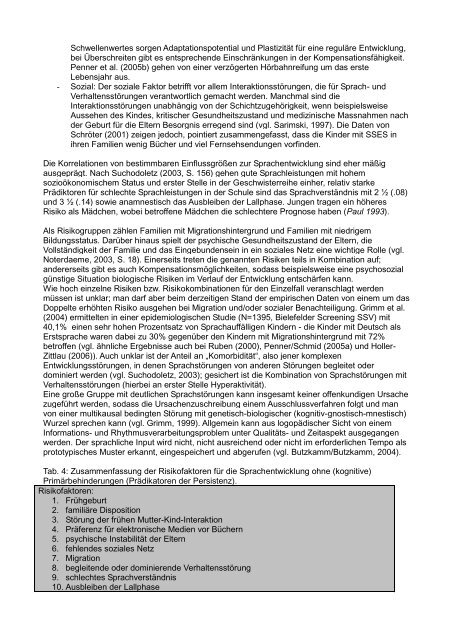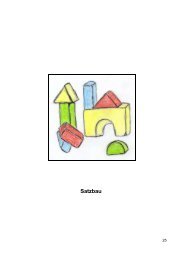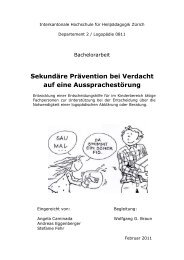Prävalenz-Forschung: Zusammenfassung der Datenlage - HfH ...
Prävalenz-Forschung: Zusammenfassung der Datenlage - HfH ...
Prävalenz-Forschung: Zusammenfassung der Datenlage - HfH ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schwellenwertes sorgen Adaptationspotential und Plastizität für eine reguläre Entwicklung,<br />
bei Überschreiten gibt es entsprechende Einschränkungen in <strong>der</strong> Kompensationsfähigkeit.<br />
Penner et al. (2005b) gehen von einer verzögerten Hörbahnreifung um das erste<br />
Lebensjahr aus.<br />
- Sozial: Der soziale Faktor betrifft vor allem Interaktionsstörungen, die für Sprach- und<br />
Verhaltensstörungen verantwortlich gemacht werden. Manchmal sind die<br />
Interaktionsstörungen unabhängig von <strong>der</strong> Schichtzugehörigkeit, wenn beispielsweise<br />
Aussehen des Kindes, kritischer Gesundheitszustand und medizinische Massnahmen nach<br />
<strong>der</strong> Geburt für die Eltern Besorgnis erregend sind (vgl. Sarimski, 1997). Die Daten von<br />
Schröter (2001) zeigen jedoch, pointiert zusammengefasst, dass die Kin<strong>der</strong> mit SSES in<br />
ihren Familien wenig Bücher und viel Fernsehsendungen vorfinden.<br />
Die Korrelationen von bestimmbaren Einflussgrößen zur Sprachentwicklung sind eher mäßig<br />
ausgeprägt. Nach Suchodoletz (2003, S. 156) gehen gute Sprachleistungen mit hohem<br />
sozioökonomischem Status und erster Stelle in <strong>der</strong> Geschwisterreihe einher, relativ starke<br />
Prädiktoren für schlechte Sprachleistungen in <strong>der</strong> Schule sind das Sprachverständnis mit 2 ½ (.08)<br />
und 3 ½ (.14) sowie anamnestisch das Ausbleiben <strong>der</strong> Lallphase. Jungen tragen ein höheres<br />
Risiko als Mädchen, wobei betroffene Mädchen die schlechtere Prognose haben (Paul 1993).<br />
Als Risikogruppen zählen Familien mit Migrationshintergrund und Familien mit niedrigem<br />
Bildungsstatus. Darüber hinaus spielt <strong>der</strong> psychische Gesundheitszustand <strong>der</strong> Eltern, die<br />
Vollständigkeit <strong>der</strong> Familie und das Eingebundensein in ein soziales Netz eine wichtige Rolle (vgl.<br />
Noterdaeme, 2003, S. 18). Einerseits treten die genannten Risiken teils in Kombination auf;<br />
an<strong>der</strong>erseits gibt es auch Kompensationsmöglichkeiten, sodass beispielsweise eine psychosozial<br />
günstige Situation biologische Risiken im Verlauf <strong>der</strong> Entwicklung entschärfen kann.<br />
Wie hoch einzelne Risiken bzw. Risikokombinationen für den Einzelfall veranschlagt werden<br />
müssen ist unklar; man darf aber beim <strong>der</strong>zeitigen Stand <strong>der</strong> empirischen Daten von einem um das<br />
Doppelte erhöhten Risiko ausgehen bei Migration und/o<strong>der</strong> sozialer Benachteiligung. Grimm et al.<br />
(2004) ermittelten in einer epidemiologischen Studie (N=1395, Bielefel<strong>der</strong> Screening SSV) mit<br />
40,1% einen sehr hohen Prozentsatz von Sprachauffälligen Kin<strong>der</strong>n - die Kin<strong>der</strong> mit Deutsch als<br />
Erstsprache waren dabei zu 30% gegenüber den Kin<strong>der</strong>n mit Migrationshintergrund mit 72%<br />
betroffen (vgl. ähnliche Ergebnisse auch bei Ruben (2000), Penner/Schmid (2005a) und Holler-<br />
Zittlau (2006)). Auch unklar ist <strong>der</strong> Anteil an „Komorbidität“, also jener komplexen<br />
Entwicklungsstörungen, in denen Sprachstörungen von an<strong>der</strong>en Störungen begleitet o<strong>der</strong><br />
dominiert werden (vgl. Suchodoletz, 2003); gesichert ist die Kombination von Sprachstörungen mit<br />
Verhaltensstörungen (hierbei an erster Stelle Hyperaktivität).<br />
Eine große Gruppe mit deutlichen Sprachstörungen kann insgesamt keiner offenkundigen Ursache<br />
zugeführt werden, sodass die Ursachenzuschreibung einem Ausschlussverfahren folgt und man<br />
von einer multikausal bedingten Störung mit genetisch-biologischer (kognitiv-gnostisch-mnestisch)<br />
Wurzel sprechen kann (vgl. Grimm, 1999). Allgemein kann aus logopädischer Sicht von einem<br />
Informations- und Rhythmusverarbeitungsproblem unter Qualitäts- und Zeitaspekt ausgegangen<br />
werden. Der sprachliche Input wird nicht, nicht ausreichend o<strong>der</strong> nicht im erfor<strong>der</strong>lichen Tempo als<br />
prototypisches Muster erkannt, eingespeichert und abgerufen (vgl. Butzkamm/Butzkamm, 2004).<br />
Tab. 4: <strong>Zusammenfassung</strong> <strong>der</strong> Risikofaktoren für die Sprachentwicklung ohne (kognitive)<br />
Primärbehin<strong>der</strong>ungen (Prädikatoren <strong>der</strong> Persistenz).<br />
Risikofaktoren:<br />
1. Frühgeburt<br />
2. familiäre Disposition<br />
3. Störung <strong>der</strong> frühen Mutter-Kind-Interaktion<br />
4. Präferenz für elektronische Medien vor Büchern<br />
5. psychische Instabilität <strong>der</strong> Eltern<br />
6. fehlendes soziales Netz<br />
7. Migration<br />
8. begleitende o<strong>der</strong> dominierende Verhaltensstörung<br />
9. schlechtes Sprachverständnis<br />
10. Ausbleiben <strong>der</strong> Lallphase