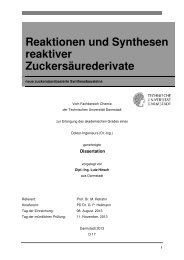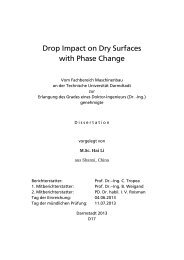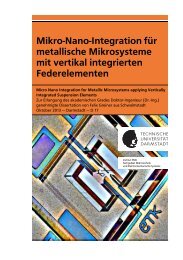Download (1908Kb) - tuprints - Technische Universität Darmstadt
Download (1908Kb) - tuprints - Technische Universität Darmstadt
Download (1908Kb) - tuprints - Technische Universität Darmstadt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Nachfragespitzen im ÖPNV treten im Allgemeinen am Vormittag und am Nachmittag auf, häufig<br />
ist auch eine weitere Nachfragespitze am Mittag zu beobachten. In der Spitzenzeit am Vormittag<br />
werden üblicherweise überwiegend Fahrten zur Arbeit und zur Ausbildung (vor allem durch<br />
Schüler) durchgeführt; am Nachmittag dominieren in der Regel die Fahrten von der Arbeit und<br />
Fahrten mit dem Zweck Freizeit. Treten Nachfragespitzen am Mittag auf, werden diese vor allem<br />
durch Fahrten von der Schule verursacht. Fahrten mit dem Zweck Einkauf und sonstige private<br />
Erledigungen sind zwar von Bedeutung für die Gesamtnachfrage, tragen aber nur in geringem<br />
Maße zur Entstehung der hohen Nachfrage in den Spitzenzeiten bei.<br />
Entwicklung der tageszeitlichen Nachfrageverteilung<br />
Offensichtlich lösen sich kollektive Zeitstrukturen hin zu individuellen Zeitstrukturen auf. Die<br />
allgemeine Entwicklung der tageszeitlichen Verteilung der Verkehrsnachfrage der letzten Jahre<br />
wird, auf der Grundlage empirischer Befunde, folgendermaßen beschrieben: „unterproportionale<br />
Zunahme der Spitzenbelastungen (Abflachen der Verkehrsspitzen), Ausdehnung der Verkehrsspitzen<br />
(vor allem in die späteren Nachmittags- und Abendstunden) sowie Zunahme in den zuvor<br />
verkehrsschwächeren Zeiten (Auffüllen der Täler)“ 6 .<br />
Der Trend zum Ausgleich der Tagesganglinie kann anhand eines Vergleichs der Anteile der Wege in<br />
den Hauptverkehrszeiten (6:00 – 8:30 Uhr, 16:00 – 18:30 Uhr) nach den KONTIV (Kontinuierliche<br />
Erhebungen zum Verkehrsverhalten) 1976, 1982 und 1989 sowie nach MiD (Mobilität in<br />
Deutschland) 2002 belegt werden (Bild 2). 7<br />
Anteil der Wege<br />
in den<br />
Hauptverkehrszeiten<br />
KONTIV 1976 38,5%<br />
KONTIV 1982 38,3%<br />
KONTIV 1989 37,6%<br />
MiD 2002 32,8%<br />
Bild 2: Anteile der Wege in den Hauptverkehrszeiten (6:00 – 8:30 Uhr, 16:00 – 18:30 Uhr)<br />
an allen Wegen 1976-2002 8<br />
SCHEINER nennt für diese Entwicklung die folgenden Gründe: „Die Veränderungen sind auf<br />
mehrere Entwicklungen zurückzuführen. Sie zeigen einerseits den ökonomischen Strukturwandel<br />
zu Gunsten des tertiären Sektors auf Kosten der stärker reglementierten Arbeitszeiten in der<br />
Produktion. Zum anderen wird darin die Flexibilisierung der Arbeits- und Betriebszeiten insgesamt<br />
und insbesondere innerhalb des tertiären Sektors deutlich (Gleitzeit, längere Ladenöffnungszeiten).<br />
Drittens sind die Auswirkungen der demographischen Alterung zu erkennen. Viertens schließlich<br />
können hier auch strukturelle Veränderungen der Freizeit zum Ausdruck kommen, die für die<br />
Verschiebung des Abbaus in den Abendstunden verantwortlich sein mögen.“ 9<br />
6 FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) (2006b).<br />
7 Scheiner (2006).<br />
8 Der Einfluss methodischer Unterschiede zwischen den Erhebungen kann vernachlässigt werden.<br />
9 Scheiner (2006).<br />
2 Beeinflussung der Zeitwahl von ÖPNV-Nutzern