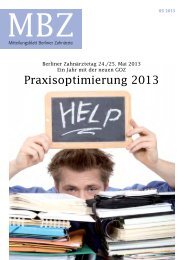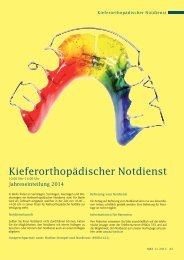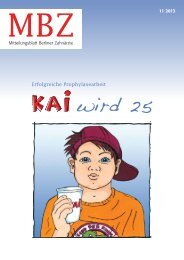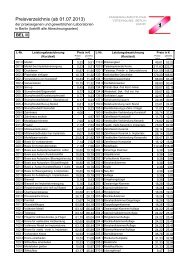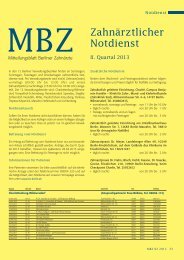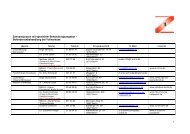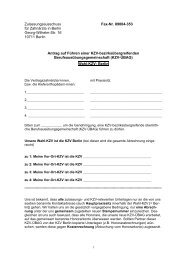MBZ Ausgabe 02/2013 - Zahnärztekammer Berlin
MBZ Ausgabe 02/2013 - Zahnärztekammer Berlin
MBZ Ausgabe 02/2013 - Zahnärztekammer Berlin
- TAGS
- berlin
- www.kzv-berlin.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
heidnischen Mark. Nicht nur die Mutterkirche<br />
in Magdeburg, auch Havelberg<br />
und Brandenburg besaßen Konvente<br />
der Prämon stratenser-Chorherren. Diese<br />
Priester mit Ordensgelübde leben als<br />
Regularkanoniker in einer Gemeinschaft;<br />
sie sind keine Mönche, legen aber das<br />
Armuts-, Enthaltsamkeits- und Gehorsamsgelübde<br />
ab und folgen der Augustinus-Regel.<br />
Jerichow<br />
Das reinste Zeugnis früher märkischer<br />
Prämonstratenser-Architektur, das erhalten<br />
blieb, ist die Klosterkirche St. Marien<br />
und St. Nicolai in Jerichow. Damit komme<br />
ich nach der etwas längeren kulturhistorischen<br />
Einführung zu unserem ersten<br />
Besichtigungsort, wo eine kundige<br />
Führerin wartete, um uns Kloster und<br />
Kirche zu zeigen und zu erläutern.<br />
1144 vom Grafen von Stade gegründet<br />
und von König Konrad III., dem ersten<br />
Staufer auf dem Thron, Nachfolger von<br />
Lothar III., bestätigt, entstand im Laufe<br />
des 12. und 13. Jahrhunderts in mehreren<br />
Bauabschnitten eine romanische<br />
Klosteranlage mit Basilika, Klausur, Wirtschaftsgebäuden<br />
und Umfassungsmauer.<br />
Die Kirche entspricht als dreischiffige<br />
Basilika mit Querschiff und Vierung, Chor<br />
und Apsis, und mit zwei – allerdings gotisch<br />
vollendeten – Westtürmen einem<br />
St. Marien und St. Nicolai in Jerichow<br />
weit verbreiteten Kirchenbautyp<br />
dieser Epoche. Die zweischiffige,<br />
hohe Krypta hingegen,<br />
die den Chorraum stark<br />
anhebt, ist eine Besonderheit.<br />
Das gilt auch für die flache<br />
Holzdecke, die vielerorts einer<br />
Einwölbung weichen musste.<br />
Nach der Reformation löste<br />
sich das Stift auf, unterschiedlichste<br />
Nutzungen<br />
und Plünderungen führten<br />
zum allmählichen Verfall, bis<br />
schließlich Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
König Friedrich Wilhelm<br />
IV. durch Ferdinand von<br />
Quast eine stilgerechte Restaurierung<br />
durchführen ließ,<br />
der dann weitere Sanierungen<br />
folgten.<br />
Von Westen her eintretend, erschließt<br />
sich das einzigartige Raumerlebnis romanischer<br />
Sakralarchitektur: Mächtige<br />
gemauerte Rundpfeiler mit Würfelkapitellen<br />
tragen die Arkaden des Mittelschiffs,<br />
über der Krypta erhebt sich der<br />
Chorraum, die Klarheit und Strenge der<br />
Architektur stimmt feierlich. Ein besonderer<br />
Eindruck aber entsteht durch das<br />
verwendete Material und seine Farbe, es<br />
ist roter Backstein. Er bildet den Kontrast<br />
zu den hellen Kämpferplatten aus Haustein<br />
und zum weißen Verputz der Laibungen<br />
und Blenden.<br />
Im Innenhof des Kreuzgangs<br />
Ziegelsteine<br />
Panorama<br />
Ziegelsteine sind uralte Bauelemente.<br />
Sie werden aus tonhaltigem Lehm geformt<br />
und gebrannt, je nach Tongehalt<br />
bei 900 bis 1.200 Grad. Die ältesten<br />
Ziegel fand man in Jericho. In Mesopotamien<br />
entwickelte man den Glasurbrand<br />
(z. B. Ischtar-Tor aus Babylon), die Meister<br />
im Ziegelbau aber waren die Römer,<br />
die diese Technik im gesamten Reich<br />
verbreiteten. Die römischen Ziegel sind<br />
dünn und elegant, Paradebeispiele für<br />
römischen Backsteinbau sind die Konstantin-Basilika<br />
in Trier und die Hagia<br />
Sophia in Byzanz. Während der Völkerwanderung<br />
ging das Wissen um die Ziegelherstellung<br />
und -verwendung verloren,<br />
aber im 8. Jahrhundert entstanden<br />
wieder erste Ziegeleien. Fehlende Natursteinvorkommen,<br />
gepaart mit reichlichem<br />
Vorhandensein von Lehm in den<br />
Flussniederungen, begünstigten die rasche<br />
Verbreitung der Technik, sodass die<br />
Klosterziegeleien im 11. und 12. Jahrhundert<br />
an der Elbe aufblühten. Das<br />
„Klosterformat“ war in den einzelnen<br />
Bauschulen noch unterschiedlich, die<br />
durchschnittliche Größe war 29 x 14 x 9<br />
cm. Die Industrialisierung forderte Normen,<br />
so wurde 1872 das etwas kleinere<br />
„Reichsformat“ eingeführt, heute ist das<br />
Normalformat 24 x 11,5 x 7,1 cm, auch<br />
dieses immer noch klobiger als der feine<br />
römische Ziegel. Die Außenmauern der<br />
romanischen Backsteinbauten blieben<br />
grundsätzlich unverputzt, speziell herge-<br />
<strong>MBZ</strong> <strong>02</strong> <strong>2013</strong><br />
55