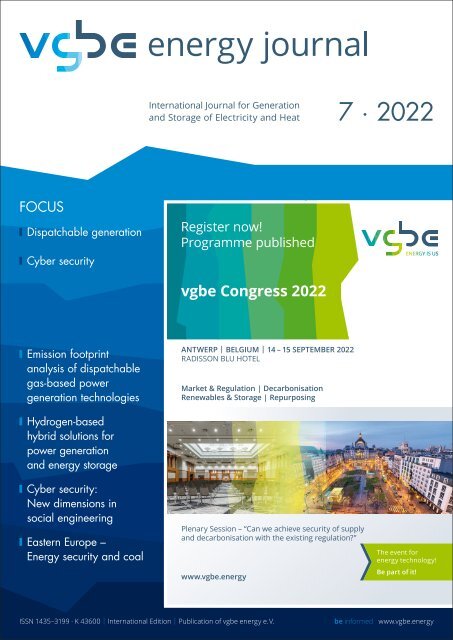vgbe energy journal 7 (2022) - International Journal for Generation and Storage of Electricity and Heat
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>International</strong> <strong>Journal</strong> <strong>for</strong> <strong>Generation</strong><br />
<strong>and</strong> <strong>Storage</strong> <strong>of</strong> <strong>Electricity</strong> <strong>and</strong> <strong>Heat</strong><br />
7 · <strong>2022</strong><br />
FOCUS<br />
Dispatchable generation<br />
Cyber security<br />
Register now!<br />
Programme published<br />
<strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong><br />
Emission footprint<br />
analysis <strong>of</strong> dispatchable<br />
gas-based power<br />
generation technologies<br />
ANTWERP | BELGIUM | 14 – 15 SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />
RADISSON BLU HOTEL<br />
Market & Regulation | Decarbonisation<br />
Renewables & <strong>Storage</strong> | Repurposing<br />
Hydrogen-based<br />
hybrid solutions <strong>for</strong><br />
power generation<br />
<strong>and</strong> <strong>energy</strong> storage<br />
Cyber security:<br />
New dimensions in<br />
social engineering<br />
Eastern Europe –<br />
Energy security <strong>and</strong> coal<br />
Plenary Session – “Can we achieve security <strong>of</strong> supply<br />
<strong>and</strong> decarbonisation with the existing regulation?”<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
The event <strong>for</strong><br />
<strong>energy</strong> technology!<br />
Be part <strong>of</strong> it!<br />
Ms Angela Langen<br />
t +49 201 8128-310<br />
e angela.langen@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
ISSN 1435–3199 · K 43600 | <strong>International</strong> Edition | Publication <strong>of</strong> <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e. V.<br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong>-congress<strong>2022</strong> StD-AD (A4).indd 1 22.08.<strong>2022</strong> 11:14:27
UMFANGREICHES KNOW-HOW FÜR DIE BRANCHE<br />
WÖRTERBUCH MIT<br />
LEXIKONCHARAKTER<br />
Dieses Wörterbuch unterstützt bei:<br />
• Der Abwicklung von Exportaufträgen, der Auswertung und<br />
Anwendung ausländischer, technischer Regelwerke und<br />
Dokumentationen sowie bei technischen Übersetzungen<br />
• Dampfturbinen, Gasturbinen, Exp<strong>and</strong>er, Verdichter,<br />
Wasserturbinen und verw<strong>and</strong>te Technologien<br />
Jetzt im<br />
Shop bestellen<br />
und Wissen sichern!<br />
www.vulkan-shop.de<br />
Heinz-Peter Schmitz<br />
1. Auflage 2020<br />
Artikelnummer: 35073<br />
Auch als eBook erhältlich.<br />
Preis: € 180,-<br />
Hochaktuell und top-relevant:<br />
Br<strong>and</strong>neu erschienen!<br />
VULKAN VERLAG. FÜR ALLE, DIE MEHR WISSEN WOLLEN.<br />
www.vulkan-verlag.de
Editorial<br />
Enlit selects Germany <strong>for</strong><br />
timely <strong>energy</strong> congress<br />
Dear readers,<br />
When Enlit Europe opens its doors at Messe Frankfurt on 29<br />
November <strong>2022</strong>, the 15,000 to 20,000 <strong>energy</strong> industry pr<strong>of</strong>essionals<br />
expected to attend will be experiencing something<br />
both new <strong>and</strong> exciting, yet somewhat familiar. They may not<br />
be unacquainted with the name “Enlit”, but the two events<br />
that coalesced to <strong>for</strong>m Enlit, POWER-GEN Europe <strong>and</strong> European<br />
Utility Week, will be well known to many, especially<br />
those from the host country, who attended POWER-GEN Europe<br />
on the numerous occasion it staged in Germany.<br />
But a large-scale conference <strong>and</strong> exhibition, bringing together,<br />
participants from one end <strong>of</strong> the <strong>energy</strong> transition to<br />
the other could not be better timed, or better located, given<br />
the unprecedented turmoil in the industry. In Germany <strong>and</strong><br />
across Europe we see a sector reeling from the <strong>energy</strong> shock<br />
while, at the same time, looking to implement ambitious EU<br />
packages like The Green Deal, Fit For 55 <strong>and</strong> REPower EU.<br />
Today’s challenges require urgent action <strong>and</strong> change on a<br />
scale that is almost <strong>of</strong>f the chart. In many countries, consumers<br />
are struggling with soaring <strong>energy</strong> bills, which are<br />
set to rise further <strong>and</strong> putting some <strong>energy</strong> companies in<br />
peril. Meanwhile, Western Europe is being held to ransom<br />
by Russian restrictions on gas flows, a hot summer is adding<br />
to dem<strong>and</strong> <strong>and</strong> drying up hydro resources, all <strong>of</strong> which is<br />
leading to some coal-fired generation being brought back on<br />
line <strong>and</strong> a serious re-think <strong>of</strong> Germany’s nuclear phase-out.<br />
These are serious issues that have to be tackled, requiring<br />
short, medium <strong>and</strong> long-term strategies that will involve<br />
European collaboration across a wide cross section <strong>of</strong> actors,<br />
including the <strong>energy</strong> suppliers, their end-customers,<br />
network operators, equipment <strong>and</strong> service providers, market<br />
associations like VGBE, regulators <strong>and</strong> governments. All<br />
these stakeholders <strong>and</strong> more will be present at Enlit Europe,<br />
making it a unique melting pot <strong>for</strong> ideas <strong>and</strong> innovation,<br />
right along the <strong>energy</strong> value chain.<br />
From source to generation, from grid to consumer, the<br />
boundaries <strong>of</strong> the sector are blurring <strong>and</strong> this evolution is<br />
being shaped by established players, external disruptors,<br />
innovative start-ups <strong>and</strong> the increasingly engaged end-user.<br />
Enlit Europe brings all <strong>of</strong> these people together to seize<br />
current opportunities, spotlight future ones, <strong>and</strong> inspire the<br />
next generation to participate in the journey.<br />
Since its launch, Enlit has been building a global community<br />
<strong>of</strong> pr<strong>of</strong>essionals engaged in aspects <strong>of</strong> the <strong>energy</strong> transition,<br />
who increasingly look to Enlit.World <strong>and</strong> its associated<br />
media titles, as a source <strong>of</strong> analysis <strong>and</strong> insights into the<br />
strategic <strong>and</strong> technological development occurring in the<br />
sector. Fresh news <strong>and</strong> analysis is delivered through websites,<br />
eNewsletters, podcasts, interviews <strong>and</strong> articles with<br />
the most recent feature being Enlit on the Road – a series<br />
that focuses on <strong>energy</strong> innovation <strong>and</strong> change occurring in<br />
a particular city <strong>of</strong> region.<br />
In Frankfurt later this year, the Enlit community will be<br />
joined by many <strong>energy</strong> experts from 29 November to 1 December,<br />
to meet <strong>and</strong> inspire each other <strong>and</strong> to develop their<br />
discussions <strong>and</strong> actions to take steps <strong>for</strong>ward in the <strong>energy</strong><br />
transition. Those three days <strong>of</strong> face-to-face interactions represent<br />
the climax <strong>of</strong> an endeavour that the Enlit community<br />
are engaged in 365-days a year – collaborating <strong>and</strong> innovating<br />
to solve the most pressing <strong>energy</strong>-related issues. It’s<br />
what makes Enlit not just any <strong>energy</strong> event.<br />
The hub theatres will be focusing on the 4 Ds <strong>of</strong> the <strong>energy</strong><br />
transition: Decarbonisation, Digitalisation, Decentralisation<br />
<strong>and</strong> Democratisation <strong>and</strong> will bring inspiring leaders <strong>and</strong><br />
experienced pr<strong>of</strong>essionals to the stage to deliver top-class<br />
presentations <strong>and</strong> panels right onto the exhibition floor.<br />
The Enlit Europe Summit promises a new <strong>and</strong> exciting<br />
conference experience. Designed as a festival <strong>of</strong> <strong>energy</strong><br />
knowledge, it showcases industry thought-leaders across<br />
three stages in totally contrasting <strong>for</strong>mats. This is where<br />
the industry’s visionaries take the debate <strong>for</strong>ward around<br />
the future direction <strong>of</strong> <strong>energy</strong> <strong>and</strong> interlinked sectors, such<br />
as transportation <strong>and</strong> heavy industry, leading the conversation<br />
when it comes to overcoming the roadblocks <strong>and</strong><br />
identifying where the sweet spots <strong>for</strong> opportunity <strong>and</strong> innovation<br />
are.<br />
The Summit will put an emphasis on the sense <strong>of</strong> urgency<br />
to accelerate the <strong>energy</strong> transition while bolstering <strong>energy</strong><br />
security. The sessions will bring you right up-to-date with<br />
the European Commission’s Action Plan, reveal sector integration<br />
in action, unpack the future <strong>of</strong> digitalisation, debate<br />
the most likely <strong>energy</strong> scenarios <strong>and</strong> much more. In summary,<br />
it’s delivering on the Enlit promise, to be the most<br />
“Inclusive guide to the <strong>energy</strong> transition”.<br />
Nigel Blackaby<br />
Content Director, Enlit Europe<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 1
Editorial<br />
Enlit <strong>2022</strong> in Deutschl<strong>and</strong><br />
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,<br />
Wenn die Enlit Europe am 29. November <strong>2022</strong> in der Messe<br />
Frankfurt ihre P<strong>for</strong>ten öffnet, werden die 15.000 bis 20.000<br />
erwarteten Fachleute der Energiebranche etwas Neues und<br />
Aufregendes, aber auch etwas Vertrautes erleben. Der Name<br />
„Enlit“ ist ihnen vielleicht nicht unbekannt, aber die beiden<br />
Veranstaltungen, die jetzt die Enlit bilden, POWER-GEN<br />
Europe und European Utility Week, werden vielen bekannt<br />
sein. Vor allem denjenigen aus dem diesjährigen Gastgeberl<strong>and</strong>,<br />
die die POWER-GEN Europe zu zahlreichen Gelegenheiten<br />
in Deutschl<strong>and</strong> besucht haben.<br />
Aber eine groß angelegte Konferenz und Ausstellung, die<br />
Teilnehmer von einem Ende der Energiewende zum <strong>and</strong>eren<br />
zusammenbringt, könnte angesichts der beispiellosen<br />
aktuellen Turbulenzen in der Branche weder zu einem besseren<br />
Zeitpunkt noch an einem besseren Ort stattfinden. In<br />
Deutschl<strong>and</strong> und ganz Europa sehen wir einen Sektor, der<br />
unter dem Energieschock leidet und gleichzeitig ehrgeizige<br />
EU-Pakete wie den Green Deal, Fit For 55 und REPower EU<br />
umsetzen will.<br />
Die heutigen Heraus<strong>for</strong>derungen er<strong>for</strong>dern dringende Maßnahmen<br />
und Veränderungen in einem Ausmaß, das fast<br />
schon unvorstellbar ist. In vielen Ländern haben die Verbraucher<br />
mit steigenden Energierechnungen zu kämpfen,<br />
die noch weiter ansteigen werden und auch Energieunternehmen<br />
in Bedrängnis bringen. Währenddessen wird Westeuropa<br />
durch russische Beschränkungen der Gaslieferungen<br />
in Atem gehalten, ein heißer Sommer erhöht die Nachfrage<br />
und beschränkt Wasserressourcen, was dazu führt, dass einige<br />
kohlebefeuerte Kraftwerke wieder in Betrieb genommen<br />
werden und der deutsche Atomausstieg politisch überdacht<br />
wird.<br />
Dies sind ernste Probleme, die angegangen werden müssen<br />
und kurz-, mittel- und langfristige Strategien er<strong>for</strong>dern, die<br />
eine europäische Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum<br />
von Akteuren, einschließlich Energieversorgern, Endkunden,<br />
Netzbetreibern, Ausrüstungs- und Dienstleistungsanbietern,<br />
Verbänden wie dem <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong>, Regulierungsbehörden<br />
und Regierungen, er<strong>for</strong>dern werden. Alle diese<br />
Akteure und noch mehr werden auf der Enlit Europe vertreten<br />
sein, was sie zu einem einzigartigen Ereignis für Ideen<br />
und Innovationen entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette<br />
macht.<br />
Von der Quelle bis zur Erzeugung, vom Netz bis zum Verbraucher<br />
überschneiden sich die Grenzen des Sektors, und<br />
diese Entwicklung wird von etablierten Akteuren, externen<br />
Disruptoren, innovativen Start-ups und den zunehmend engagierten<br />
Endverbrauchern geprägt. Enlit Europe bringt all<br />
diese Menschen zusammen, um aktuelle Chancen zu nutzen,<br />
künftige Chancen aufzuzeigen und die nächste <strong>Generation</strong><br />
zu inspirieren, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen.<br />
Seit ihrer Gründung adressiert Enlit eine globale Gemeinschaft<br />
von Fachleuten, die sich mit Aspekten der Energiewende<br />
befassen und die Enlit.World und die zugehörigen<br />
Medientitel zunehmend als Quelle für Analysen und Einblicke<br />
in die strategische und technologische Entwicklung des<br />
Sektors nutzen. Aktuelle Nachrichten und Analysen werden<br />
über Websites, eNewsletter, Podcasts, Interviews und Artikel<br />
verbreitet. Die jüngste Aktion ist „Enlit on the Road“ – eine<br />
Serie, die sich auf Energieinnovationen und Veränderungen<br />
in einer bestimmten Stadt oder Region konzentriert.<br />
In Frankfurt wird die Enlit-Gemeinschaft vom 29. November<br />
bis zum 1. Dezember <strong>2022</strong> mit zahlreichen Energieexperten<br />
zusammentreffen, um sich gegenseitig zu inspirieren und<br />
ihre Diskussionen und Aktionen zu vertiefen, mit dem Ziel,<br />
die Energiewende voranzutreiben. Diese drei Tage des persönlichen<br />
Austauschs stellen den Höhepunkt der gemeinsamen<br />
Aktivitäten dar, das die Enlit-Gemeinschaft 365 Tage<br />
im Jahr begleitet – Zusammenarbeit und Innovation zur Lösung<br />
der dringendsten Probleme in der nergieversorgung.<br />
Das ist es, was Enlit zu einer besonderen Energieveranstaltung<br />
macht.<br />
So werden sich die „Hub-Theatres“ auf die 4 Ds der Energiewende<br />
konzentrieren: Dekarbonisierung, Digitalisierung,<br />
Dezentralisierung und Demokratisierung. Sie werden<br />
Führungspersönlichkeiten und erfahrene Fachleute auf die<br />
Bühne bringen, um hochkarätige Präsentationen und Diskussionsrunden<br />
direkt in der Ausstellung zu halten.<br />
Der „Enlit Europe Summit“ verspricht ein neues und aufregendes<br />
Konferenzerlebnis. Der „Enlit Europe Summit“ ist als<br />
Event des Energiewissens konzipiert und präsentiert die Vordenker<br />
der Branche auf drei Bühnen in völlig unterschiedlichen<br />
Formaten. Hier treiben die Visionäre der Branche die<br />
Debatte über die künftige Ausrichtung der Energiebranche<br />
und damit verbundener Sektoren wie Transport und Schwerindustrie<br />
voran und führen das Gespräch, wenn es darum<br />
geht, Hindernisse zu überwinden und zu erkennen, wo die<br />
besten H<strong>and</strong>lungsoptionen und Innovationen liegen.<br />
Das Treffen wird den Schwerpunkt auf die Notwendigkeit<br />
aufzeigen, die Energiewende zu beschleunigen und gleichzeitig<br />
die Energiesicherheit zu stärken. Die Sitzungen werden<br />
Sie auf den neuesten St<strong>and</strong> des Aktionsplans der Europäischen<br />
Kommission bringen, die Integration des Sektors<br />
in der Praxis aufzeigen, die Zukunft der Digitalisierung beleuchten,<br />
die wahrscheinlichsten Energieszenarien diskutieren<br />
und vieles mehr. Zusammenfassend lässt sich sagen,<br />
dass Enlit das Versprechen einlöst, „der Leitfaden für die<br />
Energiewende“ zu sein.<br />
Nigel Blackaby<br />
Content Director, Enlit Europe<br />
2 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
<strong>vgbe</strong> Online-Seminar<br />
Basics Wasserchemie<br />
im Kraftwerk<br />
5. und 6. Oktober <strong>2022</strong><br />
Der Betrieb moderner Kraftwerksanlagen wird häufig<br />
durch chemisch bedingte Probleme im Bereich des<br />
Wasser-Dampf-Kreislaufs negativ beeinflusst. Aus diesem<br />
Grund ist es wichtig, die grundlegenden Zusammenhänge<br />
zu kennen und die chemische Fahrweise<br />
entsprechend der betrieblichen Belange einzustellen.<br />
Die Teilnehmenden sollen durch das Basisseminar<br />
„Basics Wasserchemie im Kraftwerk“ in die Lage versetzt<br />
werden, die chemischen Vorgänge in ihren Anlagen<br />
besser zu verstehen. Für die ebenso angebotenen<br />
Seminare „Wasseraufbereitung“ und „Chemie im<br />
Wasser-Dampf- Kreislauf“ dient „Basics Wasserchemie<br />
im Kraftwerk“ als hilfreiche Vorbereitung.<br />
Den Teilnehmenden wird darüber hinaus die Möglichkeit<br />
geboten, spezifische Probleme ihrer Anlagen zu<br />
diskutieren und Fragen zu stellen.<br />
Pr<strong>of</strong>itieren Sie durch Ihre Teilnahme am Seminar „Basics<br />
Wasserchemie im Kraftwerk“* von den langjährigen<br />
Erfahrungen der Mitarbeitenden der Technischen<br />
Dienste des <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong>.<br />
INFORMATIONEN | PROGRAMM | ANMELDUNG<br />
https://t1p.de/7ooby (Shortlink)<br />
KONTAKT<br />
Konstantin Blank<br />
e <strong>vgbe</strong>-wasserdampf@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
t +49 201 8128-214<br />
Foto: © depositphotos<br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> service GmbH<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
Deilbachtal 173 |<br />
45257 Essen |<br />
Deutschl<strong>and</strong>
<strong>International</strong> <strong>Journal</strong> <strong>for</strong> <strong>Generation</strong><br />
<strong>and</strong> <strong>Storage</strong> <strong>of</strong> <strong>Electricity</strong> <strong>and</strong> <strong>Heat</strong> 7 · <strong>2022</strong><br />
Enlit selects Germany <strong>for</strong> timely <strong>energy</strong> congress<br />
Enlit <strong>2022</strong> in Deutschl<strong>and</strong><br />
Nigel Blackaby 1<br />
Eastern Europe – Energy security <strong>and</strong> coal<br />
Osteuropa – Energieversorgungssicherheit und Kohle<br />
Stephen Mills 65<br />
Abstracts/Kurzfassungen6<br />
Members‘ News 8<br />
Industry News 20<br />
News from Science & Research 22<br />
Power News 34<br />
Events in brief<br />
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable<br />
gas-based power generation technologies<br />
Analyse des Emissions-Fußabdrucks von flexiblen<br />
gasbasierten Stromerzeugungstechnologien<br />
Tobias Sieker, Nils Petersen, Thomas Bexten, Manfred Wirsum,<br />
Arne Güdden, Johannes Claßen, Stefan Pischinger,<br />
Christian Lenz, Thorsten Krol <strong>and</strong> Heimo Friede 32<br />
Empowering people to act: How awareness <strong>and</strong><br />
behaviour campaigns can enable citizens to save<br />
<strong>energy</strong> during <strong>and</strong> beyond today’s <strong>energy</strong> crisis<br />
Bürger beim H<strong>and</strong>eln unterstützen: Wie Sensibilisierungsund<br />
Empfehlungskampagnen die Bürger in die Lage<br />
versetzen können, während der heutigen Energiekrise<br />
und darüber hinaus Energie zu sparen<br />
Brian Motherway, Kristina Klimovich, Emma Mooney<br />
<strong>and</strong> Céline Gelis 71<br />
Plastic replaces alloyed metal <strong>for</strong> applications<br />
in aggressive environments<br />
Kunstst<strong>of</strong>f ersetzt legiertes Metall bei Anwendungen<br />
in aggressiver Umgebung 75<br />
DIN 28177: First st<strong>and</strong>ard <strong>for</strong> structural tubes published<br />
Dimple tubes drastically shrink plant <strong>and</strong> equipment<br />
DIN 28177: Erste Norm für Strukturrohre veröffentlicht<br />
Dimple Tubes lassen Anlagen und Apparate<br />
drastisch schrumpfen<br />
Udo Hellwig 77<br />
Hydrogen-based hybrid solutions<br />
<strong>for</strong> power generation <strong>and</strong> <strong>energy</strong> storage<br />
Wasserst<strong>of</strong>fbasierte Hybridlösungen<br />
für die Energieerzeugung und Energiespeicherung<br />
Jürgen Wilkening <strong>and</strong> Jochen Lorz 48<br />
New dimensions in social engineering<br />
Künstliche Intelligenz, Darknet und OSINT im Social Engineering<br />
Stefan Loubichi 58<br />
4 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Ms Angela Langen<br />
Content<br />
<strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong><br />
Antwerp, Belgium<br />
14 to 15 September <strong>2022</strong><br />
Programme out now – check our website at www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Register now!<br />
Programme published<br />
<strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong><br />
Main Topics:<br />
Energy transition <strong>and</strong> security <strong>of</strong> supply in Europe<br />
Plenary Session “Can we achieve security <strong>of</strong> supply<br />
<strong>and</strong> decarbonisation with the existing regulation?”<br />
ANTWERP | BELGIUM | 14 – 15 SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />
RADISSON BLU HOTEL<br />
Market & Regulation | Decarbonisation<br />
Renewables & <strong>Storage</strong> | Repurposing<br />
Market & Regulation<br />
Decarbonisation<br />
Renewables & <strong>Storage</strong><br />
Repurposing<br />
Plenary Session – “Can we achieve security <strong>of</strong> supply<br />
<strong>and</strong> decarbonisation with the existing regulation?”<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
t +49 201 8128-310<br />
e angela.langen@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong>-congress<strong>2022</strong> StD-AD (A4).indd 1 22.08.<strong>2022</strong> 11:14:27<br />
Conference Report: <strong>vgbe</strong> Conference<br />
„Steam Turbines <strong>and</strong> Operation <strong>of</strong> Steam Turbines <strong>2022</strong>“<br />
Konferenzbericht: <strong>vgbe</strong> Fachtagung<br />
„Dampfturbinen<br />
und Dampfturbinenbetrieb <strong>2022</strong>“ 79<br />
Conference report: <strong>vgbe</strong> Conference<br />
„Electrical Engineering, Instrumentation & Control<br />
<strong>and</strong> In<strong>for</strong>mation Technology in the <strong>energy</strong> supply“<br />
Konferenzbericht: <strong>vgbe</strong> Konferenz „KELI <strong>2022</strong> – Konferenz<br />
Elektro-, Leit- und In<strong>for</strong>mationstechnik in der<br />
Energieversorgung“82<br />
Operating results 86<br />
<strong>vgbe</strong> Congress/<strong>vgbe</strong>-Kongress <strong>2022</strong><br />
Programme out.<br />
Register now!<br />
14 <strong>and</strong> 15 September <strong>2022</strong><br />
Radisson Blu Hotel<br />
Antwerp, Belgium<br />
For more in<strong>for</strong>mation please visit our<br />
updated website or contact us:<br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Contacts<br />
Ines Moors<br />
t +49 201 8128-222<br />
e <strong>vgbe</strong>-congress@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong> news 91<br />
| VGB PowerTech e.V. becomes <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
VGB PowerTech e.V. wird <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
| Vereinbarung Dampfkessel 014:<br />
„Beaufsichtigung von Dampfkesselanlagen“<br />
| <strong>vgbe</strong> Safety & Health Award <strong>2022</strong> –<br />
Call <strong>for</strong> nominations<br />
Angela Langen<br />
t +49 201 8128-310<br />
e angela.langen@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Personalien93<br />
Inserentenverzeichnis94<br />
Events95<br />
Imprint96<br />
Preview <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 8 | <strong>2022</strong> 96<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 5
Abstracts | Kurzfassungen<br />
Emission footprint analysis <strong>of</strong><br />
dispatchable gas-based power<br />
generation technologies<br />
Tobias Sieker, Nils Petersen,<br />
Thomas Bexten, Manfred Wirsum,<br />
Arne Güdden, Johannes Claßen,<br />
Stefan Pischinger, Christian Lenz,<br />
Thorsten Krol <strong>and</strong> Heimo Friede<br />
Despite their similarity as gas-based power generation<br />
technologies, emissions from gas turbines<br />
(GT) <strong>and</strong> gas-based reciprocating internal<br />
combustion engines (RICE) are commonly regulated<br />
independently. Thus, the present study<br />
aims to provide a comprehensive emission footprint<br />
analysis <strong>of</strong> GT <strong>and</strong> RICE power plants using<br />
an apples-to-apples metric (i.e., generated mass<br />
<strong>of</strong> a species per electrical output, g/kWhel). In<br />
the first part <strong>of</strong> the study, this metric is applied to<br />
compare GT <strong>and</strong> RICE’s current major regulatory<br />
frameworks. While the stricter NOX emission<br />
limits show that CC-GT power plants are usually<br />
more strictly regulated compared to SC-GT <strong>and</strong><br />
RICE, the CO emission limits can be classified as<br />
technology-neutral. The second part provides a<br />
comparative analysis <strong>of</strong> the emission behavior<br />
<strong>of</strong> both technologies, considering representative<br />
power plant configurations <strong>and</strong> operating<br />
regimes with emphasis on startups, part-load<br />
operation, <strong>and</strong> transient load changes.<br />
Hydrogen-based hybrid solutions <strong>for</strong><br />
power generation <strong>and</strong> <strong>energy</strong> storage<br />
Jürgen Wilkening <strong>and</strong> Jochen Lorz<br />
Renewable technologies are on the rise. As<br />
volatile <strong>energy</strong> generators, they are subject to<br />
constant, high-gradient fluctuations <strong>and</strong> are not<br />
available at all times. <strong>Storage</strong> technologies are<br />
now a common way to temporarily store electricity<br />
in order to buffer volatile generation patterns<br />
<strong>and</strong> absorb peak consumption. Hydrogen<br />
can serve as a storage medium <strong>for</strong> <strong>energy</strong> generation,<br />
but it is a carrier medium <strong>and</strong> must there<strong>for</strong>e<br />
be produced by electrolysis or other synthesis<br />
processes from other raw materials. From<br />
today’s perspective, it can be shown that the <strong>energy</strong><br />
mix <strong>of</strong> the future can be increasingly generated<br />
in a decentralised manner, despite the volatility<br />
<strong>of</strong> generation plants <strong>and</strong> fluctuations in<br />
<strong>of</strong>ftake. For this, the plants must be able to cope<br />
with a variety <strong>of</strong> possible load <strong>and</strong> generation<br />
states, <strong>for</strong> which hybrid plants appear to be particularly<br />
suitable. A groundbreaking productivity<br />
lever prior to the plant construction <strong>of</strong> a complex<br />
hybrid power plant is the s<strong>of</strong>tware-based<br />
support <strong>of</strong> the engineering processes through<br />
virtual models <strong>of</strong> plant systems, <strong>energy</strong> applications<br />
<strong>and</strong> material flows. With the help <strong>of</strong> the<br />
digital twin <strong>and</strong> process validation, <strong>energy</strong> concepts<br />
are tested, both in their functionality <strong>and</strong><br />
in their time behaviour, <strong>and</strong> process sequences<br />
are optimised even be<strong>for</strong>e realisation.<br />
New dimensions in social engineering<br />
Stefan Loubichi<br />
Social engineering is a method <strong>of</strong> obtaining<br />
security-relevant data by exploiting human<br />
behaviour. In the process, the criminal selects<br />
the person as the weak link in the security<br />
chain to put his criminal intentions into action.<br />
Criminals exploit human characteristics<br />
such as trust, helpfulness, fear, or respect <strong>for</strong><br />
authority to manipulate these people. In social<br />
engineering attacks, the focus is on the<br />
central feature <strong>of</strong> deception about the identity<br />
<strong>and</strong> intention <strong>of</strong> the attacker. Ever since<br />
life-threatening orders were issued by strangers<br />
in “deep fake” meetings during Ukraine war,<br />
or the mayor <strong>of</strong> Berlin only realised after 30<br />
minutes that she was not talking to Kyiv mayor<br />
she knew, it has become obvious that there are<br />
new <strong>for</strong>ms <strong>of</strong> “social engineering”.<br />
Eastern Europe –<br />
Energy security <strong>and</strong> coal<br />
Stephen Mills<br />
Eastern Europe has a complex history <strong>and</strong><br />
continues to be shaped by internal <strong>and</strong> external<br />
<strong>for</strong>ces. Political <strong>and</strong> economic alignments,<br />
disputes over territory <strong>and</strong> l<strong>and</strong> annexation,<br />
<strong>and</strong> split loyalties between major players such<br />
as the European Union, China <strong>and</strong> Russia are<br />
contributing factors. The Russian-Ukraine conflict<br />
highlights the fragility <strong>of</strong> <strong>energy</strong> sectors<br />
over-reliant on a single technology or heavily<br />
dependent on external sources <strong>of</strong> <strong>energy</strong>. Some<br />
eastern European countries, including several<br />
aspiring EU member states, are not able to<br />
eliminate coal power. Coal sourced from indigenous<br />
reserves or imported from a portfolio <strong>of</strong><br />
reliable outside suppliers provides some control<br />
<strong>and</strong> stability over <strong>energy</strong> costs <strong>and</strong> greater<br />
security <strong>of</strong> <strong>energy</strong> supply. Various coal power<br />
projects have been proposed or are under<br />
development in eastern Europe.<br />
Empowering people to act:<br />
How awareness <strong>and</strong> behaviour<br />
campaigns can enable citizens to<br />
save <strong>energy</strong> during <strong>and</strong> beyond<br />
today’s <strong>energy</strong> crisis<br />
Brian Motherway, Kristina Klimovich,<br />
Emma Mooney <strong>and</strong> Céline Gelis<br />
A global focus on the dem<strong>and</strong> side <strong>of</strong> the <strong>energy</strong><br />
equation has never been more important. Supply<br />
uncertainty, high prices <strong>and</strong> urgent climate<br />
targets all point to the value <strong>of</strong> <strong>energy</strong> efficiency<br />
<strong>and</strong> <strong>energy</strong> savings. Governments are responding<br />
with various measures including targeted<br />
grants <strong>and</strong> dem<strong>and</strong>-reduction campaigns.<br />
Well-designed campaigns can motivate people<br />
to reduce their <strong>energy</strong> use. Many lessons have<br />
been learned on how to design awareness <strong>and</strong><br />
behaviour change campaigns to achieve maximum<br />
effect. Four key concepts are crucial:<br />
Getting the message right. Getting the message<br />
across. Combining in<strong>for</strong>mation with behavioural<br />
insights. Campaigns <strong>for</strong> a crisis context.<br />
Plastic replaces alloyed metal <strong>for</strong><br />
applications in aggressive<br />
environments<br />
High-alloy metal has long been considered the<br />
material <strong>of</strong> choice <strong>for</strong> applications in aggressive<br />
environments such as flue gas cleaning. The fact<br />
that thermoplastics such as polyphenylene sulphide<br />
(PPS) are in no way inferior to common<br />
metals in applications under high chemical,<br />
thermal <strong>and</strong> mechanical stresses <strong>and</strong> even <strong>of</strong>fer<br />
advantages through more flexible processability<br />
is <strong>of</strong>ten overlooked. In one project, corrosion-resistant<br />
metal was completely replaced by engineering<br />
plastic in the frame system <strong>of</strong> a filter<br />
<strong>for</strong> mercury. An example <strong>of</strong> the per<strong>for</strong>mance <strong>of</strong><br />
plastic that could also be transferred to many<br />
other application areas <strong>and</strong> industries.<br />
DIN 28177: First st<strong>and</strong>ard <strong>for</strong><br />
structural tubes published<br />
Dimple tubes drastically shrink plant<br />
<strong>and</strong> equipment<br />
Udo Hellwig<br />
DIN 28177, published in February by the German<br />
Institute <strong>for</strong> St<strong>and</strong>ardisation, defines a normative<br />
st<strong>and</strong>ard <strong>for</strong> dimensions <strong>and</strong> materials<br />
<strong>of</strong> so-called dimple tubes or structural tubes <strong>for</strong><br />
heat transfer in process engineering apparatus.<br />
Such tubes made <strong>of</strong> unalloyed, alloyed or stainless<br />
steels are characterised by regular spheroidal<br />
indentations (RSE), which are created by<br />
targeted mechanical <strong>for</strong>ming. The seamless or<br />
welded tubes are particularly suitable <strong>for</strong> the<br />
production <strong>of</strong> shell-<strong>and</strong>-tube heat exchangers<br />
<strong>and</strong> <strong>for</strong> use in pressure applications.<br />
Conference Report: <strong>vgbe</strong> Conference<br />
„Steam Turbines <strong>and</strong> Operation <strong>of</strong><br />
Steam Turbines <strong>2022</strong>”<br />
With around 260 participants from Germany<br />
<strong>and</strong> abroad <strong>and</strong> an accompanying trade exhibition<br />
with 37 exhibitors, the <strong>vgbe</strong> conference<br />
„Steam Turbines <strong>and</strong> Steam Turbine Operation<br />
<strong>2022</strong>“ took place in Cologne from 14 to 15 June<br />
<strong>2022</strong>. The high number <strong>of</strong> participants <strong>and</strong> the<br />
large trade exhibition underline the importance<br />
<strong>of</strong> this <strong>vgbe</strong> conference on the one h<strong>and</strong> <strong>and</strong><br />
the great interest in an attendance event on the<br />
other. This year‘s lecture programme focused<br />
on the following topics: Repair possibilities<br />
<strong>and</strong> measures, numerical analyses <strong>and</strong> reverse<br />
engineering, retr<strong>of</strong>its <strong>and</strong> possibilities <strong>for</strong> plant<br />
optimisation, steam quality <strong>and</strong> analysis, as well<br />
as government regulations on the <strong>energy</strong> market<br />
(Grid Code, Energy Tax Act, etc.).<br />
Conference report: <strong>vgbe</strong> Conference<br />
“KELI – Electrical Engineering,<br />
Instrumentation & Control<br />
<strong>and</strong> In<strong>for</strong>mation Technology<br />
in the <strong>energy</strong> supply”<br />
Around 230 participants from Germany <strong>and</strong><br />
abroad used the KELI <strong>2022</strong> – Conference Electrical<br />
Engineering, Instrumentation & Control <strong>and</strong><br />
In<strong>for</strong>mation Technology in the <strong>energy</strong> supply as<br />
plat<strong>for</strong>m to find out about the latest KELI trends<br />
<strong>and</strong> discuss the technical challenges <strong>of</strong> current<br />
<strong>energy</strong> policy. The conference was again rounded<br />
<strong>of</strong>f by an accompanying trade exhibition with<br />
12 exhibitors from the fields <strong>of</strong> electrification,<br />
automation, drive technology, engineering<br />
s<strong>of</strong>tware, IT security, control systems <strong>and</strong> cyber<br />
security. On the two days <strong>of</strong> the conference, ten<br />
sections focused on the main actual topics <strong>of</strong><br />
electrical engineering, instrumentation & control<br />
<strong>and</strong> in<strong>for</strong>mation technology.<br />
6 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Abstracts | Kurzfassungen<br />
Analyse des Emissions-Fußabdrucks<br />
von flexiblen gasbasierten<br />
Stromerzeugungstechnologien<br />
Tobias Sieker, Nils Petersen,<br />
Thomas Bexten, Manfred Wirsum,<br />
Arne Güdden, Johannes Claßen,<br />
Stefan Pischinger, Christian Lenz,<br />
Thorsten Krol und Heimo Friede<br />
Trotz ihrer Ähnlichkeit als gasbasierte Stromerzeugungstechnologien<br />
werden die betrieblichen<br />
Emissionen von Gasturbinen (GT) und<br />
Gasmotoren (reciprocating internal combustion<br />
engines, RICE) in der Regel unabhängig vonein<strong>and</strong>er<br />
reguliert. In der vorliegenden Studie wird<br />
daher eine vergleichende Analyse des ökologischen<br />
Fußabdrucks von GT- und RICE-Kraftwerken<br />
unter Verwendung einer einheitlichen<br />
Metrik (erzeugte Masse der Emissionsspezies<br />
pro erzeugter elektrischer Arbeit in g/kWhel)<br />
vorgestellt. Im ersten Teil der Studie wird diese<br />
Metrik angewendet, um die wichtigsten Emissionsregularien<br />
für GT- und RICE-Kraftwerke zu<br />
vergleichen. Während die strengeren NOX-Emissionsregularien<br />
zeigen, dass GuD-Kraftwerke<br />
(combined cycle, CC-GT) im Vergleich zu SC-GT<br />
(single cycle, SC) und RICE in der Regel strikter<br />
reguliert werden, können die CO-Emissionsregularien<br />
als weitestgehend technologieneutral<br />
angesehen werden. Im zweiten Teil wird<br />
das Emissionsverhalten beider Technologien<br />
unter Berücksichtigung repräsentativer Kraftwerkskonfigurationen<br />
und Betriebsweisen mit<br />
Schwerpunkt auf Anfahren, Teillastbetrieb und<br />
transienten Lastwechseln untersucht.<br />
Wasserst<strong>of</strong>fbasierte Hybridlösungen<br />
für die Energieerzeugung und<br />
Energiespeicherung<br />
Jürgen Wilkening und Jochen Lorz<br />
Erneuerbare Energietechnologien sind auf dem<br />
Vormarsch. Als volatile Energieerzeuger sind sie<br />
ständigen, starken Schwankungen unterworfen<br />
und nicht jederzeit verfügbar. Speichertechnologien<br />
sind heute ein probater Weg zur Zwischenspeicherung<br />
von Strom, um schwankende<br />
Erzeugungsmuster zu puffern und Verbrauchsspitzen<br />
abzufangen. Wasserst<strong>of</strong>f kann als Speichermedium<br />
für die Energieerzeugung dienen,<br />
ist aber ein Trägermedium und muss daher<br />
durch Elektrolyse oder <strong>and</strong>ere Syntheseverfahren<br />
aus <strong>and</strong>eren Rohst<strong>of</strong>fen hergestellt werden.<br />
Aus heutiger Sicht kann gezeigt werden, dass<br />
der Energiemix der Zukunft trotz der Volatilität<br />
von Erzeugungsanlagen und schwankender<br />
Abnahme zunehmend dezentral erzeugt werden<br />
kann. Dazu müssen die Anlagen eine Vielzahl<br />
von möglichen Last- und Erzeugungszuständen<br />
bewältigen können, w<strong>of</strong>ür Hybridanlagen<br />
besonders geeignet erscheinen. Ein wegweisender<br />
Produktivitätshebel im Vorfeld des Anlagenbaus<br />
eines komplexen Hybridkraftwerks<br />
ist die s<strong>of</strong>twarebasierte Unterstützung der Engineeringprozesse<br />
durch virtuelle Modelle von<br />
Anlagensystemen, Energieanwendungen und<br />
St<strong>of</strong>fströmen. Mit Hilfe des digitalen Zwillings<br />
und der Prozessvalidierung werden Energiekonzepte<br />
sowohl in ihrer Funktionalität als auch in<br />
ihrem Zeitverhalten getestet und Prozessabläufe<br />
bereits vor der Realisierung optimiert.<br />
Künstliche Intelligenz, Darknet<br />
und OSINT im Social Engineering<br />
Stefan Loubichi<br />
Social Engineering ist eine Methode zur Erlangung<br />
sicherheitsrelevanter Daten durch Ausnutzung<br />
des menschlichen Verhaltens. Dabei<br />
sucht sich der Kriminelle die Person als schwaches<br />
Glied in der Sicherheitskette aus, um seine<br />
kriminellen Absichten in die Tat umzusetzen.<br />
Kriminelle nutzen menschliche Eigenschaften<br />
wie Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Angst oder Respekt<br />
vor Autorität aus, um diese Personen zu<br />
manipulieren. Bei Social-Engineering-Angriffen<br />
steht das zentrale Merkmal der Täuschung über<br />
die Identität und die Absichten des Angreifers<br />
im Vordergrund. Seit im Ukraine-Krieg von<br />
Fremden in „Deep Fake“-Treffen lebensbedrohliche<br />
Befehle erteilt wurden oder die Berliner<br />
Bürgermeisterin erst nach 30 Minuten merkte,<br />
dass sie nicht mit dem ihr bekannten Kiewer<br />
Bürgermeister sprach, ist klar, dass es neue Formen<br />
des „Social Engineering“ gibt.<br />
Osteuropa –<br />
Energieversorgungssicherheit<br />
und Kohle<br />
Stephen Mills<br />
Osteuropa hat eine komplexe und bewegte Geschichte<br />
und wird weiterhin von internen und<br />
externen Einflüssen geprägt. Viele Faktoren<br />
spielen eine Rolle, z.B. politische und wirtschaftliche<br />
Abhängigkeiten, Gebietsstreitigkeiten<br />
und geteilte Interessen bezüglich wichtiger<br />
Akteure wie der Europäischen Union (EU) und<br />
Russl<strong>and</strong>. Die Frage der Energiesicherheit in der<br />
Region hat nach dem Einmarsch Russl<strong>and</strong>s in<br />
die Ukraine zunehmend an Bedeutung gewonnen.<br />
Russl<strong>and</strong> ist der Hauptlieferant von Erdgas<br />
für weite Teile Europas und die darauf folgenden<br />
Unterbrechungen und Liefereinschränkungen<br />
haben die Risiken deutlich gemacht, die mit<br />
einer übermäßigen Abhängigkeit von einer einzigen<br />
externen Energiequelle verbunden sind.<br />
Viele Länder prüfen ihr Energieportfolio und<br />
versuchen, erschwingliche und nachhaltige Alternativen<br />
zu Öl, Gas und Kohle aus Russl<strong>and</strong> zu<br />
finden. Dies wird nicht einfach sein, zumindest<br />
nicht auf kurze Sicht. Länder mit einheimischen<br />
Energiereserven wie Stein- und Braunkohle<br />
werden besser in der Lage sein, diese neuen<br />
Heraus<strong>for</strong>derungen zu meistern. In vielen europäischen<br />
Ländern ist die Kohlenutzung zurückgegangen,<br />
was vor allem auf die EU-Politik und<br />
die nationalen Maßnahmen zur Förderung des<br />
verstärkten Einsatzes erneuerbarer Energien<br />
und von Erdgas sowie auf die höheren Kohlenst<strong>of</strong>fpreise<br />
im Rahmen des EU-Emissionsh<strong>and</strong>elssystems<br />
(ETS) zurückzuführen ist.<br />
Bürger beim H<strong>and</strong>eln unterstützen:<br />
Wie Sensibilisierungs- und<br />
Empfehlungskampagnen die Bürger<br />
in die Lage versetzen können,<br />
während der heutigen Energiekrise<br />
und darüber hinaus Energie zu sparen<br />
Brian Motherway, Kristina Klimovich,<br />
Emma Mooney und Céline Gelis<br />
Eine globale Konzentration auf die Nachfrageseite<br />
der Energiegleichung war noch nie so wichtig<br />
wie heute. Versorgungsunsicherheit, hohe Preise<br />
und dringende Klimaziele weisen auf den Wert<br />
von Energieeffizienz und Energieeinsparungen<br />
hin. Die Regierungen reagieren darauf mit<br />
verschiedenen Maßnahmen, darunter gezielte<br />
Zuschüsse und Kampagnen zur Nachfragereduzierung.<br />
Gut konzipierte Kampagnen können<br />
die Menschen dazu motivieren, ihren Energieverbrauch<br />
zu senken. Es wurden viele Lektionen<br />
darüber gelernt, wie man Kampagnen zur<br />
Bewusstseinsbildung und Verhaltensänderung<br />
gestaltet, um eine maximale Wirkung zu erzielen.<br />
Vier Schlüsselkonzepte sind dabei entscheidend:<br />
Die richtige Botschaft vermitteln. Vermittlung<br />
der Botschaft. Die Kombination von In<strong>for</strong>mationen<br />
mit Erkenntnissen über das Verhalten.<br />
Kampagnen für einen Krisenkontext.<br />
Kunstst<strong>of</strong>f ersetzt legiertes Metall bei<br />
Anwendungen in aggressiver<br />
Umgebung<br />
Hochlegiertes Metall galt lange als Werkst<strong>of</strong>f<br />
der Wahl für Anwendungen in aggressiven<br />
Umgebungen wie zum Beispiel in der Rauchgasreinigung.<br />
Dass Thermoplaste wie Polyphenylensulfid<br />
(PPS) bei Anwendungen unter<br />
hohen chemischen, thermischen und mechanischen<br />
Belastungen gängigen Metallen in nichts<br />
nachstehen und sogar Vorteile durch flexiblere<br />
Verarbeitbarkeit bieten, wird <strong>of</strong>t übersehen.<br />
Im Rahmen eines Projektes wurde korrosionsbeständiges<br />
Metall im Rahmensystem eines<br />
Filters für Quecksilber komplett durch technischen<br />
Kunstst<strong>of</strong>f ersetzt. Ein Beispiel für die<br />
Leistungsfähigkeit von Kunstst<strong>of</strong>f, das sich<br />
auch auf viele <strong>and</strong>ere Anwendungsbereichen<br />
und Branchen übertragen könnte.<br />
DIN 28177: Erste Norm für<br />
Strukturrohre veröffentlicht<br />
Dimple Tubes lassen Anlagen und<br />
Apparate drastisch schrumpfen<br />
Udo Hellwig<br />
Einen normativen St<strong>and</strong>ard für Maße und<br />
Werkst<strong>of</strong>fe sogenannter Dimple Tubes oder<br />
Strukturrohre zur Wärmeübertragung an verfahrenstechnischen<br />
Apparaten definiert die im<br />
Februar vom Deutschen Institut für Normung<br />
veröffentlichte DIN 28177. Solche Tubes aus<br />
unlegierten, legierten oder nichtrostenden<br />
Stählen sind durch regelmäßige spheroidische<br />
Einprägungen (RSE) gekennzeichnet, die<br />
durch gezielte mechanische Um<strong>for</strong>mung entstehen.<br />
Die nahtlosen oder geschweißten Rohre<br />
sind besonders für die Produktion von Rohrbündel-Wärmeübertragern<br />
und den Einsatz<br />
in Druckanwendungen geeignet.<br />
Konferenzbericht: <strong>vgbe</strong> Fachtagung<br />
„Dampfturbinen und<br />
Dampfturbinenbetrieb <strong>2022</strong>“<br />
Mit rund 260 Teilnehmenden aus dem In- und<br />
Ausl<strong>and</strong> und einer begleitenden Fachausstellung<br />
mit 37 Ausstellern hat die <strong>vgbe</strong> Fachtagung<br />
„Dampfturbinen und Dampfturbinenbetrieb<br />
<strong>2022</strong>“ vom 14. bis 15. Juni <strong>2022</strong> in Köln stattgefunden.<br />
Die hohe Teilnehmerzahl und die<br />
große Fachausstellung unterstreichen einerseits<br />
die Bedeutung dieser <strong>vgbe</strong>-Tagung und <strong>and</strong>ererseits<br />
das große Interesse an einer Präsenzveranstaltung.<br />
Im diesjährigen Vortragsprogramm<br />
wurden schwerpunktmäßig folgende Themen<br />
beh<strong>and</strong>elt: Inst<strong>and</strong>setzungsmöglichkeiten und<br />
-maßnahmen, Numerische Analysen und Reverse-Engineering,<br />
Retr<strong>of</strong>its und Möglichkeiten<br />
zur Anlagenoptimierung, Dampfqualität und<br />
-analytik sowie Staatliche Vorgaben am Energiemarkt<br />
(Grid Code, EnergieStG, etc.).<br />
Konferenzbericht: <strong>vgbe</strong> Konferenz<br />
„KELI <strong>2022</strong> – Konferenz Elektro-, Leitund<br />
In<strong>for</strong>mationstechnik in der<br />
Energieversorgung“<br />
Rund 230 Teilnehmer aus dem In- und Ausl<strong>and</strong><br />
haben die KELI <strong>2022</strong> – Konferenz Elektro-, Leitund<br />
In<strong>for</strong>mationstechnik in der Energieversorgung<br />
des <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> als Platt<strong>for</strong>m genutzt, um<br />
sich über die neuesten Trends zu in<strong>for</strong>mieren<br />
und die technischen Heraus<strong>for</strong>derungen der<br />
aktuellen Energiepolitik zu diskutieren. Die<br />
Konferenz wurde wieder durch eine begleitende<br />
Fachausstellung mit 12 Ausstellern aus den<br />
Bereichen Elektrifizierung, Automation, Antriebstechnik,<br />
Engineering-S<strong>of</strong>tware, IT-Sicherheitslösungen,<br />
Leittechniksystemen und Cybersicherheit<br />
abgerundet.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 7
Members’ News<br />
Members´<br />
News<br />
EEW: Ohne Aussprache und<br />
ohne Worte: Bundeskabinett<br />
entscheidet für steigende<br />
Abfallgebühren...<br />
(eew) EEW Energy from Waste (EEW) hat<br />
die am 13. Juli <strong>2022</strong> vom Bundeskabinett<br />
ohne Aussprache getr<strong>of</strong>fene Entscheidung<br />
bei der energetischen Verwertung nicht<br />
recycelbarer Abfälle freiwerdende CO 2 -<br />
Emissionen künftig besteuern zu wollen,<br />
mit Verwunderung zur Kenntnis genommen.<br />
Damit entstünde eine sich weiter anheizende<br />
Inflationsspirale, die vor allem<br />
Haushalte mit geringem Einkommen exponentiell<br />
stark belasten wird.<br />
„Das Bundeskabinett hat sich heute ohne<br />
weitere Aussprache für steigende Abfallgebühren<br />
entschieden und dabei auch noch<br />
den Klimaschutz auf der Strecke gelassen.<br />
Kommt das BEHG in dieser Form, werden<br />
mehr Abfälle exportiert und schlimmstenfalls<br />
deponiert. Damit würde mehr Methan<br />
emittiert und das Problem klimaschädlicher<br />
CO 2 -Emissionen verfünfundzwanzigfacht.<br />
Wir setzen uns für eine europäische Lösung<br />
unter Einbeziehung aller Abfallbeh<strong>and</strong>lungsmethoden<br />
ein“, sagt Bernard M. Kemper,<br />
Vorsitzender der Geschäftsführung von<br />
EEW Energy from Waste, in einer ersten<br />
Reaktion.<br />
Die einzige zu erwartende Lenkungswirkung<br />
des Brennst<strong>of</strong>femissionsh<strong>and</strong>elsgesetzes<br />
(BEHG) wird eine Verlagerung der Abfallströme<br />
in preiswerte und häufig schlechtere<br />
Verwertungswege und damit einhergehend<br />
mehr klimaschädliche Emissionen<br />
sein. „Während wir uns in Deutschl<strong>and</strong> frei<br />
von Emissionen glauben, wird unser Abfall<br />
auf den Deponien Europas 25fach klimawirksameres<br />
Methan in die Atmosphäre aufsteigen<br />
lassen.<br />
LL<br />
www.eew-<strong>energy</strong>fromwaste.com<br />
(222341656)<br />
Alpiq: Inbetriebnahme von<br />
Nant de Drance –<br />
ein wesentliches Element für<br />
die Versorgungssicherheit in<br />
der Schweiz und in Europa<br />
(alpiq) Nach 14 Jahren Arbeit mit intensiven<br />
Testphasen hat das Pumpspeicherkraftwerk<br />
Nant de Drance im Wallis am 1. Juli <strong>2022</strong><br />
seinen Betrieb aufgenommen. Mit den äußerst<br />
flexiblen sechs Maschinengruppen<br />
und einer Leistung von 900 MW spielt Nant<br />
de Drance eine wesentliche Rolle für die Stabilisierung<br />
des Stromnetzes der Schweiz<br />
und Europas. Es trägt zur Stromversorgungssicherheit<br />
in der Schweiz bei. Anlässlich<br />
der bevorstehenden Inbetriebnahme<br />
haben Bundesrätin Simonetta Sommaruga<br />
und der Walliser Regierungsratspräsident<br />
Roberto Schmidt das Kraftwerk heute in Augenschein<br />
genommen. Offiziell wird Nant<br />
de Drance SA das Kraftwerk zusammen mit<br />
den Aktionären Alpiq, SBB, IWB und FMV<br />
im September einweihen.<br />
Vierzehn Jahre nach Beginn der Bauarbeiten<br />
geht das Pumpspeicherkraftwerk Nant<br />
de Drance am 1. Juli <strong>2022</strong> in Betrieb. Bundesrätin<br />
Simonetta Sommaruga und der<br />
Walliser Regierungsratspräsident Roberto<br />
Schmidt nahmen die Gelegenheit wahr, das<br />
Kraftwerk zu besuchen und aus der Nähe zu<br />
betrachten. Es liegt 600 Meter unter der<br />
Erde in einer Kaverne zwischen den Speicherseen<br />
Emosson und Vieux Emosson in<br />
der Gemeinde Finhaut im Wallis und besitzt<br />
sechs Pumpturbinen mit einer Leistung von<br />
je 150 MW. Dank ihrer Flexibilität können<br />
die Maschinengruppen innerhalb von weniger<br />
als fünf Minuten vom Pumpbetrieb bei<br />
Vollleistung zum Turbinenbetrieb bei Vollleistung<br />
wechseln; das heißt, von -900 MW<br />
zu +900 MW. Die von Nant de Drance turbinierte<br />
Wassermenge beträgt 360 m 3 pro Sekunde,<br />
also in etwa die Durchflussmenge<br />
der Rhône bei Genf im Sommer. Der obere<br />
See Vieux Emosson speichert alleine 25 Millionen<br />
m 3 Wasser, was einer Speicherkapazität<br />
von 20 Millionen kWh entspricht. Dank<br />
dieser Eigenschaften spielt Nant de Drance<br />
eine fundamentale Rolle bei der Stabilisierung<br />
des Stromnetzes.<br />
Angesichts der Zunahme erneuerbarer<br />
Energien wie Windkraft und Photovoltaik<br />
mit unregelmäßiger Produktion ist eine solche<br />
Flexibilität notwendig, um Schwankungen<br />
im Stromnetz auszugleichen und jederzeit<br />
ein Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung<br />
und Stromverbrauch aufrechtzuerhalten.<br />
Nant de Drance fungiert als gigantische<br />
Batterie, die auch kurzfristig überschüssigen<br />
Strom aus dem Netz speichert<br />
oder notwendige Energie produziert, wenn<br />
die Nachfrage höher ist als die Produktion.<br />
Ein Werk, das Spitzentechnologe mit<br />
geschichträchtigem Know-how vereint<br />
Der Bau des Pumpspeicherkraftwerks Nant<br />
de Drance war eine außergewöhnliche Anstrengung.<br />
Genauso wie die großen Stauanlagen<br />
aus der Mitte des letzten Jahrhunderts<br />
er<strong>for</strong>derte auch diese Baustelle eine koordinierte<br />
Aktivierung außergewöhnlicher<br />
menschlicher, finanzieller und technischer<br />
Ressourcen. Bis zu 650 Arbeitskräfte und<br />
etwa 60 Unternehmen arbeiteten auf dem<br />
Höhepunkt der Bauarbeiten an der Realisierung<br />
des Kraftwerks, dessen Kosten etwa<br />
2 Milliarden Schweizer Franken betrugen.<br />
Für die unterirdische Maschinenkaverne mit<br />
einer Länge von 194 m, einer Höhe von 52 m<br />
und einer Breite von 32 m mussten<br />
400.000 m 3 Fels entfernt und Stollen mit einer<br />
Länge von 17 km gelegt werden. Der<br />
Alpiq: Inbetriebnahme von Nant de Drance – ein wesentliches Element für die<br />
Versorgungssicherheit in der Schweiz und in Europa; hier in der Bauphase. Foto: Alpiq<br />
8 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Members´News<br />
Staudamm Vieux Emosson auf 2.200 Metern<br />
Höhe wurde um 21,5 Meter erhöht, um<br />
die Kapazität des Speichersees zu verdoppeln<br />
und eine angemessene Speicherkapazität<br />
für die Anlage zu bieten.<br />
Die sechs Turbinenpumpen des Kraftwerks<br />
zeichnen sich durch modernste Wasserkrafttechnologie<br />
aus. Die Drehzahl der Maschinengruppen<br />
kann im Pumpen- und Turbinenmodus<br />
stufenlos geregelt werden und<br />
ermöglicht es dem Kraftwerk, eine möglichst<br />
optimale Leistung zu liefern und sich<br />
an die kleinsten Schwankungen des Strommarkts<br />
anzupassen.<br />
Eine ausgeglichene<br />
Umweltauswirkung<br />
Um seine Umweltauswirkung zu minimieren,<br />
hat Nant de Drance von Anbeginn der<br />
Arbeiten eng mit den Umweltorganisationen<br />
zusammengearbeitet. Vierzehn Projekte<br />
mit Kosten in Höhe von insgesamt zweiundzwanzig<br />
Millionen Schweizer Franken wurden<br />
bereits bzw. werden aktuell oder in<br />
Kürze umgesetzt. Diese sollen die Umweltauswirkungen<br />
ausgleichen, die der Bau des<br />
Pumpspeicherkraftwerks und der Höchstspannungsleitung,<br />
die das Werk mit dem<br />
Stromnetz verbindet, mit sich bringen.<br />
Die meisten Maßnahmen zielen darauf ab,<br />
bestimmte Biotope auf regionaler Ebene<br />
wiederaufleben zu lassen, insbesondere<br />
Feuchtbiotope.<br />
Feierlichkeiten im Zeichen<br />
kommender <strong>Generation</strong>en<br />
Nant de Drance SA und ihre Aktionäre Alpiq,<br />
SBB, IWB und FMV weihen das Kraftwerk<br />
im September <strong>2022</strong> ein. Die Feierlichkeiten<br />
werden ganz im Zeichen der heutigen<br />
Jugend, der zukünftigen <strong>Generation</strong>en und<br />
der Energiezukunft stehen. Schüler aus dem<br />
Vallée du Trient werden die Gelegenheit haben,<br />
das Kraftwerk, das zur Zukunft des<br />
Energiesystems beitragen wird, zu erkunden<br />
und aktiv an den Feierlichkeiten teilnehmen.<br />
Die allgemeine Öffentlichkeit wird<br />
eingeladen, das Kraftwerk an den Tagen der<br />
<strong>of</strong>fenen Tür zu erleben.<br />
Produktionsanlage für Wasserst<strong>of</strong>f<br />
entsteht bis zum Jahr 2026<br />
im Überseehafen Rostock<br />
• Konsortium aus Energieversorgern und<br />
Hafenbetreiber gründet rostock Energy-<br />
Port cooperation GmbH<br />
(enbw) Innerhalb der nächsten 4 Jahre soll<br />
im Überseehafen Rostock auf dem Gelände<br />
des Steinkohlekraftwerks eine 100-MW-Produktionsanlage<br />
für die Erzeugung von grünem<br />
Wasserst<strong>of</strong>f entstehen. Die Elektrolyseanlage<br />
ist das Herzstück des Projektes „Hy-<br />
Tech Hafen Rostock“, das sich auf Förderung<br />
im Rahmen des IPCEI (Important Project <strong>of</strong><br />
Common European Interest) Programms<br />
beworben hat. Eine finale Investitionsentscheidung<br />
ist noch nicht getr<strong>of</strong>fen und erst<br />
nach Erhalt des Förderbescheides geplant.<br />
Ausgearbeitet und gebaut werden soll die<br />
Anlage von der rostock EnergyPort cooperation<br />
GmbH, einem gemeinsamen Unternehmen<br />
von EnBW Neue Ener gien GmbH, RheinEnergie<br />
AG, RWE <strong>Generation</strong> SE und der<br />
ROSTOCK PORT GmbH, das jüngst in der<br />
Hanse- und Universitätsstadt gegründet<br />
wurde. Die vier Partner beteiligen sich jeweils<br />
mit knapp 25 % an dem neuen Unternehmen.<br />
Ziel ist der Auf- und Ausbau einer<br />
nachhaltigen und grünen Produktions- und<br />
Verteilungsstruktur für Wasserst<strong>of</strong>f. Der dafür<br />
er<strong>for</strong>derliche Strom soll aus Erneuerbaren<br />
Energien, wie z.B. Windkraftanlagen auf<br />
See und an L<strong>and</strong>, bezogen werden. Jährlich<br />
sollen so bis zu 6.500 Tonnen Wasserst<strong>of</strong>f<br />
klimaneutral im Überseehafen Rostock erzeugt,<br />
in ein überregionales Verteilnetz<br />
(Wasserst<strong>of</strong>f-Startnetz) eingespeist und lokalen<br />
Verbrauchern zur Verfügung gestellt<br />
werden. Der St<strong>and</strong>ort ermöglicht den Ausbau<br />
der Anlage auf eine Leistung von bis zu<br />
1.000 MW und kann zur nachhaltigen Energieversorgung<br />
und Energiesicherheit<br />
Deutschl<strong>and</strong>s einen wichtigen Beitrag leisten.<br />
Die Investitionen liegen im dreistelligen<br />
Millionenbereich und sollen mit Hilfe von<br />
Fördermitteln getätigt werden.<br />
„Gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen<br />
treibt die RheinEnergie die zielgerichtete<br />
Trans<strong>for</strong>mation des Kraftwerkst<strong>and</strong>orts<br />
Rostock von der Steinkohle hin zu<br />
grünem Wasserst<strong>of</strong>f voran. Damit schaffen<br />
wir eine Perspektive, nicht nur für den<br />
St<strong>and</strong>ort selbst, sondern für die gesamte Region.<br />
Die benötigten Mengen an grünem<br />
Wasserst<strong>of</strong>f stellen wir im Rahmen der neu<br />
gegründeten Gesellschaft künftig allen<br />
Marktteilnehmern zur Verfügung“, sagt Dr.<br />
Dieter Steinkamp, Vorst<strong>and</strong>svorsitzender<br />
der RheinEnergie AG.<br />
„Wir sehen in der Realisierung eines solchen<br />
Projektes und einem sich daran anschließenden<br />
weiteren Ausbau eine große<br />
Chance, eine Kohlekraftwerksst<strong>and</strong>ort langfristig<br />
in einen zukunftsfähigen Energiest<strong>and</strong>ort<br />
zu trans<strong>for</strong>mieren. Wir sichern<br />
damit auch Arbeitsplätze vor Ort“, sagt Rainer<br />
Allmannsdörfer, Geschäftsführer der<br />
EnBW Neue Energien GmbH, der auch Geschäftsführer<br />
des Kohlekraftwerkes ist.<br />
„Die erfolgreiche Trans<strong>for</strong>mation von fossilen<br />
Energieträgern wie Kohle zu nichtfossilen<br />
Energieträgern wie Wasserst<strong>of</strong>f betrifft<br />
viele Teile des Hafens. Ein konsequenter<br />
Einstieg in den Aufbau einer Wasserst<strong>of</strong>fwirtschaft<br />
in Mecklenburg-Vorpommern<br />
wird die fossilen Energieträger ablösen<br />
und zur Dekarbonisierung der Region<br />
führen. Als ein Partner des gemeinsamen<br />
Unternehmens möchten wir weiterhin Impulsgeber<br />
für eine klimaschonende und<br />
nachhaltige Hafenwirtschaft sein“, hebt<br />
ROSTOCK PORT-Geschäftsführer Jens<br />
Scharner hervor.<br />
„Der Überseehafen Rostock ist ein idealer<br />
Startpunkt für ein Wasserst<strong>of</strong>f-Hub im Nordosten<br />
Deutschl<strong>and</strong>s. Im Rahmen des neuen<br />
Konsortiums trägt RWE als weltweit führendes<br />
Unternehmen bei Erneuerbaren Energien<br />
und mit ihrer Kompetenz bei der Wasserst<strong>of</strong>ferzeugung<br />
maßgeblich zur grünen<br />
Trans<strong>for</strong>mation des St<strong>and</strong>orts und der Region<br />
bei“, sagt Sopna Sury, COO Hydrogen<br />
RWE <strong>Generation</strong>.<br />
L L <strong>energy</strong>port-rostock.de<br />
www.enbw.com<br />
www.rheinenergie.de<br />
www.rwe.com (222341709)<br />
Nant de Drance in Kürze<br />
Das Kraftwerk Nant de Drance ist ein<br />
Pumpspeicherkraftwerk mit einer Leistung<br />
von 900 MW in einer unterirdischen Kaverne<br />
zwischen den beiden Speicherseen<br />
Emosson und Vieux Emosson im Wallis. Für<br />
den Betrieb des Pumpspeicherkraftwerks ist<br />
die Nant de Drance SA zuständig. Aktionäre<br />
sind Alpiq (39 %), SBB (36 %), IWB (15 %)<br />
und FMV (10 %).<br />
L L www.nant-de-drance.ch (222341652)<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 9
Members´News<br />
EnBW weiht 300 MW Solarenergie<br />
in Br<strong>and</strong>enburg ein<br />
• „Ein Stück weit energieunabhängiger“:<br />
Offizielle Einweihung der Solarparks<br />
„Alttrebbin“ und „Gottesgabe“<br />
• Zusammen mit dem Solarpark „Weesow-Willmersdorf“<br />
ist das Solarcluster<br />
nahe Berlin damit komplett<br />
(enbw) „Jede Kilowattstunde aus erneuerbaren<br />
Energien macht Deutschl<strong>and</strong> ein<br />
Stück weit unabhängiger von Importen an<br />
fossilen Energieträgern“, sagte EnBW-Vorst<strong>and</strong>smitglied<br />
Georg Stamatelopoulos am<br />
Freitagnachmittag bei der Einweihung der<br />
beiden zusammen rund 300 MW großen<br />
Solarparks in Br<strong>and</strong>enburg.<br />
Knapp ein Jahr ist es her, dass die EnBW<br />
die bisher größte Solar-Freiflächenanlage<br />
Deutschl<strong>and</strong>s, den Solarpark Weesow-Willmersdorf<br />
in Br<strong>and</strong>enburg in Betrieb genommen<br />
hat. Mit der Einweihung der beiden<br />
förderfreien XXL-Solarparks in Alttrebbin<br />
und Gottesgabe mit jeweils rund 150 Megawatt<br />
ist das EnBW-Solarcluster östlich von<br />
Berlin komplett. Damit leistet die Solarenergie<br />
einen wichtigen Beitrag zur regenerativen<br />
Energieversorgung in Deutschl<strong>and</strong>.<br />
Sonne nutzen für den Klimaschutz<br />
Durch die umweltfreundliche Energieerzeugung<br />
aus diesen drei großen Solarparks<br />
lassen sich jährlich rund 325.000 Tonnen<br />
CO 2 -Emissionen vermeiden. „Als EnBW<br />
möchten wir so einen spürbaren Beitrag zur<br />
nachhaltigen Stromerzeugung und damit<br />
für die Energiewende leisten“, ergänzte Stamatelopoulos.<br />
Zusammen mit dem Parlamentarischen<br />
Staatssekretär im Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Klimaschutz,<br />
Michael Kellner, dem L<strong>and</strong>rat des Märkisch-Oderl<strong>and</strong>es,<br />
Gernot Schmidt, und den<br />
Bürgermeistern Werner Mielenz und Mario<br />
Eska weihte er die beiden neuen Projekte<br />
<strong>of</strong>fiziell ein.<br />
Staatssekretär Kellner beglückwünschte<br />
alle Beteiligten: „Zu sehen was hier geleistet<br />
wurde, macht gute Laune und ist ein Signal,<br />
dass es mit der Energiewende voran geht.<br />
Der Ausbau durch förderfreie Solarparks<br />
wie hier, ist eine riesige Chance und ein<br />
St<strong>and</strong>ortvorteil für Br<strong>and</strong>enburg.“<br />
Gruppenfoto von der <strong>of</strong>fiziellen Einweihung der EnBW-Solarpark Alttrebbin und Gottesgabe<br />
in Neuhardenberg (Foto EnBW/Fotograf Paul Langrock) v.l.n.r. Dr. Georg Stamatelopoulos,<br />
Vorst<strong>and</strong> Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur EnBW Werner Mielenz, Bürgermeister der<br />
Gemeinde Neutrebbin Gernot Schmidt, L<strong>and</strong>rat des L<strong>and</strong>kreises Märkisch-Oderl<strong>and</strong><br />
Thorsten Jörß, Leiter Projektentwicklung Photovoltaik, EnBW AG Parl. Staatssekretär<br />
Michael Kellner, MdB, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Mario Eska,<br />
Bürgermeister der Gemeinde Neuhardenberg<br />
Seit Ende März sind beide Anlagen vollständig<br />
in Betrieb. Die rund 700.000 Solarmodule<br />
erzeugen umweltfreundlichen<br />
Strom für den Jahresbedarf von rund 90.000<br />
Haushalten. Batteriespeicher mit jeweils 3,9<br />
Megawattstunden Kapazität decken den Eigenbedarf<br />
der Umspannwerke und Wechselrichter<br />
und speisen darüber hinaus erzeugte<br />
Energie ins Stromnetz ein. So trägt die Kombination<br />
aus Erneuerbaren-Anlagen und<br />
dezentralen Speichersystemen dazu bei,<br />
Solarstrom stetiger verfügbar zu machen.<br />
„Wo immer sinnvoll und wirtschaftlich umsetzbar,<br />
planen wir solche Speichersysteme<br />
in unsere Solarparks ein“, erläuterte Thorsten<br />
Jörß, Leiter der Projektentwicklung Photovoltaik<br />
bei EnBW, der die Gäste bei der<br />
Einweihung begrüßte.<br />
Geschichte erleben – Von der Bronzezeit<br />
zum zweiten Weltkrieg<br />
Neben den alltäglichen Überraschungen<br />
auf einer Baustelle boten die Solarparks<br />
Alttrebbin und Gottesgabe dem mittlerweile<br />
erprobten Bau-Team der EnBW weitere interessante<br />
Einblicke in die Geschichte. Beide<br />
Flächen lagen in einer Kampfmittelverdachtszone,<br />
die umfangreiche Räumungsarbeiten<br />
er<strong>for</strong>derlich machen. „Alleine diese<br />
Arbeiten schlugen mit einem hohen sechsstelligen<br />
Betrag zu Buche“, in<strong>for</strong>mierte<br />
Jörß. „Wobei die Fläche jetzt von Altlasten<br />
aus Kriegszeiten, etlichen Schrottresten und<br />
über 100 Hufeisen befreit ist.“<br />
Bei den Erdarbeiten für die Netzanbindung<br />
an das Umspannwerk bei Metzdorf<br />
f<strong>and</strong>en Archäologen einen Brunnen mit vielen<br />
Keramikscherben, die Experten nach<br />
erster Schätzung auf die Eisenzeit vor etwa<br />
2.500 Jahren datieren. Dabei stießen sie<br />
auch auf die Grabstätte eines Kindes. Ein<br />
Steinbeil darin lässt vermuten, dass es sich<br />
um eine Grabstätte aus der späten Bronzezeit<br />
h<strong>and</strong>elt – also vor etwa 3.000 Jahren.<br />
„Das sind spannende Ereignisse, die jeden<br />
Bau eines Solarparks abwechslungsreich<br />
und einzigartig machen“, so Jörß, der stolz<br />
auf die Leistung des Teams ist, das innerhalb<br />
eines Jahres gleich zwei große Solarparks<br />
gleichzeitig gebaut und in Betrieb genommen<br />
hat. Insgesamt mussten während der<br />
Bauphase rund 30 Haupt- und Nebengewerke<br />
sowie über 100 Lieferanten gesteuert<br />
werden – plus die Überraschungen vor Ort.<br />
Im Herbst folgen noch über<br />
3.000 Sträucher zur Grünfläche<br />
Technisch sind die Anlagen fertig. Damit<br />
sie sich über die Jahre hinweg richtig ins<br />
L<strong>and</strong>schaftsbild fügen, legt die EnBW im<br />
Herbst noch mal H<strong>and</strong> an. Sowohl in Alttrebbin<br />
als auch in Gottesgabe pflanzt die EnBW<br />
noch über 3.000 Sträucher an, darunter<br />
Hartriegel, Weißdorn, Wildapfel, Wildbirne<br />
und weitere heimische Arten. Mit der Zeit<br />
entsteht so innerhalb und um die Solaranlagen<br />
attraktiver Lebensraum und Nahrungshabitat<br />
für Kleintiere, Insekten und Vögel.<br />
LL<br />
www.enbw.com (222341713)<br />
EnBW bereitet Kohlekraftwerke<br />
auf verstärkten Betrieb im Winter<br />
vor – Versorgungssicherheit<br />
oberste Priorität<br />
(enbw) Die Bundesregierung und der Bundesrat<br />
haben am 8. Juli <strong>2022</strong> das sogenannte<br />
Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz<br />
(EKBG) beschlossen. Es ist im Juli in Kraft<br />
und getreten sieht zum einen ein Verstromungsverbot<br />
für Gas und zum <strong>and</strong>eren den<br />
verstärkten Einsatz von Kohlekraftwerken<br />
für die Stromerzeugung vor.<br />
Im Falle einer Gasmangellage soll im Zeitraum<br />
bis 31. März 2024 Reservekraftwerken<br />
eine befristete Rückkehr in den Strommarkt<br />
ermöglicht werden, um den Gasverbrauch<br />
zu reduzieren. Über eine Rechtsverordnung<br />
kann darüber hinaus der Einsatz von Gas im<br />
Kraftwerkssektor soweit wie möglich eingeschränkt<br />
werden. Allerdings gelten Ausnahmen<br />
für wärmegekoppelte Kraftwerke, deren<br />
Wärmeerzeugung nicht ersetzt werden<br />
kann.<br />
10 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Members´News<br />
Seitens EnBW wird aktuell mit Hochdruck<br />
daran gearbeitet, die Kohleblöcke in der<br />
Netzreserve und am Markt intensiv auf den<br />
Betrieb im Winter vorzubereiten. Dabei geht<br />
es u.a. um die verstärkte Beschaffung und<br />
den Transport von Kohle sowie den Flächenbedarf<br />
für die Lagerung von zusätzlichen<br />
Kohlemengen. Auch die Frage der notwendigen<br />
Arbeitskräfte spielt eine wichtige Rolle,<br />
da die langfristige Personalplanung von<br />
den Prämissen des ursprünglichen Kohleausstiegs<br />
ausging. Zudem investiert die<br />
EnBW in umfangreiche Revisions- und Inst<strong>and</strong>haltungsmaßnahmen,<br />
um die Verfügbarkeit<br />
der Anlagen sicherzustellen.<br />
Die EnBW betreibt derzeit noch an vier eigenen<br />
St<strong>and</strong>orten in Karlsruhe, Heilbronn,<br />
Stuttgart-Münster und Altbach-Deizisau insgesamt<br />
fünf Kohleblöcke am Markt. Im Zuge<br />
des geplanten Kohleausstiegs bis 2030 hatte<br />
die EnBW geplant, den Kohleblock RDK 7<br />
Mitte <strong>2022</strong> zur Stilllegung anzumelden und<br />
somit aus dem Marktbetrieb zu nehmen. Vor<br />
dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der<br />
aktuellen Entwicklung auf dem Gasmarkt hat<br />
der Konzern aber beschlossen, RDK 7 bis<br />
mindestens zum Ende des Winters<br />
2023/2024 weiter am Markt zu betreiben.<br />
„Wir leisten unseren Beitrag, indem wir<br />
kurzfristig unsere Kohlekraftwerke bestmöglich<br />
einsatzbereit und verfügbar halten.<br />
Im Winter kann so Strom mit Hilfe von Kohle<br />
erzeugt werden und das eingespeicherte<br />
Gas bleibt der Versorgung der Haushalte<br />
vorbehalten“, so Dr. Georg Stamatelopoulos,<br />
Vorst<strong>and</strong> für Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur<br />
der EnBW.<br />
Zusätzlich hat die EnBW in Baden-Württemberg<br />
fünf Kohleblöcke, die sich in der<br />
Netzreserve befinden und nur auf Anweisung<br />
des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW<br />
betrieben werden. Da die Netzreserveblöcke<br />
kurzfristig zur Sicherung der Systemstabilität<br />
angefragt werden können, hält<br />
die EnBW diese stets einsatzbereit. Sie werden<br />
im Zuge des Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz<br />
nicht in den Markt zurückkehren,<br />
sondern verbleiben in der Netzreserve.<br />
„Aufgrund ihres Alters können unsere<br />
Kohleblöcke, die sich in der Netzreserve befinden,<br />
nicht zurück in den Marktbetrieb<br />
gehen“, erklärt Stamatelopoulos. „Aus technischen<br />
Gründen ist es nicht möglich, dass<br />
diese ununterbrochen zur Stromerzeugung<br />
eingesetzt werden können, sie leisten aber<br />
einen wichtigen Beitrag, um Einbrüche in<br />
der Systemstabilität abzufedern und die<br />
Versorgungssicherheit jederzeit zu gewährleisten.<br />
Sie sind quasi nicht in der Startaufstellung<br />
der Mannschaft, aber wichtig<br />
auf der Ersatzbank.“<br />
LL<br />
www.enbw.com (222341716)<br />
100 Jahre Energie im Fluss<br />
Südbaden<br />
• Neckar AG begeht ihr 100-jähriges Bestehen<br />
mit einem Festakt auf dem Neckar<br />
Stuttgart. Die Menschen im L<strong>and</strong> schätzen<br />
die Schönheit und Energie des Neckars – des<br />
„Wilden Gesellen“, wie ihn die Kelten nannten.<br />
Er war und ist eine wichtige Lebensader<br />
in Baden-Württemberg. Mit dem Beschluss<br />
des Bundes, den Neckar zwischen Mannheim<br />
und Plochingen schiffbar zu machen,<br />
begann ein neues Kapitel in seiner Geschichte.<br />
Der Auftrag ging am 1. Juni 1921 an die<br />
dazu neu gegründete Neckar AG. Das heißt,<br />
ihr 100. Geburtstag war bereits 2021. P<strong>and</strong>emiebedingt<br />
begeht sie jedoch erst dieses<br />
Jahr ihr großes Jubiläum. Passend zum Anlass<br />
luden die beiden Vorstände der Neckar<br />
AG, Thorsten Koch und Ralf Neulinger, am<br />
11. Juli zu einer Fahrt mit dem Schiff auf<br />
dem Neckar ein. „Wir freuen uns, dass wir<br />
dieses Jahr endlich unser rundes Jubiläum<br />
in angemessenem Rahmen begehen kön-<br />
Monoklärschlamm-<br />
Verbrennung<br />
Im Zweckverb<strong>and</strong> „Klärschlammverwertung Zweckverb<strong>and</strong> Südbaden“ haben sich 27 Kläranlagenbetreiber zusammengeschlossen, um den bei<br />
seinen Verb<strong>and</strong>smitgliedern anfallenden Klärschlamm ordnungsgemäß thermisch zu beh<strong>and</strong>eln und den Phosphor zurückzugewinnen.<br />
Zur Umsetzung der Aufgabe soll auf dem Gelände der Kläranlage des Abwasserzweckverb<strong>and</strong>es Breisgauer Bucht in 79362 Forchheim eine<br />
Monoklärschlammverbrennung errichtet werden.<br />
Zur Begleitung der Maßnahme suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen<br />
Projektleiter (m/w/d)<br />
Sie sind als Projektleiter für die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme der Verbrennungsanlage fachlich, organisatorisch und personell<br />
hauptverantwortlich. Sie sind direkt der Geschäftsleitung unterstellt.<br />
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium des Maschinenbau-, Chemie- oder Verfahrensingenieurwesens bzw. ein Studium gleichwertiger<br />
Art. Für die Aufgabenerfüllung ist neben den verfahrenstechnischen Grundkenntnissen eine mehrjährige Berufserfahrung er<strong>for</strong>derlich. Wir<br />
legen Wert auf Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen.<br />
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und attraktive Tätigkeit im öffentlichen Dienst und eine leistungsgerechte Vergütung, abhängig von<br />
Ihrer Berufserfahrung, bis Entgeltgruppe 14 TVöD.<br />
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Geschäftsleiter Herr Hünting unter Tel.: 0761/152 17- 31 gerne zur Verfügung.<br />
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 16.09.<strong>2022</strong> an den Klärschlammverwertung Zweckverb<strong>and</strong> Südbaden, Hanferstr. 6 in<br />
D-79108 Freiburg i. Br., z.Hd. Herrn Reichenbach, oder gerne per Mail an bewerbung@kzv-suedbaden.de<br />
www.kzv-suedbaden.de<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 11
Members´News<br />
Schleusen- und Wehranlagen zur Schiffbarmachung<br />
des Flusses kostete. Auch heute<br />
noch zahlt die Neckar AG das Darlehen für<br />
den Bau der Schifffahrtsstraße ab. Die Wasserkraftwerke<br />
der Neckar AG produzieren<br />
rund 500 Millionen Kilowattstunden Strom<br />
und können damit rund 170.000 Haushalte<br />
pro Jahr CO2-frei mit Strom versorgen. 2011<br />
ging mit der Fertigstellung des Wasserkraftwerks<br />
Esslingen die jüngste Anlage an das<br />
Stromnetz.<br />
Gut gelaunte Gäste der Jubiläumsfeier: v.l.n.r. Thorsten Koch, kaufm. Vorst<strong>and</strong> der Neckar AG,<br />
Dr. Georg Stamatelopoulos, Mitglied des Vorst<strong>and</strong> der EnBW, Dr. Volker Wissing MdB,<br />
Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Frank Nopper, Oberbürgermeister der Stadt<br />
Stuttgart, Ralf Neulinger, techn. Vorst<strong>and</strong> der Neckar AG, Dr. Andre Baumann,<br />
Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg,<br />
Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung<br />
des Bundes (Foto: EnBW)<br />
nen. Nicht nur die Vorstände, sondern vor<br />
allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
der Neckar AG haben in ihrer langen<br />
Geschichte - im wahrsten Sinne des Wortes<br />
über <strong>Generation</strong>en hinweg viel bewegt in<br />
Baden-Württemberg. Darauf sind wir stolz<br />
und können gemeinsam mit unseren Gästen<br />
heute an diese große Leistung erinnern und<br />
darauf anstoßen.<br />
Auch Dr. Volker Wissing MdB, Bundesminister<br />
für Digitales und Verkehr, Dr. Andre<br />
Baumann, Staatssekretär im Ministerium<br />
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft<br />
Baden-Württemberg, Carsten Strähle, Geschäftsführer<br />
der Hafen Stuttgart GmbH<br />
und Dr. Georg Stamatelopoulos, Mitglied<br />
des Vorst<strong>and</strong>s der EnBW Energie Baden-Württemberg<br />
AG, kamen, um mitzufeiern<br />
und das Unternehmen zu würdigen.<br />
Ort. Die Gespräche zwischen Bund und<br />
L<strong>and</strong> dazu laufen bereits. Uns geht es darum,<br />
für die Häfen und Investoren, für Binnenschifffahrt<br />
und Bauindustrie Planungssicherheit<br />
zu schaffen. Damit der Neckar<br />
auch in Zukunft seine Rolle als wichtige<br />
Wasserstraße einnehmen kann.“<br />
Dank des weitsichtigen Firmengründers<br />
Otto Konz errichtete die Neckar AG parallel<br />
zum Ausbau an den Staustufen des Neckarabschnitts<br />
zwischen Plochingen und Mannheim<br />
auch Laufwasserkraftwerke. Mit dem<br />
Erlös aus den langfristig geschlossenen Verträgen<br />
mit den Stromabnehmern der Kraftwerke<br />
sicherte sich das Unternehmen die<br />
immensen Investitionen, die der Bau der<br />
Den Beitrag der Wasserkraft zur Gewinnung<br />
erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg<br />
hob Dr. Baumann hervor: „Für<br />
mich hat die Neckar AG gleich in zweifacher<br />
Hinsicht wertvolles für das L<strong>and</strong> geleistet.<br />
Neben der Infrastruktur hat sie auch die<br />
Energiewirtschaft vorangebracht. Seit nunmehr<br />
100 Jahren sorgen die Kraftwerke entlang<br />
des Neckars für eine nachhaltige Energieerzeugung,<br />
die auch in der Zukunft wichtiger<br />
denn je sein wird. Gleichzeitig müssen<br />
wir aber auch den Zust<strong>and</strong> unserer Gewässer<br />
im Blick behalten. Deshalb gilt es nun,<br />
die Anstrengungen zur Verbesserung der<br />
Durchgängigkeit und zum Schutz der Fische<br />
<strong>for</strong>tzusetzen und weiter daran zu arbeiten,<br />
dass der Neckar und seine Zuflüsse zu unseren<br />
grünen Lebensadern in Baden-Württemberg<br />
werden.“<br />
Der Ausbau der Staustufen führte entlang<br />
des Neckars auch zu einem Anstieg der<br />
Nutzflächen für Verkehr, Industrie und<br />
L<strong>and</strong>wirtschaft. Ein Beispiel dafür ist der<br />
Binnenhafen in Stuttgart. Er ist ein bedeutender<br />
Güterumschlagplatz und ein Drehkreuz<br />
für die Verladung von Gütern zwischen<br />
Straße, Schiene und Wasser. Carsten<br />
Strähle ist sich sicher: „Die Schiffbarmachung<br />
des Neckars durch die Neckar AG war<br />
maßgeblich für die gute Verkehrsinfrastruk-<br />
Die Neckar AG gestaltete den Neckar zu<br />
einer der wichtigsten Wasserstraßen und<br />
erneuerbaren Energiequellen in Baden-Württemberg<br />
um und hat damit entscheidend<br />
zur Industrialisierung des Südwestens<br />
Deutschl<strong>and</strong>s beigetragen. 1968<br />
war der Auftrag erfüllt und das Ziel erreicht.<br />
Die Neckar AG hatte die 27 Staustufen zwischen<br />
Plochingen und Mannheim waren<br />
fertiggestellt und der Fluss in einen modernen<br />
und leistungsfähigen Großschifffahrtsweg<br />
verw<strong>and</strong>elt.<br />
„Mit dem Ausbau des Flusses hat die Neckar<br />
AG einen wesentlichen Beitrag für die<br />
wirtschaftliche Entwicklung des L<strong>and</strong>es geschaffen“,<br />
betonte Dr. Volker Wissing. „Daran<br />
wollen wir anknüpfen und ein Gesamtkonzept<br />
für eine moderne, klimafreundliche<br />
Neckarschifffahrt entwickeln. Mitwirken<br />
sollen alle Beteiligten wie etwa Häfen, Binnenschifffahrt<br />
und die Industrie hier vor<br />
Blick in die Maschinenhalle des Wasserkraftwerks Cannstatt (Foto: EnBW)<br />
12 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Members´News<br />
tur in Baden-Württemberg. Die Nutzung der<br />
Wasserstraßen als Verkehrsweg für den Gütertransport<br />
ist entscheidend für die Entlastung<br />
der Straßen. Um die Ziele bei Klimaund<br />
Umweltschutz zu erreichen ist die Inst<strong>and</strong>setzung<br />
und Ausbau der Schleusen ein<br />
dringender Faktor. Der Ausbau für 135 Meter<br />
Schiffe ist ein klares Signal für die Zukunft<br />
der umweltfreundlichen Binnenschifffahrt.“<br />
Für die Schleusen und Wehranlagen ist<br />
heute das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt<br />
Neckar zuständig. Die Neckar AG kümmert<br />
sich um den Betrieb, die Wartung und<br />
die Inst<strong>and</strong>haltung der Laufwasserkraftwerke<br />
am schiffbaren Neckar. Außerdem sorgt<br />
sie für die Einhaltung der für die Schifffahrt<br />
er<strong>for</strong>derlichen Pegelstände an den Staustufen.<br />
Die EnBW und ihre Vorgängerunternehmen<br />
waren der Neckar AG schon lange verbunden.<br />
Zunächst als Stromabnehmer und<br />
seit der Privatisierung im Jahr 1995 dann<br />
auch als Hauptaktionär. Dr. Georg Stamatelopoulos<br />
schätzt die Neckar AG als wertvollen<br />
Partner. „Heute betreiben wir fast alle<br />
Wasserkraftwerke am schiffbaren Neckar<br />
gemeinsam. Auf die Erfahrungen und die<br />
Stärke der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
der Neckar AG können wir bauen. So werden<br />
wir auch in Zukunft unseren Beitrag für<br />
eine sichere und ökologische Stromversorgung<br />
im Ländle leisten. Wir stehen heute<br />
wieder vor großen Heraus<strong>for</strong>derungen. Gehen<br />
wir es mit der gleichen Tatkraft und<br />
Entschlossenheit an wie die damaligen Pioniere<br />
der Neckar AG!“<br />
Die Modernisierung des Neckars hat mit<br />
einer ersten, integral betrachteten Maßnahme<br />
an der Staustufe Remseck-Aldingen<br />
schon begonnen. Bund, L<strong>and</strong>, Neckar AG<br />
und EnBW werden gemeinsam dafür sorgen,<br />
dass der „wilde Geselle“ auch zukünftig<br />
moderne Wasserstraße und Quelle nachhaltiger<br />
Energieerzeugung bleibt.<br />
LL<br />
www.enbw.com (222341717)<br />
EDF announces the opening <strong>of</strong><br />
its permanent EDF Nuclear<br />
Czechia branch<br />
(edf) On the occasion <strong>of</strong> its Czech-French<br />
Partners’ Day <strong>for</strong> the Dukovany 5 nuclear<br />
power plant project, EDF announced the<br />
opening <strong>of</strong> its EDF Nuclear Czechia branch<br />
in Prague, dedicated to supporting the development<br />
<strong>of</strong> EDF nuclear activities <strong>for</strong> the<br />
Czech market. This decision confirms EDF’s<br />
long-term commitment to support the Czech<br />
nuclear ambitions with its reactor technologies<br />
<strong>and</strong> a comprehensive value proposition.<br />
The announcement was made during a<br />
press conference attended by French Minister<br />
Delegate <strong>for</strong> Foreign Trade <strong>and</strong> Economic<br />
Attractiveness Franck Riester, who<br />
expressed the French government’s full<br />
support to the <strong>of</strong>fer led by EDF <strong>for</strong> the construction<br />
<strong>of</strong> an EPR1200 reactor at the Dukovany<br />
site.<br />
EDF has appointed Mr. Roman Zdebor as<br />
Branch Managing Director <strong>of</strong> EDF Nuclear<br />
Czechia odštěpný závod. With almost 30<br />
years <strong>of</strong> experience in the nuclear industry,<br />
mainly associated with ŠKODA JS in the<br />
Czech Republic, Mr. Zdebor held a number<br />
<strong>of</strong> leading positions ranging from technical<br />
to commercial activities. Through his career,<br />
he collaborated, among others, with the<br />
French nuclear industry as part <strong>of</strong> ŠKODA JS<br />
activities <strong>for</strong> the EPR projects. In recent<br />
years, he worked as Construction Readiness<br />
Director at Hanhikivi nuclear power plant<br />
project in Finl<strong>and</strong> <strong>and</strong> now joined EDF in the<br />
Czech Republic to contribute his skills <strong>and</strong><br />
know-how at the service <strong>of</strong> the country’s nuclear<br />
revival.<br />
EDF Nuclear Czechia will support all EDF’s<br />
nuclear activities in the Czech Republic,<br />
with a prime focus on contributing to the<br />
consolidation <strong>of</strong> EDF’s EPR1200 bid <strong>for</strong> the<br />
Dukovany 5 tendering process launched by<br />
ČEZ <strong>and</strong> on accelerating the cooperation<br />
momentum between the tendering teams in<br />
France <strong>and</strong> Czech industrial partners.<br />
During its Czech-French Partners’ Day<br />
hosted at the Czech Chamber <strong>of</strong> Commerce<br />
in Prague, a “closed-door event” bringing<br />
together the tier one Czech <strong>and</strong> French industrial<br />
companies selected to be part <strong>of</strong><br />
EDF’s industrial scheme <strong>for</strong> the construction<br />
<strong>of</strong> one EPR1200 nuclear unit at the Dukovany<br />
site, EDF <strong>and</strong> its partners, namely BAEST<br />
Machines & Structures, Bouygues Travaux<br />
Publics, EDF, Framatome, GE Steam Power,<br />
Hutní Montáže a. s., I&C Energo a.s., Metrostav<br />
DIZ s.r.o., Reko Praha a.s., Sigma Group<br />
a.s., <strong>and</strong> ŠKODA JS a.s, shared the status <strong>of</strong><br />
their joint work to establish an integrated<br />
delivery team <strong>and</strong> reiterated their mutual<br />
commitment <strong>and</strong> shared values with the<br />
signing <strong>of</strong> the Dukovany 5 Delivery Team’s<br />
Values Pledge <strong>for</strong> EDF’s EPR1200 proposal.<br />
In addition, EDF, Bouygues Travaux Publics<br />
<strong>and</strong> Metrostav DIZ s.r.o further rein<strong>for</strong>ced<br />
their collaboration with the signature <strong>of</strong> a<br />
Tripartite Teaming Agreement focused on<br />
civil works activities to secure a high share<br />
<strong>of</strong> local content <strong>for</strong> the construction <strong>of</strong> the<br />
Dukovany 5 project. The event was inaugurated<br />
by French Minister Delegate Franck<br />
Riester, in presence <strong>of</strong> Czech Deputy Minister<br />
<strong>of</strong> Industry <strong>and</strong> Trade Tomáš Ehler.<br />
Vakisasai Ramany, EDF Senior Vice-President<br />
in charge <strong>of</strong> New Nuclear Development,<br />
said: “The establishment <strong>of</strong> EDF Nuclear<br />
Czechia is yet another demonstration<br />
<strong>of</strong> EDF’s commitment to support the Czech<br />
nuclear programme <strong>and</strong> I am very pleased to<br />
welcome Roman Zdebor in our team <strong>and</strong><br />
UNSER SERVICE<br />
FÜR THERMISCHE<br />
ABFALLVERWERTUNG<br />
KESSEL & APPARATE<br />
■ Serviceverträge für Revisionen und<br />
die kontinuierliche Inst<strong>and</strong>haltung<br />
■ Reparatur-, Wartungs- und Umbaumaßnahmen<br />
für Rohrbündelwärmetauscher<br />
■ Lieferung von Ersatzteilen und<br />
Austauschkomponenten<br />
inkl. Cladding<br />
■ Montagen und Demontagen<br />
■ Rostarbeiten<br />
■ Vorort-Plattierungen mittels<br />
CMT-Verfahren<br />
■ Engineering und Konstruktion<br />
■ Schichtdicken- und Fe-Messungen<br />
von Plattierungen<br />
■ Wärmetechnische Berechnungen,<br />
Umlaufberechnungen<br />
■ Analyse der Heizflächeneffizienz und<br />
Optimierung der Wärmeaufnahme<br />
IHRE 24-H-HOTLINE<br />
0172 - 4380 330<br />
www.borsig.de/bs<br />
BORSIG Service GmbH<br />
Tel.: 030 4301-01<br />
Fax: 030 4301-2771<br />
E-Mail: info@bs.borsig.de<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 13
Members´News<br />
company. Our presence in the Czech Republic<br />
is rein<strong>for</strong>ced to support our ambition to<br />
<strong>of</strong>fer ČEZ <strong>and</strong> the Czech people the most<br />
reliable <strong>and</strong> sustainable long-term partnership<br />
<strong>for</strong> a sovereign <strong>and</strong> robust Czech new<br />
nuclear programme. EDF takes measure <strong>of</strong><br />
the responsibility <strong>and</strong> the great opportunities<br />
that a common Czech-French partnership<br />
would provide to both our countries<br />
<strong>and</strong> Europe. We reaffirm our objective to<br />
consolidate the engagement between our<br />
industries <strong>for</strong> the success <strong>of</strong> Dukovany 5 <strong>and</strong><br />
future EPR projects in Europe.”<br />
Roman Zdebor, EDF Nuclear Czechia –<br />
Branch Managing Director, said: “The establishment<br />
<strong>of</strong> the EDF branch in the Czech<br />
Republic comes at a crucial time <strong>and</strong> is further<br />
pro<strong>of</strong> <strong>of</strong> EDF‘s commitment to anchor<br />
its partnership with the Czech nuclear industry,<br />
which I am proud to have been part<br />
<strong>of</strong> <strong>for</strong> almost 30 years. It also confirms EDF’s<br />
goal to provide ČEZ with the most competitive<br />
<strong>of</strong>fer. The organization <strong>of</strong> EDF’s Czech-<br />
French Partners’ Day was a unique opportunity<br />
to define concretely how we envision to<br />
deliver a truly Czech-French nuclear project<br />
<strong>for</strong> Dukovany 5. EDF has a long <strong>and</strong> successful<br />
history <strong>of</strong> cooperation with the Czech<br />
nuclear industry, <strong>and</strong> it is an extraordinary<br />
honour <strong>for</strong> me to be appointed to this new<br />
strategic position to support EDF’s European<br />
<strong>of</strong>fer in my home-country”.<br />
LL<br />
www.edf.com (222341659)<br />
Erste deutsche<br />
„Wind+Speicher-Kombination“<br />
geht in Betrieb<br />
• Innovationsprojekt von Smart Power und<br />
juwi setzt Maßstäbe<br />
(s-p) Bei der ersten bundesweiten Innovationsausschreibung<br />
der Bundesnetzagentur<br />
hatte das „Wind+Speicher“-Projekt in der<br />
br<strong>and</strong>enburgischen Uckermark im September<br />
2020 den Zuschlag erhalten. Es ist bis<br />
heute deutschl<strong>and</strong>weit das erste und bislang<br />
einzige Wind+Speicher-Projekt im Rahmen<br />
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.<br />
Im Windpark Schmölln II realisierte juwi<br />
daraufhin zwei Windkraftanlagen vom Typ<br />
Vestas V136 mit einer Nennleistung von je<br />
3,6 MW. Der dazugehörige Batteriespeicher<br />
mit einer Kapazität von 3 MWh wurde von<br />
Smart Power errichtet und ist nun erfolgreich<br />
in Betrieb genommen worden. Die<br />
Anlage trägt zur Versorgungssicherheit und<br />
Netzstabilität bei, denn dank des Lithium-Ionen-Speichers<br />
kann auch in windarmen<br />
Zeiten Ökostrom in das Stromnetz eingespeist<br />
werden. Ein- und ausgespeichert<br />
wird ausschließlich der vor Ort erzeugte<br />
Ökostrom aus den beiden Anlagen des<br />
Windparks Schmölln II, so sieht es die Verordnung<br />
zu den Innovationsausschreibungen<br />
(InnAusV) der Bundesnetzagentur vor.<br />
Der Speicher besteht aus einem 40 Fuß<br />
High Cube Container, einer Energiestation<br />
mit Mittelspanungsschaltanlage sowie einem<br />
Trafo und Wechselrichter und ist an das<br />
20 KV Netz angeschlossen. Bei dem Batteriecontainer<br />
h<strong>and</strong>elt es sich um einen klimatisierten<br />
Isoliercontainer, um die Batterien<br />
möglichst schonend zu beh<strong>and</strong>eln und somit<br />
eine lange Lebensdauer zu garantieren.<br />
Verbaut sind insgesamt 28 Racks mit jeweils<br />
12 Batteriemodul-Einschüben, die in Summe<br />
eine Leistung von 3,0 MW erbringen<br />
können.<br />
Durch seinen intelligenten Aufbau ist das<br />
System eigensicher und schaltet im Fehlerfall<br />
selbstständig ab. Das Klimatisierungskonzept<br />
sieht vor, den Wechselrichter nur<br />
passiv zu kühlen, während der Batterieraum<br />
aktiv gekühlt bzw. geheizt wird. Dies er<strong>for</strong>derte<br />
eine räumliche Trennung von Wechselrichter<br />
und Batterien, was aber zu einer<br />
erhöhten Systemsicherheit beiträgt.<br />
Aktuell realisieren juwi und Smart Power<br />
in Baden-Württemberg ein weiteres Speicherprojekt<br />
in Verbindung mit erneuerbaren<br />
Energien: Den Solarpark Seckach im<br />
Neckar-Odenwald-Kreis. Anfang 2023 soll<br />
der 9,8 Megawatt starke Solarpark Seckach<br />
mit dem 3,7 Megawatt starken Batteriespeicher<br />
(3,7 MWh) ans Netz gehen. Betrieben<br />
wird die Anlagenkombination vom Mannheimer<br />
Energieunternehmen MVV.<br />
„Das Thema Speicherfähigkeit von Strom<br />
aus regenerativen Quellen gewinnt aktuell<br />
weiter an Dynamik und wird künftig eine<br />
noch wichtigere Rolle spielen. Umso mehr<br />
freuen wir uns, nach dem Auftakt in<br />
Schmölln ein weiteres Speicherprojekt mit<br />
Smart Power umzusetzen,“ sagt juwi-Vorst<strong>and</strong><br />
Christian Arnold.<br />
Thorsten Klöpper, Geschäftsführer der<br />
Smart Power GmbH: „Als Pionier von intelligenten<br />
Speichertechnologien freuen wir uns<br />
mit juwi einen starken und verlässlichen<br />
Partner an unserer Seite zu haben. Gemeinsam<br />
werden wir weitere Meilensteine der<br />
Energiewende realisieren.“<br />
LL<br />
www.smart-power.net (222341610)<br />
Bio-Fernwärme: Lustenau geht<br />
weg vom Gas und Öl<br />
(lega) Die Gemeinde Lustenau plant gemeinsam<br />
mit der Kärntner Kelag Energie &<br />
Wärme und dem Lustenauer Kurt Rauch ein<br />
Biomasse-Heizwerk und ein Fernwärmenetz<br />
für Lustenau. Alle öffentlichen Gebäude wie<br />
Schulen oder Kindergärten, große Firmen<br />
im Millennium Park und Industrie Nord und<br />
Privathäuser sollen mit der Wärme aus Biomasse<br />
für Heizung und Warmwasser versorgt<br />
werden. „Wir haben das mittelfristige<br />
Ziel, über ein etwa 12 Kilometer langes<br />
Fernwärmenetz etwa 100 bis 200 Gebäude<br />
in Lustenau mit rund 15 bis 20 Millionen<br />
Kilowattstunden umweltfreundlicher Wärme<br />
aus Biomasse zu beliefern“, erläutert<br />
Adolf Melcher, Geschäftsführer der Kelag<br />
Energie & Wärme. Dadurch werden jährlich<br />
rund 3.000 Tonnen CO 2 eingespart.<br />
Lustenaus Energieraumplan hat bereits<br />
2019 augenscheinlich gemacht, was derzeit<br />
durch die aktuellen Ereignisse noch an Brisanz<br />
gewonnen hat: Wir müssen unseren<br />
Energieverbrauch reduzieren und erneuerbare<br />
Energie nutzen. Wie vielerorts sind<br />
auch in Lustenau Öl und Gas die dominierenden<br />
Energieträger, nur ein knappes<br />
Zehntel des gesamten Energieverbrauchs im<br />
Ort stammt aus erneuerbaren Energiequellen.<br />
172 Millionen Kilowattstunden beträgt<br />
der jährliche Gesamtenergiebedarf von Lustenau,<br />
46.500 Tonnen CO 2 werden dabei<br />
ausgestoßen. Das soll sich jetzt ändern. Erneuerbare<br />
Energien mit Hauptaugenmerk<br />
auf Biomasse sollen künftig eine Hauptrolle<br />
spielen und Klimaschutz-Maßnahmen den<br />
Energieverbrach senken, lautet der Plan der<br />
Gemeinde. So soll der CO 2 -Ausstoß um<br />
mehr als 90 Prozent reduziert werden.<br />
Lokal-regionale Partnerschaft<br />
Möglich macht dies eine lokal-regionale<br />
Partnerschaft des Kärntner Energiedienstleisters<br />
Kelag Energie & Wärme mit der Lustenauer<br />
Rauch LFL von Kurt Rauch. Die Kelag<br />
Energie & Wärme baut das Biomasse-Heizwerk<br />
und das Fernwärmenetz in<br />
Lustenau und ist verantwortlich für das<br />
Kundenmanagement. Die Rauch LFL beschafft<br />
auf lokalem Weg die Biomasse und<br />
unterstützt die Kelag Energie & Wärme beim<br />
Betrieb des Heizwerkes.„Raus aus Öl und<br />
Gas ist ein Gebot der Stunde. Wir wollen<br />
unserer Bevölkerung und zukünftigen <strong>Generation</strong>en<br />
eine sichere, klimaverträgliche<br />
und preisstabile Wärmeversorgung zur Verfügung<br />
stellen. Das macht uns unabhängig<br />
von Energieimporten und erhöht die Wertschöpfung<br />
im Ort“, unterstreicht Bürgermeister<br />
Kurt Fischer.<br />
Die Energiewende ist auch<br />
eine Wärmewende<br />
„Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen<br />
zeigen drastisch unsere Abhängigkeit<br />
von Importen fossiler Energie, deren<br />
Nutzung den Klimaw<strong>and</strong>el befeuert“, erläutert<br />
Manfred Freitag, Sprecher des Vorst<strong>and</strong>es<br />
der Kelag. „Die verstärkte Nutzung erneuerbarer<br />
Energie ist ein Teil der Energiewende,<br />
sie trägt dazu bei, dass wir bei der<br />
Raumwärme auf fossile Energie zumindest<br />
teilweise verzichten können. Anders <strong>for</strong>muliert:<br />
Fernwärme aus Biomasse erlaubt es<br />
14 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Members´News<br />
uns, aus Öl und Gas rauszukommen. Durch<br />
den Einsatz von Biomasse in Lustenau werden<br />
wir pro Jahr rund 3.000 t CO 2 einsparen<br />
können. Das ist aktiver Klimaschutz!“<br />
Geglückte Grundstücksfindung<br />
Das Grundstück, das die Kelag Energie &<br />
Wärme in Zusammenarbeit mit Kurt Rauch<br />
für den Bau des Biomasse-Heizkraftwerkes<br />
gefunden hat, liegt am Glaserweg direkt angrenzend<br />
an die Rauch LFL. Das schafft weitere<br />
Synergien. „Mein Unternehmen beschäftigt<br />
sich schon lange mit Biomasse und<br />
versorgt aktuell auch Heizwerke in Vorarlberg<br />
mit grüner Energie“, berichtet Kurt<br />
Rauch. „Die Tochtergesellschaft der Kelag<br />
Energie & Wärme, die Bionahwärme Lauterach,<br />
gehört bereits zu unseren Kunden. So<br />
lag es nahe, auch in Lustenau die Stärken<br />
meines Unternehmens und der Kelag Energie<br />
& Wärme zu bündeln, um damit einen<br />
großen Schritt in Richtung Klimaschutz zu<br />
machen. Es freut mich sehr, dass ich insbesondere<br />
bei der Findung des idealen Grundstückes<br />
aktiv zur Lösung beitragen konnte.“<br />
Vorzeigeprojekt<br />
Die Bio-Fernwärme in Lustenau soll ein<br />
Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz werden<br />
und ist technologisch auf neuestem<br />
St<strong>and</strong>. Die Aufbringung der regionalen Biomasse<br />
organisiert Kurt Rauch. Vor Ort richtet<br />
die Gemeinde auch eine Sammelstelle<br />
für privaten Grünschnitt ein. Etwa 10 bis 15<br />
Millionen Euro investiert die Kelag Energie<br />
& Wärme, abhängig vom Interesse der möglichen<br />
Kunden. „Wegen der aktuellen Rahmenbedingungen<br />
und der sehr interessanten<br />
Förderungen erwarten wir ein starkes<br />
Interesse für die Fernwärme aus Biomasse“,<br />
sagt Adolf Melcher.<br />
Biomasse-Heizwerk<br />
und Fernwärmenetz<br />
• Investitionen Kelag Energie & Wärme:<br />
10-15 Mio. Euro<br />
• Hausanschlüsse: 100-200<br />
• Trassenlänge: 12 km<br />
• CO 2 -Einsparung: 3.000 t/Jahr<br />
• Bau Biomasseheizwerk und Fernwärmenetz:<br />
Frühjahr 2024<br />
• Beginn der Wärmelieferung: Herbst 2024<br />
• Mögliche weitere Ausbauten: ab 2024<br />
LL<br />
www.kelag.at (222341936)<br />
LEAG zur Einsatzfähigkeit<br />
der Jänschwalder Kraftwerksblöcke<br />
E und F<br />
• Ergänzungen im Ersatzkraftwerkebereitstellungsgesetz<br />
sind er<strong>for</strong>derlich<br />
(leag) Um die derzeit in der Sicherheitsbereitschaft<br />
befindlichen Blöcke E und F des<br />
Kraftwerks Jänschwalde in den kommenden<br />
Monaten wie vom Gesetzgeber gewünscht<br />
zur Sicherung der Energieversorgung am<br />
Strommarkt – in deutlich höherem Umfang<br />
als in der Sicherheitsbereitschaft noch vorgesehen<br />
– einsetzen zu können, sind Ergänzungen<br />
im Entwurf des „Ersatzkraftwerkbereitstellungsgesetzes“<br />
er<strong>for</strong>derlich. Darauf<br />
verweist LEAG im Vorfeld der öffentlichen<br />
Anhörung zum Gesetzentwurf im Bundestagsausschuss<br />
für Klimaschutz und Energie.<br />
Dies betrifft sowohl die seit dem Jahr 2021<br />
verschärften Immissionsschutzauflagen für<br />
Braunkohlekraftwerke als auch die Feststellung<br />
der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit<br />
der die Kraftwerke versorgenden<br />
Tagebaue.<br />
LEAG ist bereit, den aufgrund der geopolitischen<br />
Lage er<strong>for</strong>derlichen zusätzlichen<br />
Beitrag zur sicheren Stromversorgung in<br />
Deutschl<strong>and</strong> zu leisten. Jedoch muss die<br />
Bundesregierung die Jänschwalder Kraftwerksblöcke<br />
E und F für die Dauer ihres geplanten<br />
Einsatzes von den Auflagen der 13.<br />
Verordnung des Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten<br />
befreien. Grund dafür ist, dass eine<br />
den neuen An<strong>for</strong>derungen entsprechende<br />
technische Nachrüstung, wie sie bei den<br />
weiteren LEAG-Kraftwerksblöcken zum Inkrafttreten<br />
der neuen An<strong>for</strong>derungen erfolgt<br />
ist, in der noch zur Verfügung stehenden<br />
Zeit bis zu einem möglichen Dauerbetrieb<br />
nicht umsetzbar wäre. Hierzu könnte<br />
zum Beispiel die gerade erst im vergangenen<br />
Mai neu geschaffene Möglichkeit einer bundesrechtlichen<br />
Abweichungsregelung auf<br />
der Grundlage des Energiesicherungsgesetzes<br />
genutzt werden.<br />
Darüber hinaus gilt es, die Brennst<strong>of</strong>fversorgung<br />
der Kraftwerke als Grundvorausset-<br />
auS- und WEitErbildunG im bErEich<br />
thermische abfallbeh<strong>and</strong>lung<br />
Fördern Sie die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter und sichern Sie den<br />
Ausbildungsst<strong>and</strong> Ihres Personals mit bedarfsgerechten und modernen<br />
Lehrgängen bei der KWS Energy Knowledge eG (KWS).<br />
Wir bieten Ihnen Kurz- und Sonderlehrgänge sowie kundenspezifische Maßnahmen<br />
zu allen Bereichen der TAB an.<br />
Jetzt neu, entwickelt von KWS und<br />
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA):<br />
geprüfter betriebswärter/-in für thermische Klärschlammbeh<strong>and</strong>lung (dWa)<br />
Die Novellierung der Klärschlammverordnung bedingt den Neubau von Monoverbrennungsanlagen.<br />
Qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter/innen für diesen Bereich!<br />
KWS Energy Knowledge eG<br />
Deilbachtal 199, 45257 Essen, Deutschl<strong>and</strong><br />
Telefon: +49 201 8489–0<br />
Telefax: +49 201 8489–123<br />
Kompetent Weiterentwicklung Sichern<br />
www.kws-eg.com<br />
info@kws-eg.com<br />
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 15
Members´News<br />
zung für die Stromproduktion sicherzustellen.<br />
Dafür ist die bundesgesetzliche Feststellung<br />
der energiepolitisch- und energiewirtschaftlichen<br />
Notwendigkeit der die Kraftwerke<br />
versorgenden Tagebaue er<strong>for</strong>derlich.<br />
Dies kann analog der für Öl- und Steinkohlereservekraftwerke<br />
bereits vorgesehenen<br />
Brennst<strong>of</strong>fbevorratung erfolgen.<br />
Die beiden Jänschwalder 500-MW-Kraftwerksblöcke<br />
E und F befinden sich in der<br />
vierjährigen Sicherheitsbereitschaft. Nach<br />
dem geltenden Gesetz ist ein Einsatz der<br />
Blöcke nur in Notfallsituationen „in einem<br />
begrenzten Zeitraum für wenige Stunden“<br />
zur „Deckung des lebenswichtigen Bedarfs<br />
an Elektrizität“ vorgesehen. Block F sollte<br />
zum 1. Oktober <strong>2022</strong>, Block E zum 1. Oktober<br />
2023 endgültig stillgelegt werden. Während<br />
der Sicherheitsbereitschaft nehmen<br />
die Blöcke nicht am aktiven Marktgeschehen<br />
teil. Die Stromproduktion und Fernwärmeversorgung<br />
von Cottbus und Peitz<br />
übernehmen seitdem die vier in Betrieb<br />
verbliebenen 500-MW-Kraftwerksblöcke<br />
(A-D). So wurde die Stadt Cottbus im Winter<br />
21/22 vollständig aus diesen vier Kraftwerksblöcken<br />
in Jänschwalde mit Fernwärme<br />
versorgt.<br />
Bereits jetzt bereitet sich LEAG auf das<br />
Wiederanfahren der Blöcke E und F für einen<br />
möglichen befristeten Dauerbetrieb vor,<br />
um einen Beitrag zur Versorgungssicherheit<br />
mit Strom und zur Reduzierung des Gasverbrauchs<br />
in Deutschl<strong>and</strong> leisten zu können.<br />
Die „befristete Versorgungsreserve Braunkohle“<br />
sieht aktuell einen Einsatzzeitraum<br />
vom 01.10.<strong>2022</strong> bis maximal zum<br />
31.03.2024 vor. Dafür werden derzeit notwendige<br />
Inst<strong>and</strong>haltungsarbeiten vorgenommen<br />
und zusätzliches Kraftwerks- sowie<br />
Bergbaupersonal eingestellt. Die An<strong>for</strong>derungen,<br />
die an die seit drei bzw. fast vier<br />
Jahren stillstehenden Blöcke für eine Rückkehr<br />
in den Markt gestellt werden, gehen<br />
weit über das in der Sicherheitsbereitschaft<br />
Verlangte hinaus.<br />
Für die weiteren Kraftwerke der LEAG -<br />
Schwarze Pumpe, Boxberg und Block R in<br />
Lippendorf - ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt<br />
kein H<strong>and</strong>lungsbedarf, da ihre Laufzeiten<br />
entsprechend des Kohleausstiegsgesetz<br />
über den 31.03.2024 hinausreichen.<br />
Die nicht in Sicherheitsbereitschaft befindlichen<br />
Blöcke der LEAG-Kraftwerke sind<br />
derzeit zu rund 95% am Strommarkt eingesetzt.<br />
Die geplante Laufzeit der LEAG-Tagebaue<br />
in der Lausitz entsprechend der Revierplanung<br />
des Unternehmens bleibt von<br />
der „befristeten Versorgungsreserve Braunkohle“<br />
unberührt.<br />
LL<br />
www.leag.de (222341745)<br />
LEAG bereitet Genehmigungsantrag<br />
für Innovatives Speicherkraftwerk<br />
vor<br />
• Modulares Kraftwerkskonzept mit Wasserst<strong>of</strong>f-Perspektive<br />
für St<strong>and</strong>ort Jänschwalde<br />
(leag) Mit dem so genannten Scoping ist in<br />
dieser Woche das Genehmigungsverfahren<br />
für die Errichtung und den Betrieb des modular<br />
aufgebauten Innovativen Speicherkraftwerks<br />
Jänschwalde (ISKW) angeschoben<br />
worden. Ein Scoping-Termin dient dazu,<br />
sich im Vorfeld der Antragseinreichung mit<br />
beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher<br />
Belange über die erwarteten An<strong>for</strong>derungen<br />
an den Genehmigungsantrag und<br />
die ihm beizufügenden Gutachten sowie<br />
weitere beizubringende Unterlagen in Bezug<br />
auf Umwelt-, Naturschutz- und Klimaschutzbelange<br />
zu verständigen.<br />
Basis des bislang einzigartigen Konzeptes<br />
der LEAG für ein innovatives Speicherkraftwerk<br />
am Kraftwerksst<strong>and</strong>ort Jänschwalde<br />
ist ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk,<br />
das zunächst mit Erdgas betrieben werden<br />
soll, aber über die technischen Voraussetzungen<br />
verfügt, Erdgas schrittweise durch<br />
Wasserst<strong>of</strong>f zu ersetzen. Die Elektrolyse von<br />
grünem Wasserst<strong>of</strong>f ist in einem weiteren<br />
Modul direkt am St<strong>and</strong>ort des ISKW vorgesehen.<br />
Ein elektro-thermischer Speicher im<br />
industriellen Maßstab (850 MWhth) soll die<br />
komplexe Kraftwerkslösung vervollständigen.<br />
Im Zusammenspiel aller Komponenten<br />
ist es möglich, flexibel und mehrdimensional<br />
zur CO 2 -reduzierten bis CO 2 -freien<br />
Energieerzeugung der Zukunft und damit<br />
zur schrittweisen Dekarbonisierung des<br />
St<strong>and</strong>ortes Jänschwalde beizutragen.<br />
Bei ihrem Projekt stützt sich die LEAG auf<br />
den umfassenden Ausbau Erneuerbarer<br />
Energien, den das Unternehmen auch selbst<br />
in der Lausitz betreibt. Mit dem Windpark<br />
Forst-Briesnig II und dem PV-Energiepark<br />
Bohrau befinden sich derzeit bereits Erzeugungskapazitäten<br />
für Grünstrom in einem<br />
Umfang von etwa 500 MW im Umfeld des<br />
St<strong>and</strong>ortes Jänschwalde im Genehmigungsverfahren.<br />
Mit der Inbetriebnahme des ISKW Jänschwalde,<br />
das je nach Modul-Größe eine<br />
elektrische Bruttoleistung von 560 MW beziehungsweise<br />
870 MW bereitstellen soll,<br />
rechnet die LEAG im Jahr 2028.<br />
LL<br />
www.leag.de (222341747)<br />
Energieerzeugung aus<br />
Wasserst<strong>of</strong>f – DEUTZ und<br />
RheinEnergie starten<br />
gemeinsamen Pilotversuch<br />
(r-e) Startschuss zum gemeinsamen Pilotversuch:<br />
Zwei Kölner Unternehmen mit langer<br />
Tradition, die DEUTZ AG als einer der<br />
weltweit führenden Hersteller von Motoren<br />
und Antriebstechnik und die RheinEnergie<br />
AG als regionaler Energieversorger mit<br />
einem klaren Bekenntnis zur Energiewende,<br />
erproben die stationäre klimaneutrale Energieerzeugung<br />
auf Basis eines Wasserst<strong>of</strong>fmotors<br />
von DEUTZ.<br />
Für das Leuchtturmprojekt haben die Kooperationspartner<br />
das erste H2-Genset am<br />
RheinEnergie-Heizkraftwerk Niehl in Betrieb<br />
genommen. Die Kombination aus dem<br />
Wasserst<strong>of</strong>fmotor TCG 7.8 H2 mit einem<br />
Generator liefert in der ersten sechsmonatigen<br />
Testphase bis zu 170 Kilovoltampere<br />
(kVA) Leistung. Der so erzeugte Strom wird<br />
direkt in das Kölner Stromnetz eingespeist.<br />
In einem zweiten Schritt soll auch die Abwärme<br />
aus dem Aggregat zur Wärmeerzeugung<br />
genutzt werden. Das Projekt bietet<br />
großes Potenzial für eine dezentrale und<br />
CO 2 -neutrale Energieversorgung in Ballungsräumen.<br />
Dr. Dieter Steinkamp, Vorst<strong>and</strong>svorsitzender<br />
der RheinEnergie, sagt: „Als großstädtischer<br />
Energieversorger sind wir auf Siedlungs-<br />
und Quartierskonzepte spezialisiert.<br />
Ein solcher Motor könnte dazu dienen,<br />
Strom und Wärme vor Ort zu erzeugen.<br />
Kombiniert mit Wärmespeichern, Wärmepumpen,<br />
Solartechnik und Stromspeichern<br />
lassen sich auf diese Weise ganze Siedlungsbereiche<br />
klimaneutral versorgen.“<br />
„Der Pilotversuch zur Erzeugung klimaneutraler<br />
Energie zeigt: Hightech und der<br />
St<strong>and</strong>ort Köln gehören zusammen. Mit der<br />
RheinEnergie haben wir einen starken Partner<br />
gefunden. Wir sind sehr gespannt auf<br />
die Praxiserprobung des TCG 7.8 H2 in unserem<br />
gemeinsamen Zukunftsprojekt“, sagt<br />
Michael Wellenzohn, DEUTZ-Vorst<strong>and</strong> für<br />
Vertrieb, Marketing und Service.<br />
Erste Testläufe des Wasserst<strong>of</strong>fmotors auf<br />
dem Prüfst<strong>and</strong> sowie des H2-Gensets auf<br />
dem Gelände von DEUTZ waren erfolgreich.<br />
Der gemeinsame Pilotversuch ist für den Motorenhersteller<br />
ein wichtiger Schritt auf dem<br />
Weg zur Serienproduktion des TCG 7.8 H2,<br />
die DEUTZ für 2024 plant. Grundsätzlich<br />
eignet sich der Wasserst<strong>of</strong>fmotor mit einer<br />
Leistung von rund 200 Kilowatt für alle Anwendungen<br />
im Einsatz abseits der Straße.<br />
„Schon jetzt verzeichnen wir großes Interesse<br />
unserer Kunden aus allen Anwendungsgebieten<br />
an unserem H2-Motor“, sagt Dr. Markus<br />
Müller, DEUTZ-Vorst<strong>and</strong> für Forschung<br />
& Entwicklung und ergänzt: „Weitere Pilotanwendungen<br />
sind bereits in Planung.“<br />
16 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Members´News<br />
Die Kooperationspartner haben gemeinsam<br />
1,3 Mio. Euro in das Pilotprojekt zur<br />
klimaneutralen Stromerzeugung investiert.<br />
Eine verlässliche dezentrale und treibhausgasfreie<br />
Energieversorgung setzt voraus,<br />
dass die H2-Infrastruktur ausgebaut und<br />
ausreichend grüner Wasserst<strong>of</strong>f zu marktfähigen<br />
Preisen zur Verfügung gestellt wird.<br />
Daher sehen die Partner nun die Politik in<br />
der Pflicht. Ohne eine regulatorische Ausgestaltung<br />
kann der Green Deal nicht gelingen.<br />
LL<br />
www.rheinenergie.de<br />
www.deutz.com (222341530)<br />
RWE nimmt in Irl<strong>and</strong> ihren<br />
größten Batteriespeicher<br />
in Betrieb<br />
• 60-Megawatt-Batteriespeicher gleicht<br />
Netzwerkschwankungen kurzfristig aus<br />
und dient als Backup<br />
• Investition von 25 Million Euro in den<br />
Lisdrum-Batteriespeicher stärkt die Rolle<br />
Erneuerbarer Energien im Zuge der Energiewende<br />
Irl<strong>and</strong>s<br />
Cathal Hennessy, Managing Director von RWE<br />
Renewables Irel<strong>and</strong>: „Wir haben 25 Millionen<br />
Euro in die Entwicklung der Batteriespeicher-Großanlage<br />
in Lisdrumdoagh investiert.<br />
Irl<strong>and</strong> setzt bereits stark auf Erneuerbare Energien,<br />
und Batteriespeicher werden gezielt gefördert.<br />
Irl<strong>and</strong> ist somit für RWE Renewables<br />
die ideale Basis, um das Geschäft mit Batteriespeichertechnologien<br />
weiter auszubauen und<br />
die Energiewende voranzubringen.“<br />
(rwe) RWE hat in der irischen Grafschaft<br />
Monaghan den Vollbetrieb ihres zweiten<br />
und bisher größten Batteriespeichers aufgenommen.<br />
Die drei Kilometer östlich von Monaghan<br />
gelegene 60-Megawatt-Anlage in Lisdrumdoagh<br />
kann in kürzester Zeit Strom ins Netz<br />
einspeisen und so Schwankungen in der<br />
Stromerzeugung ausgleichen. Außerdem<br />
bietet sie eine kurzfristige Reserve zur Überbrückung<br />
von Stromausfällen und trägt so<br />
zu einer stabileren und sichereren Stromversorgung<br />
in Irl<strong>and</strong> bei.<br />
RWE, eines der weltweit führenden Unternehmen<br />
im Bereich der erneuerbaren Energien,<br />
bringt damit nach Stephenstown, Balbriggan<br />
bereits den zweiten Batteriespeicher<br />
in Irl<strong>and</strong> ans Netz. Stephenstown in der<br />
Grafschaft Dublin, ist mit einer Kapazität<br />
von 8,5 MW seit April 2021 in Betrieb.<br />
Windanlagen an L<strong>and</strong> produzierten im ersten<br />
Halbjahr 2020 bereits 37 Prozent des<br />
Energiebedarfs Irl<strong>and</strong>s. Dies unterstreicht<br />
eindeutig die Bedeutung des Marktes für<br />
Onshore-Lösungen. Die grüne Insel hat sich<br />
zum Ziel gesetzt, 80 % des Strombedarfs bis<br />
2030 aus Erneuerbaren Energien zu erzeu-<br />
ACTIVATED<br />
LIGNITE<br />
AT ITS BEST<br />
When it comes to efficient waste gas <strong>and</strong> water<br />
treatment, HOK® Activated Lignite is the ideal<br />
fresh sorbent.<br />
Thanks to our own raw materials base, we are one<br />
<strong>of</strong> the world’s largest producers <strong>of</strong> activated lignite.<br />
This guarantees security <strong>of</strong> supply. The constant<br />
high quality <strong>of</strong> HOK® ensures a reliable separation<br />
<strong>of</strong> harmful substances.<br />
HOK® Activated Lignite.<br />
Good <strong>for</strong> the environment, good <strong>for</strong> business.<br />
www.hok.de<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 17
Members´News<br />
gen. Batteriespeicher wie Lisdrumdoagh<br />
ermöglichen es, auf Frequenzschwankungen<br />
im Netz schnell reagieren zu können,<br />
denn je nach Bedarf wird Strom entweder<br />
gespeichert oder ins Netz eingespeist. So<br />
trägt die Anlage zur effizienten Stabilisierung<br />
des Netzes bei und gewährt gleichzeitig<br />
eine zuverlässige Stromversorgung.<br />
RWE Renewables ist seit 2016 in Irl<strong>and</strong> aktiv<br />
und mittlerweile an zwei St<strong>and</strong>orten<br />
vertreten: In Kilkenny City und Dun Laoghaire<br />
in der Grafschaft Dublin. 2018 baute<br />
das Unternehmen den 10-MW-Onshore-Windpark<br />
Dromadda Beg in der Grafschaft<br />
Kerry, der erste von RWE betriebene<br />
Onshore-Windpark in Irl<strong>and</strong>.<br />
Das irische Entwicklerteam prüft derweil<br />
weitere Projekte im Bereich der Erneuerbaren<br />
Energien. Anfang des Jahres wurde so<br />
ein Planungsantrag für den 62-MW-Onshore-Windpark<br />
Lyre in der Grafschaft Cork eingereicht.<br />
Darüber hinaus entwickelt RWE<br />
auf See in Partnerschaft mit Saorgus Energy<br />
den Offshore-Windpark Dublin Array mit einer<br />
installierten Leistung von 600 bis 900<br />
MW und treibt l<strong>and</strong>esweit neue Wind-, Solar-<br />
und Batteriespeicherprojekte voran.<br />
LL<br />
www.rwe.com (222341734)<br />
Niederaußemer CO 2 -Wäsche<br />
jetzt 100.000 Stunden in Betrieb<br />
• Niederaußemer CO 2 -Wäsche jetzt<br />
100.000 Stunden in Betrieb<br />
• Feierstunde zum Betriebsjubiläum der<br />
Forschungsanlage: Die Technologie<br />
bleibt wichtig, weil sich CO 2 in industriellen<br />
Produktionsverfahren auch künftig<br />
nicht ganz vermeiden lässt.<br />
• <strong>International</strong>e Experten in Sachen<br />
CO 2 -Abscheidung nehmen an Feier teil<br />
(rwe) Das ist Weltrekord: Die CO 2 -Wäsche<br />
im RWE Innovationszentrum Niederaußem<br />
hat ihre 100.000.Betriebsstunde absolviert.<br />
Damit war die 2009 errichtete Anlage bisher<br />
fast elfeinhalb Jahre im Betrieb, um das<br />
Treibhausgas aus Rauchgasen des benachbarten<br />
Kraftwerks zu waschen. Keine <strong>and</strong>ere<br />
Anlage dieser Art hat eine ähnliche Laufleistung<br />
erreicht. Aus diesem Anlass hatte<br />
RWE Power nach Niederaußem eingeladen.<br />
Das abgetrennte CO 2 wird dort in mehreren<br />
Projekten für die Herstellung nachhaltiger<br />
Treibst<strong>of</strong>fe und Grundst<strong>of</strong>fe verwendet<br />
und auch externen Partnern für Forschungszwecke<br />
zur Verfügung gestellt. „Unsere<br />
CO 2 -Wäsche ist seit Jahren eine wichtige<br />
Platt<strong>for</strong>m für die internationale Zusammenarbeit<br />
bei der Optimierung dieser für den<br />
sektorübergreifenden Klimaschutz essentiellen<br />
Technik“, beschrieb RWE Power-Vorst<strong>and</strong><br />
Dr. Lars Kulik die Bedeutung der Forschungsanlage.<br />
Feierstunde zum Betriebsjubiläum der Forschungsanlage: Die Technologie bleibt wichtig, weil<br />
sich CO 2 in industriellen Produktionsverfahren auch künftig nicht ganz vermeiden lässt.<br />
An der Feier im RWE Innovationszentrum<br />
nahmen rund 50 Experten aus Industrie,<br />
Forschung und Projektträgern aus den Niederl<strong>and</strong>en,<br />
Norwegen, Großbritannien und<br />
den USA teil. Unter ihnen waren auch die<br />
Partner des transatlantischen Forschungsprojektes<br />
LAUNCH; sie befassen sich mit der<br />
Frage: Wie kann man bei der CO 2 -Abscheidung<br />
weiter Waschmittel sparen und damit<br />
ihre Wirtschaftlichkeit steigern? Genau wie<br />
Motoröl in einem Auto während des Betriebes<br />
langsam altert, verliert auch das<br />
CO 2 -Waschmittel mit der Zeit durch Oxidation<br />
an Aktivität. „Die weltweit einzigartigen<br />
Langzeittests in Niederaußem sind eine<br />
wichtige Säule für LAUNCH. Sie helfen der<br />
Fachwelt, die Alterung von CO 2 -Waschmitteln<br />
zu verstehen und innovative Gegenmaßnahmen<br />
zu testen“, beschreibt Tilman<br />
Bechthold, Leiter Forschung und Entwicklung<br />
bei RWE Power, die Rolle der Anlage.<br />
Die neuen Erkenntnisse helfen dabei, die<br />
Auslegung und den Betrieb von CO 2 -Abtrennungen<br />
zum Beispiel an Klärschlamm-, Biomasse-<br />
und Müllverbrennungsanlagen zu<br />
vereinfachen. Ebenso dienen sie dazu, den<br />
Aufbau einer Kohlenst<strong>of</strong>f-Kreislaufwirtschaft<br />
zu beschleunigen. „Wenn wir die Verwertung<br />
des CO 2 und die regenerative Stromerzeugung<br />
mitein<strong>and</strong>er koppeln, haben wir einen<br />
geschlossenen Kohlenst<strong>of</strong>fkreislauf für klimaneutrale<br />
Chemikalien und Treibst<strong>of</strong>fe.<br />
Das wiederum ist ein großer Schritt in Richtung<br />
Sektorenkopplung und bedeutet mehr<br />
Sicherheit in der Strom- und Rohst<strong>of</strong>fversorgung,<br />
höhere Stabilität im Stromnetz und<br />
weitere deutliche Emissionsminderungen“,<br />
beschrieb RWE Power-Vorst<strong>and</strong> Kulik den<br />
weitreichenden Nutzen der Forschung am<br />
Innovationszentrum in Niederaußen.<br />
Das LAUNCH-Projekt wird von der EU und<br />
den Regierungen der beteiligten Länder gefördert.<br />
Das Gesamtbudget des über drei<br />
Jahre laufenden Projektes beläuft sich auf<br />
rund 7,2 Millionen Euro. Die Forschungsaktivitäten<br />
von RWE werden vom Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Klimaschutz in<br />
Höhe von fast 700.000 Euro gefördert.<br />
Hintergrund: Die CO 2 -Wäsche im RWE<br />
Innovationszentrum Niederaußem<br />
Im Rahmen von europäischen Forschungsprojekten<br />
treibt RWE die Entwicklung der<br />
sogenannten CO 2 -Wäsche-Technik voran.<br />
Als erste Anlage an einem Kraftwerk in<br />
Deutschl<strong>and</strong> wurde 2009 in Kooperation mit<br />
BASF und Linde die Pilotanlage zur CO 2 -Wäsche<br />
im Innovationszentrum in Niederaußem<br />
errichtet. Dort wird beispielsweise geklärt,<br />
mit welchen Waschmitteln das Rauchgas<br />
besonders wirksam und wirtschaftlich<br />
von CO 2 gereinigt werden kann. Das CO 2<br />
wird mit einem Waschmittel im Absorber<br />
abgetrennt und im Desorber regeneriert. Anschließend<br />
kann es für die Herstellung von<br />
Treibst<strong>of</strong>fen und Grundchemikalien sowie<br />
für die Energiespeicherung genutzt werden.<br />
Die CO 2 -Wäsche-Pilotanlage in Niederaußem<br />
versorgt Projekte zur CO 2 -Nutzung und<br />
Sektorenkopplung mit hochreinem CO 2 und<br />
dient zudem als Testplatt<strong>for</strong>m für die weitere<br />
Optimierung der Abtrenntechnik.<br />
In der Pilotanlage des Innovationszentrums<br />
werden rund 300 Kilogramm Kohlendioxid<br />
pro Stunde abgeschieden. Dies entspricht<br />
bei der verarbeiteten Rauchgasmenge<br />
einem Abtrennungsgrad von 90 Prozent.<br />
Die Anlage verfügt über eine ausgezeichnete<br />
Verfügbarkeit von mehr als 97 Prozent und<br />
ist seit 2009 quasi kontinuierlich in Betrieb.<br />
Das Verfahren und die für die CO 2 -Wäsche<br />
benötigte Technologie sind so konzipiert,<br />
dass eine große B<strong>and</strong>breite von industriellen<br />
Prozessen mit den entsprechenden Anlagen<br />
ausgerüstet werden kann. Hierzu gehören<br />
zum Beispiel Biomasse-, Müll- und Klärschlammverbrennungsanlagen<br />
sowie Zement-<br />
und Stahlwerke.<br />
LL<br />
www.rwe.com (222341739)l<br />
18 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Industry<br />
News<br />
Company<br />
Announcements<br />
E.ON und Deutsche ErdWärme<br />
kooperieren, um Wärmewende<br />
zu beschleunigen<br />
• Partner verfolgen das Ziel, grüne Wärme<br />
zu attraktiven Preisen bereitzustellen<br />
und regionale Energieerzeugung zu stärken<br />
• Tiefe Geothermie könnte in Deutschl<strong>and</strong><br />
mehr als ein Viertel des jährlichen Wärmebedarfes<br />
(über 300 TWh) abdecken<br />
• Gemeinsame Projekte sollen erste Potenziale<br />
in Nordrhein-Westfalen erschließen<br />
(eon) Ohne eine erfolgreiche Wärmewende<br />
kann die Energiewende nicht gelingen. Vor<br />
diesem Hintergrund haben das Energieunternehmen<br />
E.ON und die Deutsche ErdWärme<br />
(DEW) eine Kooperationsvereinbarung<br />
für die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung<br />
von Geothermie-Projekten unterzeichnet.<br />
Ziel der Zusammenarbeit ist es,<br />
regional erzeugte, bezahlbare grüne Energie<br />
für die Wärmewende bereitzustellen und<br />
damit die Energiesicherheit zu stärken. Die<br />
beiden Unternehmen werden ihr Know-how<br />
bündeln, um in Tiefen von etwa 1.000 bis<br />
4.000 Metern gespeicherte Wärmeenergie<br />
zu gewinnen und in Form von grüner Wärme<br />
für Verbraucher bereitzustellen.<br />
„Die Wärmewende ist eine Mammutaufgabe<br />
und er<strong>for</strong>dert in vielen Bereichen ein<br />
konsequentes Neudenken. Klar ist, dass es<br />
für eine CO 2 -neutrale Wärmeversorgung<br />
nicht die eine Lösung gibt. Insbesondere die<br />
tiefe Erdwärme kann im zukünftigen Technologiemix<br />
eine entscheidende Rolle spielen,<br />
obwohl sie in Deutschl<strong>and</strong> heute noch<br />
am Anfang steht“, so Alex<strong>and</strong>er Fenzl, verantwortlich<br />
für Kundenlösungen bei E.ON<br />
in Deutschl<strong>and</strong>. „Die Kooperation mit der<br />
DEW wird uns zudem dabei helfen, die zuletzt<br />
stark gestiegene Nachfrage gezielt zur<br />
Schaffung neuer grüner Infrastrukturen zu<br />
nutzen.“<br />
„Erdwärme kann fossile Energieträger in<br />
den Bereichen Heizung und Warmwasser<br />
sowie als industrielle Prozesswärme klimaneutral<br />
ersetzen. Für bevölkerungsreiche,<br />
von Industrie und Gewerbe geprägte Regionen<br />
ist sie deshalb besonders attraktiv.<br />
Durch die Kooperation mit E.ON, die auch<br />
Bestätigung unserer Kompetenzen bei der<br />
Projektentwicklung ist, schaffen wir gemeinsam<br />
ideale Voraussetzungen, um dieses<br />
Potenzial für Nordrhein-Westfalen bestmöglich<br />
nutzbar zu machen“, sagt Herbert<br />
Pohl, Gründer und Geschäftsführer der<br />
DEW, Deutschl<strong>and</strong>s größtem privaten Projektentwickler<br />
im Bereich der tiefen Geothermie.<br />
Geothermie unverzichtbar für eine erfolgreiche<br />
Wärmewende<br />
Ein Blick auf den Energiebedarf in<br />
Deutschl<strong>and</strong> zeigt, welchen erheblichen<br />
Einfluss die Wärmeversorgung auf das Erreichen<br />
der Klimaziele hat: Rund 40 Prozent<br />
des Energieverbrauchs entfallen heute auf<br />
den Wärmesektor. Öl und Gas spielen beim<br />
Heizen von Wohnungen, Büros und Gewerbe<br />
nach wie vor eine führende Rolle. Die<br />
Folge sind hohe CO 2 -Emissionen. Als erneuerbare<br />
und unerschöpfliche Energiequelle<br />
vor Ort kann die tiefe Erdwärme einen großen<br />
Beitrag zur Dekarbonisierung leisten.<br />
Sie liefert Energie wetterunabhängig, zuverlässig<br />
und zu stabilen Preisen und belegt<br />
dabei nur wenig Fläche.<br />
Laut Erhebungen des Fraunh<strong>of</strong>er Instituts<br />
könnte die tiefe Erdwärme in Deutschl<strong>and</strong><br />
über 300 TWh und damit ein Viertel des<br />
jährlichen Wärmebedarfes abdecken. Im<br />
Unterschied zur oberflächennahen Erdwärme<br />
werden bei der Tiefengeothermie Lagerstätten<br />
bis mehrere Kilometer unter der Erdoberfläche<br />
erschlossen.<br />
Im Rahmen der Kooperation planen E.ON<br />
und DEW die Umsetzung erster Pilotprojekte<br />
in Nordrhein-Westfalen. E.ON verfügt<br />
über umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung<br />
und Skalierung von Projekten mit<br />
unterschiedlichsten kommunalen und industriellen<br />
Kunden sowie in der Anbindung<br />
neuer Energiequellen an die notwendigen<br />
Verteilungsinfrastrukturen. Die DEW ist auf<br />
tiefe Geothermie spezialisiert. Sie bringt vor<br />
allem das geologische Knowhow mit, um<br />
Erdwärmeanlagen auf dem neuesten technologischen<br />
St<strong>and</strong> zu planen.<br />
Die Zusammenarbeit reicht von der Identifikation<br />
geeigneter Projekte über die Umsetzung<br />
entsprechender Machbarkeitsstudien,<br />
die Durchführung der Genehmigungsverfahren,<br />
die Entwicklung attraktiver Projektportfolios<br />
und Finanzierungsmodelle bis hin<br />
zum Kraftwerksbau und dem Betrieb der<br />
Anlagen. Zudem h<strong>of</strong>fen die Kooperationspartner<br />
durch die Bündelung ihrer Kompetenzen<br />
auf deutliche Zeiteinsparungen bei<br />
der Projektrealisierung.<br />
Deutsche ErdWärme:<br />
Die Deutsche ErdWärme ist Deutschl<strong>and</strong>s<br />
größter privater Entwickler und Betreiber<br />
von Erdwärmeanlagen. Das 2017 gegründete<br />
Unternehmen ist auf tiefe Geothermie<br />
spezialisiert und plant Erdwärmeanlagen<br />
Industry News<br />
MEORGA<br />
MSR-Spezialmessen<br />
Prozess- u. Fabrikautomation<br />
Fachmesse für<br />
Prozess- und Fabrikautomation<br />
Messtechnik<br />
Steuerungstechnik<br />
Regeltechnik<br />
Automatisierungstechnik<br />
Prozessleitsysteme<br />
+ 36 begleitende Fachvorträge<br />
Der Eintritt zur Messe<br />
und die Teilnahme an den<br />
Fachvorträgen ist für die<br />
Besucher kostenlos.<br />
Wirtschaftsregion Rhein-Ruhr<br />
Bochum<br />
26.10.<strong>2022</strong><br />
8.00 bis 16.00 Uhr<br />
RuhrCongress Bochum<br />
Stadionring 20<br />
44791 Bochum<br />
BESUCHER-<br />
REGISTRIERUNG<br />
er<strong>for</strong>derlich für Einlass-Code<br />
Meorga<br />
Messen<br />
2023:<br />
Leverkusen<br />
Hamburg<br />
Ludwigshafen<br />
L<strong>and</strong>shut<br />
www.meorga.de<br />
26.04.2023<br />
21.06.2023<br />
13.09.2023<br />
18.10.2023<br />
MEORGA GmbH - Sportplatzstr. 27 - 66809 Nalbach<br />
Telefon <strong>vgbe</strong> 06838 <strong>energy</strong> 8960035 <strong>journal</strong> - info@meorga.de<br />
7 · <strong>2022</strong> | 19
Industry News<br />
auf dem neuesten technologischen St<strong>and</strong>.<br />
Aktuell realisiert die Deutsche ErdWärme<br />
mehrere Kraftwerksprojekte am Oberrhein,<br />
die erneuerbaren Strom und Wärme aus<br />
Geothermie bereitstellen und für die umliegenden<br />
Städte und Gemeinden attraktive<br />
Angebote für eine erfolgreiche Energie- und<br />
Wärmewende schaffen.<br />
LL<br />
www.eon.com (222341721)<br />
www.deutsche-erdwaerme.de<br />
Emerson unterstüzt Albioma<br />
beim Wechsel zu<br />
erneuerbaren Energien<br />
• Multi-Millionen-Dollar-Projekt auf La<br />
Réunion ermöglicht die Umstellung des<br />
Kraftwerks auf Biomasse, wodurch die<br />
Emissionen um 84 % gesenkt werden<br />
(emerson) Das Technologie- und S<strong>of</strong>twareunternehmen<br />
Emerson wurde vom<br />
unabhängigen französischen Energieversorger<br />
Albioma damit beauftragt, bei der Umstellung<br />
des Bois Rouge-Kohlekraftwerks<br />
auf 100 % erneuerbare Energie zu unterstützen.<br />
Albioma verfolgt das Ziel, seine bestehenden<br />
Kraftwerke für fossile Brennst<strong>of</strong>fe<br />
auf erneuerbare Energien umzustellen. Mit<br />
den Automatisierungssystemen und der<br />
S<strong>of</strong>tware von Emerson kann das Bois Rouge-Kohlekraftwerk<br />
auf die Nutzung von Biomasse<br />
umgestellt werden.<br />
Das mehrere Millionen Dollar umfassende<br />
Projekt ist das jüngste Beispiel dafür, wie die<br />
Technologien von Emerson Kunden dabei<br />
helfen, auf nachhaltigere Energien umzusteigen.<br />
Das Kraftwerk ist eines von drei<br />
Anlagen, die Albioma auf La Réunion im Indischen<br />
Ozean betreibt. Es wird vollständig<br />
auf die Nutzung von Biomasse (Holzpellets)<br />
umgerüstet werden. Die Umrüstung der<br />
108-Megawatt-Anlage wird die Treibhausgasemissionen<br />
um ca. 640.000 Tonnen<br />
CO 2 -Äquivalente pro Jahr senken, was im<br />
Vergleich zum aktuellen Betriebsniveau einer<br />
Senkung der direkten Emissionen um<br />
84 % entspricht.<br />
„Das Ziel unseres Unternehmens ist es, bis<br />
spätestens 2030 einen Anteil an erneuerbaren<br />
Energien von knapp 100 % zu erreichen,<br />
und die vollständige Einstellung des Kohlebetriebs<br />
an unserem Vorzeigest<strong>and</strong>ort stellt<br />
einen wichtigen Meilenstein im Rahmen<br />
dieser grünen Revolution dar“, so Pascal<br />
Langeron, Chief Operating Officer von Albioma<br />
auf La Réunion. „Emerson ist ein<br />
Automatisierungspartner, zu dem wir ein<br />
vertrauensvolles Verhältnis haben und dessen<br />
umfassende Erfahrung und Expertise<br />
auf dem Gebiet der Biomassekraftwerke einen<br />
entscheidenden Einfluss auf den fristgerechten<br />
Abschluss dieses Projekts haben<br />
werden.“<br />
Emerson unterstüzt Albioma beim Wechsel zu erneuerbaren Energien.<br />
Umstellung des Bois Rouge-Kohlekraftwerks auf 100 % erneuerbare Energie.<br />
Die Bois Rouge-Anlage besteht aus drei<br />
Kraftwerken. Zwei Kraftwerke werden bereits<br />
von Emersons dezentralem Prozessleitsystem<br />
(DCS) Ovation gesteuert, das zur<br />
Nutzung von Biomasse angepasst werden<br />
wird. Das dritte Kraftwerk wird durch ein<br />
neues Ovation-System ersetzt. Im Rahmen<br />
der Modernisierung der Kraftwerke werden<br />
zudem neue Turbinenschutz- und Zust<strong>and</strong>süberwachungssysteme,<br />
Sicherheitssysteme<br />
für die Kesselanlagen sowie Aktualisierung<br />
der Kesselkreisregelungen und Messum<strong>for</strong>mer<br />
eingeführt.<br />
Um sicherzustellen, dass das Projekt in<br />
dem verfügbaren Zeitrahmen fertiggestellt<br />
wird – eine wichtige Bedingung von Albioma<br />
–, wird Emerson seine Methoden für<br />
Projektsicherheit, seine digitalen Technologien<br />
und seine S<strong>of</strong>twarekompetenz bereitstellen.<br />
Neben der lokalen technischen Unterstützung<br />
für das Projekt wird Emerson<br />
seine Kollaborationsplatt<strong>for</strong>m Remote<br />
Virtual Office (RVO) bereitstellen, eine sichere<br />
virtuelle Engineering- und Prüfumgebung,<br />
mit der Albioma Zugriff auf die Ressourcen<br />
und den kontinuierlichen Support<br />
von Emerson hat, um die Risiken und Kosten<br />
Projekts zu reduzieren.<br />
„Da wir Kunden bei ihren Umstellungsprojekten<br />
unterstützen, spielt Emerson beim<br />
weltweiten Umstieg auf nachhaltige Energien<br />
eine überaus wichtige Rolle“, so Bob Yeager,<br />
President von Power & Water Solutions<br />
bei Emerson. „Mithilfe unserer Automatisierungstechnologien,<br />
S<strong>of</strong>tware, Lösungen<br />
und Erfahrung in puncto Biomasseprojekten<br />
wird Albioma sein Ziel, dass die Bois Rouge-Anlage<br />
Spitzenleistungen erbringt und<br />
durch die erhebliche Senkung der Kohlendioxidemissionen<br />
gleichzeitig die Umwelt<br />
schont, erreichen.“<br />
Die Umstellung wird während einer geplanten<br />
Unterbrechung im Juni <strong>2022</strong> beginnen<br />
und soll innerhalb von fünf Monaten<br />
abgeschlossen werden.<br />
LL<br />
www.emerson.com (222341622)<br />
Lhyfe und Chantiers de<br />
l’Atlantique kooperiere bei<br />
erneuerbarer Wasserst<strong>of</strong>fproduktion<br />
auf See<br />
(lhyfe) Lhyfeund Chantiers de l’Atlantique,<br />
ein weltweit führendes Unternehmen für<br />
den Bau von hochkomplexen Schiffen und<br />
Offshore Technik, haben eine gemeinsame<br />
Absichtserklärung für die Entwicklung von<br />
Offshore-Wasserst<strong>of</strong>fproduktionsanlagen<br />
unterzeichnete.<br />
Die Kooperation soll die Produktion von<br />
grünem Wasserst<strong>of</strong>f für die Industrie so<br />
nachhaltig wie möglich gestalten und<br />
gleichzeitig die Expertise von Lhyfe im<br />
Offshore-Bereich zu stärken. Die Nähe zu<br />
Offshore-Windparks bietet hierfür optimale<br />
Voraussetzungen, die benötigte Energie ausreichend<br />
zu erhalten und die Wasserst<strong>of</strong>f-Produktion<br />
leistungsfähig und emissionsarm<br />
umzusetzen. Ziel ist es, die erneuerbare<br />
Wasserst<strong>of</strong>fproduktion auf See und in<br />
Hafengebieten zu entwickeln. Die Produktionslösungen<br />
sollen für eine Mindestkapazität<br />
von 100 MW entwickelt und auf Fundamenten<br />
auf dem Meeresboden oder schwimmenden<br />
Platt<strong>for</strong>men installiert werden.<br />
Lhyfe und Chantiers de l’Atlantique wollen<br />
durch diese Absichtserklärung ihre Zusammenarbeit<br />
vertiefen. Beide Unternehmen<br />
kooperieren bereits seit 18 Monaten im Rahmen<br />
des SEM-REV-Projekts. Gemeinsam<br />
bereiten die Partner derzeit den Start des<br />
weltweit ersten Offshore Elektrolyseurs vor<br />
der französischen Küste im September <strong>2022</strong><br />
vor. Das neue Projekt soll die Erfahrungen<br />
der SEM-REV-Initiative bündeln und das<br />
System zur Skalierung aufbereiten. Chantiers<br />
de l’Atlantique entwirft, baut und installiert<br />
die Platt<strong>for</strong>men, die für die Offshore<br />
Projekte die netzgebundenen und netzunabhängigen<br />
Windparks notwendig sind. Lhyfe<br />
tritt als Projektierer und Produzent auf und<br />
ist für die Planung sowie den Betrieb der<br />
Elektrolyse-Anlagen zuständig.<br />
„Die Offshore-Produktion von grünem<br />
Wasserst<strong>of</strong>f ist ein zentraler Schlüssel für<br />
die europäische Wasserst<strong>of</strong>fbranche und die<br />
20 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
angestrebte Unabhängigkeit. Die Erweiterung<br />
unseres Projektportfolios durch die<br />
Zusammenarbeit mit Chantiers de l’Atlantique<br />
stärkt unsere Expertise und unterstreicht<br />
unsere Bestrebungen, dieses enorme<br />
Potenzial zu nutzen“, so Luc Graré, Head<br />
<strong>of</strong> <strong>International</strong> Business von Lhyfe.<br />
Registration<br />
& Programme<br />
Industry News<br />
Chantiers de l’Atlantique will durch die<br />
Arbeit mit Offshore-Wasserst<strong>of</strong>f die eignen<br />
Umspannwerke emissionsarmer gestalten<br />
und so eine führende Treibkraft der Energiewende<br />
werden. Das Unternehmen hat bereits<br />
erfolgreich vier Umspannwerke für<br />
Offshore-Windparks an große Energieunternehmen<br />
in Europa geliefert.<br />
Lhyfe ist als eines der führenden Unternehmen<br />
für die Produktion von grünem Wasserst<strong>of</strong>f<br />
bereits seit seiner Gründung Teil einer<br />
groß angelegten Forschungsgruppe für die<br />
Offshore-Wasserst<strong>of</strong>fproduktion. Hierfür<br />
wurden bereits mehrere Partnerschaften geschlossen.<br />
Die Wasserst<strong>of</strong>f-Produktionsanlagen<br />
des Unternehmens sind immer mit erneuerbaren<br />
Energiequellen verbunden, um<br />
100% grünen Wasserst<strong>of</strong>f für lokale Industrien<br />
und den Transportsektor zu produzieren.<br />
Insgesamt ist Lhyfe europaweit an 93 Projekten<br />
beteiligt und damit eine künftig installierte<br />
Gesamtkapazität von über 4,8 GW.<br />
<strong>vgbe</strong>/VERBUND Expert Event<br />
Digitalisation in<br />
Hydropower <strong>2022</strong><br />
17 <strong>and</strong> 18 November <strong>2022</strong><br />
Vienna, Austria*<br />
LL<br />
www.lhyfe.com (222341631)<br />
XERVON Wind baut<br />
Geschäftsaktivitäten weiter aus<br />
• Zukauf der GWS Tech Service GmbH<br />
stärkt das Leistungsangebot und erweitert<br />
den Marktzugang<br />
(xervon) Die auf technische Services für die<br />
Windenergiebranche spezialisierte XERVON<br />
Wind GmbH CONTACT erwirbt & die REGISTRATION<br />
GWS Tech Service<br />
GmbH. Im Rahmen des Erwerbs werden sowohl<br />
alle FACHLICHE Aktivitäten des KOORDINATION<br />
Unternehmens als<br />
auch alle Stephanie Mitarbeiter Wilmsen<br />
übernommen.<br />
GWS t ist +49 vorrangig 201 8128 auf 244 die Windenergiebranche<br />
e kissy@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
fokussiert und für Hersteller wie<br />
Betreiber von Windkraftanlagen tätig. Zu<br />
den operativen Schwerpunkten zählen Services<br />
rund TEILNEHMER<br />
um Aufbau, Abbau, Wartung und<br />
Inbetriebnahme<br />
Diana Ringh<strong>of</strong>f<br />
von Hydraulikanlagen,<br />
aber auch Bauteilprüfungen, Checks prüfpflichtiger<br />
t +49<br />
Ausrüstungskomponenten<br />
201 8128 232<br />
sowie<br />
Schulungen e <strong>vgbe</strong>-dampfturb@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
in der Hydraulik- und Verschraubungstechnik.<br />
Im Bereich Befahranlagen<br />
werden AUSSTELLUNG<br />
Reparaturen und Prüfungen<br />
in Zusammenarbeit mit Überwachungsstellen<br />
erbracht. Angela Langen<br />
t +49 201 8128 310<br />
Als Partner e angela.langen@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
der Windenergiebranche erbringt<br />
XERVON Wind hochspezialisierte<br />
Dienstleistungen für Windkraftanlagen an<br />
L<strong>and</strong> und <strong>vgbe</strong> auf See. <strong>energy</strong> Neben e. Inspektions-, V. Wartungs-<br />
und Deilbachtal Reparaturleistungen 173 | 45257 zählen Essen Services<br />
rundum die Anlagenerrichtung<br />
| Deutschl<strong>and</strong><br />
zum<br />
WEBSITE<br />
w https://t1p.de/digi<strong>2022</strong><br />
CONTACT<br />
<strong>vgbe</strong> | Hydro – Office<br />
Ms Eva Silberer<br />
t +49 201 8128 202<br />
e <strong>vgbe</strong>-digi-hpp@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
* Online participation is possible.<br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 21
Industry News<br />
Portfolio. Das breite Leistungsangebot deckt<br />
alle relevanten Aufgabenstellungen ab, bis<br />
hin zu komplexen Lösungen für optimale<br />
Betriebszustände sowie maximalen Stromertrag.<br />
An den St<strong>and</strong>orten Lingen und<br />
Köln beschäftigt das Mitte 2021 gegründete<br />
Unternehmen rund 70 Mitarbeiter. XERVON<br />
Wind ist Teil des XERVON-Verbundes und<br />
gehört somit organisatorisch zu REMONDIS<br />
Maintenance & Services.<br />
LL<br />
www.xervon-wind.de (222341639)<br />
www.remondis.de<br />
Vulcan Energie und Enel Green<br />
Power kooperieren für CO 2 -freies<br />
Lithium in Italien<br />
(vulcan) Vulcan Energie, Pionier in der Herstellung<br />
CO 2 -freien Lithiums, und Enel<br />
Green Power (EGP), größter Produzent geothermischer<br />
Energie in Italien, arbeiten<br />
künftig gemeinsam an der Erkundung und<br />
Entwicklung des italienischen Aufsuchungsgebietes<br />
Cesano von Vulcan. Ziel der Kooperation<br />
ist es, zuverlässig und dauerhaft erneuerbare<br />
Energie und Wärme für die Region<br />
bereitzustellen sowie das Zero Carbon<br />
Lithium TM -Projekt Vulcans auch in Italien<br />
voranzutreiben. Beide Unternehmen haben<br />
außerdem angekündigt weitere Möglichkeiten<br />
der Zusammenarbeit zu prüfen.<br />
Schätzungen zufolge soll der europäische<br />
Lithiumbedarf bis 2030 um das 18-fache<br />
steigen. Weiterhin ist die europäische Batterieindustrie<br />
maßgeblich abhängig von ausländischen<br />
Rohst<strong>of</strong>fimporten, so auch von<br />
Lithium. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken,<br />
wollen die beiden Unternehmen<br />
ihr jeweiliges Fachwissen in den Bereichen<br />
der direkten Lithiumextraktion (DLE)<br />
und der Geothermie zusammenbringen, um<br />
die Unabhängigkeit des europäischen Wirtschaftsst<strong>and</strong>orts<br />
und der Batterieindustrie<br />
zu sichern und zu stärken.<br />
„Die Kooperation mit EGP ist für uns auf<br />
allen Ebenen sinnvoll. Als Italiens größter<br />
Anbieter von Geothermie mit einer installierten<br />
Leistung von 774 MW in Italien, sind<br />
die Synergieeffekte enorm. Die Kopplung<br />
der Expertise von EGP mit unserem internationalen<br />
Ingenieurteam, soll die Erweiterung<br />
und Diversifizierung unseres Projektentwicklungsportfolios<br />
außerhalb des<br />
Oberrheingrabens und Deutschl<strong>and</strong>s konsequent<br />
vorantreiben. Letztendlich streben<br />
wir an, ein globales Zero Carbon Lithium<br />
TM -Geschäft mit europäischem Schwerpunkt<br />
zu entwickeln“, so Dr. Horst Kreuter,<br />
Geschäftsführer von Vulcan.<br />
Bereits im Januar konnte Vulcan die Lizenz<br />
für das Aufsuchungsgebiet Cesano erwerben,<br />
deren Erträge sich die beiden Unternehmen<br />
im Rahmen ihrer Zusammenarbeit<br />
50:50 aufteilen werden. Die Konzession erstreckt<br />
sich dabei über ein Gebiet von<br />
11,5 km 2 nordwestlich von Rom. EGP hat<br />
bereits Probebohrungen im Cesano-Gebiet<br />
durchgeführt und relevante Daten aus den<br />
dortigen Reservoiren gesammelt. Bisherige<br />
Thermalwasser-Proben ergaben eine überdurchschnittlich<br />
hohe Lithiumkonzentration<br />
von 350 bis 380 mg/l. Gemeinsam konzentrieren<br />
sich die beiden Unternehmen<br />
vorerst auf die Bewertung des Lithium-Potenzials<br />
im<br />
Aufsuchungsgebiet, beginnend<br />
mit einer Scoping-Studie<br />
Vulcan konnte zudem erst kürzlich die Erweiterung<br />
seines Lizenzgebietes im Oberrheingraben<br />
bekannt geben. Das Aufsuchungsgebiet<br />
des Unternehmens erstreckt<br />
sich nun auf über mehr als 1100 km 2 . Zudem<br />
laufen die Vorbereitungen für die Errichtung<br />
der im Herbst geplanten Demonstrationsanlage.<br />
LL<br />
v-er.eu (222341643)l<br />
Products <strong>and</strong><br />
Services<br />
Draeger: BG ProAir verschafft<br />
Rettungskräften langen Atem<br />
• Neues Kreislauf-Atemschutzgerät von<br />
Dräger für Langzeiteinsätze<br />
• Überdruck-Atemkreislauf erhöht den<br />
Schutz vor gefährlichen Substanzen<br />
• Intelligentes Tragesystem verteilt das Gewicht<br />
des Geräts gleichmäßig<br />
• Verschiedene Kühloptionen und verringerter<br />
Atemwiderst<strong>and</strong> sorgen für leichteres<br />
Atmen<br />
(draeger) Das Kreislauf-Atemschutzgerät<br />
Dräger BG ProAir schützt Rettungskräfte<br />
der Feuerwehr oder der Grubenwehr bei<br />
langen Einsätzen. Damit keine gefährlichen<br />
Substanzen aus der Umgebungsluft in das<br />
geschlossene Atemsystem gelangen, versorgt<br />
das BG ProAir den Träger kontinuierlich<br />
mit Überdruck, auch bei steigender<br />
Atemfrequenz. Vor dem Einatmen wird die<br />
Luft gekühlt und mit Sauerst<strong>of</strong>f angereichert.<br />
Die Sauerst<strong>of</strong>fzufuhr passt sich der<br />
individuellen Arbeitsbelastung des Trägers<br />
an. Bei geringer Belastung sind so noch längere<br />
Einsätze möglich. Beim Ausatmen wird<br />
Kohlendioxid durch einen CO 2 -Absorber<br />
entfernt. Ein integrierter Niederdrucksensor<br />
warnt bei fehlender Sauerst<strong>of</strong>fzufuhr.<br />
Das Gewicht des BG ProAir verteilt sich<br />
gleichmäßig auf dem Körper und ist auch<br />
bei längeren Einsätzen leicht und bequem<br />
zu tragen. Das Gehäuse hat hoch sichtbare<br />
Reflektoren und ein spezielles Lichtsystem,<br />
damit sich die Teammitglieder gut sehen<br />
und den Status des Geräts jederzeit erkennen<br />
können. Ein neues Kühlkonzept erleichtert<br />
das Atmen mit Atemschutzgerät. Dazu<br />
gehören ein modernes Regenerationsmaterial<br />
und ein vereinfachtes Eis-Kühlsystem.<br />
Dieses senkt die Temperatur der eingeatmeten<br />
Luft, ohne den Atemkreislauf zu öffnen<br />
oder Komponenten während des Einsatzes<br />
entfernen zu müssen. Zudem wurde der<br />
Atemwiderst<strong>and</strong> reduziert.<br />
Jederzeit in Verbindung bleiben<br />
Ein kontrastreiches Vollfarbdisplay zeigt<br />
die wichtigsten Daten wie Flaschendruck,<br />
Einsatzwarnungen und Einsatzzeiten auch<br />
bei Dunkelheit, hellem Sonnenlicht oder<br />
Rauch gut lesbar an. Über ein integriertes<br />
Bluetooth-Modul lässt sich das Atemschutzgerät<br />
mit Computern oder <strong>and</strong>eren externen<br />
Geräten verbinden, etwa um Einstellungen<br />
zu konfigurieren oder Daten herunterzuladen.<br />
Mittels integrierter Daten-Telemetrie<br />
und RFID unterstützt das BG ProAir eine<br />
Atemschutzüberwachung und eine Überwachung<br />
des Absorbers.<br />
Einfach montieren, demontieren<br />
und reinigen<br />
Die Montage und Demontage des BG Pro-<br />
Air erfolgt über Schnellanschlüsse. Die Einweisung<br />
benötigt so weniger Zeit. Das Atemschutzgerät<br />
kann ganz ohne Werkzeuge gewartet<br />
werden. Service-Intervalle wurden<br />
reduziert. Der Druckminderer muss zum<br />
Beispiel nur alle zehn Jahre gewechselt werden.<br />
Für die Reinigung des BG ProAir müssen<br />
Träger nur wenige Teile demontieren,<br />
die alle maschinenwaschbar sind. Das neue<br />
Eis-Kühlsystem kommt ohne Wasser aus.<br />
Das Regenerationsmaterial benötigt kein Eis<br />
und kann bei Temperaturen unter 25 Grad<br />
Celsius aufbewahrt werden.<br />
LL<br />
www.draeger.com (222341634)<br />
Fluke: Die drei größten Sicherheitsrisiken<br />
bei Solaranlagen<br />
• Das weltweit erste CAT-III-1500V-True-<br />
RMS-Solarzangenmessgerät schafft deutlich<br />
mehr Sicherheit bei der Inbetriebnahme<br />
und Installation von Solarmodulen<br />
(fluke) Mit dem Ziel, die Sicherheit von<br />
Technikern zu gewährleisten, in<strong>for</strong>miert<br />
Fluke, über die drei größten elektrischen<br />
Gefahren, die man bei der Installation und<br />
Wartung von Solaranlagen vermeiden sollte.<br />
Erneuerbare Energien zählen zu den am<br />
schnellsten wachsenden Märkten der Welt -<br />
der deutsche Solarenergiemarkt soll zwischen<br />
<strong>2022</strong> und 2027 um 7 % wachsen und<br />
bis 2030 nahezu 80 % des Stroms aus erneuerbaren<br />
Energien liefern.<br />
22 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Industry News<br />
Diese rasante Expansion beschleunigt die<br />
Suche nach Möglichkeiten zur Reduzierung<br />
der Risiken, die mit der Inbetriebnahme und<br />
Installation von Solar-/Photovoltaik-Anlagen<br />
(PV) verbunden sind. Daraus folgt ein<br />
Bedarf an hochpräzisen H<strong>and</strong>messgeräten,<br />
die in diesen Anwendungen sichere und zuverlässige<br />
Messungen durchführen können.<br />
Mit Einführung des weltweit ersten CAT-III-<br />
1500V-True-RMS Solarzangenmessgeräts –<br />
dem Fluke 393 FC – deckt das Unternehmen<br />
diesen Bedarf.<br />
Bei PV-Anwendungen ist der Strom „außer<br />
Kontrolle“ und wird nicht durch die Elektronik<br />
begrenzt. Die Wahl eines geeigneten<br />
Solarprüfgeräts ist daher von entscheidender<br />
Bedeutung, will man Mitarbeiter - und<br />
die PV-Anlage selbst - vor einer Reihe potenzieller<br />
elektrischer Gefahren schützen.<br />
1. Stromschlag<br />
Das Fluke 393 FC schützt vor den drei<br />
wichtigsten elektrischen Gefahren - Stromschlag<br />
durch spannungsführende Leiter;<br />
Überschläge, die Brände auslösen; und<br />
Lichtbögen, die Explosionen verursachen<br />
können. Kontrollmaßnahmen und bewährte<br />
Praktiken zur Minderung dieser Risiken unterscheiden<br />
sich bei der Arbeit mit Photovoltaikanlagen<br />
von der Arbeit mit allen <strong>and</strong>eren<br />
Arten von Energieerzeugungsanlagen.<br />
Es ist daher wichtig, dass Multimeter, Messleitungen<br />
und Sicherungen für die Anwendung<br />
geeignet sind, an der gearbeitet wird.<br />
Ein Stromschlag durch spannungsführende<br />
Leiter kann auftreten, wenn der Strom<br />
einen unerwünschten Weg durch den<br />
menschlichen Körper nimmt; dabei können<br />
schon 50 mA tödliche Folgen haben, wenn<br />
sie durch das Herz fließen. Ursachen für<br />
Stromschläge sind meist mangelhafte Isolierung<br />
von Kabeln und Leitungen, beschädigte<br />
Isolierung von Sicherheitsabdeckungen<br />
oder unsachgemäße Erdung. Die wichtigsten<br />
Stellen, an denen solche Bedingungen in<br />
einer PV-Anlage herrschen, sind der Schaltschrank,<br />
der Erdungsleiter der Anlage sowie<br />
die Leiter der PV-Quelle und des Ausgangsstromkreises.<br />
2. Unerwünschte Überschläge<br />
und Lichtbögen<br />
Lichtbögen, die Brände auslösen, sind<br />
elektrische Hochspannungsentladungen<br />
zwischen zwei oder mehr Leitern. Diese<br />
Entladungen verursachen Hitze, die zu einer<br />
Schädigung oder sogar zum Abbr<strong>and</strong><br />
der Kabelisolierung führen kann. PV-Anlagen<br />
sind besonders anfällig für Überschläge,<br />
die durch Leitungs-Unterbrechungen<br />
oder unerwartete Ströme zwischen zwei<br />
Leitern verursacht werden, <strong>of</strong>t als Folge eines<br />
Erdschlusses.<br />
Überschläge sind ein Phänomen großer<br />
PV-Anlagen mit mittleren bis hohen Spannungen.<br />
Erst seit Einführung großer Solarenergiesysteme<br />
sind Überschläge im Gleichstrombereich<br />
ein Thema. Daher empfiehlt es<br />
sich, bei Gleichstromsystemen mit mehr als<br />
120 V eine Risikoanalyse durchzuführen.<br />
Besonders häufig tritt das Problem bei der<br />
Fehlersuche in stromführenden Verteilerkästen<br />
auf, in denen PV-Quellstromkreise<br />
zur Erhöhung des Stroms parallelgeschaltet<br />
sind, oder bei der Prüfung von Mittel- und<br />
Hochspannungsschaltanlagen und Trans<strong>for</strong>matoren.<br />
Lichtbögen entstehen, wenn<br />
eine erhebliche Energiemenge für einen<br />
Lichtbogenfehler in Gleich- und Wechselstromleitern<br />
zur Verfügung steht. Dabei<br />
werden heiße Gase und Strahlungsenergie<br />
mit Temperaturen von bis zu 19.500 °C freigesetzt<br />
(viermal so heiß wie die Sonnenoberfläche).<br />
Am stärksten gefährdet<br />
sind Wechselrichter für Wohngebäude mit<br />
einer Eingangsspannung von bis zu 500 V<br />
und Großwechselrichter mit bis zu 1500 V.<br />
Man sollte daher unbedingt ein Messgerät<br />
verwenden, das für die entsprechende Messkategorie<br />
oder CAT-Einstufung sowie für<br />
das Spannungsniveau der Anwendung ausgelegt<br />
ist. So kann das Gerät nicht nur<br />
durchschnittliche Spannungen messen, sondern<br />
auch hohe Spannungsspitzen und<br />
Transienten, die Stromschläge oder einen<br />
Lichtbogen auslösen können.<br />
3. Umstellung auf 1500 V<br />
Die meisten großen Hersteller von Wechselrichtern<br />
und Solarmodulen stellen von<br />
1000- auf 1500-V-Systeme um, um höhere<br />
Wirkungsgrade zu erzielen. Bei Solaranlagen<br />
kommen vermehrt Systeme der Überspannungskategorie<br />
CAT III 1500 V zum<br />
Einsatz, und CAT-III- sowie CAT-IV-Geräte<br />
sind für PV-Anlagen in großen Höhen unerlässlich.<br />
Das Messgerät wurde speziell für PV-Installationstechniker<br />
und Wartungsspezialisten<br />
entwickelt, die in Hochspannungs-Gleichstromumgebungen<br />
arbeiten.<br />
Die Zange kann bis zu 1500 V Gleichstrom,<br />
1000 V Wechselstrom, DC-Leistung und<br />
-Strom bis zu 999,9 A Gleich- oder Wechselstrom<br />
über die dünne Klemmbacke messen<br />
– ideal für die beengten Platzverhältnisse in<br />
Verteilerkästen oder Wechselrichtern. Ein<br />
weiteres wichtiges Merkmal der Klemme,<br />
auf die eine dreijährige Garantie gewährt<br />
wird und die der Schutzart IP54 entspricht<br />
(wodurch sie sich gut für den Einsatz im<br />
Freien eignet), ist eine akustische Polaritätsanzeige.<br />
Sie hilft, versehentliche Fehlverdrahtungen<br />
zu vermeiden und stellt sicher,<br />
dass die PV-Paneele korrekt installiert sind.<br />
Polaritätsfunktionen sowie akustische und<br />
visuelle Polaritätsprüfungen sind bei der<br />
Inbetriebnahme einer neuen Anlage von<br />
entscheidender Bedeutung, sei es auf der<br />
Ebene des Verteilerkastens oder auf der Ebene<br />
des Wechselrichters. Mit einer DC-Polaritätsprüfung<br />
kann man leicht feststellen, ob<br />
die Polarität von Strängen versehentlich<br />
vertauscht wurde, und so das Risiko von<br />
Bränden am Schaltkasten sowie von Schäden<br />
an der Anlage und Gefahren für das<br />
Personal vermeiden.<br />
Sicher, zuverlässig<br />
und widerst<strong>and</strong>sfähig<br />
Sämtliche Prüfergebnisse werden über die<br />
Fluke Connect-S<strong>of</strong>tware, die zum Lieferumfang<br />
des Fluke 393 FC True-RMS Solar<br />
Clamp Meters gehört, aufgezeichnet und<br />
gemeldet. Techniker können mit einem<br />
Smartphone schnell Messungen durchführen<br />
und speichern, wobei 10 Minuten aufzeichnet<br />
und die Messwerte an Kollegen<br />
weitergeleitet werden. Das sichere, zuverlässige<br />
und robuste Messgerät kann Messungen<br />
und Aufzeichnungen von bis zu zwei<br />
Wochen Dauer vornehmen; es wird außerdem<br />
mit einer flexiblen 18-Zoll-iFlex-Stromsonde<br />
für erweiterte Wechselstrommessungen<br />
bis zu 2500 A geliefert. Die Messleitungen<br />
sind außerdem für CAT III 1500 V DC<br />
ausgelegt.<br />
LL<br />
www.fluke.com (222341544)<br />
Trianel entscheidet sich für einen<br />
Wechsel zur BTC Lösung<br />
für Virtuelle Kraftwerke<br />
(btc-ag) Mithilfe der S<strong>of</strong>twarelösung BTC I<br />
Virtual Power Plant (VPP) wird ab Oktober<br />
<strong>2022</strong> das virtuelle Kraftwerk von Trianel mit<br />
einer Leistung von 2.500 MW gesteuert. Von<br />
der Ertüchtigung des Virtuellen Kraftwerks<br />
pr<strong>of</strong>itieren die Kunden von Trianel im Fahrplanbetrieb,<br />
in der Direktvermarktung, bei<br />
der Regelleistungsvermarktung und im Bilanzkreis-Ausgleich.<br />
Das damit verbundene<br />
Projekt ist bereits gestartet.<br />
Mit dem BTC I VPP können Energiemengen<br />
von dezentralen Anlagen gebündelt und<br />
das Leistungsvermögen des Anlagenpools<br />
flexibel gesteuert und vermarktet werden.<br />
Dies erleichtert auch das Bilanzkreismanagement<br />
und die Regelenergievermarktung.<br />
Instabilitäten einzelner Anlagen können<br />
durch <strong>and</strong>ere Anlagen des Verbunds<br />
ausgeglichen werden und größere Energiemengen<br />
bei geringerem Risiko von Fahrplanabweichungen<br />
vermarktet werden.<br />
Das von Trianel geplante Migrationsprojekt<br />
umfasst die Ablösung des bisherigen<br />
Leitsystems. Die BTC Lösung VPP als S<strong>of</strong>tware-as-a-Service<br />
(SaaS) wird dabei aus<br />
den betriebsredundanten Rechenzentren in<br />
Oldenburg zur Verfügung gestellt. Neben<br />
einer gewinnbringenden Vermarktung der<br />
Kapazitäten wird ein vollumfängliches Mo-<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 23
News from Science & Research<br />
nitoring der Erzeugungsanlagen sowie deren<br />
Steuerung gewährleistet. Neben der<br />
Kernkomponente des BTC I VPP wird Trianel<br />
auch das Stromcockpit einführen. Über<br />
diese Applikation haben die Anlagenbetreiber<br />
jederzeit Überblick über den Vermarktungsprozess<br />
ihrer Anlage, indem sie beispielsweise<br />
Nichtverfügbarkeiten eintragen,<br />
H<strong>and</strong>elsergebnisse und Anlagenzeitreihen<br />
erhalten oder den Einsatz ihrer Anlage<br />
selbstständig planen können.<br />
Die Komplexität des Projektes macht deutlich:<br />
eine detaillierte Planung und enge Abstimmungsprozesse<br />
mit allen Stakeholdern<br />
des Projektes sind essenziell für eine erfolgreiche<br />
Migration.<br />
Die Energieanlagen im Virtuellen Kraftwerk<br />
von Trianel sind alle in den kritischen<br />
Systemdienstleistungsprozess der Übertragungsnetzbetreiber<br />
(ÜNB) für die Regelleistungserbringung<br />
eingebunden. Die Vermarktung<br />
des entsprechenden Anlagenportfolios<br />
gilt es daher im Zuge des Leitsystem-Austausches<br />
möglichst ununterbrochen<br />
sicherzustellen. Den ÜNB werden infolgedessen<br />
frühzeitig das Migrationsprojekt und<br />
das Präqualifikationskonzept vorgestellt.<br />
Dr.-Ing. Carsten Wissing, Senior Business<br />
Development Manager für das Virtuelle<br />
Kraftwerk der BTC, ist sich der Heraus<strong>for</strong>derung<br />
bewusst, setzt aber auf Erfahrung und<br />
Transparenz: „Der intensive Austausch mit<br />
Trianel hat uns gezeigt, dass durch unser<br />
gemeinschaftliches Know-how und jahrelange<br />
Erfahrung dem begonnenen Erfolgskurs<br />
nichts im Wege steht. Wir wissen um<br />
die Wichtigkeit von Transparenz und akribischer<br />
Vorarbeit bei einer solchen Migration.“<br />
Dem kann Bastian Wurm, Leiter Direktvermarktung<br />
bei Trianel nur beipflichten:<br />
„Die Detailtiefe in den Abstimmungsprozessen<br />
sowie die partnerschaftliche Zusammenarbeit<br />
in den konzeptionellen Vorüberlegungen<br />
sind eine gute Basis für die Umsetzung<br />
des Projekts. Die Flexibilität und Intelligenz<br />
des neuen Systems haben uns überzeugt<br />
und bringen unseren Kunden einen<br />
echten Mehrwert in der Vermarktung aber<br />
auch durch den Zugriff auf ihre Anlagen<br />
über das neue Kundenportal. Durch die<br />
BTC-Lösung wird unser Virtuelles Kraftwerk<br />
fit gemacht für die technischen und wirtschaftlichen<br />
An<strong>for</strong>derungen einer dezentralen<br />
und erneuerbaren Energiewelt.“<br />
www.btc-ag.de (222341535)<br />
News from<br />
Science &<br />
Research<br />
Die Lebensdauer von<br />
Bauwerken verlängern<br />
(hm) Der Bausektor spielt eine entscheidende<br />
Rolle auf der Nachhaltigkeitsagenda. Die<br />
Verlängerung der Lebensdauer von Windenergieanlagen,<br />
Brücken und <strong>and</strong>eren Bauwerken<br />
sowie ressourcenschonendere Konstruktionen<br />
sind derzeit die größten Heraus<strong>for</strong>derungen<br />
im Bauwesen und Maschinenbau.<br />
HM-Forschende entwickeln dazu ein<br />
Ingenieurmodell, durch das sich die Haltbarkeit<br />
für geschweißte Stahlkonstruktionen<br />
besser einschätzen lässt.<br />
Der ressourcenschonende Stahlbau bringt<br />
Lösungen für die drängenden Probleme unserer<br />
Zeit. Im Zuge der Energiewende werden<br />
zum Beispiel erneuerbaren Energien<br />
stark ausgebaut. In Deutschl<strong>and</strong> sind aktuell<br />
rund 30.000 Windenergieanlagen im<br />
Einsatz. Zentral für ihre Wirtschaftlichkeit:<br />
die Haltbarkeit. Stahlkonstruktionen von<br />
Windenergieanlagen, Brücken oder großen<br />
Maschinen werden unter <strong>and</strong>erem durch<br />
starke Winde oder große Lasten beansprucht.<br />
Dies führt zur Werkst<strong>of</strong>fermüdung<br />
und somit zu Rissen und Brüchen an deren<br />
Schweißnähten.<br />
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit<br />
im Fokus<br />
Das Forschungsprojekt MOBEKO hat das<br />
Ziel, die Lebensdauer von Bauwerken zu<br />
verlängern und Konstruktionen ressourcenschonender<br />
zu erstellen. Ein HM-Forschungsteam<br />
um Pr<strong>of</strong>. Dr. Imke Engelhardt,<br />
Leiterin des Labors für Stahl- und Leichtmetallbau,<br />
und Richard Schiller vom Institut<br />
für Material- und Bau<strong>for</strong>schung der HM<br />
entwickeln einen „Modifizierten Betriebsfestigkeitsnachweis<br />
von unbeh<strong>and</strong>elten und<br />
HFH-nachbeh<strong>and</strong>elten Schweißkonstruktionen<br />
unter Berücksichtigung von Kollektiv<strong>for</strong>m,<br />
Spannungsverhältnis und Kerbdetail“<br />
(MOBEKO).<br />
Längere Haltbarkeit<br />
durch Nachbeh<strong>and</strong>lung<br />
Maßgebend für die Ermüdungsfestigkeit<br />
von Stahlbaukonstruktionen sind die Qualität<br />
der Schweißnähte und eventuelle Unregelmäßigkeiten<br />
der Nahtübergänge. In ausführlichen<br />
Versuchsreihen ermitteln die<br />
Forschenden die Einflüsse von Nachbeh<strong>and</strong>lungen<br />
der Schweißnähte auf die Lebensdauer<br />
der Bauteile. Besonders interessant<br />
sind die HFH-Verfahren, sogenannte höherfrequente<br />
Hämmerverfahren, die händisch<br />
angewendet werden. Mit einem Gerät in der<br />
Größe eines Bohrers, das einen gehärteten<br />
Stift hat und mit einer Frequenz von 150 bis<br />
200 Hz angeregt wird, ver<strong>for</strong>men Arbeiter<br />
die Schweißnahtübergänge plastisch. Dies<br />
verbessert die Nahtgeometrie und verfestigt<br />
die R<strong>and</strong>schicht und ist dadurch länger haltbar.<br />
Weitere Qualitätssicherung ist durch<br />
eine visuelle Kontrolle möglich. Engelhardt<br />
sagt dazu: „Bislang ist nicht geklärt, wie sich<br />
die Wirkung von Nachbeh<strong>and</strong>lungen in einem<br />
verlässlichen Betriebsfestigkeitsnachweis<br />
rechnerisch ansetzen lässt.“<br />
Bessere Lebensdauerabschätzung<br />
am Beispiel Windenergieanlagen<br />
Bei Offshore-Windenergieanlagen kommen<br />
zusätzlich zu den Windlasten auf den<br />
Rotoren noch Belastungen der gesamten<br />
Konstruktion durch Wellen hinzu. Engelhardt<br />
erläutert: „Wenn wir mit unseren Forschungen<br />
zum Beispiel erreichen können,<br />
dass die W<strong>and</strong>stärken der Offshore-Gründungsstrukturen<br />
von 100 mm auf 80 mm<br />
reduziert werden können, dann sparen wir<br />
bei jeder Anlage viele Tonnen Stahl ein.“<br />
Das Projekt MOBEKO wird gefördert vom<br />
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz<br />
und läuft bis zum 30. September<br />
<strong>2022</strong>.<br />
LL<br />
www.hm.edu (222341232)<br />
Flächenpotenziale für die Windenergie<br />
an L<strong>and</strong> aktualisiert<br />
(iee) Die Studie zur Ermittlung der Flächenpotenziale<br />
für die Windenergienutzung an<br />
L<strong>and</strong> aus dem Jahr 2011 wurde nun aktualisiert.<br />
Gemeinsam zeigen darin das Fraunh<strong>of</strong>er<br />
IEE, das Umweltplanungsbüro bosch&partner<br />
und der Bundesverb<strong>and</strong> WindEnergie<br />
BWE e.V. anh<strong>and</strong> einer bundesweiten<br />
Raumbewertung auf, dass in allen 16<br />
Bundesländern bei konsequenter Ausweisung<br />
ausreichend Flächen verfügbar sind,<br />
um das Mindestziel von 2 Prozent der Bundesfläche<br />
für die Windenergie zu erreichen.<br />
Unter Berücksichtigung öffentlich zugänglicher<br />
Daten hat die Neuauflage der Studie<br />
auf Basis einer bundesweiten Raumbewertung<br />
Potenzialflächen für die Windenergienutzung<br />
in den Bundesländern erarbeitet.<br />
Dazu wurden zunächst alle kategorischen<br />
Ausschlussflächen ermittelt. Die danach<br />
verbliebenen Flächen wurden in sechs verschiedene<br />
Konfliktrisikoklassen von Klasse 1<br />
(kein Konfliktrisiko) bis Klasse 6 (faktisch<br />
nicht nutzbar) eingeteilt. „Gemäß dieser<br />
Analyse sind 26,1 Prozent der Bundesfläche<br />
24 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
News from Science & Research<br />
Anmeldung & Programm<br />
(93.268 km 2 ) keine Ausschlussflächen“,<br />
stellt Dr. Carsten Pape, Leiter Szenarien und<br />
Systemmodellierung des Fraunh<strong>of</strong>er IEE,<br />
fest.<br />
Die Studie, die im Auftrag des BWE erstellt<br />
wurde, kommt zu dem Ergebnis: In den Flächenländern<br />
gibt es nachweislich mehr als<br />
genug Platz. Die Flächenpotenziale für den<br />
Ausbau der Windenergie und damit ausreichende<br />
Energieproduktion sind eindeutig<br />
vorh<strong>and</strong>en. Auch in Bayern, Baden-Württemberg<br />
und Sachsen. Die drei Länder hängen<br />
beim Ausbau bislang deutlich hinterher.<br />
Angesichts der energieintensiven Industrien<br />
besteht hier enormer Nachholbedarf.<br />
Aber auch für die Stadtstaaten gilt: Potenziale<br />
sind vorh<strong>and</strong>en. Zusätzliche Optionen<br />
ließen sich durch die Nutzung der Windenergie<br />
in Industriegebieten heben. Das zeigen<br />
beispielsweise die 14 Windenergieanlagen<br />
im Hamburger Hafen.<br />
Auf 2 % der Fläche lassen sich 200 GW<br />
Leistung installieren, die aus heutiger Sicht<br />
770 TWh sauberen Strom liefern können.<br />
Dafür sind 30.000 bis 35.000 Anlagen er<strong>for</strong>derlich.<br />
Wenn angesichts des Krieges in der<br />
Ukraine und der dadurch ausgelösten Krise<br />
der fossilen Energieträger ein beschleunigter<br />
Umstieg auf erneuerbare Energien erfolgen<br />
soll, sind ggf. die Strommengenziele<br />
anzuheben. Das kann dazu führen, dass für<br />
die Windenergie mehr als zwei Prozent der<br />
Fläche notwendig werden.<br />
Fachtagung<br />
mit Fachausstellung<br />
IT-Sicherheit in<br />
Energieanlagen <strong>2022</strong><br />
8. und 9. November <strong>2022</strong><br />
Moers<br />
Ausgewiesene Fläche müssten dabei in jedem<br />
Fall auch bebaubar und vollständig<br />
nutzbar sein. Gleichzeitig gelte es dafür Sorge<br />
zu tragen, dass die Flächen effektiv genutzt<br />
werden. Dafür brauche es einen modernen<br />
Anlagenpark.<br />
Um die CONTACT starken Ziele & zu REGISTRATION<br />
erreichen, braucht<br />
es die Unterstützung in den Kommunen.<br />
Der Bundesverb<strong>and</strong> FACHLICHE Windenergie KOORDINATION regt an,<br />
die nun<br />
Stephanie<br />
vorgelegte<br />
Wilmsen<br />
Studie im Bund-Länder-Kooperationsausschuss<br />
zu diskutieren,<br />
t +49 201 8128 244<br />
damit Politik und Branche zu einem gemeinsamen,<br />
e kissy@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
fachlich fundierten Verständnis<br />
gelangen können.<br />
TEILNEHMER<br />
LL<br />
www.iee.fraunh<strong>of</strong>er.de (222341252)<br />
Diana Ringh<strong>of</strong>f<br />
t +49 201 8128 232<br />
e <strong>vgbe</strong>-dampfturb@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Forschungs-Neutronenquelle<br />
ermöglicht AUSSTELLUNG Einblick in<br />
Lithium-Akkus<br />
Angela Langen<br />
(tum) Mit t +49 Neutronen 201 8128 hat 310 ein Forschungsteam<br />
unter e angela.langen@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Leitung der Technischen Universität<br />
München (TUM) tief in das Innere von<br />
Batterien geblickt, während diese geladen<br />
und entladen <strong>vgbe</strong> wurden. <strong>energy</strong> Die e. aus V. den Beobachtungen<br />
Deilbachtal gewonnenen Erkenntnisse 173 | 45257 könnten Essen | Deutschl<strong>and</strong><br />
dabei helfen, Ladevorgänge zu optimieren.<br />
WEBSITE<br />
w https://t1p.de/<strong>vgbe</strong>-ITSI<strong>2022</strong><br />
INFORMATIONEN & ANMELDUNG<br />
Barbara Bochynski<br />
t +49 201 8128 205<br />
e <strong>vgbe</strong>-it-sicherheit@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
FACHAUSSTELLUNG<br />
Steffanie Fidorra-Fränz<br />
t +49 201 8128 299<br />
e steffanie.fidorra-fraenz@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 25
News from Science & Research<br />
Wird ein Elektro-Auto aufgeladen, steigt<br />
die Ladeanzeige anfangs schnell, zum<br />
Schluss aber deutlich langsamer. „Das ist<br />
wie beim Einräumen eines Schranks: Am<br />
Anfang ist es einfach, Gegenstände in den<br />
Schrank zu stellen, aber je voller er wird,<br />
desto mehr muss man sich anstrengen, einen<br />
freien Platz zu finden“, erklärt Dr. Anatoliy<br />
Senyshyn von der Forschungs-Neutronenquelle<br />
Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)<br />
der TUM.<br />
Wie die innere Struktur einer Batterie vor<br />
und nach dem Laden aussieht, ist bereits<br />
bekannt. Ein Forschungs-Team unter Leitung<br />
des Heinz Maier-Leibnitz Zentrums an<br />
der TUM beobachtete nun erstmals auch die<br />
Lithium-Verteilung einer Batterie während<br />
des kompletten Lade- und Entladeprozesses<br />
am Material<strong>for</strong>schungsdiffraktometer<br />
STRESS-SPEC. Die Messungen überprüften<br />
sie am hochauflösenden Pulverdiffraktometer<br />
SPODI.<br />
Verteilung der Lithium-Ionen<br />
entscheidend<br />
Beim Laden w<strong>and</strong>ern die Lithium-Ionen<br />
dabei von der positiv geladenen Elektrode<br />
zur negativ geladenen Elektrode, beim Entladen<br />
in die <strong>and</strong>ere Richtung.<br />
In den nun durchgeführten Untersuchungen<br />
konnten die Forschenden beobachten,<br />
dass sich die Verteilung des Lithiums beim<br />
Laden und Entladen ständig verändert. „Ist<br />
das Lithium ungleich verteilt, funktioniert<br />
in Bereichen der Batterie, in denen zu viel<br />
oder zu wenig Lithium vorh<strong>and</strong>en ist, der<br />
Austausch von Lithium zwischen Anode und<br />
Kathode nicht zu hundert Prozent. Eine<br />
gleichmäßige Verteilung steigert dagegen<br />
die Leistungsfähigkeit“, erklärt Senyshyn.<br />
Genauer, kleiner, besser<br />
Den Forschenden gelang es, die ungleiche<br />
Verteilung von Lithium in einer Batterie mit<br />
sehr hoher Auflösung festzuhalten: Um die<br />
gesamte Batterie zu erfassen, untersuchten<br />
sie ein winziges Teilvolumen nach dem <strong>and</strong>eren<br />
und setzten diese Einzelmessungen<br />
dann zu einem großen Bild zusammen.<br />
Mithilfe des Deutschen Elektronen-Synchrotron<br />
DESY der Helmholtz-Gemeinschaft<br />
und der European Synchrotron Radiation<br />
Facility ESRF war es möglich, Teilvolumina<br />
mit Abmessungen im Mikrometerbereich<br />
zu wählen. Dadurch erkannten die<br />
Forschenden, dass nicht nur entlang der<br />
Elektrodenschichten, sondern auch senkrecht<br />
zu den Schichten das Lithium ungleich<br />
verteilt ist.<br />
Schnell laden vs. Reichweite<br />
Die beobachteten Effekte könnten langfristig<br />
dabei helfen, Akkus, zum Beispiel für<br />
Elektro-Autos, weiterzuentwickeln, so Senyshyn:<br />
„Viele Eigenschaften von Batterien<br />
lassen sich durch die Verteilung des Lithiums<br />
beeinflussen. Wenn wir diese besser<br />
unter Kontrolle haben, können wir die Per<strong>for</strong>mance<br />
von Batterien in Zukunft deutlich<br />
verbessern.“<br />
LL<br />
www.frm2.tum.de (222341234)<br />
Marktfähige Power-to-X-<br />
Technologien entwickeln<br />
(spin) Im Rahmen eines neuen Projektes des<br />
Spitzenclusters Industrielle Innovationen<br />
(SPIN) entsteht eine <strong>of</strong>fene Versuchsplatt<strong>for</strong>m<br />
für die Entwicklung von Power-to-X-Technologien.<br />
Untersucht werden<br />
dabei Möglichkeiten, CO 2 -haltige Abgasströme<br />
zunächst in ein Synthesegas aus<br />
Kohlenmonoxid und Wasserst<strong>of</strong>f und dann<br />
in verschiedene Produkte für die Chemie-,<br />
Kraftst<strong>of</strong>f- und Kunstst<strong>of</strong>findustrie umzuw<strong>and</strong>eln.<br />
Die nordrhein-westfälische L<strong>and</strong>esregierung<br />
fördert dieses Vorhaben mit<br />
5,3 Mio. Euro.<br />
Die Federführung des Projektes „PtX-Platt<strong>for</strong>m“<br />
liegt bei der Mitsubishi Power Europe<br />
GmbH. Gemeinsam mit SPIN sowie den Projektpartnern<br />
– dem Fraunh<strong>of</strong>er UMSICHT,<br />
dem Lehrstuhl für Umweltverfahrenstechnik<br />
und Anlagentechnik (LUAT) der Universität<br />
Duisburg-Essen sowie Evonik Industries<br />
– will das Unternehmen marktfähige<br />
Lösungen für die effiziente Nutzung überschüssigen<br />
Stroms entwickeln. Ein Schwerpunkt<br />
werden dabei Wasserst<strong>of</strong>f- sowie Carbon-Capture-Use-<strong>and</strong>-<strong>Storage</strong>-Technologien<br />
sein: CCU und CCS. Entsprechende containerbasierte<br />
Anlagen entstehen auf dem<br />
Gelände des LUAT. Sie umfassen u.a.<br />
CO 2 -Abtrennung und katalytische Co-Elektrolyse<br />
und stellen alle notwendigen Energieund<br />
St<strong>of</strong>fströme zur Verfügung.<br />
Das Fraunh<strong>of</strong>er UMSICHT erarbeitet im<br />
Zuge des Projektes u.a. Grundlagen, um in<br />
einem Power-to-X-Reaktor die elektrolytische<br />
Herstellung von Synthesegas im Labormaßstab<br />
zu demonstrieren. „Dazu skalieren<br />
wir neuartige Gasdiffusionselektroden und<br />
setzen sie für die Aufgabe in angepassten<br />
Reaktoren ein“, erklärt Pr<strong>of</strong>. Dr. Ulf-Peter<br />
Apfel, Leiter der Abteilung Elektrosynthese.<br />
„Weitere Komponenten der Elektrolysezellen<br />
werden so aufein<strong>and</strong>er abgestimmt, dass<br />
Verlustleistungen und Gasleckagen minimiert<br />
sowie die Zusammensetzung des Synthesegases<br />
möglichst kontrolliert variiert<br />
werden können.“ Neben der Erstellung der<br />
er<strong>for</strong>derlichen Komponenten führt das Institut<br />
auch die Entwicklung, Errichtung und<br />
Inbetriebnahme eines skalierten Elektrolysesystems<br />
(inkl. der Testst<strong>and</strong>peripherie)<br />
durch und integriert alles in die Containerumgebung<br />
der Platt<strong>for</strong>m.<br />
Darüber hinaus testen die Wissenschaftlerinnen<br />
und Wissenschaftler des Fraunh<strong>of</strong>er<br />
UMSICHT Katalysator-Systeme, die neu von<br />
Evonik entwickelt worden sind und bei der<br />
Synthese von Alkoholen zum Einsatz kommen.<br />
„Wir schauen uns Umsatz, Menge und<br />
Konzentration sowohl der auftretenden Produkte<br />
als auch der Nebenprodukte an und<br />
haben dabei vor allem die Lebensdauer des<br />
Katalysators im Blick“, so Pr<strong>of</strong>. Apfel. „Auf<br />
Basis unserer Testergebnisse nimmt Evonik<br />
dann weitere Optimierungen der Katalysatoren<br />
sowie deren Scale-up in Angriff.“ Das<br />
beste System wird dann für den Pilotreaktor<br />
ausgewählt.<br />
SPIN<br />
SPIN schafft Allianzen aus relevanten Akteuren<br />
in NRW wie Wirtschaftskonzerne,<br />
mittelständische Unternehmen, Start-ups<br />
sowie Universitäten und Forschungsinstituten<br />
in den Bereichen Energie und Digitaltechnologie.<br />
Ziel ist es, in anwendungsbezogenen<br />
Forschungsprojekten Zukunftstechnologien<br />
voranzutreiben. Der Fokus liegt dabei<br />
auf der Entwicklung von klimafreundlichen<br />
Technologien, Verfahren und Produkten zur<br />
erfolgreichen Trans<strong>for</strong>mation der Industrie<br />
und des Energiesystems in der Region Rhein-<br />
Ruhr. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation,<br />
Digitalisierung und Energie des L<strong>and</strong>es<br />
Nordrhein-Westfalen (MWIDE) fördert<br />
seit Dezember 2021 für drei Jahre den Aufbau<br />
der SPIN-Geschäftsstelle im Co-Working-Space<br />
des Essener ruhrHUB. Das Spitzencluster<br />
beschäftigt zurzeit fünf Mitarbeitende<br />
und umfasst 14 Mitglieder, die gemeinsam<br />
mit weiteren Partnern an sechs bewilligten<br />
Forschungsprojekten mit einem Projektvolumen<br />
von rund 20 Mio. Euro arbeiten.<br />
SPIN ist auch eines von 73 Projekten der<br />
Ruhr-Konferenz zur Gestaltung des Strukturw<strong>and</strong>els<br />
der Metropole Ruhr.<br />
LL<br />
www.spin.ruhr/projekt/p2x-produkte-aus-gruenstrom/<br />
(222341236)<br />
TU Wien erfindet<br />
chemischen Wärmespeicher<br />
(tu-w) Energie chemisch speichern, verlustfrei<br />
monatelang lagern und im Winter damit<br />
heizen: Das wird durch einen nun patentierten<br />
chemischen Reaktor möglich.<br />
Energie langfristig zu speichern ist wohl<br />
das größte bisher ungelöste Problem der<br />
Energiewende. An der TU Wien wurde nun<br />
ein neuartiger chemischer Wärmespeicher<br />
erfunden, mit dem man große Energiemengen<br />
auf umweltfreundliche Weise praktisch<br />
unbegrenzt lange speichern kann.<br />
26 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
News from Science & Research<br />
Man verwendet Wärme, um eine chemische<br />
Reaktion auszulösen. Dabei entstehen<br />
energiereiche chemische Verbindungen, die<br />
problemlos und ohne Energieverlust monatelang<br />
gelagert werden können. Bei Bedarf<br />
lässt sich dann die chemische Reaktion umkehren,<br />
dabei wird die Energie wieder freigesetzt.<br />
So kann man etwa Abwärme von<br />
Industrieanlagen oder auch Sonnenwärme<br />
im Sommer speichern, um damit den Winter<br />
hindurch Gebäude zu heizen. Die chemische<br />
Reaktion und der dafür speziell entwickelte<br />
Suspensionsreaktor wurden nun patentiert.<br />
Im Sommer speichern,<br />
im Winter nutzen<br />
Es gibt viele Methoden, Energie zu speichern,<br />
doch alle haben ihre Nachteile: Man<br />
kann Batterien aufladen, doch ihre Kapazität<br />
ist begrenzt. Man kann mit elektrischem<br />
Strom Wasserst<strong>of</strong>f herstellen, doch er kann<br />
nur schwer langfristig gelagert werden. Die<br />
neue Methode der TU Wien beruht auf einem<br />
ganz <strong>and</strong>eren Prinzip – der Umw<strong>and</strong>lung<br />
von Wärmeenergie in chemische Energie<br />
und wieder zurück.<br />
„Es gibt unterschiedliche chemische Reaktionen,<br />
die man für diesen Zweck nutzen<br />
kann. Wir verwenden etwa Borsäure, ein<br />
festes Material, das wir mit Öl vermischen“,<br />
erklärt Pr<strong>of</strong>. Franz Winter vom Institut für<br />
Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und<br />
technische Biowissenschaften der TU Wien.<br />
„Diese ölige Suspension kommt in einen Reaktor,<br />
dessen W<strong>and</strong> auf eine Temperatur<br />
zwischen 70 °C und 200 °C aufgeheizt wird.“<br />
Viele Prozesse in der Industrie finden in diesem<br />
Temperaturbereich statt, daher ist diese<br />
Methode optimal geeignet, um Abwärme<br />
von Industrieanlagen zu nutzen, die sonst<br />
einfach verlorengehen würde. Man kann<br />
solche Temperaturen aber auch einfach erreichen,<br />
indem man Sonnenlicht bündelt.<br />
Durch die Hitze kommt es zu einer chemischen<br />
Reaktion – so wird etwa Borsäure in<br />
Boroxid umgew<strong>and</strong>elt, und dabei wird Wasser<br />
freigesetzt. Die ölige Boroxid-Suspension<br />
kann man dann in Tanks lagern. Wenn<br />
man dieser Suspension dann wieder Wasser<br />
zuführt, läuft die chemische Reaktion umgekehrt<br />
ab, und die gespeicherte Wärme<br />
wird wieder freigesetzt.<br />
„Damit ist der Kreislauf geschlossen und<br />
die Suspension kann ein weiteres Mal verwendet<br />
werden“, erklärt Franz Winter. „Im<br />
Labor haben wir gezeigt, dass auf diese Weise<br />
problemlos viele Auf- und Entladungsvorgänge<br />
möglich sind.“<br />
Viele Vorteile gleichzeitig<br />
Die Technologie wurde bereits patentiert,<br />
nun soll noch genauer untersucht werden,<br />
wie sie sich am besten und effizientesten<br />
anwenden lässt. „Für unterschiedliche Anwendungsbereiche<br />
werden unterschiedliche<br />
Reaktorgrößen optimal sein“, sagt Franz<br />
Winter. „Man muss diese Reaktoren immer<br />
als Teil eines Gesamtsystems sehen. Je nachdem,<br />
welche Wärmemengen bei welchen<br />
Temperaturen etwa in einer Industrieanlage<br />
anfallen und welche <strong>and</strong>eren energietechnischen<br />
Einrichtungen es dort bereits gibt,<br />
muss man den Prozess optimal anpassen.“<br />
Neben Borsäure können auch <strong>and</strong>ere Chemikalien<br />
eingesetzt werden – auch Salzhydrate<br />
wurden untersucht. Borsäure und<br />
Salzhydrate vereinen gleich mehrere Vorteile:<br />
Sie sind kostengünstig und einfach verfügbar,<br />
relativ ungefährlich und über viele<br />
Zyklen hinweg stabil und können beliebig<br />
lange aufbewahrt werden. Die Reaktortechnologie<br />
kann auf industrielle Maßstäbe<br />
hochskaliert werden. Das verwendete Öl<br />
erlaubt optimalen Wärmetransfer und<br />
schützt gleichzeitig den Reaktor während<br />
der Reaktion und die Festst<strong>of</strong>fe während der<br />
Lagerung.<br />
Einen genauen Wirkungsgrad des Prozesses<br />
kann man derzeit noch nicht angeben –<br />
er wird stark davon abhängen, wie der Speicher<br />
mit <strong>and</strong>eren Technologien gekoppelt<br />
wird. Der große Vorteil ist, die langfristige<br />
Speichermöglichkeit von Wärmemengen,<br />
die sonst einfach verlorengehen würden,<br />
und deren bedarfsorientierte Nutzung.<br />
„Wir wollen nun, auch gemeinsam mit Industriepartnern,<br />
intensiv an dieser Technologie<br />
weiter<strong>for</strong>schen“, kündigt Franz Winter<br />
an. „Wir sind überzeugt davon, dass mit<br />
dieser Erfindung ein wichtiger Schritt nach<br />
vorne gelungen ist, der in den nächsten Jahren<br />
auch den Schritt in die industrielle Anwendung<br />
finden wird.“<br />
LL<br />
www.tuwien.at (222341255)<br />
Neue Erdbebenanalysen<br />
stärken die Katastrophenvorsorge<br />
in Europa<br />
(gfz) Im 20. Jahrhundert haben Erdbeben in<br />
Europa mehr als 200.000 Todesopfer ge<strong>for</strong>dert<br />
und Schäden in Höhe von über 250<br />
Milliarden Euro verursacht. Umfassende<br />
Analysen der Erdbebengefährdung und des<br />
Erdbebenrisikos spielen eine bedeutende<br />
Rolle, wenn es darum geht, die Auswirkungen<br />
katastrophaler Erdbeben zu verringern.<br />
Das kürzlich veröffentlichte aktualisierte<br />
Erdbebengefährdungsmodell sowie das erste<br />
Erdbebenrisikomodell für Europa stellen<br />
die Grundlagen bereit, um die Erdbebenprävention<br />
zu stärken und die Bevölkerung widerst<strong>and</strong>sfähiger<br />
zu machen. Die Modelle<br />
verbessern das Verständnis darüber, wo<br />
starke Erschütterungen am ehesten auftreten<br />
und welche Auswirkungen künftige Erdbeben<br />
in Europa haben werden. Seismologinnen,<br />
Geologen und Ingenieurinnen aus<br />
ganz Europa entwickelten die Modelle, mit<br />
Beteiligung von Mitarbeitenden des Deutschen<br />
GeoForschungsZentrums Potsdam<br />
(GFZ). Die Forschungsarbeiten wurden<br />
durch das Forschungs- und Innovationsprogramm<br />
Horizon 2020 der Europäischen<br />
Union gefördert.<br />
Hintergrund zu<br />
Erdbebengefährdung und -risiko<br />
Erdbeben können weder verhindert noch<br />
genau vorhergesagt werden. Erdbebengefährdungs-<br />
und Erdbebenrisikomodelle ermöglichen<br />
es jedoch, wirksame Vorsorgemaßnahmen<br />
festzuschreiben und damit die<br />
Auswirkungen auf Gebäude und ihre Bewohner<br />
erheblich zu verringern. Die Europäischen<br />
Erdbebengefährdungs- und Erdbebenrisikomodelle<br />
2020 beschreiben, wo<br />
durch Erdbeben ausgelöste Erschütterungen<br />
zu erwarten sind, wie stark und wie<br />
häufig diese auftreten und welche möglichen<br />
Auswirkungen sie auf die bebaute Umwelt<br />
und auf Menschen haben. Zu diesem<br />
Zweck wurden alle den Modellen zugrundeliegenden<br />
Datensätze aktualisiert und harmonisiert<br />
– ein komplexes Unterfangen angesichts<br />
der riesigen Datenmengen und der<br />
stark unterschiedlichen tektonischen Gegebenheiten<br />
in Europa. Eine solche Harmonisierung<br />
ist unabdingbar, um wirksame länderübergreifende<br />
Strategien zur Katastrophenvorsorge<br />
zu etablieren, wie beispielsweise<br />
die Festlegung von Versicherungskonzepten<br />
oder die Bestimmung von zeitgemässen<br />
Bauvorschriften auf europäischer (z. B.<br />
Eurocode 8) und nationaler Ebene. In Europa<br />
beschreibt Eurocode 8 die empfohlenen<br />
Normen für eine erdbebengerechte Bauweise<br />
von Neubauten und für die Ertüchtigung<br />
bestehender Gebäude mit dem Ziel, die Auswirkungen<br />
von Erdbeben einzudämmen.<br />
Das aktualisierte Europäische Erdbebengefährdungsmodell<br />
sowie das neue Erdbebenrisikomodell<br />
sind frei zugänglich inklusive<br />
der ihnen zugrundeliegenden Datensätze.<br />
Erweiterte Datensätze verbessern<br />
das aktualisierte Erdbebengefährdungsmodell<br />
Die Erdbebengefährdung beschreibt potenzielle<br />
Bodenerschütterungen durch<br />
künftige Erdbeben und beruht auf dem Wissen<br />
über vergangene Erdbeben, der Geologie,<br />
Tektonik und den lokalen Bedingungen<br />
an beliebigen Orten in ganz Europa. Das<br />
kürzlich publizierte Europäische Erdbebengefährdungsmodell<br />
2020 (ESHM20) ersetzt<br />
das Vorgängermodell aus dem Jahr 2013.<br />
Die erweiterten Datensätze, welche in die<br />
neue Version des Modells integriert worden<br />
sind, ermöglichen eine umfassendere Beurteilung<br />
der Erdbebengefährdung in Europa.<br />
Diese hat zur Folge, dass die Einschätzungen<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 27
News from Science & Research<br />
der zu erwartenden Bodenerschütterungen<br />
in den meisten Teilen Europas im Vergleich<br />
zum Modell von 2013 nach unten korrigiert<br />
wurden. Hiervon ausgenommen sind einige<br />
Regionen in der westlichen Türkei, Griechenl<strong>and</strong>,<br />
Albanien, Rumänien, im Süden<br />
Spaniens und Portugals. Dort wurden die<br />
Einschätzungen der zu erwartenden Bodenerschütterungen<br />
nach oben angepasst. Das<br />
aktualisierte Modell bestätigt die Türkei,<br />
Griechenl<strong>and</strong>, Albanien, Italien und Rumänien<br />
als die Länder mit der höchsten Erdbebengefährdung<br />
in Europa, gefolgt von den<br />
<strong>and</strong>eren Ländern des Balkans. Aber auch in<br />
Regionen mit niedriger oder mässiger Gefährdungseinschätzung<br />
können jederzeit<br />
schadenbringende Erdbeben auftreten.<br />
Neben diesen Erkenntnissen bilden spezifische<br />
Erdbebengefährdungskarten des aktualisierten<br />
europäischen Erdbebengefährdungsmodells<br />
eine wichtige In<strong>for</strong>mationsgrundlage<br />
für die zweite <strong>Generation</strong> der Eurocode<br />
8 Normen. Diese können als wichtige<br />
Referenz für nationale Normen dienen, wobei<br />
die nationalen Modelle, s<strong>of</strong>ern vorh<strong>and</strong>en,<br />
die massgeblichen Grundlagen für die<br />
Baunormen und weitere Aspekte der Erdbebenvorsorge<br />
auf nationaler, regionaler und<br />
lokaler Ebene liefern. Die Berücksichtigung<br />
von Erdbebengefährdungsmodellen in Vorschriften<br />
für eine erdbebengerechte Bauweise<br />
trägt dazu bei, Gebäude angemessen gegen<br />
Erdbeben abzusichern. Eine erdbebengerechte<br />
Bauweise ist eine der wirksamsten<br />
Massnahmen, um die europäische Bevölkerung<br />
besser vor Erdbeben zu schützen.<br />
Ältere Gebäude, eine hohe Erdbebengefährdung<br />
und städtische Gebiete<br />
bestimmen das Erdbebenrisiko<br />
Das Erdbebenrisiko beschreibt die erwarteten<br />
Folgen eines Erdbebens auf die Bevölkerung<br />
und die Wirtschaft. Um das Erdbebenrisiko<br />
zu bestimmen, werden In<strong>for</strong>mationen<br />
über den lokalen Untergrund, die<br />
Dichte von Gebäuden und Menschen, die<br />
Verletzbarkeit des Gebäudebest<strong>and</strong>es sowie<br />
robuste Einschätzungen der Erdbebengefährdung<br />
benötigt. Gemäß dem Europäischen<br />
Erdbebenrisikomodell 2020<br />
(ESRM20) ist das Erdbebenrisiko dort am<br />
höchsten, wo es viele ältere, das heißt vor<br />
den 1980er Jahren errichtete Gebäude gibt,<br />
in städtischen Gebieten und wo eine hohe<br />
Erdbebengefährdung besteht.<br />
Obwohl die meisten europäischen Länder<br />
über neuere Bauvorschriften und -normen<br />
verfügen, die einen angemessenen Schutz<br />
vor Erdbeben gewährleisten, gibt es noch<br />
immer viele nicht oder nur unzureichend<br />
ertüchtigte ältere Gebäude. Sie bergen ein<br />
höheres Risiko für ihre Bewohner. Das<br />
höchste Erdbebenrisiko betrifft daher insbesondere<br />
städtische Gebiete, die zudem <strong>of</strong>t<br />
eine Geschichte von schadenbringenden<br />
Erdbeben aufweisen und damit Städte wie<br />
Istanbul und Izmir in der Türkei, Catania<br />
und Neapel in Italien, Bukarest in Rumänien<br />
und Athen in Griechenl<strong>and</strong>. Allein auf diese<br />
vier Länder entfallen fast 80 % des modellierten<br />
wirtschaftlichen Schadens von 7 Milliarden<br />
Euro, den Erdbeben im jährlichen<br />
Durchschnitt in Europa verursachen. Aber<br />
auch Städte wie Zagreb (Kroatien), Tirana<br />
(Albanien), S<strong>of</strong>ia (Bulgarien), Lissabon<br />
(Portugal), Brüssel (Belgien) und Basel<br />
(Schweiz) tragen ein überdurchschnittlich<br />
hohes Erdbebenrisiko verglichen mit weniger<br />
exponierten Städten wie Berlin<br />
(Deutschl<strong>and</strong>), London (Vereinigtes Königreich)<br />
oder Paris (Frankreich).<br />
Die Entwicklung der Modelle beruht<br />
auf einer gemeinsamen Anstrengung<br />
– die Rolle des GFZ<br />
Ein Kernteam von Forschenden aus verschiedenen<br />
Einrichtungen in ganz Europa,<br />
mit Beteiligung des GFZ, hat gemeinsam an<br />
der Entwicklung des ersten <strong>of</strong>fen zugänglichen<br />
Erdbebenrisikomodells für Europa und<br />
an der Aktualisierung des europäischen Erdbebengefährdungsmodells<br />
gearbeitet. Sie<br />
haben an einem Vorhaben mitgewirkt, das<br />
vor mehr als 30 Jahren begann und an dem<br />
Tausende von Menschen aus ganz Europa<br />
beteiligt waren. Diese Anstrengungen wurden<br />
in all diesen Jahren durch mehrere von<br />
der Europäischen Kommission finanzierte<br />
Projekte und durch nationale Gruppen unterstützt.<br />
Wissenschaftler des GFZ haben eine wichtige<br />
Rolle bei der Entwicklung des ESHM20<br />
und des ESRM20 gespielt und drei entscheidende<br />
Komponenten der Modelle beigesteuert.<br />
Der erste Beitrag ist ein neuer Katalog<br />
von Erdbeben für Europa vom Beginn des<br />
20. Jahrhunderts bis heute. Die Leitung dieses<br />
Projektes lag bei Graeme Weatherill,<br />
Wissenschafter in der GFZ-Sektion 2.6 „Erdbebengefährdung<br />
und Dynamische Risiken”.<br />
Dieser Katalog fasst Erdbebendaten<br />
aus Dutzenden von Datenquellen und seismischen<br />
Aufzeichnungsnetzen in ganz Europa<br />
zusammen und harmonisiert sie zu einem<br />
gemeinsamen Referenzkatalog, aus<br />
dem das ESHM20 Statistiken über die Häufigkeit<br />
von Erdbeben abgeleitet hat.<br />
Der zweite wichtige Beitrag ist ein vollständiges<br />
paneuropäisches Modell zur Vorhersage<br />
von Bodenerschütterungen unter Leitung<br />
von Fabrice Cotton, der am GFZ die Sektion<br />
2.6 „Erdbebengefährdung und Dynamische<br />
Risiken” leitet. Dieses baut auf den jüngsten,<br />
schnell wachsenden Datenbanken von Bodenbewegungsbeobachtungen<br />
in Europa<br />
auf. Die Forschenden nutzen modernste Modellierungstechniken,<br />
um die Verteilung<br />
starker Bodenbewegungen für künftige Erdbeben<br />
in Europa vorherzusagen, wobei die<br />
Vorhersagen regional angepasst werden, um<br />
die komplexe Mischung tektonischer Umgebungen<br />
in Europa zu berücksichtigen.<br />
Schließlich hat das GFZ unter Leitung von<br />
Graeme Weatherill das erste paneuropäische<br />
Modell entwickelt, das den Einfluss der<br />
oberflächennahen Geologie und der lokalen<br />
St<strong>and</strong>ortbedingungen auf starke Bodenbewegungen<br />
an der Erdoberfläche beschreibt.<br />
Dieses Modell ist für die seismische Risikoanalyse<br />
von entscheidender Bedeutung: Es<br />
sagt einerseits die Stärke der Erschütterungen<br />
vorher, denen die Gebäude an einem<br />
St<strong>and</strong>ort bei künftigen Erdbeben ausgesetzt<br />
sein werden. Und <strong>and</strong>ererseits die Art und<br />
Weise, in der dies durch die Eigenschaften<br />
der Bodenoberfläche in der Nähe der Gebäude<br />
selbst beeinflusst wird. Alle diese Datensätze<br />
und Modelle wurden mit dem<br />
ESHM20 und dem ESRM20 öffentlich zugänglich<br />
gemacht, was Forschenden und<br />
Ingenieur:innen in ganz Europa helfen<br />
kann, sie ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend<br />
anzupassen und zu verbessern.<br />
Das GFZ hat auch den Vorsitz der EFEHR<br />
(European Facilities <strong>of</strong> Earthquake Hazard<br />
<strong>and</strong> Risk) inne, die 2020 gegründet wurde,<br />
um die langfristige Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit<br />
und Zugänglichkeit von quell<strong>of</strong>fenen<br />
und transparenten europäischen Modellen<br />
zur Erdbebengefährdung und zum<br />
Erdbebenrisiko sicherzustellen.<br />
Das EFEHR Konsortium<br />
EFEHR (European Facilities <strong>for</strong> Earthquake<br />
Hazard <strong>and</strong> Risk) pflegt und entwickelt<br />
das Erdbebengefährdungs- und Erdbebenrisikomodell<br />
für Europa in Zusammenarbeit<br />
mit der GEM Stiftung und dem European<br />
Plate Observing System (EPOS) weiter.<br />
EFEHR ist ein gemeinnütziges Netzwerk von<br />
Organisationen und Gemeinschaftsressourcen<br />
mit dem Ziel, die Analyse der Erdbebengefährdung<br />
und des Erdbebenrisikos im europäisch-mediterranen<br />
Raum voranzutreiben.<br />
Projektförderung: Die Entwicklung der<br />
Erdbebengefährdungs- und Erdbebenrisikomodelle<br />
2020 wurde durch das Forschungsund<br />
Innovationsprogramm Horizont 2020<br />
der Europäischen Union unter den Finanzhilfevereinbarungen<br />
730900, 676564 und<br />
821115 der Projekte SERA, EPOS-IP und<br />
RISE gefördert.<br />
L L www.efehr.org (222341300)<br />
www.hazard.efehr.org<br />
www.risk.efehr.org<br />
28 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Power<br />
News<br />
Registration*<br />
& Programme<br />
Power News<br />
AGEB: Energieverbrauch in<br />
Deutschl<strong>and</strong><br />
Daten für das<br />
1. und 2. Quartal <strong>2022</strong><br />
(ageb) Das sich spürbar abschwächende<br />
Wirtschaftswachstum, eine milde Witterung<br />
sowie deutliche Energieeinsparungen vor<br />
dem Hintergrund kräftig steigender Preise<br />
haben im 1. Halbjahr des laufenden Jahres<br />
zu einem Rückgang des Energieverbrauchs<br />
in Deutschl<strong>and</strong> um 3,5 Prozent geführt.<br />
Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft<br />
Energiebilanzen erreichte<br />
der inländische Primärenergieverbrauch<br />
im 1. Halbjahr <strong>2022</strong> eine Höhe von 5.950<br />
Petajoule (PJ) beziehungsweise 203,0 Millionen<br />
Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t<br />
SKE).<br />
Workshop<br />
2 nd KISSY<br />
Provider Day <strong>2022</strong><br />
27 September <strong>2022</strong><br />
Online Webinar<br />
Die AG Energiebilanzen geht davon aus,<br />
dass die hohen Energiepreise einerseits zu<br />
kurzfristig wirkenden Energieeinsparungen<br />
geführt haben, <strong>and</strong>ererseits aber auch langfristig<br />
wirkende Einsparungen auslösen,<br />
weil sich Investitionen in die Senkung des<br />
Energieverbrauchs stärker lohnen. Das im 1.<br />
Halbjahr auf 1,5 Prozent gefallene Wirtschaftswachstum<br />
hatte nur noch einen geringen<br />
verbrauchssteigernden Effekt.<br />
Ohne den verbrauchssenkenden Effekt der<br />
milden Witterung wäre der Energieverbrauch<br />
nach Berechnungen der AG Energiebilanzen<br />
nur um 0,5 Prozent gesunken. Unter<br />
Berücksichtigung des Temperatureffekts<br />
sowieder<br />
CONTACT<br />
weiter verringerten<br />
& REGISTRATION<br />
Vorräte bei<br />
den Verbrauchern FACHLICHE wäre KOORDINATION<br />
der Energieverbrauch<br />
im 1. Halbjahr sogar leicht gestiegen.<br />
Vom Wirtschaftswachstum Stephanie Wilmsen und der Demografie<br />
gingen t +49 positive 201 8128 Impulse 244aus, die von<br />
den preisgetriebenen Einspareffekten überkompensiert<br />
e kissy@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
wurden.<br />
Der Verbrauch TEILNEHMER von Mineralöl war in den<br />
ersten sechs Monaten des laufenden Jahres<br />
insgesamt Diana um 7,3 Ringh<strong>of</strong>f Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.<br />
t +49 201 Alle 8128 Mineralölprodukte 232 verzeichneten<br />
e <strong>vgbe</strong>-dampfturb@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Zuwächse: Der Verbrauch von<br />
Ottokraftst<strong>of</strong>f stieg um 5,7 Prozent, beim<br />
Dieselkraftst<strong>of</strong>f gab es einen Zuwachs um<br />
AUSSTELLUNG<br />
3,5 Prozent. Der Absatz von Flugkraftst<strong>of</strong>f<br />
stieg kräftig Angela um mehr Langen als 60 Prozent und die<br />
Lieferungen von Rohbenzin an die chemische<br />
Industrie erhöhten sich um mehr als 6<br />
t +49 201 8128 310<br />
Prozent. e Der angela.langen@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Heizölabsatz verzeichnete einen<br />
Zuwachs von etwas über 10 Prozent.<br />
Der Anstieg <strong>vgbe</strong> des <strong>energy</strong> Mineralölverbrauchs e. V. insgesamt,<br />
insbesondere Deilbachtal jedoch 173 | die 45257 Zuwächse Essen | Deutschl<strong>and</strong><br />
beim Absatz von Flugkraftst<strong>of</strong>f und Heizöl,<br />
WEBSITE<br />
w https://t1p.de/<strong>vgbe</strong>-kissy<strong>2022</strong>sep<br />
CONTACT & REGISTRATION<br />
Stephanie Wilmsen<br />
t +49 201 8128 244<br />
e kissy@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
* Participation is free,<br />
Registration is required!<br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 29
Power News<br />
beruhen größtenteils auf einem statistischen<br />
Basiseffekt, da der Absatz im 1. Quartal<br />
2021 unter <strong>and</strong>erem p<strong>and</strong>emiebedingt<br />
kräftig eingebrochen war.<br />
Der Erdgasverbrauch verminderte sich im<br />
1. Halbjahr des laufenden Jahres deutlich<br />
um knapp 15 Prozent. Hauptursache für diese<br />
Entwicklung war die mildere Witterung<br />
sowie das hohe Preisniveau. Zudem verringerte<br />
sich der Einsatz von Erdgas zur Stromerzeugung,<br />
weil die erneuerbaren Energien<br />
– vor allem im 1. Quartal – höhere Beiträge<br />
lieferten.<br />
Der Verbrauch an Steinkohle nahm insgesamt<br />
um 9,2 Prozent zu. Der Einsatz von<br />
Steinkohle in Kraftwerken erhöhte sich um<br />
26 Prozent. Einfluss auf diese Entwicklung<br />
hatten die geänderte Wettbewerbssituation<br />
auf dem europäischen Strommarkt. Die Eisen-<br />
und Stahlindustrie verringerte ihre<br />
Nachfrage um 5 Prozent.<br />
Der Verbrauch von Braunkohle lag um<br />
10,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraumes,<br />
aber um etwa 5 Prozent unter<br />
dem Vergleichswert von 2019 und folgt<br />
somit weiter dem längerfristigen Reduktionspfad.<br />
In den ersten beiden Monaten des<br />
laufenden Jahres sorgte die hohe Produktion<br />
von Strom aus Windanlagen für einen<br />
Rückgang bei der Braunkohleverstromung,<br />
von März bis Juni stieg der Bedarf von Strom<br />
aus Braunkohlekraftwerken hingegen deutlich<br />
an, da weniger Strom aus Windenergieanlagen<br />
ins Netz eingespeist wurde. Außerdem<br />
ersetzte Strom aus Braunkohlekraftwerken<br />
einen Teil der Stromerzeugung aus<br />
den Ende 2021 abgeschalteten Kernkraftwerken<br />
und trug zur Versorgungssicherheit<br />
auf dem europäischen Strommarkt bei.<br />
Die Stromerzeugung aus Kernenergie verringerte<br />
sich im Berichtszeitraum verglichen<br />
mit dem 1. Halbjahr des Vorjahres um gut<br />
die Hälfte. Der starke Rückgang ist auf die<br />
Stilllegung der Anlagen in Grohnde, Brokdorf<br />
und Gundremmingen und der damit<br />
verbundenen Verminderung der installierten<br />
Leistung von 8.113 auf 4.055 Megawatt<br />
(MW) zurückzuführen.<br />
Der Beitrag der erneuerbaren Energien<br />
stieg im 1. Halbjahr <strong>2022</strong> um 4,7 Prozent.<br />
Bei außergewöhnlich guten Windverhältnissen<br />
insbesondere im Februar steigerten die<br />
Windenergieanlagen ihren Beitrag im 1.<br />
Halbjahr um 18 Prozent. Die Solarenergie<br />
konnte um 20 Prozent zulegen. Bei der Biomasse,<br />
die mehr als die Hälfte des erneuerbaren<br />
Energieverbrauchs liefert, kam es<br />
witterungsbedingt insgesamt zu einem<br />
leichten Rückgang um 2 Prozent.<br />
LL<br />
www.ag-energiebilanzen.de<br />
(222341526)<br />
Was, wenn der Blitz einschlägt?<br />
Unfälle melden, Schutz verbessern<br />
• Allein in Deutschl<strong>and</strong> gibt es jährlich<br />
52 Blitzunfälle mit Personenschaden,<br />
Sachschäden liegen bei über 200 Mio. €<br />
• VDE ABB startet die Aktion<br />
Blitzunfallanalyse (VABULA)<br />
(vde) Ob auf einem großen Open Air-Konzert<br />
oder bei einem Spaziergang im Wald:<br />
Vor einem aufziehenden Gewitter hat jeder<br />
Mensch Respekt. 2020 waren es 399.000<br />
Blitze, die in Deutschl<strong>and</strong> einschlugen und<br />
52 Blitzunfälle mit Personenschaden. Zum<br />
Weltblitzschutztag startete der VDE Ausschuss<br />
für Blitzschutz und Blitz<strong>for</strong>schung<br />
(VDE ABB) die VDE Aktion Blitzunfallanalyse<br />
(VABULA). Bislang beruhen die Entwicklung<br />
von Blitzschutzanlagen und Empfehlungen<br />
für individuelles Verhalten zum Teil<br />
auf Erfahrungswerten, eine breite Datenbasis<br />
gibt es dafür nicht. Um die Schutzmaßnahmen<br />
für die Bürgerinnen und Bürger zu<br />
erhöhen, ruft der VDE deshalb alle auf, Blitzunfälle<br />
und geschädigte Personen zu melden,<br />
die weitere Datenerhebung übernehmen<br />
Fachexperten.<br />
Warum sich mitmachen lohnt<br />
Aufgrund der kaum verfügbaren Daten zur<br />
Wirkung von Blitzen auf den menschlichen<br />
Körper gibt es für viele Situationen keine<br />
konkreten Empfehlungen. So ist zum Beispiel<br />
nicht klar, welchen Abst<strong>and</strong> ein Mensch<br />
zur Sicherheit zu einer Erdungsleitung einhalten<br />
muss, wenn dort ein Blitz in die Erde<br />
geleitet wird. Auch gibt es keine Angaben<br />
dazu, wie weit man auf freiem Feld von einem<br />
Mast entfernt sein sollte.<br />
Diagnostik und Therapie ließen sich verbessern,<br />
wenn mehr bekannt wäre über die<br />
Auswirkungen von direkten Einschlägen,<br />
der Berührung von Gegenständen, in die der<br />
Blitz eingeschlagen hat, oder bei der Wirkung<br />
der sogenannten Schrittspannung im<br />
menschlichen Körper. In diesem Fall führt<br />
der Blitz, der in die Erde eingeleitet wurde,<br />
zu einer Spannung zwischen den Füßen eines<br />
Menschen, der einen Schritt macht.<br />
Und so geht‘s<br />
Auf https://www.vde.com/blitzunfall-melden<br />
finden sich alle In<strong>for</strong>mationen, die zur<br />
Mitarbeit an der Aktion benötigt werden.<br />
Online kann ein Blitzunfall gemeldet werden<br />
sowie die Personen, die ggf. durch die<br />
Blitzeinwirkung geschädigt wurden. Die<br />
weitere Arbeit übernimmt eine regional ansässige<br />
Blitzschutz-Fachkraft in Kooperation<br />
mit dem VDE. Selbstverständlich werden<br />
alle Vorgaben zum Schutz persönlicher Daten<br />
erfüllt.<br />
LL<br />
www.vde.com (222341221)<br />
Events in brief<br />
Fachmessen für Prozessund<br />
Fabrikautomation für die<br />
Wirtschaftsregionen<br />
Südwest sowie Rhein-Ruhr<br />
MEORGA veranstaltet am 14. September<br />
<strong>2022</strong> in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen<br />
und am 26. Oktober <strong>2022</strong> im<br />
RuhrCongress Bochum jeweils Fachmessen<br />
für Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik,<br />
Prozessleitsysteme und Automatisierungstechnik.<br />
Hier zeigen jeweils rund 160 Fachfirmen –<br />
darunter die Marktführer der Branche – ihr<br />
Leistungsspektrum, Geräte und Systeme,<br />
Engineering- und Serviceleistungen sowie<br />
neue Trends im Bereich der Automatisierung.<br />
Darüber hinaus können sich die Besucher<br />
in 36 praxisnahen Fachvorträgen umfassend<br />
über den aktuellen St<strong>and</strong> der<br />
MSR-Technik in<strong>for</strong>mieren.<br />
Auf den Ständen sind die jeweiligen regionalen<br />
Ansprechpartner vertreten, welche<br />
den größten Wert auf das lösungsorientierte<br />
Fachgespräch in einer pr<strong>of</strong>essionellen und<br />
serviceorientierten Messeatmosphäre legen.<br />
Dabei werden nicht nur neue Kundenkontakte<br />
aufgebaut, sondern auch bestehende<br />
gepflegt.<br />
Die Messe wendet sich an Fachleute und<br />
Entscheidungsträger, die in ihren Unternehmen<br />
für die Optimierung der Geschäfts- und<br />
Produktionsprozesse entlang der gesamten<br />
Wertschöpfungskette verantwortlich sind.<br />
Der Eintritt zur Messe und die Teilnahme an<br />
den Fachvorträgen sind für die Besucher<br />
kostenlos und sollen ihnen In<strong>for</strong>mationen<br />
und interessante Gespräche ohne Hektik<br />
und Zeitdruck ermöglichen.<br />
Die er<strong>for</strong>derliche Besucherregistrierung<br />
erfolgt über die Internetseite von MEORGA.<br />
https://meorga.de/anmeldung.php<br />
Veranstaltungsdaten<br />
• MSR-Fachmesse Südwest<br />
Mittwoch, 14. September <strong>2022</strong><br />
8:00 bis 16:00 Uhr<br />
Friedrich-Ebert-Halle, Ludwigshafen<br />
• MSR-Fachmesse Rhein-Ruhr<br />
Mittwoch, 26. Okt. <strong>2022</strong><br />
8:00 bis 16:00 Uhr<br />
RuhrCongress, Bochum<br />
LL<br />
www.meorga.de<br />
30 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Power News<br />
Anmeldung & Programm<br />
Schwerpunkt Niederl<strong>and</strong>e auf der<br />
WindEnergy Hamburg:<br />
Eine innovationsstarke Branche<br />
und ein breites Dienstleistungsangebot<br />
(w-e-h) Die Niederl<strong>and</strong>e haben hervorragende<br />
natürliche Bedingungen für die Gewinnung<br />
von Windenergie. Und die niederländische Regierung<br />
setzt stark auf Offshore-Windparks: Im<br />
Jahr 2050 soll die gesamte in den Niederl<strong>and</strong>en<br />
verbrauchte Energie aus erneuerbaren Quellen<br />
stammen und Offshore-Windkraft ist der<br />
Schlüssel für den Übergang zu einer kohlenst<strong>of</strong>ffreien<br />
Energieversorgung. Gemeinsam mit<br />
Deutschl<strong>and</strong>, Dänemark und Belgien haben<br />
sich die Niederl<strong>and</strong>e im Mai <strong>2022</strong> auf die Esbjerg-Erklärung<br />
geeinigt und beschlossen, bis<br />
2030 mindestens 65 Gigawatt (GW) an Offshore-Windenergie<br />
zu installieren. Daher spielen<br />
die Niederl<strong>and</strong>e auch für die WindEnergy Hamburg<br />
eine wichtige Rolle: „Nach Deutschl<strong>and</strong><br />
und Dänemark sind niederländische Unternehmen<br />
mit zur Zeit 73 angemeldeten Ständen die<br />
drittgrößte Gruppe unter unseren Ausstellern.<br />
Mehr als 30 der Aussteller nehmen im September<br />
im Dutch Village der Netherl<strong>and</strong>s WindEnergy<br />
Association (NWEA) teil. So zeigen wir<br />
die große B<strong>and</strong>breite der niederländischen<br />
Windindustrie“, sagt Andreas Arnheim, Projektleiter<br />
der WindEnergy Hamburg.<br />
Workshop<br />
Öl im Kraftwerk <strong>2022</strong><br />
10. und 11. November <strong>2022</strong><br />
Bedburg<br />
WindEnergy Hamburg<br />
Alle zwei Jahre trifft sich eine der spannendsten<br />
Branchen auf dem weltweit führenden Networking-Hub<br />
der Windenergie: Auf der WindEnergy<br />
Hamburg im Herzen der pulsierenden<br />
Hansestadt präsentieren mehr als 1.250 Unternehmen<br />
aus 40 Ländern in zehn Messehallen<br />
bis zu 30.000 Besuchern aus 100 Nationen ihre<br />
Innovationen und Lösungen. Anlagenhersteller<br />
und Zulieferer entlang der gesamten Wertschöpfungskette<br />
der Windenergie onshore und<br />
<strong>of</strong>fshore CONTACT geben auf 68.500 & REGISTRATION<br />
m2 einen umfassenden<br />
Marktüberblick. Service-Anbieter, von der<br />
Planung FACHLICHE und Projektierung, KOORDINATION<br />
über Installation,<br />
Betrieb und Wartung, Vermarktung, Zertifizierung<br />
bis Stephanie hin zur Finanzierung Wilmsenbieten ihre Expertise<br />
an. t +49 Begleitet 201 wird 8128 die 244 Expo von hochkarätig<br />
besetzten e kissy@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Konferenz-Sessions zu allen<br />
Schwerpunktthemen, die die Branche bewegen.<br />
Das Team der WindEnergy Hamburg gestaltet<br />
dieses<br />
TEILNEHMER<br />
Programm gemeinsam mit seinen<br />
Partnern, Diana unter Ringh<strong>of</strong>f<br />
<strong>and</strong>erem dem globalen Windenergieverb<strong>and</strong><br />
GWEC, dem europäischen Verb<strong>and</strong><br />
WindEurope, den nationalen Verbänden<br />
t +49 201 8128 232<br />
VDMA und e <strong>vgbe</strong>-dampfturb@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
BWE sowie führenden Medien und<br />
Ausstellern der Branche. Vom 27. bis 30. September<br />
AUSSTELLUNG<br />
<strong>2022</strong> werden alle Sessions kostenfrei<br />
auf vier Open Stages direkt in den Messehallen<br />
angeboten. Angela Parallel Langen zur WindEnergy Hamburg<br />
<strong>2022</strong> wird t +49 auch 201 erstmals 8128 die 310 H2 Expo <strong>and</strong> Conference<br />
e<br />
stattfinden,<br />
angela.langen@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
der neue internationale<br />
Treffpunkt für die Erzeugung, Verteilung und<br />
Nutzung von grünem Wasserst<strong>of</strong>f.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e. V.<br />
LL<br />
www.wind<strong>energy</strong>hamburg.com<br />
Deilbachtal 173 | 45257 Essen | Deutschl<strong>and</strong><br />
(222341617)<br />
WEBSITE<br />
w https://t1p.de/<strong>vgbe</strong>-OEKW<strong>2022</strong><br />
FACHLICHE KOORDINATION<br />
Anna-Maria Mika<br />
t +49 201 8128 268<br />
e <strong>vgbe</strong>-oil-pp@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
ANMELDUNG & INFORMATIONEN<br />
Diana Ringh<strong>of</strong>f<br />
t +49 201 8128 232<br />
e <strong>vgbe</strong>-oil-pp@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 31
Emission footprint analysis <strong>of</strong><br />
dispatchable gas-based power<br />
generation technologies<br />
Tobias Sieker, Nils Petersen, Thomas Bexten, Manfred Wirsum, Arne Güdden,<br />
Johannes Claßen, Stefan Pischinger, Christian Lenz, Thorsten Krol <strong>and</strong> Heimo Friede<br />
Kurzfassung<br />
Analyse des Emissions-Fußabdrucks<br />
von flexiblen gasbasierten<br />
Stromerzeugungstechnologien<br />
Trotz ihrer Ähnlichkeit als gasbasierte Stromerzeugungstechnologien<br />
werden die betrieblichen<br />
Emissionen von Gasturbinen (GT) und<br />
Gasmotoren (reciprocating internal combustion<br />
engines, RICE) in der Regel unabhängig<br />
vonein<strong>and</strong>er reguliert. In der vorliegenden<br />
Studie wird daher eine vergleichende Analyse<br />
des ökologischen Fußabdrucks von GT- und<br />
RICE-Kraftwerken unter Verwendung einer<br />
einheitlichen Metrik (erzeugte Masse der<br />
Emissionsspezies pro erzeugter elektrischer<br />
Arbeit in g/kWh el ) vorgestellt. Im ersten Teil<br />
der Studie wird diese Metrik angewendet, um<br />
die wichtigsten Emissionsregularien für GTund<br />
RICE-Kraftwerke zu vergleichen. Während<br />
die strengeren NO X -Emissionsregularien<br />
zeigen, dass GuD-Kraftwerke (combined cycle,<br />
CC-GT) im Vergleich zu SC-GT (single cycle,<br />
SC) und RICE in der Regel strikter reguliert<br />
Authors<br />
Tobias Sieker<br />
Nils Petersen<br />
Thomas Bexten<br />
Manfred Wirsum<br />
Institute <strong>of</strong> Power Plant Technology,<br />
Steam <strong>and</strong> Gas Turbines<br />
RWTH Aachen University<br />
Aachen, Germany<br />
Arne Güdden<br />
Johannes Claßen<br />
Stefan Pischinger<br />
Chair <strong>of</strong> Thermodynamics <strong>of</strong><br />
Mobile Energy Conversion<br />
Systems<br />
RWTH Aachen University<br />
Aachen, Germany<br />
Christian Lenz<br />
Thorsten Krol<br />
Heimo Friede<br />
Siemens Energy Global GmbH<br />
& Co. KG, Germany<br />
werden, können die CO-Emissionsregularien<br />
als weitestgehend technologieneutral angesehen<br />
werden. Im zweiten Teil wird das Emissionsverhalten<br />
beider Technologien unter Berücksichtigung<br />
repräsentativer Kraftwerkskonfigurationen<br />
und Betriebsweisen mit<br />
Schwerpunkt auf Anfahren, Teillastbetrieb<br />
und transienten Lastwechseln untersucht. Für<br />
die Bewertung des ökologischen Fußabdrucks<br />
werden Emissionen von Treibhausgasen (z. B.<br />
CO 2 , CH 4 ) und lokalen Schadst<strong>of</strong>fen (z. B.<br />
NO X , CO) berücksichtigt. Wenn die Klimaauswirkungen<br />
der Methanemissionen miteinberechnet<br />
werden, wird der Effizienzvorteil von<br />
RICE gegenüber der SC-GT je nach Betrachtungszeitraum<br />
der Schadensanalyse teilweise<br />
oder vollständig aufgehoben. Die Emissionsspezies<br />
mit dem größten Einfluss auf die Toxizitätsbewertung<br />
sind hingegen NO X und Formaldehyd.<br />
Da RICE-Kraftwerke in der Regel mit<br />
Abgasnachbeh<strong>and</strong>lungssystemen (exhaust<br />
after treatment, EAT) ausgestattet werden, ist<br />
die Toxizitätswirkung von RICE vergleichbar<br />
mit der eines CC-GT-Kraftwerks ohne EAT,<br />
während die Schädlichkeit der SC-GT ohne<br />
EAT in etwa doppelt so hoch ist. Allerdings<br />
muss hierbei die Anfahrphase des Kraftwerks<br />
zukünftig näher untersucht werden. Gasturbinen<br />
können in niedriger Teillast aufgrund des<br />
notwendigen Einsatzes von Diffusionsbrennern<br />
deutlich höhere Emissionen als im Vormischbetrieb<br />
aufweisen. Andererseits kann<br />
der Kaltstart von RICE-Kraftwerken zu erhöhten<br />
Emissionen führen, da die Konvertierungseffizienz<br />
der notwendigen Katalysatoren bei<br />
niedrigen Temperaturen reduziert ist. l<br />
Introduction<br />
The European Green Deal sets the ambitious<br />
objective <strong>of</strong> making the EU carbon-neutral by<br />
2050 [1]. To achieve this objective, The EU<br />
recently introduced taxonomy regulations<br />
aiming to direct investments toward sustainable<br />
projects <strong>and</strong> activities [2]. Within the<br />
<strong>energy</strong> sector, this paradigm change requires<br />
a transition towards sustainable power generation<br />
technologies <strong>and</strong> more comprehensive<br />
environmental considerations. For sustainable<br />
<strong>energy</strong> systems dominated by renewable<br />
<strong>energy</strong>, dispatchable power generation<br />
technologies are an essential asset <strong>for</strong> maintaining<br />
the security <strong>of</strong> supply. Due to their efficiency<br />
<strong>and</strong> operational flexibility, both gas<br />
turbines (GT) <strong>and</strong> gas-fueled reciprocating<br />
internal combustion engines (RICE) are well<br />
suited <strong>for</strong> this task. However, despite their<br />
similarity, emissions resulting from the operation<br />
<strong>of</strong> GT <strong>and</strong> RICE are commonly regulated<br />
independently, using individual references<br />
<strong>and</strong> metrics (e.g., German BImSchV [3]).<br />
Moreover, publicly available studies <strong>and</strong> reports<br />
(e.g., BAT Reference Document <strong>for</strong><br />
Large Combustion Plants [4]) typically investigate<br />
the emission characteristics <strong>of</strong> GT <strong>and</strong><br />
RICE without direct comparison, although<br />
both technologies increasingly compete in<br />
power projects. Considering both the growing<br />
relevance <strong>of</strong> dispatchable gas-based power<br />
generation technologies <strong>and</strong> the need <strong>for</strong><br />
more extensive environmental impact considerations,<br />
the present study aims to provide a<br />
comprehensive emission footprint analysis <strong>of</strong><br />
GT <strong>and</strong> RICE using an apples-to-apples metric<br />
(i.e., generated mass <strong>of</strong> a species per electrical<br />
output, g/kWh el ). In the first part <strong>of</strong> the<br />
study, this apples-to-apples metric is applied<br />
to compare current major regulatory frameworks<br />
<strong>of</strong> both technologies (e.g., German<br />
BImSchV, EU BREF, US EPA 40 CFR) <strong>and</strong><br />
highlights relevant differences. The second<br />
part <strong>of</strong> the study provides a comparative analysis<br />
<strong>of</strong> the emission behavior <strong>of</strong> both GT <strong>and</strong><br />
RICE. Representative power plant configurations<br />
<strong>and</strong> operating regimes are considered,<br />
i.e., “peaking” <strong>and</strong> “baseload” operation, <strong>for</strong><br />
plants with an output between 50 <strong>and</strong><br />
200 MW el . The resulting overall emissions <strong>of</strong><br />
GT <strong>and</strong> RICE are calculated using an EXCELbased<br />
model framework, which is parameterized<br />
using publicly available per<strong>for</strong>mance<br />
<strong>and</strong> emission data <strong>of</strong> both technologies. Similarly,<br />
emission reduction technologies (e.g.,<br />
SCR) are modeled based on literature data.<br />
Employing the introduced apples-to-apples<br />
metric, the overall emissions <strong>of</strong> the investigated<br />
scenarios <strong>and</strong> technologies can be compared<br />
directly. The final part <strong>of</strong> the study discusses<br />
the environmental footprint <strong>of</strong> the<br />
considered gas-based power generation technologies.<br />
The impact <strong>of</strong> the technology choice<br />
<strong>and</strong> operating scenario on the overall emission<br />
footprint is highlighted.<br />
32 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong>
mg<br />
[ ]<br />
mg<br />
[ ]<br />
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable gas-based power generation technologies<br />
1 Legislation overview<br />
1.1 Utilization <strong>of</strong> g/kWh el as an<br />
apples-to-apples metric <strong>for</strong><br />
environmental footprint<br />
analyses<br />
Regulations <strong>and</strong> scientific publications commonly<br />
employ ppmvd 1 , mg/m N 3 , <strong>and</strong> also<br />
non-SI units as metrics <strong>for</strong> quantifying emissions<br />
from dispatchable gas-based power<br />
generation technologies. Emission values<br />
are typically normalized to a reference oxygen<br />
content to account <strong>for</strong> dilution <strong>of</strong> pollutants<br />
due to excess air <strong>and</strong> varying oxygen<br />
contents in the exhaust gas. In most cases,<br />
emissions from GT <strong>and</strong> RICE are normalized<br />
to different oxygen contents 2 . As a result,<br />
normalized emission values cannot be compared<br />
directly. Furthermore, even when the<br />
same reference oxygen content is utilized,<br />
emissions reported in ppmvd or mg/m N ³ do<br />
not account <strong>for</strong> power generation efficiency<br />
associated with the emission release. The<br />
present study uses g/kWh el as an apples-toapples<br />
metric <strong>for</strong> GT <strong>and</strong> RICE emissions to<br />
overcome these limitations. On the one<br />
h<strong>and</strong>, this metric accounts <strong>for</strong> the massbased<br />
emission release, which is essential <strong>for</strong><br />
environmental impact considerations. On<br />
the other h<strong>and</strong>, it considers the electrical efficiency<br />
<strong>of</strong> the investigated power generation<br />
technology, which is a primary indicator <strong>for</strong><br />
a comprehensive technology comparison.<br />
1.2 Comparison <strong>of</strong> major regulatory<br />
frameworks <strong>of</strong> GT <strong>and</strong> RICE<br />
As they impose binding constraints on power<br />
plant operators, regulations have an important<br />
impact on the emission footprint <strong>of</strong><br />
gas-based power generation technologies.<br />
However, significant variations in scope <strong>and</strong><br />
strictness can be observed when considering<br />
1<br />
ppmvd: parts per million by volume (dry)<br />
2<br />
For example, the German 13 th BImSchV defines<br />
a reference oxygen content <strong>of</strong> 15 vol.% <strong>for</strong><br />
GT <strong>and</strong> a reference oxygen content <strong>of</strong> 5 vol.%<br />
<strong>for</strong> RICE [3].<br />
3<br />
Environmental, Health <strong>and</strong> Safety Guidelines<br />
– Small Combustion Facilities Emission Guidelines<br />
[5]<br />
4<br />
Best available techniques (BAT) conclusions<br />
<strong>for</strong> large combustion plants [4]<br />
5<br />
Directive on the limitation <strong>of</strong> emissions from<br />
certain pollutants into the air from medium<br />
combustion plants (EMCP) [6]<br />
6<br />
Verordnung über Großfeuerungs-, Gasturbinen-<br />
und Verbrennungsmotoranlagen (13.<br />
BImSchV) [3]<br />
7<br />
Verordnung über mittelgroße Feuerungs- Gasturbinen-<br />
und Verbrennungsmotoranlagen<br />
(44. BImSchV) [7]<br />
8<br />
Exemplary Environmental Protection Agency<br />
(EPA) site permit [8]<br />
9<br />
The EU BAT conclusions specify value ranges<br />
instead <strong>of</strong> fixed emission limits. There<strong>for</strong>e,<br />
F i g u r e 1 considers the upper <strong>and</strong> lower<br />
bound <strong>of</strong> the respective NO X value ranges<br />
(BAT low <strong>and</strong> high).<br />
kWh el<br />
NO X emissions<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
GT-SC<br />
RICE-SC<br />
GT-CC<br />
RICE-CC<br />
0<br />
30 35 40 45 50 55 60 65 70<br />
el in %<br />
Fig.1. Emission limits <strong>of</strong> major current NO X regulations <strong>for</strong> GT <strong>and</strong> RICE.<br />
kWh el<br />
CO emissions<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
GT-SC<br />
RICE-SC<br />
GT-CC<br />
RICE-CC<br />
13 th BImSchV<br />
WorldBank<br />
BAT low<br />
BAT high<br />
EPA (exemplary)<br />
EMCP<br />
44 th BImSchV<br />
13.BImSchV<br />
BAT low<br />
BAT high<br />
EPA (exemplary)<br />
44. BImSchV<br />
0<br />
30 35 40 45 50 55 60 65 70<br />
el in %<br />
Fig.2. Emission limits <strong>of</strong> the major current CO regulation <strong>for</strong> GT <strong>and</strong> RICE.<br />
current emission regulations <strong>for</strong> GT <strong>and</strong><br />
RICE from a national to a global level. To account<br />
<strong>for</strong> this variety, the present study examines<br />
emission guidelines issued by the<br />
World Bank 3 (WB), emission limits provided<br />
by the EU 4,5 <strong>and</strong> emission limits defined by<br />
national regulators in Germany 6,7 <strong>and</strong> the<br />
United States 8 . Employing the previously introduced<br />
metric <strong>of</strong> g/kWh el , Figure 1<br />
shows an apples-to-apples comparison between<br />
these regulations focusing on nitrogen<br />
oxides (generally referred to as NO X )<br />
emissions 9 depending on the net electrical<br />
efficiency <strong>of</strong> the generating unit.<br />
As most investigated regulations define<br />
emission limits in ppmvd or mg/m N ³, the<br />
conversion to g/kWh el requires in<strong>for</strong>mation<br />
regarding electrical efficiency. Differentiating<br />
between single cycle (SC) <strong>and</strong> combined<br />
cycle (CC) configurations, F i g u r e 1 accounts<br />
<strong>for</strong> a range <strong>of</strong> efficiency values associated<br />
with state-<strong>of</strong>-the-art GT <strong>and</strong> RICE 10 .<br />
For RICE, even though the legislation does<br />
not distinguish between SC <strong>and</strong> CC, the two<br />
technologies are colored differently due to<br />
their different electrical efficiencies. The<br />
displayed data indicate that the more strict<br />
regulations (i.e., EU BAT conclusions,<br />
13 th BImSchV, an exemplary EPA permit <strong>for</strong><br />
gas turbines) result in comparable emission<br />
limits in mass per generated <strong>energy</strong> output<br />
<strong>for</strong> SC-GT <strong>and</strong> SC-RICE. In contrast, the<br />
10<br />
For a given emission limit defined in ppmvd or<br />
mg/m N ³, an increase in electrical efficiency<br />
results in a decreased value in g/kWh el .<br />
Above certain efficiency thresholds <strong>for</strong> SC<strong>and</strong><br />
CC-GT configurations, the 13 th BImSchV<br />
<strong>and</strong> the EU BAT conclusions stipulate a linear<br />
increase in emission limits depending on the<br />
electrical efficiency. As a result, F i g u r e 1<br />
<strong>and</strong> F i g u r e 2 show constant emission limits<br />
when these efficiency limits are surpassed.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 33
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable gas-based power generation technologies<br />
Tab. 1. Comparison <strong>of</strong> NO X <strong>and</strong> CO emission regulations <strong>for</strong> given electrical efficiencies.<br />
Regulation<br />
13 th BImSchV<br />
44 th BImSchV<br />
BAT low<br />
BAT high<br />
EMCP<br />
EPA (exemplary)<br />
World Bank<br />
SC-GT<br />
231<br />
(-8 %)<br />
384<br />
(+54 %)<br />
115<br />
(-14 %)<br />
269<br />
(-46 %)<br />
384<br />
(-39 %)<br />
237<br />
(-65 %)<br />
395<br />
(-70 %)<br />
NO X emission limit<br />
[mg/kWh el ]<br />
RICE<br />
(Ref.)<br />
250<br />
250<br />
133<br />
500<br />
633<br />
671<br />
1331<br />
CO emission limit<br />
[mg/kWh el ]<br />
CC-GT SC-GT RICE<br />
(Ref.)<br />
82<br />
(-67 %)<br />
268<br />
(+7 %)<br />
54<br />
(-59 %)<br />
164<br />
(-67 %)<br />
268<br />
(-58 %)<br />
22<br />
(-97 %)<br />
275<br />
(-79 %)<br />
770<br />
(+23 %)<br />
770<br />
(+23 %)<br />
38<br />
(-81 %)<br />
308<br />
(-54 %)<br />
625<br />
625<br />
200<br />
667<br />
CC-GT<br />
545<br />
(-13 %)<br />
536<br />
(-14 %)<br />
27<br />
(-87 %)<br />
231<br />
(-65 %)<br />
n/a n/a n/a<br />
144<br />
(-64 %)<br />
402<br />
27<br />
(-93 %)<br />
n/a n/a n/a<br />
El. Efficiency [%] 39 45 56 39 45 56<br />
2 Modelling <strong>of</strong> actual engine<br />
<strong>and</strong> gas turbine<br />
emissions<br />
While regulations define binding constraints<br />
<strong>for</strong> the operation <strong>of</strong> gas-based power generation<br />
technologies, a comprehensive emission<br />
footprint analysis must account <strong>for</strong> the<br />
real emission behavior considering a variety<br />
<strong>of</strong> power plant configurations <strong>and</strong> operating<br />
regimes. The following sections aim to present<br />
the methodology applied in the present<br />
study to model real emission behavior. To<br />
represent the operating characteristics <strong>of</strong><br />
current RICE <strong>and</strong> GT, publicly available data<br />
were collected <strong>and</strong> used to derive load-dependent<br />
emission characteristics. Field<br />
measurements, testbed data, <strong>and</strong> manufacturer<br />
publications were considered <strong>for</strong> this<br />
approach. The data <strong>and</strong> methods are shown<br />
in the following sections.<br />
emission limits <strong>for</strong> CC-GT configurations imposed<br />
by the 13 th BImSchV, the EU BAT conclusions,<br />
<strong>and</strong> the EPA permit st<strong>and</strong> out much<br />
stricter than RICE’s emission limits. This indicates<br />
that current major regulations <strong>of</strong><br />
NO X emissions are not fully technology-neutral<br />
<strong>and</strong> place a higher burden on operators<br />
<strong>of</strong> CC-GT power plants. However, while<br />
RICE must fulfill the 13 th BImSchV emission<br />
limits <strong>for</strong> all operable loads, the limits <strong>for</strong><br />
GTs apply only <strong>for</strong> loads higher than 70 % <strong>of</strong><br />
the nominal load. All emission limits below<br />
this load threshold are to be negotiated with<br />
the local authority [3]. The implications <strong>of</strong><br />
these specifics <strong>for</strong> actual plant emissions will<br />
be briefly discussed in section 5.1.<br />
Equivalent to F i g u r e 1 , F i g u r e 2 shows<br />
an apples-to-apples comparison between<br />
major carbon monoxide (CO) emissions<br />
regulations.<br />
The displayed overlap <strong>of</strong> the areas corresponding<br />
to GT <strong>and</strong> RICE configurations<br />
indicates similar emission limits <strong>for</strong> both<br />
technologies according to 13 th <strong>and</strong> 44 th<br />
BImSchV <strong>and</strong> can be stated as technologyneutral.<br />
However, some regulations (i.e.,<br />
EPA permit <strong>and</strong> EU BAT conclusions (low &<br />
high)) result in lower emission limits <strong>for</strong> GT<br />
compared to RICE.<br />
For a better comparison, the limit values <strong>for</strong><br />
plants currently in operation are analyzed<br />
<strong>and</strong> listed in Ta b l e 1 . For this purpose, a<br />
mean electric efficiency <strong>for</strong> each technology<br />
is assumed. The respective emission limits<br />
are given in mass per <strong>energy</strong> output <strong>and</strong> the<br />
relative deviation from the RICE limit value<br />
as a reference.<br />
Besides the broadly similar NO X limit values<br />
<strong>for</strong> RICE <strong>and</strong> SC-GT imposed by 13 th BIm-<br />
SchV, BAT low, <strong>and</strong> an exemplary EPA permit<br />
(<strong>for</strong> SC-GT), there are also widely differing<br />
limit values <strong>for</strong> both technologies within<br />
a regulation. For example, a significant<br />
deviation is found in the limit value given<br />
by the World Bank. This threshold is more<br />
than three times higher <strong>for</strong> RICE than <strong>for</strong><br />
Tab. 2. Overview <strong>of</strong> <strong>for</strong>mation processes <strong>of</strong> considered species in gas-based power generation<br />
technologies.<br />
Species Favorable conditions Formation in RICE Formation in GT<br />
NO X ––<br />
High temperature<br />
––<br />
Sufficient oxygen excess<br />
CO ––<br />
Incomplete combustion<br />
––<br />
Flame extinction<br />
UHC ––<br />
Incomplete combustion<br />
––<br />
Flame extinction<br />
HCHO ––<br />
intermediate<br />
species during fuel<br />
oxidation<br />
––<br />
Incomplete combustion<br />
PM ––<br />
Fuel-rich zones<br />
––<br />
High temperatures<br />
––<br />
As there is no C-C bond<br />
in CH 4 , PM emissions<br />
derived from CH 4 combustion<br />
are very low<br />
SC- <strong>and</strong> CC-GT <strong>and</strong> there<strong>for</strong>e is <strong>of</strong> the scale<br />
<strong>of</strong> F i g u r e 1. In contrast, the limit value<br />
imposed by the 44 th BImSchV result in higher<br />
NO X emissions <strong>for</strong> SC-GT compared to<br />
RICE.<br />
––<br />
fuel-rich, hot<br />
combustion inside the<br />
pre-chamber can result<br />
in ~50 % <strong>of</strong> the total<br />
NOX <strong>for</strong>mation<br />
––<br />
lean main chamber<br />
com-bustion has<br />
significant oxygen<br />
excess but is<br />
comparably cold.<br />
––<br />
flame quenching<br />
––<br />
from unburned<br />
hydrocarbons (UHC)<br />
––<br />
flame quenching mainly<br />
in close-wall regions <strong>and</strong><br />
cavities<br />
––<br />
The quenching distance<br />
increases <strong>for</strong> leaner<br />
mixtures <strong>and</strong> lower<br />
temperatures.<br />
––<br />
Volume quenching can<br />
occur in ultra-lean<br />
mixtures <strong>and</strong> <strong>for</strong> late<br />
combustion phasing.<br />
––<br />
Formation during flame<br />
quenching <strong>and</strong> during<br />
expansion from UHC<br />
––<br />
Formation in the<br />
exhaust <strong>for</strong><br />
temperatures >600 °C.<br />
––<br />
mainly from the prechamber<br />
––<br />
PM (<strong>and</strong> SO X emissions<br />
may occur due to combustion<br />
<strong>of</strong> lubricating<br />
oil (consumption ~0.4 g/<br />
kWh el <strong>for</strong> modern gas<br />
engines)<br />
––<br />
At higher loads due to<br />
high flame temperature<br />
––<br />
During diffusion-type<br />
pilot burner operation,<br />
high <strong>for</strong>mation at<br />
locations with<br />
stoichiometric<br />
conditions<br />
––<br />
relatively low at higher<br />
loads due to complete<br />
combustion<br />
––<br />
Increasing <strong>for</strong>mation<br />
with load reduction<br />
operation<br />
––<br />
Very high at ignition <strong>and</strong><br />
startups<br />
––<br />
as <strong>for</strong> CO, <strong>for</strong>mation<br />
increases at lower partloads<br />
compared to CO<br />
––<br />
As <strong>for</strong> CO, but at lower<br />
loads<br />
––<br />
Dependent on gas<br />
quality<br />
––<br />
Formation mainly at<br />
diffusion-type pilot<br />
operation<br />
2.1 Pollutant <strong>for</strong>mation<br />
in RICE <strong>and</strong> GT<br />
Be<strong>for</strong>e discussing the real emission data, a<br />
brief overview <strong>of</strong> the fundamental <strong>for</strong>mation<br />
processes <strong>of</strong> the relevant pollutants are<br />
described in Ta b l e 2 .<br />
34 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable gas-based power generation technologies<br />
CH 4 in g/kWh<br />
8.0<br />
6.4<br />
4.8<br />
3.2<br />
1.6<br />
0.0<br />
13 th BlmSchV LBSI (be<strong>for</strong>e 15.07.2024)<br />
200 300 400 500<br />
Bore in mm<br />
Field measurement (Load = 100 %)<br />
Testbed result (Load= 100 %)<br />
Testbed cycle result (E2 / E3)<br />
LBSI: Be<strong>for</strong>e 2010 / After 2010<br />
LPDF: Be<strong>for</strong>e 2010 / After 2010<br />
2.2 Emissions <strong>of</strong> RICE<br />
Bore in mm<br />
To model the emission behavior <strong>of</strong> RICE,<br />
publicly available datasets were used. The<br />
following considerations focus mainly on<br />
CH 4 <strong>and</strong> NO X , since gas engines historically<br />
have an oxidation catalyst (OC) <strong>for</strong> CO <strong>and</strong><br />
<strong>for</strong>maldehyde (HCHO) suppression (e.g., in<br />
Germany, at least if TA-Luft 2002 was applicable).<br />
There<strong>for</strong>e, field measurements <strong>of</strong><br />
these components are rare, <strong>and</strong> it is <strong>of</strong>ten not<br />
clearly stated whether a catalyst was used.<br />
This study focuses on medium-speed engines<br />
(engine speed
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable gas-based power generation technologies<br />
PM in<br />
mg/kWh<br />
HCHO in<br />
g/kWh<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
13 th BlmSchV<br />
Bore in mm<br />
Bore in mm<br />
Fig. 5. RICE PM, <strong>for</strong>maldehyde (HCHO) <strong>and</strong> CO emissions at full load [1], [12], [13], [16], [29].<br />
increase with reducing load. The reduced<br />
temperature level leads to an increased<br />
quenching layer thickness. Many results are<br />
influenced by improper AFR control,<br />
though. To distinguish the influences, these<br />
will be discussed in the following based on<br />
the excellent summary by Krivopolianskii<br />
[35]. The simplest measure is to avoid fuel<br />
slip during the gas exchange. All modern engines<br />
no longer have this problem. AFR control<br />
can significantly improve CH 4 emissions.<br />
Especially older DF engines <strong>of</strong>ten did not<br />
have any control mechanism <strong>for</strong> the turbocharger.<br />
Moreover, the marine engines depicted<br />
are significantly overturned <strong>for</strong> NO X<br />
emissions since the <strong>International</strong> Maritime<br />
Organization (IMO) does not specify an<br />
UHC limit currently, but IMO Tier III specifies<br />
a NO X limit <strong>of</strong> ~ 2.4 g/kWh el depending<br />
on the engine speed. This leads to significantly<br />
leaner operation at low load, where<br />
richer operation would be required <strong>for</strong> similar<br />
combustion efficiencies. Possibilities in<br />
this regard are blow<strong>of</strong>f-valves (BOV), throttle<br />
valves, <strong>and</strong> waste gates or a variable turbine<br />
geometry (VTG) turbocharger. In addition,<br />
higher charge air temperatures reduce<br />
the quenching layer thickness, but increase<br />
NO X emissions <strong>and</strong> may lead to derating depending<br />
on the methane number <strong>of</strong> the gas.<br />
Moreover, cavities in the combustion chamber<br />
should be reduced. Emissions from cavities<br />
increase with richer AFR <strong>and</strong> can there<strong>for</strong>e<br />
not be reduced with measures that shift<br />
the operation to lower CH 4 emissions at increased<br />
NO X emissions. Furthermore, the<br />
piston bowl can be optimized <strong>for</strong> the surface-to-volume<br />
ratio to minimize wall<br />
quenching. This optimization cannot be conveyed<br />
to dual-fuel engines to the same degree<br />
due to operation in diesel mode.<br />
As most modern engines consider these optimization<br />
measures, the solid curves (black:<br />
LBSI, dark red: LPDF) were derived from the<br />
data presented <strong>for</strong> modeling. Due to a lack<br />
<strong>of</strong> data <strong>for</strong> loads below 10 %, emission <strong>and</strong><br />
fuel mass flows are modeled to be constantly<br />
the value at 10 % load as a conservative estimate.<br />
According to data presented by<br />
Baas [36], the light-<strong>of</strong>f should be reached<br />
CO in g/kWh<br />
Field measurement (Load = 100 %)<br />
Testbed result (Load= 100 %)<br />
Testbed cycle result (E2 / E3)<br />
LBSI: Be<strong>for</strong>e 2010 / After 2010<br />
LPDF: Be<strong>for</strong>e 2010 / After 2010<br />
2.0<br />
within 20 to 30 min after startup. This time<br />
will vary depending on the detailed design<br />
<strong>of</strong> the exhaust system.<br />
Finally, F i g u r e 5 summarizes the PM, <strong>for</strong>maldehyde,<br />
<strong>and</strong> CO emissions. To reach the<br />
13 th BImSchV CO emission limit, an OC is<br />
required. CO has a relatively low light-<strong>of</strong>f<br />
temperature, though. According to data presented<br />
by Baas [36], the light-<strong>of</strong>f should be<br />
reached within ~ 3 min after startup but<br />
might vary depending on the detailed design<br />
<strong>of</strong> the exhaust system.<br />
Similarly, the 13 th BImSchV <strong>for</strong>maldehyde<br />
emission limit requires an OC. Light-<strong>of</strong>f<br />
should be reached within ~5 min after starting<br />
due to a slightly higher light-<strong>of</strong>f temperature<br />
compared to CO. Also, here the light<strong>of</strong>f<br />
might vary depending on the detailed<br />
design <strong>of</strong> the exhaust system.<br />
13 th BImSchV PM limits are not a major concern<br />
<strong>for</strong> gas operation, not even <strong>for</strong> dual-fuel<br />
gas engines. Specific PM emissions increase<br />
in low load situations (higher specific oil<br />
consumption <strong>and</strong> diesel share <strong>for</strong> dual-fuel<br />
gas engines). Still, the data analyzed <strong>for</strong><br />
dual-fuel gas engines suggests that the limits<br />
are still met <strong>for</strong> part-load. However, operation<br />
in liquid fuel mode produces significantly<br />
higher PM emissions (~120 mg/<br />
kWh el at high load).<br />
For all these components, load-dependent<br />
emissions were rare in the literature. Still, CO<br />
<strong>and</strong> <strong>for</strong>maldehyde are considered to be loaddependent.<br />
For CO, a best guess based on<br />
experience was derived, while <strong>for</strong> <strong>for</strong>maldehyde,<br />
the load dependency <strong>of</strong> the methane<br />
emissions is used. This is a conservative estimate<br />
since <strong>for</strong>maldehyde from quenching<br />
should be like CO with a less severe rise at<br />
part load compared to CH 4 .<br />
2.3 Emissions <strong>of</strong> gas turbines<br />
13 th BlmSchV<br />
13 th BlmSchV<br />
0.0<br />
200 300 400 500 200 300 400 500<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
In analogy to RICE, the GT part load emission<br />
characteristics were derived using the<br />
discussed emission <strong>for</strong>mation processes in<br />
combination with publicly available data.<br />
While gas turbine manufacturers mainly provide<br />
full-load data <strong>for</strong> regulated emission<br />
species such as NO X <strong>and</strong> CO, in<strong>for</strong>mation on<br />
(mostly) unregulated species (e.g., UHC, <strong>for</strong>maldehyde,<br />
PM) is lacking as they are typically<br />
not measured during operation. Moreover,<br />
data on part-load characteristics <strong>of</strong> the<br />
emission species with in the present study’s<br />
scope is scarce. Such in<strong>for</strong>mation is dependent<br />
on the corresponding gas turbine; thus,<br />
manufacturer dependent <strong>and</strong> typically confidential.<br />
However, suitable data sets could be<br />
identified, allowing the derivation <strong>of</strong> a partload<br />
characteristic <strong>for</strong> the main emission<br />
species, i.e., NO X , CO, <strong>and</strong> UHC, <strong>of</strong> state-<strong>of</strong>the-art<br />
premixed-type (typically referred to<br />
as Dry-low-NO X (DLN)) gas turbine engines.<br />
As the primary source <strong>of</strong> raw in<strong>for</strong>mation,<br />
the Environmental Protection Agency (EPA)<br />
database was used. Power plant operators in<br />
the USA are obliged to submit detailed in<strong>for</strong>mation<br />
on their key-monitoring data to the<br />
EPA [14]. This data comprises hourly values<br />
<strong>for</strong> electrical power output, fuel consumption,<br />
<strong>and</strong> emissions <strong>of</strong> nearly all available<br />
power generation units in the USA. For the<br />
present study, the APMD (Air Markets Program<br />
Data) 2021 data set [14] was utilized.<br />
Suitable data sets were identified by applying<br />
appropriate filters to comply with the<br />
scope <strong>of</strong> the present study, e.g., single-cycle<br />
combustion turbines, nominal electrical<br />
power between 10-100 MW, natural gasfired,<br />
<strong>and</strong> no designated emission control<br />
strategy. Five data sets comprising over<br />
20,000 load points were extracted <strong>and</strong> used<br />
<strong>for</strong> further evaluation.<br />
The expected NO X characteristics can be derived<br />
from the <strong>for</strong>mation processes described<br />
in Ta b l e 2 <strong>and</strong> include the following<br />
features:<br />
––<br />
NO X emissions slightly decrease during<br />
load reduction from full-load conditions<br />
due to the lower flame temperature <strong>of</strong> the<br />
pre-mixed DLN burner<br />
––<br />
NO X emissions are roughly constant until<br />
the switch to diffusion-type pilot burner<br />
operation<br />
––<br />
NO X emissions increase due to load transfer<br />
to the pilot burner<br />
––<br />
NO X emissions are at their maximum if<br />
the pilot burner operates at its load maximum<br />
––<br />
NO X emissions decrease with further load<br />
decrease due to lower flame temperature<br />
<strong>and</strong> load reduction <strong>of</strong> the pilot burner<br />
Considering the expected NO X characteristics,<br />
the operation data was evaluated in<br />
more detail to account <strong>for</strong> different combustor<br />
operation modes, i.e., diffusion-type pilot<br />
operation at low loads <strong>and</strong> load-dependent<br />
switch to a pre-mixed DLN burner at a<br />
particular load point. Relative dependencies<br />
between different load points were derived<br />
from the data <strong>and</strong> combined with “ideal”<br />
NO X trend curves provided in the scientific<br />
literature [15] to derive a part-load characteristic<br />
<strong>for</strong> newly-built turbines. The loaddependent<br />
NO X emission characteristic is<br />
presented in F i g u r e 6 .<br />
36 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable gas-based power generation technologies<br />
Emissions in<br />
0ppmvd @ 15 % O 2<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
0 20 40 60 80 100<br />
An efficiency characteristic is needed to convert<br />
the full-load emission values to the selected<br />
apples-to-apples metric, i.e., mg/<br />
kWh el , over the entire load range. The underlying<br />
efficiency characteristic used in the present<br />
study was derived by combining available<br />
in<strong>for</strong>mation from gas turbine manufacturers<br />
[17] <strong>and</strong> scientific literature [18], [19].<br />
As a result, the NO X emission part-load characteristic<br />
can be converted into the applesto-apples<br />
metric. F i g u r e 7 shows the exemplary<br />
results <strong>for</strong> a SC-GT with an emission<br />
level <strong>of</strong> 15 ppmvd @ 15 vol.% O 2 <strong>and</strong><br />
electrical efficiency <strong>of</strong> 39 % at full load [20],<br />
which equals 236 mg/kWh el . It should be<br />
noted that F i g u r e 7 depicts the emission<br />
behavior <strong>of</strong> the gas turbine over the entire<br />
load range, including load points below the<br />
minimum environmental load. At loads below<br />
the MEL, emissions are no longer in<br />
compliance with the legislation. Thus, operation<br />
over extended periods is not permissible<br />
at loads below the MEL.<br />
While data on NO X emissions must be reported<br />
to the EPA, reporting <strong>of</strong> other pollutantssuch<br />
as CO or UHC emissions is not m<strong>and</strong>atory.<br />
Since no other turbine data source<br />
could be identified, a plausible part load CO<br />
& UHC emission characteristic was derived<br />
from the scientific literature [15], [21], [22].<br />
The following trends are expected <strong>for</strong> CO:<br />
––<br />
Very low emissions at full load due to<br />
complete combustion<br />
––<br />
Constant, low emissions at load reduction<br />
until a particular load point (<strong>for</strong> CO typically<br />
20-50 % <strong>of</strong> nominal load, <strong>for</strong> UHC<br />
typically ~10-20 %-points lower as <strong>for</strong> CO)<br />
Power in %<br />
Fig. 6. Load-dependent GT NO X emissions in ppmvd.<br />
Emission in mg kWh el<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
regulated by<br />
local<br />
authority<br />
Power in %<br />
Fig. 7. Load-dependent GT NO X , CO, <strong>and</strong> UHC emissions in [mg/kWh el ].<br />
NOx<br />
CO el = 39 %<br />
UHC<br />
13. BlmSchV (NOx)<br />
13. BlmSchV (CO)<br />
regulated by<br />
13. BlmSchV<br />
0<br />
0 25 50 75 100<br />
––<br />
Rapid <strong>and</strong> exponential increase towards<br />
lower loads when diffusion-type pilot burners<br />
are activated <strong>for</strong> flame stabilization<br />
The expected results were used to benchmark<br />
the derived CO part-load characteristics.<br />
For UHC the same trend as <strong>for</strong> CO emissions<br />
was assumed but shifted 10 %-points<br />
towards the lower load in compliance with<br />
the underlying scientific literature [15],<br />
[21], [22]. The resulting trend curves parametrized<br />
<strong>for</strong> CO <strong>and</strong> UHC emissions are displayed<br />
in F i g u r e 7. The corresponding<br />
full-load emission values are 19 mg/kWh el<br />
<strong>for</strong> CO (2 ppmvd @ 15 vol.% O 2 ) <strong>and</strong><br />
33 mg/kWh el <strong>for</strong> UHC (TOC as C 3 H 8 ; 2 ppmvd<br />
@ 15 vol.% O 2 ) based on an electrical<br />
efficiency <strong>of</strong> 39 %. Additionally, the 13 th<br />
BImSchV emission limits are displayed corrected<br />
with the underlying part load efficiency<br />
characteristic <strong>of</strong> a SC-GT.<br />
For the present study, a somewhat optimistic<br />
starting point (at 20 % relative load) <strong>for</strong><br />
the CO emission increase was chosen to represent<br />
state-<strong>of</strong>-the-art gas turbines <strong>and</strong> comply<br />
with the underlying scientific literature.<br />
However, it should be mentioned that the<br />
individual starting point varies manufacturer-<br />
<strong>and</strong> engine-dependent.<br />
For <strong>for</strong>maldehyde <strong>and</strong> PM emissions, loaddependent<br />
part-load characteristics could<br />
not be found in the publicly available literature.<br />
Primarily, investigations on <strong>for</strong>maldehyde<br />
emissions from gas turbine engines are<br />
very scarce. This may be attributed to <strong>for</strong>maldehyde<br />
emissions being typically very<br />
low [21], although they account <strong>for</strong> the<br />
highest share <strong>of</strong> hazardous air pollutants<br />
(HAP) [23]. Formaldehyde <strong>for</strong>ms as an early<br />
intermittent species <strong>of</strong> methane oxidation<br />
[24]. Thus, very low <strong>for</strong>maldehyde emissions<br />
are expected under complete combustion<br />
conditions, although a similar trend to<br />
CO can be anticipated towards very low<br />
loads [25]. However, no detailed in<strong>for</strong>mation<br />
on the <strong>for</strong>mation process <strong>of</strong> <strong>for</strong>maldehyde<br />
<strong>for</strong> reduced loads was found in the<br />
available literature. As a result, <strong>for</strong> the present<br />
study, <strong>for</strong>maldehyde emissions were<br />
accounted <strong>for</strong> by a constant value over the<br />
entire load range (3 mg/mN 3 [23], i.e.,<br />
23 mg/kWh el <strong>for</strong> an electrical efficiency <strong>of</strong><br />
39 %). Since the available literature data is<br />
not sufficient to model PM with satisfactory<br />
accuracy, an averaged value over the entire<br />
load range was assumed (1 mg/mN 3 [26],<br />
i.e., 8 mg/kWh el <strong>for</strong> an electrical efficiency<br />
<strong>of</strong> 39 %). This should be a conservative estimation<br />
since PM emissions from gas turbines<br />
are generally very low [27]. The corresponding<br />
part load trend curves <strong>for</strong> both<br />
PM <strong>and</strong> HCHO emissions are subsequently<br />
derived by the application <strong>of</strong> the part-load<br />
efficiency characteristic <strong>of</strong> a SC-GT.<br />
3 Modeling approach <strong>for</strong> the<br />
gas-based power plants<br />
This section explains the underlying modeling<br />
approach <strong>for</strong> aggregating individual<br />
RICE or GTs into a power plant configuration,<br />
the plant operation <strong>for</strong> a given load<br />
pr<strong>of</strong>ile, <strong>and</strong> the corresponding emission calculation.<br />
For this purpose, an EXCEL-based<br />
model framework was developed.<br />
To highlight the different modes <strong>of</strong> operation<br />
<strong>of</strong> gas-based power generation plants,<br />
an exemplary “peaking” scenario <strong>and</strong> an exemplary<br />
“baseload” scenario are examined<br />
in detail. The two scenarios differ in power<br />
plant configuration. The peaking scenario<br />
comprises plant configurations that feature<br />
multiple <strong>and</strong> rapid startups <strong>and</strong> shutdowns<br />
as well as transient operations. There<strong>for</strong>e,<br />
one SC-GT <strong>and</strong> the corresponding number<br />
<strong>of</strong> about 10 MW el RICE to reach the same<br />
power output represent the plant configuration<br />
<strong>of</strong> the peaking scenario. In contrast, the<br />
baseload scenario features plant configurations<br />
that focus on efficient power generation<br />
close to full-load operation. Consequently,<br />
a CC-GT <strong>and</strong> the corresponding<br />
number <strong>of</strong> about 20 MW el RICE to reach the<br />
same power output represent the plant configurations<br />
<strong>of</strong> the baseload scenario. The<br />
corresponding load pr<strong>of</strong>iles used <strong>for</strong> each<br />
scenario are derived from publicly available<br />
actual plant operation pr<strong>of</strong>iles <strong>of</strong> a CC-GT<br />
power plant located in Germany 11 [37].<br />
Since the real load pr<strong>of</strong>ile <strong>of</strong> an aggregated<br />
RICE power plant may exceed the transient<br />
capabilities <strong>of</strong> conventional GTs, a load pr<strong>of</strong>ile<br />
was chosen that both technologies can<br />
be operated with. In the case <strong>of</strong> high tran-<br />
11<br />
The load pr<strong>of</strong>iles used are originally from the<br />
600 MW CC-GT power plant Lausward in Germany.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 37
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable gas-based power generation technologies<br />
Tab. 3. Scenario overview <strong>and</strong> full-load emission values <strong>for</strong> plant configuration.<br />
Category Parameter Peaking Scenario Baseload-Scenario<br />
Plant<br />
Configuration<br />
Full-load<br />
Emissions<br />
Load Pr<strong>of</strong>ile<br />
GT RICE GT RICE<br />
Nr. <strong>of</strong> aggregates (& type) 1 x SC 6 2x1 CC 12 8<br />
P el,engine [MW] 57 9,5 163 20,4<br />
η el [%] 39,1 47,4 58,5 48,5<br />
CO 2 [g/kWh el ] 505 417 338 407<br />
CH 4 [mg/kWh el ] 33 2400 22 2400<br />
NO X [mg/kWh el ] 236 (24*) 1400<br />
(140*)<br />
CO [mg/kWh el ] 19 1200<br />
(120*)<br />
158 (16*) 1400<br />
(140*)<br />
13 1200<br />
(120*)<br />
HCHO [mg/kWh el ] 23 90 (9*) 15 90 (9*)<br />
PM [mg/kWh el ] 8 13 5 13<br />
Equivalent full-load hours [h] 3735 6003<br />
Number <strong>of</strong> plant starts per year 286 26<br />
Av. plant load in operation [%] 81 91<br />
Actual operating hours per start 16 254<br />
Year & Calendar week 2020, 40 & 41 2020, 3 & 4<br />
*: with emissions after treatment (EAT) with an assumed constant 90% conversion efficiency<br />
However, the efficiency mode is more appropriate<br />
<strong>for</strong> a direct comparison to a gas turbine<br />
power plant with, in this comparison,<br />
lower transient capabilities.<br />
In the following, the modelling approach is<br />
exemplarily described <strong>for</strong> the peaking scenario<br />
since the dynamic operation <strong>of</strong> the<br />
gas-based power plants as a backup <strong>for</strong> renewable<br />
power generation will gain importance<br />
in the future. F i g u r e 8 presents the<br />
part-load characteristics <strong>of</strong> the aggregated<br />
plant configurations comprising electrical<br />
efficiency <strong>and</strong> emissions. As the nominal<br />
plant load is set to the nominal power <strong>of</strong> the<br />
gas turbine, the trends <strong>for</strong> the SC-GT plant<br />
configuration follow the trends <strong>of</strong> the individual<br />
machine, presented in section 3.3.<br />
Due to the need <strong>for</strong> engine aggregation <strong>for</strong><br />
the RICE power plant to cover the desired<br />
plant load, both deployment strategies are<br />
displayed, <strong>and</strong> the efficiency <strong>and</strong> emission<br />
advantage are detectable, while the spinning<br />
mode represents the behaviour <strong>of</strong> a virtual<br />
single-engine. For the RICE configurations,<br />
sient load pr<strong>of</strong>iles, a different GT technology,<br />
e.g., aero derivatives, could be selected<br />
but was not considered in the present study.<br />
Detailed load pr<strong>of</strong>iles <strong>for</strong> two-week operation<br />
were extracted <strong>and</strong> scaled from the actual<br />
plants’ nominal power to the nominal<br />
power <strong>of</strong> the desired scenario plant configuration.<br />
While daily startups <strong>and</strong> a load reduction<br />
around noon characterize the load<br />
pr<strong>of</strong>ile <strong>of</strong> the peaking scenario, the baseload<br />
scenarios load pr<strong>of</strong>ile features one startup<br />
every two weeks <strong>and</strong> otherwise operation<br />
close to full load.<br />
The main characteristics <strong>of</strong> the investigated<br />
operation scenarios are listed in Ta b l e 3 .<br />
The same electrical plant power <strong>and</strong> load<br />
pr<strong>of</strong>ile are used <strong>for</strong> each scenario’s GT <strong>and</strong><br />
RICE configurations. In addition, the load<br />
pr<strong>of</strong>ile characteristics were extrapolated to a<br />
full-year virtual operation, although two<br />
weeks were actually calculated.<br />
Finally, two alternative strategies are considered<br />
to examine the plant operator’s engine<br />
deployment when engine aggregation is necessary<br />
to cover the required plant load. While<br />
in “efficiency mode”, there is only one engine<br />
operating in part load, <strong>and</strong> the remaining active<br />
engines are operated in full-load, in<br />
“spinning mode”, the plant load is equally<br />
distributed to all engines. Thus, the minimum<br />
<strong>and</strong> the maximum number <strong>of</strong> active<br />
engines covering the plant load are represented.<br />
Furthermore, since the engines operate<br />
at the same load point in “spinning<br />
mode”, the plant’s efficiency <strong>and</strong> emission<br />
curves follow a virtual single engine with the<br />
same nominal load as the power plant. In “efficiency<br />
mode”, however, only one engine is<br />
operated in part-load, while the other engines<br />
are either operated in full-load or are<br />
shut down. There<strong>for</strong>e, an efficiency advantage<br />
can be achieved compared to the “spinning<br />
mode”, while the “spinning mode”<br />
50<br />
40<br />
30<br />
Efficiency mode, RICE Spinning mode, RICE Gas turbine<br />
10<br />
HCHO in g/kWh el CO in g/kWh el<br />
Efficiency in %<br />
PM in mg/kWh el<br />
20<br />
10<br />
0<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
Power in MW<br />
Power in MW<br />
Fig. 8. Part-load characteristic <strong>of</strong> plant configuration shown as peaking configuration.<br />
guarantees a faster response to additional<br />
load dem<strong>and</strong>s as all engines are in operation<br />
at all plant loads. Thus, “spinning mode” operation<br />
makes sense <strong>for</strong> grid stabilization<br />
<strong>and</strong> <strong>for</strong> the highest load ramping requirements<br />
or in the case <strong>of</strong> <strong>of</strong>f-grid operation<br />
when high availability <strong>of</strong> power is required.<br />
12<br />
2x1 CC-GT: The plant configuration consists<br />
<strong>of</strong> two gas turbines <strong>and</strong> one steam turbine<br />
CH 4 in g/kWh el<br />
NO X in g/kWh el<br />
0.0<br />
0<br />
0.0 9.5 19.0 28.5 38.0 47.5 57.0 0.0 9.5 19.0 28.5 38.0 47.5 57.0<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Without EAT<br />
With EAT*<br />
*: Conversion efficiency<br />
<strong>of</strong> 90 % assumed<br />
also the emission values after the commonly<br />
built exhaust gas after-treatment (EAT) are<br />
displayed. For further analysis, constant conversion<br />
efficiencies <strong>of</strong> the EAT are assumed<br />
to reduce the engines’ emissions, i.e., NO X<br />
via selective catalytic reduction (SCR) <strong>and</strong><br />
CO <strong>and</strong> HCHO via an oxidization catalyst<br />
(OC). The heating behavior <strong>of</strong> the EATs during<br />
a cold start <strong>and</strong> the associated lower conversion<br />
efficiency due to cold catalyst was<br />
38 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Work<br />
CH 4 in kg<br />
NO X in kg<br />
CO in kg<br />
Fuel in t<br />
CH 4 in<br />
gt/kwh_el<br />
PM in kg<br />
HCHO in kg<br />
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable gas-based power generation technologies<br />
not taken into account. However, the constant<br />
conversion efficiency is assumed to<br />
90 %, although, typically the conversion efficiency<br />
<strong>of</strong> state-<strong>of</strong>-the-art EATs can be higher<br />
at stationary, i.e., warmed up, operating<br />
conditions. This thesis is supported by data<br />
from Baas [36] <strong>and</strong> plant NO X emission levels<br />
with SCR catalyst below 0.1 g/kWh el published<br />
by JRC [4] <strong>and</strong> EPA [14].<br />
For the calculation <strong>of</strong> the individual power<br />
plant’s operation point, each load pr<strong>of</strong>ile is<br />
analyzed minute-wise according to the following<br />
rules:<br />
––<br />
Calculation <strong>of</strong> the plant operation point by<br />
matching the required plant load given by<br />
the load pr<strong>of</strong>ile with the plant configuration’s<br />
efficiency <strong>and</strong> emission characteristic<br />
––<br />
In efficiency mode, additional engines are<br />
started if the required load gradient exceeds<br />
the possible load gradient <strong>of</strong> the active<br />
engines required to cover the load<br />
––<br />
Plant loads below 10 % are not considered<br />
(minimum plant load)<br />
––<br />
The idle operation <strong>of</strong> an engine is calculated<br />
using emission values at the minimum<br />
plant load point<br />
––<br />
A transient penalty <strong>of</strong> +10 % <strong>of</strong> the current<br />
emission value is added to account<br />
<strong>for</strong> transient load changes<br />
––<br />
A startup penalty is added to consider<br />
emissions during engine ignition <strong>and</strong> acceleration<br />
be<strong>for</strong>e synchronization. The<br />
startup penalty is calculated using the<br />
emission values at a defined minimum engine/gas<br />
turbine load point<br />
––<br />
An engine is shut down when it is not required<br />
<strong>for</strong> the next five minutes<br />
The results <strong>of</strong> the minute-wise plant operation<br />
in the SC/Peaking scenario are shown<br />
in F i g u r e 9 . As the GT <strong>and</strong> RICE configurations<br />
feature the same nominal load, all<br />
configurations’ load pr<strong>of</strong>iles <strong>and</strong> electricity<br />
outputs are the same. The difference between<br />
both RICE deployment strategies can<br />
be seen in the number <strong>of</strong> required engines.<br />
In “spinning mode”, all six engines are operated<br />
with the same load in parallel. In contrast,<br />
in “efficiency mode”, the engines are<br />
operated sequentially. Due to the higher<br />
electrical efficiency <strong>of</strong> the RICE, the cumulative<br />
fuel consumption is less than that <strong>of</strong> the<br />
GT configuration to generate the same electrical<br />
<strong>energy</strong>.<br />
In Figure 9, the time-dependent CH 4 emission<br />
generation is exemplarily shown, while<br />
the time-integrated cumulative curves <strong>for</strong> the<br />
other emissions species are shown. The plant<br />
is modelled as idle during plant shutdown<br />
periods <strong>for</strong> calculation stability since the<br />
plant load is below the minimum load threshold.<br />
However, the emissions produced during<br />
idle are not added to the final results, which<br />
can be seen in the curve <strong>for</strong> the cumulative<br />
CH 4 emissions. In addition, since EAT systems<br />
are installed as st<strong>and</strong>ard in engine power<br />
plants to comply with emission regulations,<br />
the cumulative emission values <strong>of</strong> the<br />
Power in MW el<br />
in MW el<br />
Engines<br />
60<br />
30<br />
0<br />
6<br />
3<br />
0<br />
9000<br />
6000<br />
3000<br />
0<br />
1800<br />
1200<br />
600<br />
0<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
27000<br />
18000<br />
9000<br />
0<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
12000<br />
8000<br />
4000<br />
0<br />
900<br />
600<br />
300<br />
0<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
species NO X , CO, <strong>and</strong> HCHO are also given<br />
after EAT <strong>for</strong> the RICE configurations.<br />
4 Comparative analysis <strong>of</strong><br />
different gas-based power<br />
generation technologies<br />
regarding their<br />
environmental footprint<br />
This section incorporates the emission calculation<br />
results <strong>of</strong> the investigated plant configurations<br />
<strong>and</strong> operation modes as well as a<br />
subsequent environmental impact analysis.<br />
4.1 Comparative analysis <strong>of</strong><br />
emission values<br />
Efficiency mode, RICE Spinning mode, RICE Gas turbine<br />
Work: 8166 MWh el<br />
Specific fuel consumption:<br />
Raw:<br />
Raw:<br />
Raw:<br />
Raw:<br />
Raw:<br />
0 48 96 144 192 240 288 336<br />
Figure 10 (CO 2 , CH 4 , NO X ) <strong>and</strong> F i g -<br />
u r e 11 (CO, HCHO, PM) show the results<br />
<strong>for</strong> the considered emission species <strong>for</strong> both<br />
scenarios, i.e., peaking/SC <strong>and</strong> baseload/<br />
CC operation <strong>for</strong> the GT <strong>and</strong> RICE power<br />
plant configurations. Both figures distinguish<br />
between the black-framed full-load<br />
emission value <strong>and</strong> the green-framed additional<br />
emissions due to startup, transients,<br />
<strong>and</strong> part-load operation. In addition, the<br />
Time in h<br />
Fig. 9. Modelled plant operation, shown as peaking scenario.<br />
EAT*:<br />
*:Conversion efficiency <strong>of</strong> 90 % assumed<br />
EAT*:<br />
EAT*:<br />
respective emission limit imposed by the<br />
German 13 th BImSchV is indicated in the orange<br />
boxes. However, in contrast to section<br />
2.2, the limit values shown were calculated<br />
using the plant’s average electrical efficiency<br />
during operation in the corresponding<br />
scenario. The height <strong>of</strong> the stacked bar represents<br />
the overall emissions in the applesto-apples<br />
metric, i.e., mass per generated<br />
kWh el . As the plant configurations <strong>of</strong> each<br />
scenario are calculated with the same load<br />
pr<strong>of</strong>ile, the bars also show the differences in<br />
the total emissions <strong>for</strong> GT <strong>and</strong> RICE in the<br />
same scenario.<br />
As the CO 2 plots in F i g u r e 10 indicate, the<br />
carbon dioxide emissions are significantly<br />
influenced by the electrical efficiency <strong>of</strong> the<br />
plant configuration. Thus, the CC-GT plant<br />
configuration can achieve the lowest CO 2<br />
emissions across all configurations due to<br />
the highest efficiency. Due to the higher single<br />
cycle efficiency over the entire load<br />
range <strong>for</strong> the RICE compared to the SC-GT<br />
(see F i g u r e 8 ) the RICE produces lower<br />
CO 2 emissions. Additionally, as there is no<br />
relevant efficiency loss <strong>for</strong> the RICE configurations<br />
over a wide load range when oper-<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 39
Deviation from full-load<br />
emissions due to part load,<br />
transients <strong>and</strong> starts<br />
limit<br />
Deviation from full-load<br />
emissions due to part load,<br />
transients <strong>and</strong> starts<br />
limit<br />
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable gas-based power generation technologies<br />
SC/Peaking CO 2 CH 4 NO X<br />
600<br />
3000<br />
300<br />
500<br />
2500<br />
250<br />
400<br />
2000<br />
200<br />
300<br />
1500<br />
150<br />
200<br />
1000<br />
100<br />
100<br />
500<br />
50<br />
0<br />
0<br />
0<br />
SC-GT RICE-EM RICE-SM SC-GT RICE-EM RICE-SM SC-GT RICE-EM RICE-SM<br />
CC/Baseload<br />
CO 2 CH 4 NO X<br />
600<br />
3000<br />
300<br />
500<br />
2500<br />
250<br />
400<br />
2000<br />
200<br />
300<br />
1500<br />
150<br />
200<br />
1000<br />
100<br />
100<br />
500<br />
50<br />
0<br />
0<br />
0<br />
CC-GT RICE-EM CC-GT RICE-EM CC-GT CC-GT RICEwEAT<br />
EM<br />
Fig. 10. Emission results <strong>for</strong> CO 2 , CH 4 <strong>and</strong> NO X <strong>for</strong> both scenarios (above: Peaking,<br />
below: Baseload).<br />
Emissions in g/kWh el<br />
Emissions in g/kWh el<br />
ated in “efficiency mode” (see F i g u r e 8 )<br />
the deviation from the full-load CO 2 emissions<br />
is negligible. Despite the loss <strong>of</strong> efficiency<br />
in “spinning mode”, additional CO 2<br />
emissions associated with startup, part-load<br />
<strong>and</strong> transient operation are still marginal in<br />
the evaluated scenario. Only <strong>for</strong> the SC-GT<br />
configuration in peaking operation, there is<br />
a noticeable deviation from the full-load<br />
CO 2 emissions value due to reduced plant efficiency<br />
in part load.<br />
The CH 4 emissions <strong>of</strong> the RICE configurations<br />
significantly exceed the CH 4 emissions<br />
<strong>of</strong> the GT configurations. In both operation<br />
scenarios, CH 4 emissions <strong>of</strong> the RICE configurations<br />
increase only slightly due to<br />
startups, part-load operation, <strong>and</strong> transient<br />
load changes. The influence <strong>of</strong> operation<br />
other than full load is only visible in spinning<br />
mode, as all engines startup at each<br />
plant start simultaneously. However, all<br />
RICE configurations comply with the limit<br />
value <strong>of</strong> the 13 th BImSchV.<br />
In the peaking scenario, the NO X emissions<br />
<strong>of</strong> the GT configuration exceed the RICE<br />
configurations’ emissions. This can be attributed<br />
to the EAT, which is only considered <strong>for</strong><br />
RICE power plants in the <strong>for</strong>m <strong>of</strong> an OC (<strong>for</strong><br />
CO <strong>and</strong> HCHO) <strong>and</strong> SCR (NO X ) with an averaged,<br />
constant conversion efficiency since<br />
the raw emissions are typically an order <strong>of</strong><br />
magnitude greater than the emission values<br />
with EAT. However, while the difference is<br />
significant in the peaking scenario, emissions<br />
are comparable <strong>for</strong> both technologies<br />
in the baseload scenario. Additionally, the<br />
transient operation does not significantly affect<br />
the emission values <strong>for</strong> both RICE configurations.<br />
The SC-GT’s startup <strong>and</strong> partload<br />
emission characteristics considerably<br />
influence the total emissions in both scenarios.<br />
In the peaking scenario, the high NO X<br />
emissions at lower partial load <strong>and</strong> startup<br />
operation attributable to the pilot burner<br />
(see F i g u r e 7 ) cause a visible deviation<br />
from the full-load emissions. On the other<br />
Emissions in mg/kWh el<br />
Emissions in mg/kWh el<br />
Emissions in mg/kWh el<br />
Emissions in mg/kWh el<br />
h<strong>and</strong>, in the baseload scenario, the slight dip<br />
in NO X emission at a very high part-load (see<br />
F i g u r e 7 ) is responsible <strong>for</strong> reduced specific<br />
emissions compared to full-load.<br />
Both RICE configurations in peaking operation<br />
are clearly below the NO X limit value <strong>of</strong><br />
the 13 th BImSchV with EAT system, although<br />
higher values are likely to be observed during<br />
the warmup <strong>of</strong> the EAT. However, these<br />
elevated emission levels during operation<br />
with lowered EAT efficiency are accounted<br />
<strong>for</strong> by half-hourly averages in the 13 th BIm-<br />
SchV. The half-hourly emission averages are<br />
twice as high as the shown hourly mean value.<br />
A slight exceedance can be observed <strong>for</strong><br />
the SC-GT, however, the shown limit value<br />
can solely serve as an indicator since the 13 th<br />
BImSchV limit <strong>for</strong> GTs only applies to loads<br />
above 70 % <strong>of</strong> the nominal power. As the<br />
shown emission results consider the entire<br />
load range <strong>and</strong> include transient processes,<br />
the presented value is not directly comparable<br />
with the limit value given by the 13 th<br />
wEAT<br />
wEAT wEAT<br />
Full-load emissions 13th BlmSchV<br />
BImSchV. However, the full-load emission<br />
value <strong>for</strong> the SC-GT is already within the<br />
limit value range. There<strong>for</strong>e, considering<br />
only the load range above 70 %, compliance<br />
with the limit value is already technologically<br />
challenging. For the baseload configurations,<br />
the comparison between the limit<br />
values implied by the 13 th BImSchV shows<br />
the significantly stricter regulation <strong>of</strong> CC-GT<br />
emissions compared to RICE, see F i g u r e 1<br />
<strong>and</strong> section 2.2. As a result, the CC-GT substantially<br />
exceeds the limit despite comparable<br />
absolute emissions with RICE, while the<br />
emissions produced by RICE stay well below<br />
their limit value. The CC-GT limit implied by<br />
the 13 th BImSchV can only be met using an<br />
exhaust gas after-treatment (i.e., SCR). If<br />
this additional equipment is applied, the CC-<br />
GT emissions are significantly below the<br />
limit value as well as the emissions <strong>of</strong> the<br />
RICE configuration, which uses exhaust gas<br />
after-treatment in any case.<br />
In the peaking scenario, the SC-RICE configurations<br />
produce higher emission values<br />
<strong>for</strong> CO compared to the SC-GT configuration.<br />
However, while the SC-RICE emissions<br />
at the nominal load essentially define the<br />
absolute emissions, the SC-GT emissions are<br />
mainly driven by startup, transient <strong>and</strong> partload<br />
operation. Due to many startup processes<br />
<strong>and</strong> the associated operation at low<br />
load points, the SC-GT emissions increase<br />
significantly compared to the full-load emissions<br />
in the peaking scenario. In contrast, in<br />
the baseload scenario, the CO emissions <strong>of</strong><br />
the CC-GT configuration are considerably<br />
lower, <strong>and</strong> negligible deviation from the<br />
full-load value is visible. This is because the<br />
load pr<strong>of</strong>ile predominantly provides operation<br />
in the upper load range <strong>and</strong> just a single<br />
plant start every two weeks.<br />
Despite the apparent differences between<br />
scenarios <strong>and</strong> technologies, the CO limit values<br />
<strong>of</strong> the 13 th BImSchV are complied with<br />
in all considered cases. For the RICE configurations,<br />
however, this requires an OC.<br />
SC/Peaking<br />
CO HCHO PM<br />
140<br />
30<br />
14<br />
120<br />
25<br />
12<br />
100<br />
20<br />
10<br />
80<br />
15<br />
8<br />
60<br />
6<br />
40<br />
10<br />
4<br />
20<br />
5<br />
2<br />
0<br />
0<br />
0<br />
SC-GT RICE-EM RICE-SM SC-GT RICE-EM RICE-SM SC-GT RICE-EM RICE-SM<br />
Emissions in mg/kWh el Emissions in mg/kWh el<br />
Emissions in mg/kWh el<br />
Emissions in mg/kWh el<br />
CC/Baseload CO HCHO PM<br />
140<br />
30<br />
14<br />
120<br />
25<br />
12<br />
100<br />
20<br />
10<br />
80<br />
15<br />
8<br />
60<br />
6<br />
40<br />
10<br />
4<br />
20<br />
5<br />
2<br />
0<br />
0<br />
0<br />
CC-GT RICE-EM CC-GT RICE-EM CC-GT RICE-EM<br />
Fig. 11. Emission results <strong>for</strong> CO, HCHO, <strong>and</strong> PM <strong>for</strong> both scenarios<br />
(above: Peaking; below: Baseload).<br />
Emissions in mg/kWh el<br />
Emissions in mg/kWh el<br />
Full-load emissions 13th BlmSchV<br />
40 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable gas-based power generation technologies<br />
The PM emissions produced by RICE are typically<br />
well above those associated with GT<br />
operation. This can be mainly attributed to<br />
the different combustion principles. However,<br />
both technologies’ emissions are at a low<br />
level. The displayed limit value is derived<br />
from liquid fuels since <strong>for</strong> methane as fuel, no<br />
PM limit value is given in the 13 th BImSchV.<br />
In the case <strong>of</strong> HCHO emissions, a relevant<br />
difference between RICE <strong>and</strong> GT is apparent.<br />
This finding can be attributed to the fact that<br />
the OC <strong>for</strong> RICE significantly reduces HCHO<br />
emissions. However, both GT <strong>and</strong> RICE comply<br />
with the limit values <strong>of</strong> the 13 th BImSchV.<br />
4.2 Environmental Impact Analysis<br />
Based on the respective specific emission values<br />
<strong>of</strong> the species considered, the environmental<br />
impact can now be quantified as a final<br />
step <strong>of</strong> this study. Un<strong>for</strong>tunately, there is<br />
no uni<strong>for</strong>m metric <strong>for</strong> determining the environmental<br />
footprint as a single score. Instead,<br />
relevant literature suggests various<br />
damage pathways <strong>and</strong> impact categories<br />
with strongly varying confidence levels, see<br />
<strong>for</strong> example the JRC recommendations <strong>of</strong><br />
the European Commission on Life Cycle Impact<br />
Analyses [40]. Furthermore, even <strong>for</strong> a<br />
specific environmental damage pathway, the<br />
metrics <strong>and</strong> their characterization factors<br />
vary greatly <strong>for</strong> the individual species.<br />
There<strong>for</strong>e, in this study, two parameters are<br />
chosen so that all species under consideration<br />
appear at least once. Firstly, the Global<br />
Warming Potential (GWP) is analyzed to represent<br />
the effect <strong>of</strong> greenhouse gas emissions.<br />
The second parameter represents the<br />
damage caused by air pollutants, i.e., the Human<br />
Toxicity Potential (HTP). Since the difference<br />
in the emission results <strong>for</strong> both operation<br />
strategies (“efficiency mode” <strong>and</strong><br />
“spinning mode”) <strong>of</strong> the RICE configurations<br />
in the peaking sce nario is negligible, only the<br />
“efficiency mode” results are displayed in the<br />
following section.<br />
To quantify the emissions’ impact on global<br />
warming, the GWP is used to calculate CO 2 -<br />
equivalents per kWh el . The GWP metric relates<br />
the effect <strong>of</strong> a radiation absorbing gas<br />
in the atmosphere to CO 2 molecules <strong>of</strong> an<br />
equal mass. The GWP considers the timeintegrated<br />
radiative <strong>for</strong>cing (RF), which represents<br />
the cumulative change in the radiation<br />
balance <strong>of</strong> the earth <strong>and</strong> atmosphere<br />
system <strong>of</strong> the considered species. As CO 2 has<br />
a long atmospheric lifetime, the time-integrated<br />
RF increases <strong>for</strong> centuries. In contrast,<br />
the other major GHG considered in the<br />
present study (CH 4 ) has a short atmospheric<br />
lifetime. There<strong>for</strong>e, the time-integrated RF<br />
stays constant after about 50 years because<br />
the CH 4 has almost been degraded <strong>and</strong> no<br />
longer causes RF [38]. Hence, the calculation<br />
<strong>of</strong> the GWP depends on the respective<br />
time horizon. For a short-lived gas like CH 4 ,<br />
the GWP declines with an increasing time<br />
horizon. Thus, the time horizon <strong>for</strong> evaluating<br />
the GWP metric depends on many factors<br />
<strong>and</strong> considerations: On the one h<strong>and</strong>, it<br />
CO 2 -eq emissions in g/kWh el<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
SC/Peaking<br />
CO 2 -eq emissions in g/kWh el<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
CC/Baseload<br />
0<br />
SC-GT RICE SC-GT RICE CC-GT RICE CC-GT RICE<br />
GWP 100 GWP 20 GWP 100 GWP 20<br />
kg CO2 -eq.<br />
GWP 20, CH4 = 84 ; GWP 100, CH4 = 28<br />
kg CH4<br />
kg CO2 -eq.<br />
kg CH4<br />
Fig. 12. Environmental impact comparison as Global Warming Potential<br />
(Characterization Factors from [38]).<br />
Toluene-eq emissions in mg/kWh el<br />
1800<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
Toluene-eq emissions in mg/kWh el<br />
Tab. 4. Characterization Factors <strong>for</strong> Human<br />
Toxicity Potential [41].<br />
RICE<br />
GT<br />
CO 2<br />
CH 4<br />
Species CO NO X HCHO PM 10<br />
kg Tolueneeq<br />
/ kg<br />
0.27 4.3 16 2.9<br />
is necessary to consider the short-term climate<br />
impact <strong>of</strong> short-lived gases. On the<br />
other h<strong>and</strong>, their contribution to global<br />
warming should not be overestimated in the<br />
long turn, possibly resulting in wrong incentives<br />
<strong>for</strong> emission reduction measures [39].<br />
There<strong>for</strong>e, the commonly used GWP 100<br />
(CH 4 = 28 [38]) <strong>and</strong> the GWP 20 (CH 4 = 84<br />
[38]) are presented in F i g u r e 1 2 to quantify<br />
the short- <strong>and</strong> medium-term impact on<br />
climate change <strong>of</strong> the results shown in section<br />
5.1.<br />
When CO 2 emissions <strong>and</strong> CO 2 -equivalents <strong>of</strong><br />
the CH 4 emissions are accumulated, the<br />
RICE’s efficiency advantage compared to the<br />
SC-GT is mostly compensated. There<strong>for</strong>e,<br />
under consideration <strong>of</strong> the GWP 100 , the SC<br />
configurations have comparable emissions.<br />
However, considering the GWP 20 results in<br />
higher RICE emissions than the SC-GT due<br />
to the increased characterization factor <strong>of</strong><br />
CH 4 considering the shorter time horizon.<br />
On the other h<strong>and</strong>, the GTs emissions are<br />
well below the RICE emissions <strong>for</strong> CC configurations.<br />
This is because the CC-GT’s electrical<br />
efficiency is higher than the efficiency<br />
<strong>of</strong> the RICE, <strong>and</strong> there are no relevant CH 4<br />
emissions <strong>for</strong> GTs (see F i g u r e 11 ).<br />
In addition to the climate impact, the Human<br />
Toxicity Potential was analyzed to consider<br />
local pollutants. In Ta b l e 4 , the characterization<br />
factors <strong>for</strong> the different species<br />
are shown in Toluene equivalents. In this<br />
rating, the HCHO emissions are quantified<br />
as the most dangerous <strong>of</strong> the considered<br />
species in terms <strong>of</strong> human toxicity. Moreover,<br />
in [41], a characterization factor <strong>for</strong> ammonia<br />
<strong>of</strong> 7.5 is given as well. At this point, it<br />
should be mentioned that ammonia is required<br />
<strong>for</strong> the operation <strong>of</strong> the SCR catalytic<br />
converter <strong>and</strong>, depending on the necessary<br />
NOX reduction rate <strong>and</strong> consequently the<br />
amount <strong>of</strong> ammonia used, ammonia emissions<br />
can occur, which then also has an environmental<br />
impact. However, the available<br />
data on ammonia emission is limited; there<strong>for</strong>e,<br />
this effect cannot be illustrated at this<br />
point <strong>of</strong> the study.<br />
The results <strong>of</strong> the HTP calculation are shown<br />
in F i g u r e 1 3 . The figure illustrates that<br />
the HTP results are mainly driven by the<br />
quantity <strong>of</strong> HCHO <strong>and</strong> NO X emissions. Although<br />
NO X emissions do not have the<br />
strongest toxic effect, their impact on the<br />
HTP results is predominant due to the high-<br />
SC/Peaking CC/Baseload GT<br />
1800<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
0<br />
0<br />
SC-GT SC-GT RICE wEAT CC-GT CC-GT<br />
wEAT<br />
wEAT<br />
Fig. 13. Environmental impact comparison as Human Toxicity Potential.<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
RICE wEAT<br />
RICE<br />
PM<br />
HCHO<br />
NO X<br />
CH<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 41
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable gas-based power generation technologies<br />
er quantity <strong>of</strong> NO X emissions compared to<br />
the other species under investigation (see<br />
Figure 10 <strong>and</strong> Figure 11). However,<br />
because <strong>of</strong> the small characterization factor<br />
<strong>of</strong> CO <strong>and</strong> the relatively low PM emissions <strong>of</strong><br />
both considered technologies, these two<br />
species do not impact the HTP significantly.,<br />
the characterization factors <strong>for</strong> the different<br />
species are shown in Toluene equivalents. In<br />
this rating, the HCHO emissions are quantified<br />
as the most dangerous <strong>of</strong> the considered<br />
species in terms <strong>of</strong> human toxicity. Moreover,<br />
in [41], a characterization factor <strong>for</strong> ammonia<br />
<strong>of</strong> 7.5 is given as well. At this point, it<br />
should be mentioned that ammonia is required<br />
<strong>for</strong> the operation <strong>of</strong> the SCR catalytic<br />
converter <strong>and</strong>, depending on the necessary<br />
NOX reduction rate <strong>and</strong> consequently the<br />
amount <strong>of</strong> ammonia used, ammonia emissions<br />
can occur, which then also has an environmental<br />
impact. However, the available<br />
data on ammonia emission is limited; there<strong>for</strong>e,<br />
this effect cannot be illustrated at this<br />
point <strong>of</strong> the study.<br />
The results <strong>of</strong> the HTP calculation are shown<br />
in F i g u r e 1 3 . The figure illustrates that<br />
the HTP results are mainly driven by the<br />
quantity <strong>of</strong> HCHO <strong>and</strong> NO X emissions. Although<br />
NO X emissions do not have the<br />
strongest toxic effect, their impact on the<br />
HTP results is predominant due to the higher<br />
quantity <strong>of</strong> NO X emissions compared to<br />
the other species under investigation (see<br />
Figure 10 <strong>and</strong> Figure 11). However,<br />
because <strong>of</strong> the small characterization factor<br />
<strong>of</strong> CO <strong>and</strong> the relatively low PM emissions <strong>of</strong><br />
both considered technologies, these two<br />
species do not impact the HTP significantly.<br />
As the GT’s specific NO X <strong>and</strong> HCHO emissions<br />
are higher than the correspondent RICE configuration’s<br />
emissions, the GTs HTP exceeds<br />
the value <strong>for</strong> RICE in both scenarios. However,<br />
only the SC-GT st<strong>and</strong>s out in this comparison,<br />
while <strong>for</strong> RICE <strong>and</strong> the CC-GT configurations,<br />
comparable values <strong>for</strong> the HTP<br />
can be observed. This is due to the higher<br />
electrical efficiency <strong>of</strong> the CC-GT, which compensates<br />
<strong>for</strong> the higher specific emissions <strong>of</strong><br />
the relevant species. Moreover, when EAT is<br />
applied to GT power plants, their HTP impact<br />
is significantly reduced.<br />
5 Summary <strong>and</strong> outlook<br />
In this study, gas-based power generation<br />
technologies, i.e., RICE <strong>and</strong> GT, were investigated<br />
with regard to their emission behavior<br />
<strong>and</strong> corresponding regulations. As regulations<br />
<strong>and</strong> scientific publications commonly<br />
employ different units <strong>and</strong> reference<br />
oxygen contents in the exhaust <strong>for</strong> quantifying<br />
emissions from GT <strong>and</strong> RICE, i.e., ppmvd<br />
or mg/Nm³, a direct comparison between<br />
technologies is typically not possible. To<br />
overcome this limitation, the present study<br />
presents the emissions in an apples-to-apples<br />
metric, i.e., mg/kWh el . Subsequently,<br />
the major regulations <strong>for</strong> NO X <strong>and</strong> CO emissions<br />
were analyzed <strong>and</strong> compared in the<br />
apples-to-apples metric. Converted to mg/<br />
kWh el , it becomes visible that the stricter<br />
regulatory frameworks (EU BAT conclusions,<br />
13 th BImSchV, EPA) result in comparable<br />
NO X emission limits <strong>for</strong> SC-GT <strong>and</strong> SC-<br />
RICE, while the limits <strong>for</strong> CC-GT are much<br />
stricter compared to the CC-RICE limits.<br />
Regarding CO emissions, the emission limits<br />
can be reasonably regarded as technologyneutral<br />
with a few exceptions, e.g., exemplary<br />
EPA permits <strong>and</strong> EU BAT conclusions.<br />
To investigate the emission behavior <strong>of</strong> the<br />
two technologies <strong>for</strong> different power plant<br />
configurations <strong>and</strong> operation regimes, this<br />
study introduces a modeling approach <strong>for</strong><br />
the emission calculation <strong>of</strong> GT <strong>and</strong> RICE<br />
power plants. In a first step, the part-load<br />
behavior <strong>of</strong> the electric efficiency <strong>and</strong> the<br />
most important emission species were derived<br />
from publicly available data. In a second<br />
step, the single GT or RICE models were<br />
aggregated to a power plant configuration<br />
using an EXCEL-based model environment.<br />
While a single-cycle GT <strong>and</strong> the corresponding<br />
number <strong>of</strong> 10-MW el RICE were considered<br />
in a “peaking” scenario, a combinedcycle<br />
GT <strong>and</strong> the corresponding number <strong>of</strong><br />
20-MW el RICE were considered in a “baseload”<br />
scenario. In addition to the emission<br />
behavior during part-load operation, the<br />
ignition <strong>and</strong> startup phase, as well as an additional<br />
penalty <strong>for</strong> the transient operation<br />
were considered. Since exhaust gas aftertreatment<br />
systems (SCR <strong>and</strong> OC) in RICE<br />
plants are commonly applied, both were included<br />
<strong>for</strong> the calculation <strong>of</strong> RICE with a<br />
constant conversion efficiency <strong>of</strong> 90 %. For<br />
the GT, however, no EAT was considered.<br />
Finally, the major emission species were calculated<br />
<strong>for</strong> both technologies in two operational<br />
scenarios, i.e., peaking <strong>and</strong> baseload<br />
operation. For better comparison <strong>of</strong> the<br />
technologies, the apples-to-apples metric <strong>of</strong><br />
mg/kWh el was used again.<br />
The plant per<strong>for</strong>mance <strong>for</strong> each operating<br />
scenario was calculated leveraging a load<br />
pr<strong>of</strong>ile derived from real plant data. Due to<br />
frequent load changes <strong>and</strong> startup processes,<br />
the emission results indicate that peaking<br />
operation can result in higher average emission<br />
values in comparison to the full-load<br />
value associated with the related technology.<br />
This finding is especially evident in the CO<br />
emission results <strong>of</strong> the GT, as CO increases<br />
drastically at partial load. For the remaining<br />
emission species considered in the present<br />
study, the part load emission value does not<br />
increase as significantly as <strong>for</strong> CO emissions.<br />
There<strong>for</strong>e, the influence <strong>of</strong> the operating regime<br />
on the results <strong>of</strong> the remaining emission<br />
species is negligible. However, RICE require<br />
EAT <strong>for</strong> NO X (SCR), CO, <strong>and</strong> HCHO<br />
(both OC) to comply with strict emission<br />
limits, e.g., the German regulation 13 th BIm-<br />
SchV. To comply with the stricter NO X limit,<br />
the CC-GT must also be equipped with EAT.<br />
Since CC-GT currently in operation are typically<br />
not equipped with EAT, they will significantly<br />
exceed the stricter emission limits<br />
despite comparable absolute emissions with<br />
RICE. In SC operation, NO X emissions <strong>of</strong> GT<br />
surpass the corresponding RICE emissions.<br />
However, SC-GT NO X emissions are within<br />
the limit value implied by strict emission legislation,<br />
e.g., 13 th BImSchV. The calculated<br />
CO emissions show that GTs have lower<br />
emissions than RICE in both scenarios. The<br />
13 th BImSchV limit value is complied with by<br />
a wide margin by all the configurations considered.<br />
Finally, the emission data <strong>for</strong> each species<br />
were examined regarding their environmental<br />
impact. The Global Warming Potential<br />
(GWP) <strong>and</strong> the Human Toxicity Potential<br />
(HTP) were applied as comparative indicators.<br />
As the efficiency drives the CO 2 emissions,<br />
the CC-GT has the lowest impact on<br />
climate change <strong>of</strong> the considered technologies.<br />
This finding is further backed by the<br />
fact that there are no significant CH 4 emissions<br />
during gas turbine operation. The efficiency<br />
advantage <strong>of</strong> the SC-RICE compared<br />
to the SC-GT is partly (using the GWP 100 ) or<br />
fully (using the GWP 20 ) compensated by the<br />
CO 2 -equivalent emissions <strong>of</strong> the RICE’s CH 4<br />
emissions. Regarding the HTP, the emission<br />
species with the highest impacts are NO X<br />
<strong>and</strong> HCHO. As the GT configurations have<br />
higher NO X <strong>and</strong> HCHO emissions in both<br />
scenarios, the impact on Human Toxicity is<br />
higher in comparison to the RICE configurations<br />
commonly built with EAT. While the<br />
CC-GT without EAT has a comparable HTP<br />
to both RICE configurations, the SC-GT<br />
st<strong>and</strong>s out with the highest HTP in this comparison.<br />
However, EAT with an average conversion<br />
rate <strong>of</strong> 90 % under all operating conditions<br />
is necessary <strong>for</strong> the RICE to achieve<br />
the calculated HTP.<br />
The methodology applied in the present<br />
study employs a holistic comparison between<br />
two technologies with the same inputs<br />
<strong>and</strong> outputs on an apples-to-apples basis.<br />
Moreover, the present study does not<br />
solely focus on thermodynamic per<strong>for</strong>mance<br />
but also leverages a detailed analysis<br />
<strong>of</strong> the emissions associated with the electricity<br />
supply through both technologies. Going<br />
a step further, the emissions are aggregated<br />
into different damage pathways <strong>and</strong> impact<br />
categories which summarize the environmental<br />
impact <strong>of</strong> other emissions species. In<br />
such a way, a comprehensive thermodynamic<br />
<strong>and</strong> ecologic analysis <strong>of</strong> both technologies<br />
in different operating scenarios is allowed.<br />
In further studies, the methodology can be<br />
improved by using more detailed transient<br />
<strong>and</strong> part-load characteristics <strong>for</strong> the emissions<br />
<strong>of</strong> the considered GT <strong>and</strong> RICE. Moreover,<br />
full-load emission values <strong>of</strong> new state<strong>of</strong>-the-art<br />
engines <strong>and</strong> “engines in operation”<br />
need to be distinguished. Additionally,<br />
the heat-up phase <strong>and</strong> degradation <strong>of</strong> the<br />
EAT systems should also be modelled to account<br />
<strong>for</strong> the conversion efficiency <strong>of</strong> the<br />
catalysts more precisely during plant start<br />
<strong>and</strong> transient operation. Potential ammonia<br />
emissions due to SCR operation should be<br />
42 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Emission footprint analysis <strong>of</strong> dispatchable gas-based power generation technologies<br />
considered as well. Furthermore, a more<br />
comprehensive range <strong>of</strong> damage metrics<br />
needs to be applied to the emission values to<br />
sharpen the environmental footprint analysis.<br />
Life cycle emissions should also be taken<br />
into account, as these are commonly used as<br />
a reference, <strong>for</strong> example in the EU taxonomy<br />
regulation. Moreover, the utilization <strong>of</strong> alternative,<br />
CO 2 -neutral fuels should also be<br />
investigated with regard to their ecological<br />
impact using the shown methodology.<br />
Literature<br />
[1] European Commission; <strong>2022</strong>; A European<br />
Green Deal. Available online at: https://<br />
ec.europa.eu/info/strategy/priorities-<br />
2019-2024/european-green-deal/.<br />
[2] European Commission; <strong>2022</strong>; EU taxonomy<br />
<strong>for</strong> sustainable activities. Available online<br />
at: https://ec.europa.eu/info/businesseconomy-euro/banking-<strong>and</strong>-finance/<br />
sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainableactivities_en.<br />
[3] Bundesministerium der Justiz; 2021;<br />
Verordnung über Großfeuerungs-, Gasturbinen-<br />
und Verbrennungsmotoranlagen<br />
(13. BImSchV).<br />
[4] European Commission Joint Research Centre;<br />
2017; Best Available Techniques (BAT)<br />
Reference Document <strong>for</strong> Large Combustion<br />
Plants; EUR 28836 EN.<br />
[5] <strong>International</strong> Finance Cooperation – World<br />
Bank Group; 2017; Environmental, Health<br />
<strong>and</strong> Safety Guidelines – Air Emissions <strong>and</strong><br />
Ambient Air Quality – Small Combustion<br />
Facilities Emissions Guidelines.<br />
[6] European Parliament <strong>and</strong> Council; 2015;<br />
Directive on the limitation <strong>of</strong> emissions<br />
from certain pollutants into the air from medium<br />
combustion plants (2015/2193).<br />
[7] Bundesministerium der Justiz; 2019; Verordnung<br />
über mittelgroße Feuerungs-Gasturbinen-<br />
und Verbrennungsmotoranlagen<br />
(14. BImSchV).<br />
[8] U.S. Environmental Protection Agency;<br />
Available online at: https://cfpub.epa.gov/<br />
rblc/index.cfm?action=PermitDetail.<br />
ProcessInfo&facility_id=28587&PROCESS<br />
_ID=112432 ; accessed: March <strong>2022</strong>.<br />
[9] U.S. Environmental Protection Agency;<br />
Available online at: https://cfpub.epa.gov/<br />
rblc/index.cfm?action=PermitDetail.<br />
ProcessInfo&facility_id=28854&PROCESS<br />
_ID=113890 ; accessed: March <strong>2022</strong>.<br />
[10] U.S. Environmental Protection Agency;<br />
Available online at: https://cfpub.epa.gov/<br />
rblc/index.cfm?action=PermitDetail.<br />
ProcessInfo&facility_id=28704&PROCESS<br />
_ID=113037 ; accessed: March <strong>2022</strong>.<br />
[11] Nielsen, M.; Illerup, J.; Birr-Petersen, K.;<br />
2008; Revised emission factors <strong>for</strong> gas engines<br />
including start/stop emissions. NERI<br />
Technical Report No. 672.<br />
[12] Miller, W.; Johnson, K.; Peng, W.; Yang, J.;<br />
2020; Local Air Benefits by Switching from<br />
Diesel Fuel to LNG on a Marine Vessel. Cali<strong>for</strong>nia<br />
Air Resources Board CARB.<br />
[13] Anderson, M.; Salo, K.; Fridell, E.; 2015;<br />
Particle- <strong>and</strong> gaseous emissions from a LNG<br />
powered ship. Environ. Sci. Technol. 2015.<br />
[14] U.S. Environmental Protection Agency:<br />
CAMD’s Power Sector Emission Data Guide<br />
Available online at: https://www.epa.gov/<br />
airmarkets/camds-power-sector-emissiondata-guide;<br />
accessed: March <strong>2022</strong>.<br />
[15] Lechner, Christ<strong>of</strong> & Seume, Joerg; 2003;<br />
Stationäre Gasturbinen. DOI:10.1007/978-<br />
3-662-10016-5.<br />
[16] Kawasaki Heavy Industries: Kawasaki Gas<br />
Turbine Generator Sets; Available online at:<br />
https://global.kawasaki.com/en/<strong>energy</strong>/<br />
pdf/Green_Brochure.pdf; accessed: March<br />
<strong>2022</strong>.<br />
[17] Aune, R.; Wright, C.; Hollaway, M.; Evaluation<br />
<strong>of</strong> the next generation <strong>of</strong> fracturing<br />
fleets: Tier IV Diesel, Tier IV Dual Fuel <strong>and</strong><br />
Electric; Available online at: https://www.<br />
libertyfrac.com/wp-content/uploads/<br />
2020/01/The-Next-<strong>Generation</strong>-<strong>of</strong>-Fracturing-Fleets-A-Liberty-ESG-Evaluation.pdf<br />
;<br />
accessed: March <strong>2022</strong>.<br />
[18] Seydel, C.; 2015; Per<strong>for</strong>mance Influences <strong>of</strong><br />
Hydrogen Enriched Fuel on Heavy-Duty Gas<br />
Turbines in Combined Cycle Power Plants.<br />
V003T08A002. 10.1115/GT2015-42018.<br />
[19] Gülen, S.; 2019; Aeroderivative Gas Turbine.<br />
10.1017/9781108241625.024.<br />
[20] Siemens Energy: We power the world with<br />
innovative gas turbines – Siemens Energy<br />
gas turbine portfolio; Available online at:<br />
https://assets.siemens-<strong>energy</strong>.com/sie-<br />
mens/assets/api/uuid:a42b9bc4-dc1e-<br />
4205-a27e-afa3de31b6f3/familybrochuregasturbines-sev11-medium144dpi.pdf<br />
; accessed:<br />
March <strong>2022</strong>.<br />
[21] Pavi, R.; Moore, G.D.: Gas Turbine Emissions<br />
<strong>and</strong> Control (GE Power Systems);<br />
Available online at: https://www.ge.com/<br />
content/dam/gepower-new/global/en_<br />
US/downloads/gas-new-site/resources/<br />
reference/ger-4211-gas-turbine-emissions<strong>and</strong>-control.pdf;<br />
accessed: March <strong>2022</strong>.<br />
[22] Winkler, Dieter & Geng, Weiqun & Engelbrecht,<br />
Ge<strong>of</strong>frey & Stuber, Peter & Knapp,<br />
Klaus & Griffin, Timothy. (2017). Staged<br />
combustion concept <strong>for</strong> gas turbines.<br />
<strong>Journal</strong> <strong>of</strong> the Global Power <strong>and</strong> Propulsion<br />
Society. 1. CVLCX0. 10.22261/CVLCX0.<br />
[23] U.S. Environmental Protection Agency:<br />
Hazardous Air Pollutant (HAP) Emission<br />
Control Technology <strong>for</strong> New Stationary<br />
Combustion Turbines.<br />
[24] <strong>International</strong> Council On Combustion Engines<br />
(CIMAC): CIMAC Position Paper –<br />
Methane <strong>and</strong> Formaldehydes Emissions <strong>of</strong><br />
Gas Engines; Available online at: https://<br />
www.cimac.com/cms/upload/Publication_<br />
Press/WG_Publications/CIMAC_<br />
WG17_2014_Apr_Position_Methane_<strong>and</strong>_<br />
Formaldehyde_Emissions.pdf; accessed:<br />
March <strong>2022</strong>.<br />
[25] Wien, S.; Beres, J.; Richani, B. (GE Energy):<br />
Air Emissions Terms, Definitions <strong>and</strong> General<br />
In<strong>for</strong>mation; 2005.<br />
[26] Siemens AG: A&WMA Annual Meeting –<br />
Siemens Small Power Presentation; Oct 19<br />
2016; Available online at: https://wcsawma.starchapter.com/images/downloads/<br />
Presentations_from_2016_Annual_Conference/overview_<strong>of</strong>_siemens_small_power_<br />
generating_units.pdf; accessed: March<br />
<strong>2022</strong>.<br />
[27] BAHR, D. W. (August 5, 2010). “GAS TUR-<br />
BINE COMBUSTION—Alternative Fuels<br />
<strong>and</strong> Emissions.” ASME. J. Eng. Gas Turbines<br />
Power. November 2010; 132(11): 116501.;<br />
https://doi.org/10.1115/ 1.4001927.<br />
[28] Lehtoranta, K.; Aakko-Saksa, P.; Murtonen,<br />
T.; Vesala, H.; Ntziachristos, L.; Rönkkö, T.;<br />
Karjalainen, P.; Kuittinen, N.; Timonen, H.;<br />
2019; Particulate Mass <strong>and</strong> Nonvolatile Particle<br />
Number Emissions from Marine Engines<br />
Using Low-Sulfur Fuels, Natural Gas,<br />
or Scrubbers. Environ. Sci. Technol. 2019,<br />
53, 3315–3322. DOI: 10.1021/acs.<br />
est.8b05555.<br />
[29] Stenersen, D.; Thonstad, O.; 2017; GHG <strong>and</strong><br />
NO X emissions from gas fuelled engines.<br />
SINTEF ocean AS, OC2017 F-108 – Unrestricted.<br />
[30] Sommer, D.; Yeremi, M.; Son, J.; Corbin, J.;<br />
Gagné, S.; Lobo, P.; Miller, J.; Kirchen, P.;<br />
2019; Characterization <strong>and</strong> Reduction <strong>of</strong> In-<br />
Use CH 4 Emissions from a Dual Fuel Marine<br />
Engine Using Wavelength Modulation Spectroscopy.<br />
Environ. Sci. Technol. 2019, 53,<br />
2892−2899. DOI: 10.1021/acs.<br />
est.8b04244.<br />
[31] Horgen, O.; 2012; Rolls-Royce Marine - The<br />
“Environship Concept”. System Solutions &<br />
Wave Piercing Technology, Rollce-Royce.<br />
[32] Ushakov, S.; Stenersen, D.; Einang, P.; 2019;<br />
Methane slip from gas fuelled ships: a comprehensive<br />
summary based on measurement<br />
data. <strong>Journal</strong> <strong>of</strong> Marine Science <strong>and</strong><br />
Technology. DOI: https://doi.org/10.1007/<br />
s00773-018-00622-z.<br />
[33] Wärtsilä press release; 2020; Cutting greenhouse<br />
gas emissions from LNG engines.<br />
Available online at: https://www.wartsila.<br />
com/media/news/06-04-2020-cuttinggreenhouse-gas-emissions-from-lng-engines.<br />
[34] Environmental Protection Agency; 2021;<br />
Technology Transfer Network: Clean Air<br />
Technology Center - RACT/BACT/LAER<br />
Clearinghouse. Available online at: https://<br />
cfpub.epa.gov/rblc/index.cfm?action=<br />
Search.BasicSearch&lang=en.<br />
[35] Krivopolianskii, V.; Valberg, I.; Stenersen,<br />
D.; Ushakov, S.; Æsøy, V.; 2018, Control <strong>of</strong><br />
the combustion process <strong>and</strong> emission <strong>for</strong>mation<br />
in marine gas engines. <strong>Journal</strong> <strong>of</strong> Marine<br />
Science <strong>and</strong> Technology. DOI: https://<br />
doi.org/10.1007/s00773-018-0556-0.<br />
[36] Baas, H.; 2017; Abgasemissionen von Gasmotoren<br />
– Planertage 2017. Caterpillar.<br />
[37] Energy-Charts; <strong>2022</strong>; Nettostromerzeugung<br />
aus Erdgas in Deutschl<strong>and</strong>, Blockscharfe<br />
Erzeugung „Düsseldorf Lausward<br />
F“. Available online at: https://<strong>energy</strong>charts.info/charts/power/.<br />
[38] Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins,<br />
J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F.<br />
Lamarque, D. Lee, B. Mendoza, T. Nakajima,<br />
A. Robock, G. Stephens, T. Takemura <strong>and</strong> H.<br />
Zhang, 2013: Anthropogenic <strong>and</strong> Natural<br />
Radiative Forcing. In: Climate Change<br />
2013: The Physical Science Basis. Contribution<br />
<strong>of</strong> Working Group I to the Fifth Assessment<br />
Report <strong>of</strong> the Intergovernmental Panel<br />
on Climate Change; [Stocker, T.F., D. Qin,<br />
G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung,<br />
A. Nauels, Y. Xia, V. Bex <strong>and</strong> P.M.<br />
Midgley (eds.)]. Cambridge University<br />
Press, Cambridge, United Kingdom <strong>and</strong><br />
New York, NY, USA.<br />
[39] Climate Analytics; Why using 20-year Global<br />
Warming Potentials (GWPs) <strong>for</strong> emission<br />
targets is a very bad idea <strong>for</strong> climate policy<br />
– URL: https://climateanalytics.org/briefings/why-using-20-year-global-warmingpotentials-gwps-<strong>for</strong>-emission-targets-is-a-<br />
very-bad-idea-<strong>for</strong>-climate-policy/; Accessed:<br />
<strong>2022</strong>-04-28.<br />
[40] European Commission, Joint Research Centre,<br />
Institute <strong>for</strong> Environment <strong>and</strong> Sustainability;<br />
Supporting In<strong>for</strong>mation to the Characterisation<br />
Factors <strong>of</strong> the ILCD Recommended<br />
Life Cycle Impact Assessment<br />
Methods, 2013; DOI: 10.2788/60825,<br />
ISBN: 978-92-79-22727-1.<br />
[41] Hertwich, E.G.; Mateles, S.F.; Pease, W.S.;<br />
McKone, T.E.; An Update <strong>of</strong> the Human Toxicity<br />
Potential with Special Consideration <strong>of</strong><br />
Conventional Air Pollutants, 2006, ISSN<br />
1504-3681, URL - https://www.ntnu.no/c/<br />
document_library/get_<br />
file?uuid=a76b6602-6052-4a03-a48de1d274223eee&groupId=10370;<br />
Accessed;<br />
<strong>2022</strong>-05-18.<br />
l<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 43
<strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong><br />
14 <strong>and</strong> 15 September <strong>2022</strong><br />
Antwerp | Radisson Blu Hotel | Belgium<br />
Dear Ladies <strong>and</strong> Gentlemen,<br />
Despite geopolitical <strong>and</strong> business challenges, it is with pleasure<br />
that we would like to cordially invite you to the “<strong>vgbe</strong> Congress<br />
<strong>2022</strong>” in the beautiful port city <strong>of</strong> Antwerp.<br />
The issues <strong>and</strong> challenges <strong>for</strong> the <strong>energy</strong> sector have not declined<br />
this year. Russia’s invasion into Ukraine has made it more<br />
than clear that a secure, af<strong>for</strong>dable <strong>and</strong> sustainable <strong>energy</strong> supply<br />
is one <strong>of</strong> the core pillars <strong>of</strong> our society <strong>and</strong> <strong>of</strong> our economy.<br />
In recent years, the aspect <strong>of</strong> sustainability/climate protection<br />
had become the dominant factor in <strong>energy</strong> policy <strong>for</strong> good reasons,<br />
while economic af<strong>for</strong>dability seemed within reach <strong>and</strong> security<br />
<strong>of</strong> supply was postulated as a given. In many countries<br />
natural gas was the fuel <strong>of</strong> choice to balance the fluctuating renewables<br />
<strong>and</strong> to pave the way to a green hydrogen economy.<br />
The increasing <strong>energy</strong> dependency on Russia <strong>for</strong> Europe was accepted<br />
because the availability <strong>of</strong> cheap natural gas from Russia<br />
<strong>and</strong> reliability <strong>of</strong> its supply was not challenged. Latest in March<br />
<strong>of</strong> this year we had all to learn the hard way that we made some<br />
wrong assumptions.<br />
On the opening day, we want to discuss with high-ranking<br />
guests whether European policy has set the right framework<br />
conditions to enable the necessary investments in the <strong>energy</strong><br />
system <strong>of</strong> the future. The challenges <strong>for</strong> this are enormous.<br />
What is needed is an increased expansion <strong>of</strong> renewables in<br />
power generation, whereby existing barriers in the area <strong>of</strong> approval<br />
procedures should be reduced <strong>and</strong> the market design<br />
optimized. Furthermore, an expansion <strong>of</strong> the necessary additional<br />
infrastructure in the area <strong>of</strong> <strong>energy</strong> storage <strong>and</strong> grids <strong>for</strong><br />
gas, hydrogen <strong>and</strong> electricity is required.<br />
Until this <strong>energy</strong> system <strong>of</strong> the future is in place <strong>and</strong> can provide<br />
a secure <strong>and</strong> independent supply <strong>of</strong> electricity <strong>and</strong> heat, we need<br />
to discuss again, how we want to provide dispatchable capacity<br />
<strong>and</strong> balance the renewables. We still have several options <strong>for</strong><br />
this, but we need to choose one, or a mix <strong>of</strong> some <strong>of</strong> the options.<br />
What we cannot do, is pretending that we are already in the future<br />
<strong>and</strong> have already available green gases <strong>and</strong> other dispatchable<br />
renewable technologies. In this context, complex issues have<br />
to be clarified in terms <strong>of</strong> technology, af<strong>for</strong>dability, climate protection<br />
<strong>and</strong> licensing law. It is up to policy makers to decide on<br />
the necessary measures. And we as an operators’ association are<br />
called upon to evaluate the technical options we have <strong>and</strong> support<br />
our member companies in implementing them.<br />
In the technical part <strong>of</strong> the congress, we want to concentrate on<br />
the issues surrounding the topics <strong>of</strong> market <strong>and</strong> regulation,<br />
decarbonization, renewables <strong>and</strong> <strong>energy</strong> storage <strong>and</strong> repurposing<br />
<strong>of</strong> conventional generation sites with actual contributions<br />
<strong>and</strong> discussions in four sessions.<br />
Networking, which we all missed so painfully during the recent<br />
Corona years, will also not be neglected between the sections<br />
<strong>and</strong> on the two evening events.<br />
We would be delighted to welcome you as our guests in the<br />
appealing city <strong>of</strong> Antwerp.<br />
be energised, be inspired, be connected, be in<strong>for</strong>med<br />
With energetic greetings<br />
Dr Georg Stamatelopoulos<br />
Dr Oliver Then<br />
Online Registration<br />
https://register.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/90122/<br />
Contacts<br />
Ms Ines Moors | t +49 201 8128-222<br />
Ms Angela Langen | t +49 201 8128-310<br />
e <strong>vgbe</strong>-congress@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
<strong>vgbe</strong> Congress programme<br />
Subject to change<br />
Conference language: English<br />
without simultaneous translation<br />
TUESDAY, 13 SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />
Approx.<br />
18:00 to<br />
21:00<br />
Get together in the Radisson Blu Hotel<br />
WEDNESDAY, 14 SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />
Moderation <strong>of</strong> the Plenary Day<br />
Sonja van Renssen<br />
Opening <strong>of</strong> the Congress<br />
10:00 Opening speech<br />
Dr Georgios Stamatelopoulos,<br />
Chairman <strong>of</strong> the Board <strong>of</strong> Directors, <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
10:25 Welcome address<br />
Jacques V<strong>and</strong>ermeiren, CEO Port <strong>of</strong> Antwerp (tbc)<br />
10:45 Honours<br />
• Innovation Award <strong>2022</strong><br />
• Health & Safety Award <strong>2022</strong><br />
WEDNESDAY, 14 SEPTEMBER <strong>2022</strong> (CONT.)<br />
Plenary Session –<br />
“ Can we achieve security <strong>of</strong> supply <strong>and</strong> decarbonization<br />
with the existing regulation?”<br />
Moderation: Sonja van Renssen<br />
14:00<br />
P1<br />
14:15<br />
P2<br />
14:30<br />
P3<br />
14:45<br />
P4<br />
Andreas Ehrenmann, ENGIE<br />
Didier Van Osselaer, Port <strong>of</strong> Antwerp-Bruges<br />
Kristian Ruby, eurelectric<br />
JJorgo Chatzimarkakis, Hydrogen Europe (tbc)<br />
15:00 Panel discussion<br />
Speakers P1-P4,<br />
Dr Georgios Stamatelopoulos <strong>and</strong><br />
Gerrit Jan Schaeffer<br />
16:00 End<br />
11:00 Report <strong>vgbe</strong> activities (<strong>vgbe</strong> 2025 & <strong>vgbe</strong> 100)<br />
Dr Oliver Then<br />
11:30 Key Note Speech – Energy transition <strong>and</strong><br />
security <strong>of</strong> supply in Europe<br />
Gerrit Jan Schaeffer, General Manager EnergyVille<br />
12:30 Lunch Break<br />
16:30 General Assembly <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
17:30 Guided tour Chocolate Nation Museum<br />
(duration approx. 60 min.)<br />
19:00 Evening event in the Chocolate Nation Museum<br />
kindly supported by<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
Deilbachtal 173<br />
45257 Essen<br />
Germany<br />
be in<strong>for</strong>med<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
<strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong><br />
14 <strong>and</strong> 15 September <strong>2022</strong><br />
Antwerp | Radisson Blu Hotel | Belgium<br />
THURSDAY, 15 SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />
Moderation<br />
Sonja van Renssen<br />
Session A | Market & Regulation<br />
09:00<br />
A1<br />
Results <strong>of</strong> the <strong>vgbe</strong> study “Security <strong>of</strong> supply 2025”<br />
N.N., Fraunh<strong>of</strong>er IEE / <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong><br />
THURSDAY, 15 SEPTEMBER <strong>2022</strong> (CONT.)<br />
Session C | Renewables & <strong>Storage</strong><br />
13:00<br />
C1<br />
Hydropower <strong>and</strong> taxonomy – Level playing field<br />
<strong>for</strong> renewables or imbalance?<br />
Martin Schönberg,<br />
VUM Verfahren Umwelt Management GmbH, Austria<br />
09:30<br />
A2<br />
10:00<br />
A3<br />
10:30 Break<br />
What does H2-ready mean<br />
<strong>for</strong> power plant industry?<br />
Dr Jens Reich, STEAG Energy Services GmbH, Germany<br />
The competition between <strong>energy</strong> storage plants<br />
<strong>and</strong> gas peakers<br />
Patrick Clerens, EASE (European Association <strong>for</strong> <strong>Storage</strong><br />
<strong>of</strong> Energy), Secretary General, Belgium<br />
Session B | Decarbonisation<br />
11:00<br />
B1<br />
11:10<br />
B2<br />
provides c<strong>of</strong>fee<br />
<strong>and</strong> cold drinks during breaks.<br />
MHI’s HydaptiveTM Concept <strong>for</strong> decarbonised power<br />
generation <strong>and</strong> <strong>energy</strong> storage.<br />
The US example<br />
Dr Michalis Agraniotis,<br />
Mitsubishi Power Europe, Germany<br />
Haru Oni efuels – from vision to reality<br />
Rolf Schumacher, HIF (Highly Innovative Fuels), Chile, <strong>and</strong><br />
Alex<strong>and</strong>er Tremel, Siemens, Germany<br />
13:10<br />
C2<br />
13:20<br />
C3<br />
Hybrid solutions in the field <strong>of</strong> hydropower<br />
Serdar Kadam, Andritz Hydro, Austria<br />
CEOG: 24/7 power supply with PV, hydrogen<br />
<strong>and</strong> fuel cell<br />
Mario Hüffer, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG,<br />
Germany<br />
13:30 Discussion<br />
14:00 Break<br />
Session D | Repurposing<br />
14:30<br />
D1<br />
14:40<br />
D2<br />
14:50<br />
D3<br />
Repurposing overview from RECPP to other projects<br />
Dr Thomas Eck, <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V., Germany<br />
Vantaan Energia boiler conversion from fossil to<br />
biomass fuels boosted with digital service solution<br />
Vesa Jokelainen <strong>and</strong> Ilkka Koskinen,<br />
Sumitomo SHI FW, Finl<strong>and</strong><br />
Technical Program hydrogen: Together on<br />
the way to a safe qualification <strong>of</strong> materials<br />
<strong>for</strong> the hydrogen industry<br />
Barbara Waldmann, RWE Power AG, Germany<br />
11:20<br />
B3<br />
Challenge Energy Transition – How to meet your<br />
utility dem<strong>and</strong> in a secure & climate friendly way<br />
Martin Damerius, Uniper, Germany<br />
11:30 Discussion<br />
12:00 Break<br />
15:00 Discussion<br />
15:30 Wrap-up <strong>and</strong> Fare well<br />
Sonja van Renssen <strong>and</strong> Oliver Then<br />
15:40 End<br />
Online Registration<br />
https://register.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/90122/<br />
Contacts<br />
Ms Ines Moors | t +49 201 8128-222<br />
Ms Angela Langen | t +49 201 8128-310<br />
e <strong>vgbe</strong>-congress@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
GET-TOGETHER<br />
TUESDAY, 13 SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />
On Tuesday 13 September <strong>2022</strong> all participants are invited to join<br />
the get-together in the Radisson Blu Astrid Hotel.<br />
i 18:00 to 21:00 – Room Aurora & The Diamond<br />
PRACTICAL INFORMATION<br />
VENUE<br />
Radisson Blu Astrid Hotel, Antwerp<br />
Koningin Astridplein 7B<br />
2018 Antwerpen, Belgium<br />
t +32 3 203 12 34<br />
w https://t1p.de/g7r1x (shortlink)<br />
REGISTRATION<br />
Please register online at:<br />
w https://register.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/90122/<br />
Registration is possible until the day <strong>of</strong> the event.<br />
The list <strong>of</strong> participants will be made available online.<br />
SIDE PROGRAMME<br />
WEDNESDAY, 14 SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />
On Wednesday 14 September <strong>2022</strong> all participants have the opportunity<br />
to take part in a guided tour in the Chocolate Nation<br />
Museum in which later the evening event will also take place.<br />
i Start 17:30 – Duration approx. one hour.<br />
EVENING EVENT<br />
WEDNESDAY, 14 SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />
On 14 September <strong>2022</strong> engie <strong>and</strong> <strong>vgbe</strong> invite all participants to<br />
an evening event in the Chocolate Nation right next to the Radisson<br />
Blu Astrid Hotel.<br />
i Chocolate Nation – 19:00 to 23:00<br />
Further in<strong>for</strong>mation see<br />
w https://www.chocolatenation.be/en<br />
Contact:<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
Ms Ines Moors<br />
Deilbachtal 173<br />
45257 Essen, Germany<br />
t +49 201 8128-222<br />
e <strong>vgbe</strong>-congress@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
CONDITIONS OF PARTICIPATION<br />
The participant fees <strong>for</strong> the <strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong><br />
are as follows (incl. VAT, 21 %):<br />
| <strong>vgbe</strong>-Members 1,190.00 €<br />
| Non-Members 1,690.00 €<br />
| University, public authorities, retired 690.00 €<br />
Students can obtain a free ticket <strong>for</strong> the entire lecture event upon<br />
presentation <strong>of</strong> a student ID (scientific staff excluded).<br />
VGBE CONGRESS <strong>2022</strong> WEBSITE<br />
w https://t1p.de/<strong>vgbe</strong><strong>2022</strong>c<br />
PRIVACY POLICY & GENERAL TERMS<br />
More details are available on the <strong>vgbe</strong>* website at<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/en/conditions-<strong>of</strong>-participation-privacy-policy<br />
* <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> has been the new br<strong>and</strong> identity <strong>of</strong> VGB PowerTech<br />
since September 2021 <strong>and</strong> the new name <strong>of</strong> the association since<br />
April <strong>2022</strong>.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
Deilbachtal 173<br />
45257 Essen<br />
Germany<br />
be in<strong>for</strong>med<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
Wasserst<strong>of</strong>fbasierte Hybridlösungen<br />
für die Energieerzeugung und<br />
Energiespeicherung<br />
Jürgen Wilkening und Jochen Lorz<br />
Abstract<br />
Hydrogen-based hybrid solutions <strong>for</strong><br />
power generation <strong>and</strong> <strong>energy</strong> storage<br />
Renewable technologies are on the rise. As<br />
volatile <strong>energy</strong> generators, they are subject to<br />
constant, high-gradient fluctuations <strong>and</strong> are<br />
not available at all times. <strong>Storage</strong> technologies<br />
are now a common way to temporarily store<br />
electricity in order to buffer volatile generation<br />
patterns <strong>and</strong> absorb peak consumption. Hydrogen<br />
can serve as a storage medium <strong>for</strong> <strong>energy</strong><br />
generation, but it is a carrier medium <strong>and</strong><br />
must there<strong>for</strong>e be produced by electrolysis or<br />
other synthesis processes from other raw materials.<br />
From today’s perspective, it can be shown<br />
that the <strong>energy</strong> mix <strong>of</strong> the future can be increasingly<br />
generated in a decentralised manner,<br />
despite the volatility <strong>of</strong> generation plants<br />
<strong>and</strong> fluctuations in <strong>of</strong>ftake. For this, the plants<br />
Autoren<br />
Dipl.-Ing. Jürgen Wilkening<br />
INP Deutschl<strong>and</strong> GmbH<br />
Römerberg, Deutschl<strong>and</strong><br />
Dr.-Ing. Jochen Lorz<br />
HEITEC Innovations GmbH<br />
Erlangen, Deutschl<strong>and</strong><br />
Vortrag gehalten auf dem<br />
53. Kraftwerkstechnischen<br />
Kolloquium, Dresden,<br />
5. und 6. Oktober 2021.<br />
Mit freundlicher Genehmigung<br />
der Autoren und Veranstalter.<br />
Insbesondere in Zentraleuropa wächst seit<br />
vielen Jahren die Erkenntnis, dass die Ausnutzung<br />
fossiler und nuklearer Brennst<strong>of</strong>fe<br />
einen erheblichen Einfluss auf Klima und<br />
Umwelt haben, sodass nach Lösungen gesucht<br />
wird, wie eine umweltverträgliche<br />
Energieversorgung der Zukunft aussehen<br />
könnte.<br />
Regenerative Technologien sind auf dem<br />
Vormarsch, aber volatile Energieerzeuger,<br />
wie Windkraft und Photovoltaik, unterliegen<br />
ständigen, hochgradienten Schwankungen<br />
und sind nicht jederzeit verfügbar. Speichertechnologien,<br />
insbesondere Batteriespeicher<br />
sind mittlerweile eine gängige<br />
Möglichkeit, Strom zwischenzuspeichern,<br />
um die volatilen Erzeugungsverläufe zu puffern<br />
und Spitzenverbräuche abzufangen.<br />
Sie bieten durch Einsatz verschiedener<br />
Technologien Möglichkeiten, den unterschiedlichen<br />
Lastan<strong>for</strong>derungen gerecht zu<br />
werden.<br />
Mit Blick auf die Wärmespeicherung gibt es<br />
einige zukunftsweisende Technologien. Viele<br />
davon befinden sich aber noch in der Entwicklungs-<br />
oder Forschungsphase.<br />
Sowohl Strom-, als auch Wärmespeichern<br />
ist eine Eigenschaft gemeinsam: Sie können<br />
die gespeicherte Energie nur eine begrenzte<br />
Zeit vorhalten. Glaubt man den Medien und<br />
den In<strong>for</strong>mationen, die in der Öffentlichkeit<br />
kursieren, haben wir in Deutschl<strong>and</strong> und<br />
Zentraleuropa genug regenerative Energiequellen,<br />
um unsere stabile Energieversorgung<br />
allein damit zu betreiben. Aber ist das<br />
so?<br />
Vernachlässigen wir einmal, dass auch<br />
Windkraft und Photovoltaik ökologischen<br />
Einfluss auf die Umwelt haben, kann man<br />
diese Aussage rechnerisch erstmal so stehen<br />
lassen, wohl wissend, dass wir weit davon<br />
entfernt sind, unsere Gigawatt an Strom aus<br />
Wind und Sonnenlicht zu generieren. Denn<br />
erstens gibt es hier erhebliche Platz- und Genehmigungsprobleme,<br />
zweitens sind diese<br />
Energieerzeuger leider nicht stetig und somust<br />
be able to cope with a variety <strong>of</strong> possible<br />
load <strong>and</strong> generation states, <strong>for</strong> which hybrid<br />
plants appear to be particularly suitable. A<br />
groundbreaking productivity lever prior to the<br />
plant construction <strong>of</strong> a complex hybrid power<br />
plant is the s<strong>of</strong>tware-based support <strong>of</strong> the engineering<br />
processes through virtual models <strong>of</strong><br />
plant systems, <strong>energy</strong> applications <strong>and</strong> material<br />
flows. With the help <strong>of</strong> the digital twin <strong>and</strong><br />
process validation, <strong>energy</strong> concepts are tested,<br />
both in their functionality <strong>and</strong> in their time<br />
behaviour, <strong>and</strong> process sequences are optimised<br />
even be<strong>for</strong>e realisation. <br />
l<br />
1 Energieversorgung im<br />
W<strong>and</strong>el<br />
Unsere gewohnte und stabile, zentrale Energieversorgung<br />
über Großkraftwerke, die<br />
fossile und nukleare Energiequellen nutzen,<br />
ist über viele Jahrzehnte kontinuierlich gewachsen.<br />
Die Groß- und Kleinverbraucher<br />
sind an die stabile und zuverlässige Versorgung<br />
aus den öffentlichen Stromnetzen gewohnt<br />
und verlassen sich vielerorts auf<br />
die ständige Verfügbarkeit von Strom und<br />
Wärme.<br />
In <strong>and</strong>eren Regionen der Welt ist das häufig<br />
nicht der Fall. In Regionen in denen Stromausfälle<br />
über Stunden und nicht selten Tage<br />
üblich sind, haben sich die Menschen und<br />
Industrien darauf eingerichtet, die er<strong>for</strong>derliche<br />
Versorgungssicherheit selbst durch geeignete,<br />
dezentrale Energieerzeugung und<br />
lokale Energiezentralen herzustellen.<br />
Die eingesetzten Energieerzeuger richten<br />
sich dabei in der Regel nach den lokal verfügbaren<br />
Energieträgern, geologischen Gegebenheiten<br />
und den vorh<strong>and</strong>enen Technologien.<br />
Sie folgen jedoch stets den Gesichtspunkten<br />
der Wirtschaftlichkeit einer<br />
Investition und den damit verbundenen Betriebskosten.<br />
Dadurch hatten bisher Aspekte<br />
der Wirtschaftlichkeit und der Verfügbarkeit<br />
üblicherweise einen höheren Stellenwert,<br />
als die der Umweltverträglichkeit.<br />
48 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong>
Wasserst<strong>of</strong>fbasierte Hybridlösungen<br />
mit planbar zu nutzen und drittens wird die<br />
Wärmeversorgung gerne dabei vergessen.<br />
Eines aber ist allen klar. Eine Energieversorgung<br />
der Zukunft muss mit einem ökologisch<br />
vertretbaren Erzeugungskonzept einhergehen.<br />
Die wesentlichen Farben der Wassers<strong>of</strong>fgewinnung<br />
Grau<br />
Elektrolyse mit fossilen Energieträgern<br />
Re<strong>for</strong>mierung von Erdgas<br />
CO2-<br />
Bilanz<br />
2 Wasserst<strong>of</strong>f als<br />
Energieträger der Zukunft<br />
Blau<br />
Re<strong>for</strong>mierung von Erdgas mit CCS-Ergänzung<br />
Derzeit wird vielerorts ein Energieträger<br />
propagiert, der in den Medien immer wieder<br />
als die Lösung aller Probleme dargestellt<br />
wird.<br />
Dass Wasserst<strong>of</strong>f zur Energieerzeugung dienen<br />
kann, ist keine neue Erkenntnis. Wasserst<strong>of</strong>f<br />
verbrennt quasi rückst<strong>and</strong>sfrei zu<br />
Wasser und kann aus dem Rohst<strong>of</strong>f Wasser<br />
in beliebiger Menge erzeugt werden.<br />
Türkis<br />
Methanpyrolyse<br />
Re<strong>for</strong>mierung von Biogas<br />
Grün<br />
Vergasung und Vergärung von Biomasse<br />
Elektrolyse durch regenerative Energie<br />
Bild 1. Wasserst<strong>of</strong>f Farbenlehre.<br />
Was bei dieser Betrachtung aber völlig außer<br />
Acht gelassen wird, ist die Tatsache,<br />
dass Wasserst<strong>of</strong>f nur ein Trägermedium darstellt.<br />
Da Wasserst<strong>of</strong>f in ungebundener Form<br />
so gut wie nicht in der Natur vorkommt,<br />
muss der Energieträger Wasserst<strong>of</strong>f erst<br />
durch Elektrolyse aus Wasser oder durch <strong>and</strong>ere<br />
Syntheseverfahren aus <strong>and</strong>eren Rohst<strong>of</strong>fen,<br />
wie Gasen erzeugt werden.<br />
Was bedeutet das? Alle Energie, die durch<br />
Wasserst<strong>of</strong>f zur Verfügung gestellt werden<br />
kann, muss vorher durch Elektrolyse oder<br />
Synthese aus <strong>and</strong>eren Medien unter Zugabe<br />
von eben dieser Energie in das Medium Wasserst<strong>of</strong>f<br />
eingebracht werden. Berücksichtigt<br />
man nun, dass bei jedem Umw<strong>and</strong>lungsprozess<br />
stets auch Verluste auftreten, muss also<br />
mehr Energie in die Erzeugung von Wasserst<strong>of</strong>f<br />
gegeben werden, als man aus dem Wasserst<strong>of</strong>f<br />
später wieder entnehmen kann.<br />
Allein in dieser Tatsache zeigt sich schon das<br />
Dilemma:<br />
Wirtschaftlich kann das Thema Wasserst<strong>of</strong>f<br />
nur angegangen werden, wenn der Bezugspreis<br />
von Strom und Rohst<strong>of</strong>fen geringer ist,<br />
als die am Ende der Verarbeitungskette aus<br />
Wasserst<strong>of</strong>f rückerzeugte Energie einbringt.<br />
Eine kleine Verbesserung dieser Bilanz kann<br />
dadurch erreicht werden, dass der Wärmeertrag<br />
bei der Umw<strong>and</strong>lung des Wasserst<strong>of</strong>fs<br />
ebenfalls genutzt wird. An dem grundsätzlichen<br />
Vorzeichen der Energiebilanz<br />
ändert sich dadurch aber nichts. Wassers<strong>of</strong>f<br />
stellt also keinen Primärenergieträger dar,<br />
sondern gleicht seitens der Energiebilanz<br />
eher einem Speichermedium.<br />
Dass Wasserst<strong>of</strong>f nicht gleich Wasserst<strong>of</strong>f<br />
ist, erkennt man relativ schnell anh<strong>and</strong> der<br />
Klassifizierung nach der Erzeugungsart.<br />
Hier hat man sich in den letzten Jahren auf<br />
eine Farbenlehre verständigt (B i l d 1 ).<br />
Wünschenswert ist natürlich ein möglichst<br />
großer Anteil an grünem Wasserst<strong>of</strong>f. Dabei<br />
stellen allerdings die Gestehungskosten<br />
von grünem Wasserst<strong>of</strong>f eine zusätzliche,<br />
große Hürde dar. Waren die Kosten<br />
für blauen oder grauen Wasserst<strong>of</strong>f aus Erdgas<br />
schon hoch, um Wasserst<strong>of</strong>f für die Infrastruktur<br />
oder die Energieindustrie zu verwenden,<br />
sind die jungen und grünen Technologien<br />
von Hause aus noch kostenintensiver.<br />
Die zusätzlichen Kosten für eine Umw<strong>and</strong>lung<br />
in Wasserst<strong>of</strong>f machen die Kostenbilanz<br />
nicht besser. Schon daraus lässt sich der<br />
ideale Anwendungsfall für eine Wasserst<strong>of</strong>ferzeugung<br />
ableiten. Wasserst<strong>of</strong>f wird immer<br />
dann interessant, wenn man Energiebedarf<br />
und Energieerzeugung nicht synchron<br />
in Einklang bringen kann. In dem Fall kann<br />
bisher ungenutzte, aber erzeugte Energie zu<br />
minimalen Bezugskosten für eine Wasserst<strong>of</strong>ferzeugung<br />
zeitlich unabhängig genutzt<br />
werden. In die Kostenbilanz fallen dann nur<br />
die Investitions- und Betriebskosten der<br />
Wasserst<strong>of</strong>ferzeugung. Dem gegenüber stehen<br />
dann die Einsparungen durch Nutzung<br />
von Wasserst<strong>of</strong>f zu <strong>and</strong>eren Zeiten. Die ökologische<br />
Bilanz wird dadurch positiv beeinflusst.<br />
Durch die flexible Nutzung von ohnehin<br />
erzeugter Energie, lassen sich Verluste<br />
minimieren und Netze stabilisieren, sodass<br />
eine bessere Ausnutzung von bestehenden<br />
Kapazitäten geschaffen werden kann.<br />
Speichertechnologieen<br />
Wärmespeicher Stromspeicher Elektrolyse<br />
Externer Netzbezug<br />
Externer<br />
Wärmebezug<br />
Externer<br />
Strombezug<br />
Lokales<br />
Stromnetz<br />
Energie<br />
Management<br />
System<br />
Verbraucher<br />
Bild 2. Zentrales Energiemanagement System EMS.<br />
Dies hat die Politik längst als öffentlichkeitswirksam<br />
erkannt. Es werden seitens der zuständigen<br />
Gremien in Bund und Ländern<br />
Förderprogramme aufgerufen, die den grünen<br />
Wasserst<strong>of</strong>f fördern und Anreize zur<br />
Investition schaffen sollen.<br />
Will man über die Wirtschaftlichkeit von<br />
Wasserst<strong>of</strong>f eine Entscheidung treffen, muss<br />
von Fall zu Fall nach den Kriterien des<br />
Rohst<strong>of</strong>f- und Energiebezugs, der zeitlichen<br />
Verfügbarkeit und dem Anwendungsund<br />
Nutzungsfall entschieden werden.<br />
Eine pauschale Aussage dazu ist kaum möglich.<br />
3 Hybride Lösungen<br />
Aus heutiger Sicht lässt sich zeigen, dass der<br />
Energiemix der Zukunft trotz der Volatilität<br />
der Erzeugungsanlagen und der Schwankungen<br />
in der Abnahme vermehrt dezentral<br />
erzeugt werden kann. Die Anlagen müssen<br />
hierfür eine Vielzahl an möglichen Last- und<br />
Erzeugungszuständen beherrschen. Sie<br />
müssen in der Lage sein, aus dem bestehenden<br />
Angebot an regenerativen Energien und<br />
den jeweils vorherrschenden Bezugskosten-<br />
Lokales<br />
Wärmenetz<br />
Erzeugungstechnologieen<br />
Wasserst<strong>of</strong>fspeicher<br />
Brennst<strong>of</strong>fzellen<br />
Lokale<br />
Wärmeerzeuger<br />
Lokale<br />
Stromerzeuger<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 49
Wasserst<strong>of</strong>fbasierte Hybridlösungen<br />
niveaus möglichst optimale Ausnutzung bei<br />
minimalen Verlusten zu gewährleisten.<br />
Eine schwierige Aufgabe, die häufig nicht<br />
nur auf die aktuelle Situation angepasst sein<br />
muss, sondern auch zuverlässige Prognosen<br />
für die wesentlichen Last- und Produktionsverläufe<br />
vorhersagen können muss.<br />
Ein solches Lastmanagement (B i l d 2 ) er<strong>for</strong>dert<br />
genaue Kenntnisse der Lastverläufe<br />
und Kennzahlen der versorgten Strom- und<br />
Wärmenetze, sowie genaue Kennzahlen und<br />
Daten der Erzeugungskomponenten und Verbraucher.<br />
Dazu ist die Möglichkeit er<strong>for</strong>derlich,<br />
automatisiert in die Erzeugung und die<br />
Steuerung von zeitunkritischen Verbräuchen<br />
einzugreifen, zu unterbrechen, zu verschieben,<br />
Lasten in den Netzen umzuverteilen und<br />
An<strong>for</strong>derungen selbstständig auszuregeln.<br />
Des Weiteren er<strong>for</strong>dert ein solches Konzept<br />
eine große B<strong>and</strong>breite an Erzeugungs- und<br />
Speicherkomponenten, um flexibel auf<br />
möglichst viele Einflussgrößen gleichzeitig<br />
reagieren zu können.<br />
Jede Komponente bietet unterschiedliche<br />
Möglichkeiten bezüglich des zeitlichen Verlaufs,<br />
der Laständerungsgradienten, der Erzeugungskapazität,<br />
der Speicherkapazität<br />
usw.<br />
Auch sind Kombinationseigenschaften<br />
wichtige Größen, die den optimalen Einsatz<br />
der jeweiligen Komponente beeinflussen.<br />
Beispielsweise lassen rein elektrisch genutzte<br />
Brennst<strong>of</strong>fzellen mit einem Wirkungsgrad<br />
von bis zu 60 % [1] noch etwas zu wünschen<br />
übrig. Sie können bei gleichzeitiger<br />
Ausnutzung der erheblichen Abwärme aber<br />
auch Steigerungen in den Bereich von 90 %<br />
[2] erreichen.<br />
Je nach energetischem Zust<strong>and</strong> und Energiebedarf<br />
der eigenen Verbraucher und Netze<br />
kann somit der Einsatz von Brennst<strong>of</strong>fzellen<br />
sinnvoll oder unsinnig sein. Dabei spielen<br />
nicht nur direkte Faktoren, wie die<br />
Wirkungsgrade, Bezugs- oder Erzeugungskosten<br />
eine Rolle. Auch kann es Vorteile mit<br />
sich bringen, vorausschauend Speicherkapazitäten<br />
aufzubauen, wenn mit großen<br />
Energiespitzen zu rechnen ist, oder Kapazitäten<br />
zu schaffen, wenn mit günstigen Bezugspreisen<br />
zu rechnen ist.<br />
Eine bestimmte Betriebsart einer Hybridanlage<br />
kann also zum einen Zeitpunkt ungünstig<br />
sein, die gleiche Betriebsart zu einem<br />
<strong>and</strong>eren Zeitpunkt aber die betriebswirtschaftlichste<br />
Fahrweise darstellen. Es ist<br />
demzufolge sinnvoll, für eine hybride Energieanlage<br />
nicht nur eine Führungsgröße,<br />
wie den Stromverbrauch zu definieren, sondern<br />
auch Priorität auf die Wärmeversorgung<br />
zu legen. Hinzu kommen Faktoren, die<br />
den bestehenden und den gewünschten Ladezust<strong>and</strong><br />
von elektrischen Speichern und<br />
Gastanks berücksichtigen, sowie Bezugsoder<br />
Marktpreise.<br />
Ein häufiges Problem dezentraler Versorgungsanlagen<br />
ist die langfristige Verschiebung<br />
erzeugter Energie in Phasen, in denen<br />
ganztägig wenig Energie erzeugt werden<br />
kann. Strom kann in wirtschaftlich arbeitenden<br />
PtH(Power to <strong>Heat</strong>)-Anlagen hauptsächlich<br />
durch Einsatz von elektrischen<br />
Heizstäben genutzt werden, um zusätzlich<br />
Wärme in Form von Dampf oder Warmwasser<br />
zu erzeugen, wenn Stromüberschuss<br />
existiert. Umgekehrt ist die W<strong>and</strong>lung von<br />
überschüssiger niederkalorischer Wärme in<br />
Strom je nach Temperaturniveau durchaus<br />
anspruchsvoll. Dies weiter auszuführen<br />
würde den Rahmen dieses Artikels allerdings<br />
deutlich sprengen.<br />
Photovoltaik-Anlagen sind ein gutes Beispiel<br />
für die Notwendigkeit eines Zusammenspiels<br />
mehrerer Komponenten für eine stabile<br />
Energieversorgung.<br />
Diese Anlagen produzieren bei Sonneneinstrahlung<br />
in den Sommermonaten, bei<br />
hochstehender Sonne, nahezu ihre nominalen<br />
Auslegungswerte an Peak-Leistung. Diese<br />
schwächt sich bereits in den Nachmittagsund<br />
Abendstunden merklich ab, da der Einstrahlwinkel<br />
des Sonnenlichts und mögliche<br />
Überschattungen durch umgebende Strukturen<br />
bei flachen Einstrahlwinkeln erhebliche<br />
Einflüsse haben.<br />
Nachts erzeugen diese Anlagen naturgemäß<br />
keine Energie, es sind also Speicher oder alternative<br />
Erzeugungsanlagen er<strong>for</strong>derlich,<br />
damit auch nachts eine Stromversorgung<br />
sichergestellt werden kann. In den Wintermonaten<br />
erzeugen diese Anlagen nur wenig<br />
Energie, sodass hier alternative Energie<strong>for</strong>men<br />
genutzt werden müssen.<br />
Strom als kurzeitiges Speichermedium in<br />
Batterien zu puffern ist ein probates Mittel.<br />
Bei Langzeitspeichern scheitert dieses<br />
Konzept an dem er<strong>for</strong>derlichen Platzbedarf<br />
für große Batteriespeicher, den erheblichen<br />
Anschaffungskosten und, je nach<br />
Typ des Batteriespeichers, auch daran,<br />
dass die Mehrzahl der verfügbaren Batteriespeicher<br />
altert und Kapazität verliert, wenn<br />
die Ladung nicht kontinuierlich bewegt<br />
wird.<br />
PV<br />
(Module 1)<br />
Batterie<br />
(Module 1)<br />
E-Ladestation<br />
H2-Verteiler<br />
H2-Speicher<br />
350 bar<br />
LKW/Busse<br />
H2-Tankstelle<br />
Bild 3. Blockschaubild für eine Hybridanlage.<br />
Es bedarf also <strong>and</strong>erer Möglichkeiten, Energie<br />
aus den Sommermonaten möglichst<br />
langfristig zu speichern, um diese im Winter<br />
abrufen zu können. Man könnte das vergleichen<br />
mit einem Holz<strong>of</strong>en, für den im Sommer<br />
das Holz gesammelt wird, das im Winter<br />
zum Heizen verwendet werden soll.<br />
Im beschriebenen Beispiel bietet Wasserst<strong>of</strong>f<br />
einige interessante Aspekte. Je nach<br />
Art der Aufbereitung lässt sich Wasserst<strong>of</strong>f<br />
unter Druck oder in chemisch gebundener<br />
Form in Tanks einlagern und bei Bedarf<br />
wieder in elektrische Energie umw<strong>and</strong>eln.<br />
Was es dazu braucht ist z. B. eine Elektrolyseanlage,<br />
eine Tankanlage zur Wasserst<strong>of</strong>fspeicherung<br />
und eine Anzahl Brennst<strong>of</strong>fzellen<br />
zur Rückverstromung. Das es dabei anspruchsvolle<br />
R<strong>and</strong>bedingungen zu bewältigen<br />
gibt, wenn es um die Speicherung von<br />
Wasserst<strong>of</strong>f geht, wird seit Jahren diskutiert<br />
und er<strong>for</strong>scht. Dies weiter auszuführen würde<br />
hier den Rahmen sprengen.<br />
Letztlich muss bei einem Hybridkraftwerk<br />
jede Komponente mit jeder Komponente<br />
energetisch und kommunikativ vernetzt<br />
werden. Beim genannten Beispiel kann je<br />
nach verfügbarer Sonnenenergie die Leistung<br />
der Photovoltaik direkt dem Verbraucher,<br />
dem Batteriespeicher oder der Elektrolyseanlage<br />
zugeführt werden. Abwärme der<br />
Elektrolyse kann zusätzlich als Wärmequelle<br />
genutzt werden.<br />
Die Elektrolyse kann zusätzlich zum direkten<br />
Anschluss an die Photovoltaik auch über<br />
die Batteriespeicher betrieben werden und<br />
kann damit freie Kapazitäten zur Spitzenlastabdeckung<br />
aus Photovoltaikstrom generieren,<br />
ohne den eigenen Lastfluss ständig<br />
den Erzeugungskapazitäten anpassen zu<br />
müssen. Die Verbraucher können neben der<br />
direkten Versorgung durch die Photovoltaik<br />
insbesondere nachts über die Batteriespeicher<br />
betrieben werden. Zusätzlich kann bei<br />
Bedarf und Erzeugungsengpass über die<br />
Brennst<strong>of</strong>fzellen Strom und Wärme aus dem<br />
Wasserst<strong>of</strong>flager erzeugt werden.<br />
O2-Speicher<br />
Elektrolyse<br />
700 bar<br />
PKW<br />
LOHC<br />
Speicher<br />
(Module 3)<br />
LOHC<br />
Verladung<br />
Digitales<br />
Modell<br />
(Module 4)<br />
H2-Zentrum<br />
(Module 6)<br />
50 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Wasserst<strong>of</strong>fbasierte Hybridlösungen<br />
Bild 4. Digitaler Zwilling mit grafischer Echtzeitsimulation in der Produktionstechnik.<br />
Das B i l d 3 zeigt ein Blockschaubild für ein<br />
mögliches Hybridkraftwerk am Beispiel eines<br />
Kunden, für den die INP Deutschl<strong>and</strong><br />
GmbH gemeinsam mit der HEITEC Innovation<br />
GmbH ein solches Konzept auf den Weg<br />
gebracht haben.<br />
Das Ganze kann aber nur funktionieren,<br />
wenn die physikalischen und elektrischen<br />
Eigenschaften aller Komponenten bekannt<br />
sind und in einer zentralen Energiemanagementinstanz,<br />
dem EMS kontinuierlich im<br />
optimalen, vorausschauenden Lastbereich<br />
gehalten und geregelt werden.<br />
4 Digitale Datenmodelierung<br />
– Der digitale Zwilling<br />
Das Simulationskonzept Virtuelle Inbetriebnahme<br />
mit Digitalen Zwillingen ist eine verbreitete<br />
und gelebte Methode zur Validierung<br />
und Inbetrieb-setzung von Steuercode<br />
in den Bereichen Sondermaschinen- und<br />
Anlagenbau, sowie in der Logistik. Dabei<br />
werden reale Geräte und Programmierungen<br />
über Netzwerke und Signalverbindungen<br />
mit virtuellen Simulationsumgebungen<br />
verbunden, die in der Lage sind, Anlagenund<br />
Maschinenverhalten in Echtzeit zu<br />
emulieren. Häufig werden reale Steuerplatt<strong>for</strong>men<br />
und Leitrechnerarchitekturen über<br />
die realen, industriellen Feldbussysteme<br />
über virtuelle Peripherie mit einem virtuellen<br />
Maschinenmodell in verbunden und das<br />
Maschinenverhalten grafisch dargestellt.<br />
B i l d 4 zeigt zwei Zustände einer virtuellen<br />
Maschine, die grafisch dem Verhalten der<br />
echten Maschine gleichen.<br />
Beim digitalen Zwilling werden Prozessabläufe,<br />
Fehlerabläufe und die Anlagensicherheit<br />
getestet, bevor der nun ausgereifte<br />
Steuercode auf die realen Anlagen aufgespielt<br />
wird. Durch diese Art der gesamtheitlichen<br />
Validierung, wird ein schneller Anlagenanlauf,<br />
ein Testen von real nicht durchführbaren<br />
Störszenarien und somit eine<br />
Vermeidung etwaiger Havarien zu einer<br />
unkritischen Projektphase, vorbeugend abgenommen.<br />
Explizit zu erwähnen ist, dass<br />
diese Simulationsmodelle rein logisch fungieren.<br />
Das heißt, eine real physikalische<br />
Abbildung der Anlage findet nicht statt. Es<br />
werden die Steuerabläufe und Übertragungsprotokolle,<br />
sowie die Leitrechneranbindungen<br />
anh<strong>and</strong> des Maschinenmodelles<br />
mit integriertem Material- und St<strong>of</strong>ffluss<br />
validiert. Dies reicht hinreichend aus, um in<br />
der Sparte Automatisierungstechnik im Bereich<br />
Sondermaschinen- und Anlagenbau,<br />
eine erfolgreiche und äußerst effiziente Inbetriebnahme<br />
sicherzustellen. In der Gebäudeleittechnik<br />
werden diese Technologien<br />
aktuell nicht eingesetzt. Durchzunehmende<br />
Automation und Steuerung von Gebäudekomplexen,<br />
insbesondere mit dem Hintergrund<br />
einer komplexen und intelligenten<br />
CO 2 -neutralen Energieversorgung, ist der<br />
Einsatz dieser Validierungsmethoden, aufbauend<br />
auf der virtuellen Inbetriebnahme<br />
mit Digitalen Zwillingen unumgänglich.<br />
Biomasse<br />
Geothermie<br />
Wind,<br />
Freiflächen<br />
- Dach PV<br />
regenerativer<br />
Strom<br />
Netz<br />
Verteiler<br />
Ein wegweisender Produktivitätshebel vor<br />
der Anlagenerrichtung eines komplexen Hybridkraftwerkes<br />
ist die s<strong>of</strong>twarebasierte Unterstützung<br />
der Engineering-Prozesse durch<br />
virtuelle Modelle von Anlagensystemen,<br />
Energieapplikationen und St<strong>of</strong>fflüssen. Mit<br />
Hilfe des Digitalen Zwillings und der Prozessvalidierung,<br />
werden Energiekonzepte,<br />
sowohl in ihrer Funktionalität als auch in<br />
ihrem Zeitverhalten, getestet und Prozessabläufe<br />
schon vor der Realisierung optimiert.<br />
Der Digitale Zwilling bildet mit der realen<br />
Inbetriebnahme am virtuellen Modell alle<br />
gegenwärtigen und künftigen Betriebsabläufe<br />
in der entsprechenden Erzeugungsumgebung,<br />
wenn nötig, in Echtzeit ab und kann<br />
diese mit der originalen Leitsteuerarchitek-<br />
Stromversorung<br />
Batteriespeicher<br />
überschüssiger<br />
Grünstrom<br />
grüner Wasserst<strong>of</strong>f<br />
Die simulative Abbildung von hybriden<br />
Strukturen zur Bereitstellung von Strom,<br />
Wärme und Kälte aus technisch unterschiedlichen<br />
Energiesystemen (Erzeugung, Speicherung,<br />
Verbrauch), ist Ziel der Anwendung.<br />
Die Erfahrungen aus der firmeneigenen<br />
Modellbibliothek Digitale Fabrik schafft<br />
die Möglichkeit einen gesamtheitlichen<br />
Zwilling der jeweiligen Anwendungen im<br />
virtuellen Raum zu erstellen, um eine autarke<br />
Energieversorgung planen, sicherzustellen<br />
und optimieren zu können. Hierbei wird<br />
auf die Technologie Digitaler Zwilling aus<br />
der Automatisierungstechnik zurückgegriffen,<br />
welche durch die Kopplung mit elektrochemischen,<br />
elektro-physikalischen und<br />
elektro-thermischen Zwillingen zu einem<br />
gesamtheitlichen und vollwertigen Abbild<br />
der realen Anwendung im virtuellen Raum<br />
reift. Das hierdurch entstehende Simulationsmodell<br />
befähigt den Betreiber und den<br />
Anlagenbauer, die notwendigen Algorithmen<br />
für die Regelung des grünen Energie-Mixes,<br />
des entstehenden Hybridkraftwerkes,<br />
die Auswertung der Messdaten und<br />
die Integration der neuen Abläufe, Regler-<br />
Algorithmik und KI, in den Leitrechnerstrukturen<br />
vorab zu validieren. Dieses Vorgehen<br />
stellt kürzeste Übergangszeiten zur<br />
autarken Energieversorgung, sowie einen<br />
bereits von Anfang an optimierten Betrieb<br />
des komplexen Zusammenspiels der Anlagen<br />
dar.<br />
5 Zentrale Steuereinheit<br />
– Das Energiemanagementsystem<br />
EMS<br />
O<br />
ELY<br />
Bild 5. Lösungsansatz Wasserst<strong>of</strong>fbasiertes Hybridkraftwerk.<br />
HS<br />
H+<br />
L<br />
O<br />
H<br />
C<br />
H-<br />
F C<br />
U E<br />
E L<br />
L L<br />
W<br />
Ä<br />
R<br />
M<br />
E<br />
S<br />
P<br />
E<br />
I<br />
C<br />
H<br />
E<br />
R<br />
K<br />
Ä<br />
L<br />
T<br />
E<br />
Gebäude<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 51
Wasserst<strong>of</strong>fbasierte Hybridlösungen<br />
tur über eine sog. Virtuelle Maschine<br />
(HeiVM) ansprechen. Durch die Parallelisierung<br />
der Entwicklungsprozesse, wird die<br />
Projektlaufzeit signifikant minimiert. Die<br />
Inbetriebnahme, sowie das Testen von alternativen<br />
Lösungsmöglichkeiten wird iterativ<br />
am Digitalen Zwilling optimiert und anschließend<br />
in die Realität überführt. Zur<br />
Kopplung und Zusammenführung aller virtuellen<br />
Teilmodelle werden flexible Schnittstellen<br />
bereitgestellt. Diese Schnittstellen<br />
bilden die Grundlage für die gesamte Systemarchitektur<br />
des Digitalen Hybridkraftwerkes<br />
(B i l d 5 ) und verknüpft die Teilzwillinge<br />
aus den Gebieten der elektrischen, thermischen<br />
und chemischen Prozesse, sowie<br />
des logischen Zwillings mit der Kopplung zu<br />
den Leitsystemen und der gesamtheitlichen<br />
Netzsimulation.<br />
Um das wasserst<strong>of</strong>fbasierte Hybridkraftwerk<br />
in Bezug auf die bestimmten Spezifikationen<br />
bestmöglich zu betreiben, werden<br />
Algorithmen und Modelle für ein Lastmanagementsystem<br />
entwickelt. Dieses soll der<br />
optimalen Abstimmung zwischen verfügbarer<br />
Erzeugung, aktuellem Verbrauch und<br />
den Ladezuständen der Speicher dienen.<br />
Ebenfalls bieten sich die unterschiedlichen<br />
Technologien sowie die räumliche Aufteilung<br />
der Lasten als Grundlage für agentenbasierte<br />
Optimierungs- bzw. Regelungskonzepte<br />
an. Dabei sollen einerseits die prognoseseitigen<br />
Einflüsse auf die Optimierungen,<br />
<strong>and</strong>ererseits der dezentrale Charakter mit<br />
den unterschiedlichen Zeitkonstanten mit<br />
Machine-Learning-Algorithmen weiterentwickelt<br />
werden.<br />
6 Die Hürden auf dem Weg<br />
zum Projekt<br />
Nachdem die grundsätzliche Funktionsweise<br />
einer hybriden Energiezentrale beschrieben<br />
und die Eckdaten eines solchen Projektes<br />
festgelegt worden sind, besteht die Notwendigkeit<br />
der Auswahl der zum Einsatz<br />
kommenden Technologien.<br />
Dabei gilt es eine Menge an Kriterien zu beachten:<br />
1 Technische Kriterien<br />
––<br />
Welche technischen Schnittstellendaten<br />
passen am besten zu der gewählten Anlagenauslegung?<br />
––<br />
Ist die Technik bereits betriebsbewährt<br />
oder ist die Technologie noch im Entwicklungsstadium?<br />
––<br />
Lässt sich die Technologie auf größere<br />
Maßstäbe skalieren?<br />
––<br />
Lässt sich die Technologie für spätere Ausbaustufen<br />
modular erweitern?<br />
––<br />
Welche späteren Weiterentwicklungen<br />
sind geplant?<br />
2 Lieferung und Betrieb<br />
––<br />
Kann die Technologie in vertretbarem<br />
Zeitrahmen geliefert werden?<br />
––<br />
In welchem Zeitrahmen sind Ersatzteillieferungen<br />
möglich?<br />
––<br />
Wie häufig und in welchem Umfang ist ein<br />
Service er<strong>for</strong>derlich?<br />
––<br />
Welche Hilfsmedien sind für einen Betrieb<br />
er<strong>for</strong>derlich?<br />
3 Betriebswirtschaftliche Aspekte<br />
––<br />
Anschaffungskosten (KAPEX)<br />
––<br />
Baukosten, wie Fundamente und Stahlbau<br />
––<br />
Auswirkung auf das Genehmigungsverfahren,<br />
wie z.B. Explosionsschutz<br />
––<br />
Kosten und Kostenentwicklungsprognose<br />
der Bezugsmedien<br />
––<br />
Preise und Preisentwicklungsprognose<br />
von Abgabemedien<br />
––<br />
Vorhaltekosten für passive Zeiträume, wie<br />
Warmhaltung oder Kühlung<br />
Wirkungsgrade<br />
––<br />
In Frage kommende Förderprogramme<br />
(siehe auch folgende Absätze)<br />
––<br />
Bereitschaft der Lieferanten, sich an Förderprogrammen<br />
zu beteiligen<br />
––<br />
Investionskosten und Finanzierungsmodell<br />
––<br />
Betriebs- bzw. Betreibermodell<br />
Ein wesentlicher Aspekt bei der Auslegung<br />
einer Anlage ist die jeweilige Zielsetzung,<br />
die mit einer Anlage verbunden ist. Die hybride<br />
Anlage ist kein globaler Ersatz für alle<br />
Arten von Energieerzeugern.<br />
Die kommerzielle Nutzung geht sehr stark<br />
einher mit den jeweiligen Gegebenheiten.<br />
Dazu gehören Aspekte, wie die Nutzung von<br />
ohnehin vorh<strong>and</strong>enen Medien oder die Einspeisung<br />
von Medien in bestehende Systeme.<br />
Dabei ist nicht nur Strom und Wärme zu<br />
berücksichtigen, sondern auch Gase und<br />
flüssige Medien.<br />
Wer glaubt, dass eine Wasserst<strong>of</strong>f-Hybridanlage<br />
zur Erzeugung und Nutzung von grünem<br />
Wasserst<strong>of</strong>f per se eine lohnende Alternative<br />
zu herkömmlicher Technik darstellt,<br />
der irrt. Allein die Kosten für eine Erzeugung<br />
von Wasserst<strong>of</strong>f aus grünem Strom<br />
liegt noch immer bei einem ganzzahligen<br />
Vielfachen gegenüber der Erzeugung aus<br />
Erdgas oder <strong>and</strong>eren Energieträgern.<br />
Kommerziell interessant wird die Sache<br />
durch die sonstigen R<strong>and</strong>bedingungen, wie<br />
beispielsweise Bezugspreise von Überschussstrom,<br />
Nutzung von Abwärme der<br />
Elektrolyse, Nutzung des entstehenden Sauerst<strong>of</strong>fs<br />
bei der Elektrolyse, Nutzung des<br />
Wasserst<strong>of</strong>fs in nachgeschalteten Produktionsanlagen,<br />
usw.<br />
Diese Liste lässt sich noch beliebig erweitern.<br />
So kann beispielsweise eine Elektrolyseanlage<br />
dadurch interessant werden, dass<br />
ein Teil des erzeugten Wasserst<strong>of</strong>fs methanisiert<br />
(z.B. als Ersatz für Erdgas) oder ammonisiert<br />
(z.B. für die Herstellung von Düngemitteln)<br />
wird. Die betriebswirtschaftliche<br />
Bilanz wird dadurch erheblich zum positiven<br />
verschoben, wenn es entsprechende Abnahmen<br />
gibt. Eine Pauschallösung ist das<br />
aber nicht.<br />
In jüngster Zeit begünstigen die Entwicklungen<br />
in Zentraleuropa den Einsatz von Wasserst<strong>of</strong>f<br />
und hybriden Lösungen und die EU,<br />
die Bundesregierung und die L<strong>and</strong>esregierungen<br />
treffen entsprechende Vorkehrungen,<br />
diese Entwicklung mit Finanzspritzen<br />
zu unterstützen.<br />
Zum einen gut, denn das schafft Anreize, in<br />
dringend benötigte Konzepte und Technologien<br />
zu investieren. Zum <strong>and</strong>eren werden<br />
aber eben diese Förderungen in erster Linie<br />
auf die Entwicklung von neuen Technologien<br />
angewendet. Bereits bestehende Technik<br />
wird dabei häufig nicht berücksichtigt.<br />
Dies führt aber in letzter Instanz dazu, dass<br />
es eine Vielzahl an potenziellen Technologien<br />
gibt, die nach der grundsätzlichen Entwicklung<br />
nicht zu kommerziellen Maßstäben<br />
weiterentwickelt werden, da für Investoren<br />
die Anreize fehlen in eine nicht<br />
betriebsbewährte Technologie zu investieren.<br />
Eben diese Technologien sind aber ohne<br />
größere Umsetzungs- und Pilotprojekte<br />
nicht in der Lage, Betriebsbewährung zu erreichen.<br />
Entgegen der weitläufigen Meinungen ist<br />
die Technologie vielerorts bereits ausreichend<br />
entwickelt, um im großen Maßstab<br />
eingesetzt werden zu können. Sie scheitert<br />
aber an den Betriebs- oder Gestehungskosten<br />
gegenüber den günstigen fossilen Alternativen.<br />
Entsprechend schwierig ist der Vorteil<br />
solcher Projekte darzustellen, die nicht<br />
selten eine gehörige Portion Idealismus aller<br />
Beteiligter und von den Investoren er<strong>for</strong>dert.<br />
7 Die Umsetzung<br />
Die konsequente Modularisierung und das<br />
Zusammenspiel verschiedener Technologien<br />
und deren Regeltechnik bedingt ein tiefgreifendes<br />
Prozesswissen, welches in dem<br />
Projekt in individuelle Simulationsbibliotheken<br />
einfließt. Die bereitgestellten Simulationsmodule<br />
unterstützen eine technoökonomische<br />
Entwicklung, Umsetzung sowie<br />
Validierung des hybriden Kraftwerkes<br />
im virtuellen Raum. Das Modell ermöglich<br />
vor der Realisierung technische und wirtschaftliche<br />
Anpassung und schafft die Möglichkeit<br />
der Skalierung über Zeit und Investitionsmöglichkeiten.<br />
Bei unserem laufenden Musterprojekt haben<br />
wir frühzeitig auf eine modulare Projektstruktur,<br />
die Erweiterbarkeit der Anlage<br />
in Ausbaustufen und die Trennung von bewährter<br />
und Startup-Technologie geachtet.<br />
Die Anlage besteht aus einem großen, zusammenhängenden<br />
Areal das durch die innerkommunale<br />
Lage gut erschlossen und<br />
angebunden ist. Mit mehreren großen Hallenstrukturen<br />
und einem sehr stark schwankenden<br />
Lastverlauf (Grundlast / Spitzenlast<br />
1:10) ist die Anlage durchaus eine Heraus<strong>for</strong>derung<br />
für ein regeneratives Energiekonzept.<br />
Ein wesentlicher Aspekt war bei der Auslegung<br />
die Betrachtung der möglichst autar-<br />
52 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Wasserst<strong>of</strong>fbasierte Hybridlösungen<br />
ken Grundlastversorgung. In unserem Fall<br />
hat sich daher angeboten, die vorh<strong>and</strong>enen<br />
Flächen und Hallendächer möglichst sinnvoll<br />
für Photovoltaik-Anlagen zu nutzen und<br />
primär die so erzeugte Energie für die Eigenversorgung<br />
zu nutzen.<br />
Dabei stellten sich mehrere Fragen:<br />
––<br />
Woher kommt der Strom nachts?<br />
Woher kommt der Strom im Winter?<br />
Wie kann eine Sektorkopplung in das<br />
Wärmenetz insbesondere in der kalten<br />
Jahreszeit realisiert werden?<br />
Im Rahmen der Voruntersuchungen wurde<br />
schnell klar, dass eine Versorgung ausschließlich<br />
über Photovoltaik nicht ausreichend<br />
sein würde, um die Anlage ausschließlich<br />
aus dieser Quelle zu speisen. Wir<br />
haben demzufolge schon frühzeitig auf diversitäre<br />
Energieeingangsgrößen geachtet.<br />
Nur so kann sichergestellt werden, dass eine<br />
zeitliche und preisliche Abhängigkeit von<br />
Eingangsgrößen minimiert wird.<br />
Des Weiteren ist es unabdingbar, die zeitliche<br />
Entkopplung zwischen Erzeugung und<br />
Verbrauch durch zwischengeschaltete Speicher<br />
sicherzustellen. Stationäre Energiespeicher<br />
als Kurzzeitspeicher sind heute<br />
keine große Heraus<strong>for</strong>derung mehr, wenn<br />
man einmal von den An<strong>for</strong>derungen für<br />
Platz und Br<strong>and</strong>schutz absieht. Auch gibt es<br />
verschiedene Technologien neben den häufig<br />
eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien,<br />
wie beispielsweise NaS (Natrium-Schwefel)<br />
und Redox-Flow, die je nach er<strong>for</strong>derlichem<br />
Last- und Speicherverhalten genutzt<br />
werden können. Wir haben uns in diesem<br />
Projekt auf Second-Life-Batterien festgelegt,<br />
die aus ökologischen Aspekten<br />
die derzeit sinnvollste Variante darstellen,<br />
ohne zusätzliche Ressourcen zu <strong>for</strong>dern.<br />
Die Batteriespeicher können in den Sommermonaten<br />
überschüssigen Strom aus der<br />
Photovoltaik aufnehmen und können zusätzlich<br />
günstigen Bezugsstrom aus Windund<br />
<strong>and</strong>eren Überschüssen aus dem Netz<br />
aufnehmen.<br />
Damit die Batteriespeicherkapazität nicht<br />
unendlich vergrößert werden muss, haben<br />
wir zusätzlich vorgesehen, Strom auch für<br />
eine modular erweiterbare Elektrolyse zur<br />
Erzeugung von Wasserst<strong>of</strong>f nutzen zu können.<br />
Das bietet gleich mehrere Vorteile:<br />
Der Wasserst<strong>of</strong>f kann in entsprechenden<br />
Druckspeichern zwischengespeichert werden.<br />
Die dabei eingesetzten Technologien<br />
werden stetig verbessert. Die Diffusionsverluste<br />
von Wasserst<strong>of</strong>f und die Schwächung<br />
der Behältermaterialien sind bereits in akzeptablen<br />
Grenzen angekommen. Zum einen<br />
lässt sich der Wasserst<strong>of</strong>f als Ergänzung zum<br />
Batteriespeicher bei Bedarf über Brennst<strong>of</strong>fzellen<br />
wieder rückverstromen, zum <strong>and</strong>eren<br />
kann der Wasserst<strong>of</strong>f auch für <strong>and</strong>ere Anwendungen<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
In unserem Fall haben wir Möglichkeiten<br />
zur LKW-Betankung beim Zulieferverkehr<br />
und zur werksinternen Vertankung für Gabelstapler<br />
und <strong>and</strong>ere Flurfahrzeuge eingeplant.<br />
Wenn sich der Wasserst<strong>of</strong>fmarkt entwickelt<br />
hat, kann bedarfsweise auch Wassers<strong>of</strong>f<br />
von externen Quellen bezogen und<br />
genutzt werden.<br />
Ein weiterer Aspekt der Wasserst<strong>of</strong>fnutzung<br />
ist die bei der Umw<strong>and</strong>lung in Wasserst<strong>of</strong>f<br />
und bei der Rückverstromung entstehende<br />
Abwärme, die wiederum in das eigene<br />
Wärmenetz eingekoppelt und dort über<br />
Warmwasserspeicher vorgehalten werden<br />
kann.<br />
Ein entsprechendes Energiemanagementsystem<br />
(EMS) ist zum einen in der Lage, den<br />
Ladezust<strong>and</strong> der Batteriespeicher dem direkten<br />
Verbrauch und der erzeugten Strommenge<br />
anzupassen, und kann zum <strong>and</strong>eren<br />
vorausschauend freie Kapazitäten in den<br />
Batteriespeichern schaffen, indem elektrische<br />
Ladung in Wasserst<strong>of</strong>f umgew<strong>and</strong>elt<br />
wird.<br />
Vor allem in den Wintermonaten ist mit einem<br />
wesentlichen Beitrag zur Stromgewinnung<br />
durch Photovoltaik nicht zu rechnen.<br />
Batteriespeicher über Monate in geladenem<br />
Zust<strong>and</strong> vorzuhalten ist wenig effektiv, zumal<br />
die meisten Batteriespeicher Materialalterung<br />
erfahren, wenn sie nicht regelmäßig<br />
be- und entladen werden.<br />
Wasserst<strong>of</strong>f langfristig in Druckspeichern zu<br />
lagern ist aufgrund der Materialalterung der<br />
Tankstrukturen und der Diffusion des Wasserst<strong>of</strong>fs<br />
keine brauchbare Lösung, sodass<br />
wir uns zusätzlich für eine chemische Bindung<br />
des Wasserst<strong>of</strong>fs zur Einlagerung entschieden<br />
haben.<br />
In unserem Fall haben wir uns für die<br />
LOHC(Liquid-Organic-Hydrogen-Carrier)-<br />
Technologie entschieden. Diese Technologie<br />
ist ausreichend betriebsbewährt und bietet<br />
Möglichkeiten im Umgang mit dem Wasserst<strong>of</strong>f,<br />
diesen, ähnlich der Einlagerung von<br />
Diesel-Kraftst<strong>of</strong>fen, zu beh<strong>and</strong>eln.<br />
Die Umw<strong>and</strong>lung von Wasserst<strong>of</strong>f in LOHC<br />
bietet, wie auch die Elektrolyse eine starke<br />
Wärmekomponente bei der Erzeugung, benötigt<br />
allerdings auch Wärme bei der Freisetzung<br />
des Wasserst<strong>of</strong>fs.<br />
In Ergänzung zu den beschriebenen Komponenten,<br />
ist auch immer eine Betrachtung der<br />
möglichen bestehenden Ressourcen sinnvoll.<br />
In diesem Fall hat sich herausgestellt, dass<br />
jedes Jahr eine Menge an Holzabfällen anfällt,<br />
die sinnvoll gesammelt und verfügbar<br />
gemacht, als thermische Abfallverwertung<br />
für eine ergänzende Wärmeerzeugung im<br />
Winter genutzt werden kann, ohne dass dafür<br />
zusätzliches Material beschafft werden<br />
müsste.<br />
Das Projekt befindet sich nun in der Startphase<br />
der Umsetzung. In einem ersten<br />
Schritt werden ein Teil der Photovoltaik und<br />
der Batteriespeicher realisiert, die sukzessive<br />
in mehreren Ausbaustufen erweitert werden.<br />
Dabei werden bereits die Schnittstellen<br />
für die Wasserst<strong>of</strong>fnutzung und die Entwicklung<br />
des EMS mit digitalem Zwilling<br />
umgesetzt.<br />
In einem weiteren Ausbauschritt wird dann<br />
die Elektrolyse und das Wasserst<strong>of</strong>fnetz implementiert,<br />
bevor im letzten Ausbauschritt<br />
die LOHC-Bevorratung umgesetzt werden<br />
soll.<br />
Ein spannendes Projekt für alle Beteiligten.<br />
Quellen:<br />
[1] Eigene Projektstudie. Die Studie wurde im<br />
Rahmen eines laufenden Projektes basierend<br />
auf Angaben und Datenblättern mehrerer<br />
Hersteller von Brennst<strong>of</strong>fzellen, sowie<br />
auf Basis von Gesprächen mit Hochschulen<br />
erstellt. Faktisch liegen die elektrischen Wirkungsgrade<br />
je nach Technologie und Hersteller<br />
zwischen 30 % und 60 %.<br />
[2] Theoretischer Wert unter Zugrundelegung<br />
von Erfahrungswerten aus Projekten mit Abwärmeausnutzung<br />
verschiedener Wärmequellen,<br />
sowie Abschätzungen der Hersteller<br />
im Rahmen der Projektstudie [1]. l<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 53
Chemiekonferenz <strong>2022</strong><br />
Conference Chemistry <strong>2022</strong><br />
25. bis 27. Oktober <strong>2022</strong>, Dresden | mit Fachausstellung<br />
25 to 27 October <strong>2022</strong>, Dresden/Germany | with Technical Exhibition<br />
Chemiekonferenz <strong>2022</strong><br />
Die 58. <strong>vgbe</strong> Chemiekonferenz beginnt in diesem Jahr mit<br />
der Vorstellung zweier vollumfänglich revidierter <strong>vgbe</strong>-St<strong>and</strong>ards<br />
und befasst sich im Folgenden mit der chemischen<br />
Konditionierung des Wasser-Dampf-Kreislaufs. Dabei wird<br />
insbesondere auch auf die Eisenproblematik und die Korrosionsvorgänge<br />
eingegangen.<br />
Im Rahmen der Wasseraufbereitung wird auf Fehlermöglichkeiten<br />
bei der TOC-Bestimmung, auf die Probleme der Harzalterung<br />
und die Nachhaltigkeit eingegangen.<br />
Erfahrungen aus dem Betrieb gibt es bei der Umstellung der<br />
Rohwasserversorgung, der Rauchgaskondensatbeh<strong>and</strong>lung<br />
und bei erhöhter Nitratkonzentration im REA-Abwasser.<br />
Bei der Kühlwasseraufbereitung sind die wesentlichen Themen<br />
Korrosion und Desinfektion.<br />
Die Konferenz wird bewährt von einer interessanten<br />
Fachausstellung begleitet.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> freut sich,<br />
Sie im Oktober in Dresden begrüßen zu dürfen.<br />
Conference Chemistry <strong>2022</strong><br />
This year, the 58 th <strong>vgbe</strong> Chemistry Conference starts with<br />
the presentation <strong>of</strong> two completely revised <strong>vgbe</strong>-St<strong>and</strong>ards<br />
<strong>and</strong> deals in the following with the chemical conditioning <strong>of</strong><br />
the water-steam cycle. In particular, issues with iron oxides<br />
<strong>and</strong> corrosive processes will be addressed.<br />
In the context <strong>of</strong> water treatment, possible errors in TOC determination,<br />
the problems <strong>of</strong> resin ageing <strong>and</strong> sustainability<br />
are addressed.<br />
Experiences from operation are available on the conversion<br />
<strong>of</strong> raw water supply, flue gas condensate treatment <strong>and</strong> increased<br />
nitrate concentration in FGD waste water.<br />
In cooling water treatment, the main topics are corrosion<br />
<strong>and</strong> disinfection. The conference will again be accompanied<br />
by an interesting<br />
trade exhibition.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> looks <strong>for</strong>ward to welcoming you to<br />
Dresden, Germany in October.<br />
Tagungsprogramm<br />
Conference programme<br />
Änderungen vorbehalten<br />
Konferenzsprachen: Deutsch und Englisch<br />
Simultanübersetzung ist vorgesehen<br />
Subject to change<br />
Conference languages: English <strong>and</strong> German<br />
Simultaneous translation intended<br />
DIENSTAG, 25. OKTOBER <strong>2022</strong><br />
TUESDAY, 25 OCTOBER <strong>2022</strong><br />
18:00 Get-Together in der Ausstellung<br />
Swan Analytical Instruments lädt alle<br />
Konferenzteilnehmer zum zwanglosen Treffen ein.<br />
Get-together in the exhibition<br />
Swan Analytical Instruments invites all participants<br />
to a get-together.<br />
MITTWOCH, 26. OKTOBER <strong>2022</strong><br />
WEDNESDAY, 26 OCTOBER <strong>2022</strong><br />
09:00 Begrüßung, Eröffnung<br />
Welcome, Opening<br />
09:10<br />
V 01<br />
9:40<br />
V 02<br />
10:10<br />
V 03<br />
V 01 – V 03<br />
Diskussionsleitung / Chairman:<br />
Walter H<strong>of</strong>fmann, RWE Power AG, Essen /<br />
Germany<br />
Die Revision des VGB-St<strong>and</strong>ards VGB-S-010 –<br />
Speisewasser-, Kesselwasser und Dampfqualität<br />
für Kraftwerke/Industriekraftwerke<br />
The revision <strong>of</strong> the VGB-St<strong>and</strong>ard VGB-S-010 –<br />
Feed water, boiler water <strong>and</strong> steam quality <strong>for</strong><br />
power plants/industrial power plants<br />
M. Rziha, PPCHEM AG Hinwil / Switzerl<strong>and</strong><br />
Die Kühlwasserrichtlinie VGB-R 455 wird ein<br />
neuer <strong>vgbe</strong>-St<strong>and</strong>ard VGBE-S-455<br />
The cooling water guidline VGB-R 455 becomes<br />
the new <strong>vgbe</strong>-St<strong>and</strong>ard VGBE-S-455<br />
M. Rziha, PPCHEM AG Hinwil / Switzerl<strong>and</strong><br />
Eisenproblematik im Wasser-Dampf-Kreislauf<br />
Iron problems in the water-steam cycle<br />
N. Mattiß, VPC GmbH, Berlin / Germany<br />
10:40 Kaffeepause und Besuch der Ausstellung<br />
C<strong>of</strong>fee break <strong>and</strong> visit <strong>of</strong> the exhibition<br />
Online-Anmeldung<br />
https://register.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/21122/<br />
Kontakt (Teilnahme)<br />
Ines Moors | t +49 201 8128-222 |<br />
e <strong>vgbe</strong>-chemie@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
11:10<br />
V 04<br />
11:40<br />
V 05<br />
12:10<br />
V 06<br />
12:40<br />
V 07<br />
V 04 – V 07<br />
Diskussionsleitung / Chairman:<br />
Michael Rziha, PPCHEM AG, Hinwil / Switzerl<strong>and</strong><br />
Ad hoc use <strong>of</strong> various water cleaning technologies<br />
to h<strong>and</strong>le an oil contamination <strong>of</strong> water/steam<br />
cycles at Kyndbyvaerket<br />
Ad hoc-Einsatz verschiedener Wasserreinigungstech<br />
nologien zur H<strong>and</strong>habung einer Ölverunreinigung von<br />
Wasser-/Dampfkreisläufen in Kyndbyvaerket<br />
M. Nielsen, Ørsted, Skaerbaek / Denmark<br />
Die Umstellung der chemischen Fahrweise<br />
auf klassische Konditionierungsmittel aufgrund erhöhter<br />
niedermolekularer Organika im<br />
Zusatzwasser, verursacht über das zur Verfügung<br />
gestellte Rohwasser aus<br />
einer Abwasserumkehrosmose<br />
The changeover <strong>of</strong> the chemical mode <strong>of</strong> operation to<br />
classic conditioning agents due to increased<br />
low-molecular organics in the make-up water, caused<br />
by the raw water provided from a wastewater reverse<br />
osmosis system<br />
C. Holl, HYDRO-ENGINEERING GmbH,<br />
Mülheim / Germany<br />
Increased availability <strong>of</strong> a 820 MW-2+1-CCGT plant by<br />
application <strong>of</strong> film <strong>for</strong>ming technology<br />
Erhöhte Verfügbarkeit einer 820-MW-2+1-GuD-Anlage<br />
durch Anwendung filmbildender Technologie<br />
O. Soukup, CEZ, Prague / Czech Republic,<br />
M. Jansen, Anodamine Europe BV,<br />
Helmond / The Netherl<strong>and</strong>s<br />
Konservierung mit filmbildenden Aminen – Grundlagen,<br />
Verfahren, Betriebserfahrungen<br />
Preservation with film <strong>for</strong>ming amines –<br />
basics, procedures, operational experience<br />
R. Wagner, REICON Wärmetechnik<br />
und Wasserchemie Leipzig GmbH, Leipzig / Germany,<br />
M. Lux,<br />
STEAG GmbH, Bexbach / Germany,<br />
M. Sodeik,<br />
Knapsack Power GmbH & Co. KG, Hürth / Germany<br />
13:10 Mittagspause und Besuch der Ausstellung<br />
Lunch break <strong>and</strong> visit <strong>of</strong> the exhibition<br />
14:00<br />
V 08<br />
14:30<br />
V 09<br />
15:00<br />
V 10<br />
15:30<br />
V 11<br />
V 08 – V 11<br />
Diskussionsleitung / Chairman:<br />
N.N.<br />
Verhalten und Auswirkungen von<br />
Korrosionsprodukten bei Anlagen mit häufigen<br />
Anfahrvorgängen und deren Überwachung –<br />
Trübungsmessung als Trendmonitor für<br />
partikuläre Korrosionsprodukte<br />
Behavior <strong>and</strong> effects <strong>of</strong> corrosion products in<br />
plants with frequent start-up processes <strong>and</strong> their<br />
monitoring – Turbidity measurement as trend<br />
monitor <strong>for</strong> particulate corrosion products<br />
L. Dittmar, Swan Analytische Instrumente GmbH,<br />
Ilmenau / Germany<br />
Online monitoring <strong>of</strong> Chloride <strong>and</strong> Sulfate <strong>for</strong> accurate,<br />
real-time corrosion control <strong>and</strong> prevention<br />
Online-Überwachung von Chlorid und Sulfat für genaue<br />
Korrosionskontrolle und -vermeidung<br />
in Echtzeit<br />
M. Rury, K. Buecher,<br />
METTLER TOLEDO THORNTON Inc., Billerica / USA<br />
Kurita Dropwise Technologie zur Verbesserung des<br />
Wirkungsgrads von Kraftwerkskondensatoren<br />
Kurita Dropwise technology as efficiency improver in<br />
power plant condensers<br />
A. de Bache, Kurita Europe GmbH, Düsseldorf /<br />
Germany, S. Mori, Kurita, Japan<br />
Reinigung von Rohrbündelwärme überträgerapparaten,<br />
die mit festen Krusten<br />
und Verschlüssen zugesetzt sind<br />
Cleaning <strong>of</strong> shell <strong>and</strong> tube heat exchanger apparatus<br />
clogged with solid crusts <strong>and</strong> closures<br />
H.-J. Kastner,<br />
Umwelt-Technik-Marketing, Brake / Germany<br />
16:00 Kaffeepause und Besuch der Ausstellung<br />
C<strong>of</strong>fee break <strong>and</strong> visit <strong>of</strong> the exhibition<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
Deilbachtal 173<br />
45257 Essen<br />
be in<strong>for</strong>med<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
Chemiekonferenz <strong>2022</strong><br />
Conference Chemistry <strong>2022</strong><br />
25. bis 27. Oktober <strong>2022</strong>, Dresden | mit Fachausstellung<br />
25 to 27 October <strong>2022</strong>, Dresden/Germany | with Technical Exhibition<br />
16:30<br />
V 12<br />
17:00<br />
V 13<br />
17:30<br />
V 14<br />
V 12 – V 14<br />
Diskussionsleitung / Chairman:<br />
N.N.<br />
Nachhaltige Wasserbeh<strong>and</strong>lung mit mobilen<br />
Wasseraufbereitungssystemen: ein komplementärer und<br />
ganzheitlicher Ansatz<br />
Resilient <strong>and</strong> sustainable treated water production with<br />
Mobile Water Services:<br />
a complementary <strong>and</strong> holistic approach<br />
A. Donath, Mobile Water Services, Heinsberg / Germany<br />
Vermeiden Sie diese Fehler bei<br />
der TOC-Messung nach der VE-Straße<br />
Mistakes you should avoid when measuring TOC<br />
D. Mauer, MionTec GmbH, Leverkusen / Germany<br />
Wie die Harzalterung endlich<br />
ihren Schrecken verliert<br />
How resin ageing lost its horror<br />
D. Mauer, MionTec GmbH, Leverkusen / Germany<br />
18:00 Ende des ersten Konferenztages<br />
End <strong>of</strong> the first conference day<br />
18:30 -<br />
22:30<br />
Gemeinsamer Spaziergang zum Motorschiff<br />
„August der Starke“<br />
Abendveranstaltung mit freundlicher Unterstützung von<br />
Kurita Europe GmbH und Purolite GmbH<br />
Bitte tragen Sie an diesem Abend das<br />
<strong>vgbe</strong>-Namensschild!<br />
Joint walk to the motor ship “August der Starke”<br />
Evening event kindly supported<br />
by Kurita Europe GmbH <strong>and</strong> Purolite GmbH.<br />
Please wear your <strong>vgbe</strong> conference badge this evening!<br />
DONNERSTAG, 27. OKTOBER <strong>2022</strong><br />
THURSDAY, 27 OCTOBER <strong>2022</strong><br />
9:00<br />
V 15<br />
V 15 – V 18<br />
Diskussionsleitung / Chairman:<br />
N.N.<br />
Wasser: effizient – sicher – nachhaltig –<br />
Die Lösung für mehr Prozesssicherheit<br />
Water: efficient – safe – sustainable –<br />
The solution <strong>for</strong> more operational safety<br />
J. Koppe,<br />
MOL Katalysatortechnik GmbH, Merseburg / Germany<br />
09:30<br />
V 16<br />
10:00<br />
V 17<br />
10:30<br />
V 18<br />
Operational experience with EDI technology<br />
<strong>for</strong> CACE measurement<br />
Betriebserfahrungen mit EDI-Technologie<br />
für CACE-Messungen<br />
M. Nogales,<br />
SWAN Analytische Instrumente AG, Hinwil / Switzerl<strong>and</strong><br />
Effektiver Austausch von Umkehrosmose-Modulen in<br />
Kraftwerken<br />
How to replace reverse osmosis membranes effectively<br />
in power plants<br />
J. Henkel,<br />
DuPont Water Solutions, Rheinmünster / Germany<br />
Construction <strong>of</strong> a recycled multi-purpose package in the<br />
field <strong>of</strong> water treatment equipment <strong>and</strong> production <strong>of</strong><br />
potable or industrial water<br />
in RUD power plant<br />
Bau eines recycelten Mehrzweckpakets im Bereich der<br />
Wasseraufbereitungsanlagen und der Produktion von<br />
Trink- oder Industriewasser<br />
im RUD Kraftwerk<br />
M. Ghazimirsaeid, M. Movaghar,<br />
Siemens Energy, Tehran / Iran<br />
11:00 Kaffeepause und Besuch der Ausstellung<br />
C<strong>of</strong>fee break <strong>and</strong> visit <strong>of</strong> the exhibition<br />
V 19 – V 21<br />
Diskussionsleitung / Chairman:<br />
N.N.<br />
11:30<br />
V 19<br />
12:00<br />
V 20<br />
12:30<br />
V 21<br />
Umbau der Rohwasserversorgung eines Kraftwerks<br />
aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen<br />
Modification <strong>of</strong> the raw water supply <strong>of</strong> a power plant<br />
due to changed framework conditions<br />
J. Ruff, RWE Power AG, Köln, M. Thor<strong>and</strong>,<br />
RWE Power AG, Grevenbroich / Germany<br />
Optimisation <strong>and</strong> debottlenecking<br />
<strong>of</strong> a flue gas condensate treatment plant<br />
Optimierung und Engpassbeseitigung einer<br />
Rauchgaskondensataufbereitung<br />
F. Fogh, Ørsted, Skaerbaek / Denmark<br />
Erhöhte Nitratkonzentration im REA-Abwasser eines<br />
Steinkohlekraftwerks<br />
Increased nitrate concentration in the FGD wastewater<br />
<strong>of</strong> a hard coal-fired power plant<br />
A. Wiesel, EnBW AG, Altbach, T. Konrad,<br />
SWM Services GmbH, München / Germany<br />
13:00 Mittagspause und Besuch der Ausstellung<br />
Lunch break <strong>and</strong> visit <strong>of</strong> the exhibition<br />
Online-Anmeldung<br />
https://register.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/21122/<br />
Kontakt | Fachausstellung/Technical Exhibition<br />
Angela Langen | t +49 201 8128-310 |<br />
e angela.langen@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
14:00<br />
V 22<br />
14:30<br />
V 23<br />
15:00<br />
V 24<br />
V 22 – V 24<br />
Diskussionsleitung / Chairman:<br />
Walter H<strong>of</strong>fmann, RWE Power AG, Essen / Germany<br />
Neue Synthesemethoden in der Desinfektion<br />
New synthesis methods in desinfection<br />
M. Weber, Calyptics, Frankfurt / Germany<br />
Research <strong>of</strong> corrosion <strong>and</strong> scaling treatment <strong>of</strong> two<br />
conventional (Chlorine <strong>and</strong> Biocide) <strong>and</strong> Ozone methods<br />
in wet cooling towers at pilot scale<br />
Untersuchung der Korrosions- und Ablagerungsbeh<strong>and</strong>lung<br />
von zwei konventionellen<br />
(Chlor und Biozid) und Ozonmethoden in<br />
Nasskühltürmen im Pilotmaßstab<br />
M. Ghazimirsaeid, Siemens Energy,<br />
A. Ataei, Tehran Azad University,<br />
M. Daneshfar, Ozoneab,<br />
M. Sadegh Hossani, Tehran University, Tehran / Iran<br />
Gas turbines going green<br />
with hydrogen combustion<br />
Gasturbinen werden<br />
mit Wasserst<strong>of</strong>fverbrennung grün<br />
K. Buecher,<br />
METTLER TOLEDO Thornton Inc., Billerica / USA<br />
15:30 Schlusswort<br />
Closing speech<br />
15:45 Ende der Konferenz<br />
End <strong>of</strong> conference<br />
Practical In<strong>for</strong>mation<br />
WEBSITE OF THE CONFERENCE<br />
w https://t1p.de/<strong>vgbe</strong>-chemie<strong>2022</strong> (shortlink)<br />
VENUE<br />
Maritim Hotel &<br />
<strong>International</strong>es Congress Center Dresden<br />
Ostra-Ufer 2<br />
01067 Dresden, Germany<br />
t +49 351 216-0<br />
w https://t1p.de/maritimDD<strong>vgbe</strong>22 (shortlink)<br />
ONLINE REGISTRATION<br />
w https://register.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/21122/<br />
Organisatorische Hinweise<br />
VERANSTALTUNGSWEBSEITE<br />
w https://t1p.de/<strong>vgbe</strong>-chemie<strong>2022</strong> (Kurzlink)<br />
VERANSTALTUNGSORT<br />
Maritim Hotel &<br />
<strong>International</strong>es Congress Center Dresden<br />
Ostra-Ufer 2<br />
01067 Dresden<br />
t +49 351 216-0<br />
e reservierung.dre@maritim.de<br />
w https://t1p.de/maritimDD<strong>vgbe</strong>22 (Kurzlink)<br />
ONLINE-ANMELDUNG<br />
w https://register.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/21122/<br />
ANMELDUNG<br />
Die Anmeldung wird bis zum 10. Oktober <strong>2022</strong> erbeten<br />
(Redaktionsschluss der namentlichen Nennung im Teilnahmeverzeichnis).<br />
Eine spätere Anmeldung, auch im Tagungsbüro,<br />
ist möglich, jedoch ohne Aufnahme in das<br />
Teilnahmeverzeichnis.<br />
TEILNAHMEBEDINGUNGEN<br />
<strong>vgbe</strong>-Mitglieder 820,- €<br />
Nichtmitglieder* 980,- €<br />
Hochschulen, Behörden, Ruheständler 400,- €<br />
Studierende<br />
frei mit Nachweis<br />
FACHAUSSTELLUNG / TECHNICAL EXHIBITION<br />
Um Ihre Dienstleistungen und Produkte in den Fokus<br />
zu rücken, bieten wir Ihnen auf der Konferenz die<br />
Gelegenheit zur Firmenpräsentation:<br />
To put your services <strong>and</strong> products in the spotlight we <strong>of</strong>fer<br />
you the opportunity to present your company at the<br />
conference.<br />
Kontakt/Contact:<br />
Angela Langen<br />
t +49 201 8128-310<br />
e angela.langen@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
* Gerne In<strong>for</strong>mieren wir Sie auch über Konditionen<br />
und Leistungen einer <strong>vgbe</strong>-Mitgliedschaft.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
Deilbachtal 173<br />
45257 Essen<br />
be in<strong>for</strong>med<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
Künstliche Intelligenz, Darknet und<br />
OSINT im Social Engineering<br />
Stefan Loubichi<br />
Abstract<br />
New dimensions in social engineering<br />
Social engineering is a method <strong>of</strong> obtaining<br />
security-relevant data by exploiting human<br />
behaviour. In the process, the criminal selects<br />
the person as the weak link in the security<br />
chain to put his criminal intentions into action.<br />
Criminals exploit human characteristics<br />
such as trust, helpfulness, fear, or respect <strong>for</strong><br />
authority to manipulate these people.<br />
In social engineering attacks, the focus is on<br />
the central feature <strong>of</strong> deception about the<br />
identity <strong>and</strong> intention <strong>of</strong> the attacker. Ever<br />
since life-threatening orders were issued by<br />
strangers in “deep fake” meetings during<br />
Ukraine war, or the mayor <strong>of</strong> Berlin only realised<br />
after 30 minutes that she was not talking<br />
to Kyiv mayor she knew, it has become obvious<br />
that there are new <strong>for</strong>ms <strong>of</strong> “social engineering”.<br />
l<br />
Deep Fakes bei KRITIS<br />
Betreibern – erstmalig 2019<br />
In einer britischen Niederlassung einer<br />
deutschen Unternehmung klingelt an einem<br />
Freitag im März 2019 um 16 Uhr, d.h. kurz<br />
vor Feierabend das Telefon. Der große Chef<br />
der Konzernzentrale bittet darum, schnell<br />
220.000 Euro an einen Lieferanten in Ungarn<br />
zu überweisen [1]. Es drohe eine riesige<br />
Vertragsstrafe und man könne nur noch<br />
schnell von Großbritannien aus überweisen,<br />
um dies zu verhindern. Natürlich würde das<br />
Geld umgehend am Montag von der Konzernzentrale<br />
in Deutschl<strong>and</strong> an die Niederlassung<br />
in Großbritannien überwiesen. Die<br />
Stimme des Konzernchefs war bekannt,<br />
gleichwohl besteht die Niederlassung in<br />
Engl<strong>and</strong> auf einer E-Mail-Bestätigung, welche<br />
prompt kommt. Das Geld wird so<strong>for</strong>t<br />
nach Ungarn überwiesen. Am Montag wurden<br />
jedoch keine 220.000 Euro aus Deutschl<strong>and</strong><br />
an die Firma in Großbritannien überwiesen,<br />
denn der Konzernchef hatte nie angerufen<br />
[2]. Die Stimmenimitation wurde<br />
realisiert mit der S<strong>of</strong>tware Lyrebird. Und<br />
bereits am 14.9.2018 hatte der Deutschl<strong>and</strong>funk<br />
ausführlich über Lyrebird berichtet [3]<br />
…<br />
Auf der diesjährigen <strong>vgbe</strong> Konferenz KELI<br />
“Elektro-, Leit- und In<strong>for</strong>mationstechnik in<br />
der Energieversorgung” vom 10.-12. Mai<br />
<strong>2022</strong> hielt der Verfasser dieses Artikels einen<br />
Fachvortrag genau über dieses Thema:<br />
“Wie Cyberkriminelle die Identität einer<br />
Führungskraft der Kritischen Infrastruktur<br />
annehmen und was man gegen Social Engineering<br />
tun kann.” [4]. Das Interesse am<br />
Vortrag war sehr groß – die Verwunderung<br />
des Vortragenden darüber, dass diese Form<br />
der Deep Fakes nicht bekannt war, war<br />
ebenfalls sehr groß.<br />
Geld ist zu ersetzen, auch wenn 220.000<br />
Euro nicht aus der Portokasse zu zahlen<br />
sind. Schlimmer wird es, wenn nicht der<br />
Konzernchef vermeintlich anruft, sondern<br />
ein vermeintlicher Anruf von BSI, Bundesnetzagentur<br />
oder der Cyberabwehr des Verfassungsschutzes<br />
erfolgen würde und man<br />
darum bittet, wegen einer sehr ernsten Bedrohungslage<br />
schnell einmal ….. Diese Folgen<br />
sollten wir uns gar nicht erst ausmalen.<br />
Wie schwierig ist dies aber alles?<br />
Maschinelles Lernen –<br />
Grundlagen für deep fakes<br />
Maschinelles Lernen (ML) ist ein Segment<br />
der Künstlichen Intelligenz, welche Systeme<br />
in die Lage versetzt, automatisiert aus Daten<br />
zu lernen und sich (kontinuierlich) zu verbessern,<br />
wobei eine Programmierung nicht<br />
er<strong>for</strong>derlich ist (vgl. B i l d 1 ).<br />
ML beginnt mit einem so genannten vorbereiteten<br />
Datensatz (=Trainingsdatensatz),<br />
wobei der Datensatz von einem ML Algorithmus<br />
nach Mustern und Zusammenhängen<br />
durchsucht wird.<br />
Es liegt ein interaktiver Prozess vor, der so<br />
<strong>of</strong>t durchlaufen wird, bis das Ergebnis eine<br />
hinreichende Qualität erreicht hat. Die Ergebnisse<br />
aus dem ML Algorithmus müssen<br />
dabei von Menschen bewertet werden.<br />
Neue Daten<br />
Autor<br />
Pr<strong>of</strong>. h.c. PhDr. Dipl.-Kfm./Dipl.-Vw.<br />
Stefan Loubichi<br />
Essen, Deutschl<strong>and</strong><br />
Merkmale<br />
Zielvariable<br />
Modelltraining<br />
KI-S<strong>of</strong>tware<br />
(“Modell“)<br />
- Zusammenhänge<br />
- Muster<br />
- Abhängigkeiten<br />
- verborgene Strukturen<br />
Bild 1. Funktionsweise von Maschinellem Lernen;<br />
Quelle: https://datasolut.com/was-ist-machine-learning/<br />
Vorhersage<br />
(bspw. Affinität, Umsatz o.<br />
KaufwahrscheinIichkeit)<br />
58 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong>
Künstliche Intelligenz, Darknet und OSINT im Social Engineering<br />
Folgende Arten von Machine Learning Algorithmen<br />
gibt es:<br />
––<br />
Überwachtes Lernen<br />
––<br />
Unüberwachtes Lernen<br />
––<br />
Teilüberwachtes Lernen<br />
––<br />
Verstärkendes Lernen<br />
Sollen ML Modelle Zusammenhänge finden,<br />
so bedarf es hierzu vorab eines Trainings.<br />
Dabei werden die nachfolgenden vier Schritte<br />
durchlaufen:<br />
––<br />
Es werden dem ML Algorithmus von einem<br />
Menschen „Trainingsdaten“ zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
––<br />
Diese Daten werden von dem ML Algorithmus<br />
nach Mustern untersucht.<br />
––<br />
Sobald der Trainingsprozess abgeschlossen<br />
ist, liegt ein sicheres Modell vor.<br />
––<br />
Abschließend kann das ML Modell dazu<br />
verwendet werden, unbekannte Daten zu<br />
analysieren und auszuwerten.<br />
An dieser Stelle sei am R<strong>and</strong>e darauf verwiesen,<br />
dass bereits vor 24 Jahren von der<br />
NATO über Neurale Netze und Maschinelles<br />
Lernen entsprechend in<strong>for</strong>miert wurde, so<br />
dass hier nichts grundlegend Neues vorliegt<br />
[5].<br />
Die für uns relevante Teilmenge des Machine<br />
Learning ist das Deep Learning (DL). DL<br />
„imitiert“ das menschliche Lernverhalten<br />
unter Zuhilfenahme großer Datenmengen.<br />
Zwischen Künstlicher Intelligenz, Machine<br />
Learning und Deep Learning besteht dabei<br />
folgende Korrelation:<br />
Oberbegriff: Künstliche Intelligenz (KI)<br />
S<strong>of</strong>tware und Programme,<br />
die Probleme allein lösen<br />
können.<br />
Mittelbegriff: Machine Learning (ML)<br />
Teilgebiet der KI – Algorithmen,<br />
die von Daten lernen<br />
können<br />
Unterbegriff: Deep Learning (DL) [6]<br />
Teilgebiet des ML–Einsatz<br />
von tiefen, neuronalen<br />
Netzen<br />
Bei sehr komplexen Mustern wie unstrukturierter<br />
Bild- und Texterkennung ist das Erlernen<br />
komplexer Muster mit klassischen<br />
ML Algorithmen nur schwer möglich. Hier<br />
bedarf es in der Regel künstlicher neuronaler<br />
Netze, wobei zur Bilderkennung gerne<br />
und sehr häufig Convolutional Neural Networks<br />
(CNN) eingesetzt werden.<br />
Zum besseren Verständnis wird hier auf die<br />
frei downloadbare Vorlesung der Stan<strong>for</strong>d<br />
Universität in Sachen CNN verwiesen [7].<br />
Zur Funktionsweise wird bei DL Sichtweise<br />
auch auf die Grafik der Stan<strong>for</strong>d Universität<br />
verwiesen, B i l d 2 :<br />
In Sachen Bildverarbeitung wird darauf verwiesen,<br />
dass CNNs im Jahr 2016 eine Fehlerquote<br />
von 0,23 % auf eine der am häufigsten<br />
genutzten Bilddatenbanken, MNIST, erreichten,<br />
was der geringsten Fehlerquote aller jemals<br />
getesteten Algorithmen entspricht.<br />
input layer<br />
hidden layer 1 hidden layer 2<br />
output layer<br />
Deep learning leicht gemacht –<br />
am Beispiel von Deep Face<br />
Lab u.a.<br />
Bei dem von jedem zu einem günstigen Preis<br />
kaufbaren Programm Deep Face Lab, welches<br />
mit einer permanenten Wiederholung<br />
des Schemas Try <strong>and</strong> Error arbeitet, werden<br />
viele aufein<strong>and</strong>erfolgende Schichten ausprobiert.<br />
So mag es zum Beispiel sein, dass<br />
die erste Schicht danach schaut, welche Farbe<br />
die wahrscheinlichste ist an der Stelle, wo<br />
der Mund ist. Die nächste Schicht schaut<br />
sich dann die Umgebung neben dem Mund<br />
an und so geht es dann Stück für Stück weiter.<br />
Deep Face Lab lernt mittels numerischer<br />
Werte, was ein spezielles Gesicht ausmacht,<br />
d.h.: Kopfhaltung, Ausdruck, Mimik. Es entsteht<br />
somit ein neuer Videoschnitt, jedoch<br />
künstlich generiert.<br />
In der medialen Darstellung wird <strong>of</strong>t erklärt,<br />
dass dies nur dann machbar sei, wenn man<br />
ein so genanntes vortrainiertes Modell hat,<br />
wie es in der Regel bei Personen des öffentlichen<br />
Lebens ist. Dies stimmt nicht.<br />
In einem solchen Fall muss das Programm<br />
lernen, ein beliebiges Gesicht in Zahlen zu<br />
übersetzen und diese Zahlen wieder in ein<br />
Gesicht zu übersetzen. Natürlich braucht<br />
man Zeit und Geld. Die Leistung eines guten<br />
Grafikprozessors (z.B. die NVIDIA Grafikkarte<br />
mit CUDA Unterstützung (mindestens<br />
GTX 1010) sowie drei bis vier Gigabyte Festplattenspeicher<br />
reichen zum Beispiel aus,<br />
dass mit der aus den Sozialen Medien bekannten<br />
Desktop Anwendung FakeApp mittels<br />
FaceSwap täuschend echt aussehende<br />
gefälschte Videos mit den Gesichtern <strong>and</strong>erer<br />
Menschen erstellt werden. [8].<br />
Wer die Hintergründe auch noch verstehen<br />
möchte, der sei auf die in Youtube zu findenden<br />
Erklärvideos zum Thema Real Time Facial<br />
Reenactment verwiesen [9].<br />
Eine weitere von Deep Face Lap genutzte<br />
Technik des Maschinellen Lernens ist „Generative<br />
Adversarial Networks (GAN) [10].<br />
Diese – seit 2014 bekannte Technologie –<br />
lässt sich einfach erklären: In einer Art Wettstreit<br />
treten zwei neuronale Netzwerke gegenein<strong>and</strong>er<br />
an: Das eine Netzwerk versucht<br />
das Modell eines perfekten Gesichtes zu errechnen.<br />
Das <strong>and</strong>ere Netzwerk versucht,<br />
entsprechende Fehler zu finden. Hiermit hat<br />
man die Büchse der P<strong>and</strong>ora geöffnet. Leider<br />
finden sich im Übrigen nur wenige Publikationen<br />
darüber, wie Deep Fake entdeckt<br />
werden kann [11].<br />
depth<br />
height<br />
width<br />
Bild 2. 3-layer Neural Network vs. Conv-Net ; Quelle: Kurs CS231n: Deep Learning <strong>for</strong> Computer<br />
Vision, Stan<strong>for</strong>d University<br />
Seit 2019 gibt es hier im Übrigen eine bahnbrechende<br />
Weiterentwicklung von Forschenden<br />
der Universität Trient aus Italien:<br />
First Order Motion Model <strong>for</strong> Image Imagination<br />
[12]. Bei Frist Order Motion wurden<br />
Erscheinungs- und Bewegungsin<strong>for</strong>mationen<br />
durch eine selbstüberwachte Formulierung<br />
entkoppelt. First Order Motion Model<br />
berechnet aus einem statischen Foto, wie<br />
sich das Gesicht beim Sprechen bewegen<br />
würde und fügt eigene Bildteile ein. Die Fehlerrate<br />
ist zwar größer als bei „klassischen<br />
Deep Learning, aber immer noch hinreichend,<br />
um bei kleinen Videosequenzen zu<br />
überzeugen.<br />
Avatarify Desktop ist im Übrigen eine im<br />
freien H<strong>and</strong>el erhältliche S<strong>of</strong>tware, die auf<br />
dem First Order Motion Model aufbaut.<br />
Auf die umfangreiche Veröffentlichung des<br />
aktuellen Wissenschaftsst<strong>and</strong>es in NeurIPS<br />
Proceedings wird an dieser Stelle ausdrücklich<br />
verwiesen [13].<br />
Kommen wir nun Problem mit der Stimmimitation.<br />
Hier sind die Produkte von Adobe,<br />
Adobe VoCo [14] und Baidu, Deep<br />
Speech [15] zu nennen. Während Adobe<br />
VoCo bis heute nicht kommerziell vermarktet<br />
wird, ist Baidu den Open Source Weg gegangen.<br />
Voice Conversion Programme (B i l d 3 ) gehen<br />
hierbei in der Regel nach folgendem<br />
Schema vor:<br />
––<br />
Analyse des gesprochenen Wortes<br />
––<br />
Zerlegung der Stimme des Sprechers in<br />
einzelne Phoneme<br />
––<br />
Texteingaben werden in Realtime mit der<br />
Stimme des Sprechers synchronisiert.<br />
Wie gut diese Systeme mittlerweile geworden<br />
sind, zeigen die Demoversionen der<br />
nachfolgenden im freien Markt erhältlichen<br />
Produkte (B i l d 4 ), wobei hier nur einige<br />
genannt werden:<br />
––<br />
https://www.descript.com/<br />
––<br />
https://www.descript.com/lyrebird<br />
––<br />
https://replicastudios.com/<br />
––<br />
https://www.resemble.ai/<br />
––<br />
https://www.respeecher.com/<br />
Die große Frage ist dabei <strong>of</strong>tmals: Aber wie<br />
groß muss denn die Dauer einer Sprachaufnahme<br />
von jem<strong>and</strong>em sein, damit man dessen<br />
Sprache clonen kann [16].<br />
DeepVoice benötigt zum Beispiel nur noch<br />
eine Sprachaufnahme von 3,7 Sekunden,<br />
um eine Stimme nahezu perfekt zu clonen.<br />
Diese Zahlen sind erschreckend.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 59
Künstliche Intelligenz, Darknet und OSINT im Social Engineering<br />
Mittlerweile stehen die Grundlagenwerke<br />
hierzu auch der Öffentlichkeit in hinreichendem<br />
Umfang zur Verfügung [17].<br />
Das Darknet<br />
(a) Training procedure<br />
Viele verlassen sich nicht mehr blind auf Videomeeting<br />
und wollen dann auch ein amtliches<br />
Lichtbilddokument zur Verifizierung<br />
sehen. Es ist hier mehr als erschreckend,<br />
dass man in diesem Zusammenhang im<br />
Darknet wirklich alles kaufen kann, auch<br />
„amtliche Ausweisdokumente“.<br />
Nachfolgend einmal eine aktuelle Preisliste,<br />
was so etwas im Darknet kosten würde:<br />
Ausweis mit folgenden Charakteristika:<br />
––<br />
Mikro-Schriftzug (600 dpi)<br />
––<br />
Wassermarke und Siegel<br />
––<br />
Hologramm<br />
––<br />
integriertes Hintergrundmuster<br />
––<br />
maschinenlesbare Zone<br />
Preis: 250 – 350 Euro<br />
Führerschein:<br />
Preis: 250 – 350 Euro<br />
Reisepass:<br />
Preis: 1.000 Euro<br />
(b) Training procedure<br />
Bild 3. YourTTS diagram depicting (a) training procedure <strong>and</strong> (b) inference procedure,<br />
Quelle: https://arxiv.org/pdf/2112.02418v3.pdf<br />
Encoder<br />
Encoder PostNet<br />
x N<br />
Convolution Block<br />
Encoder PreNet<br />
Text Embedding<br />
Wave<br />
Wave<br />
(key, value) Griffin-Lim WORLD<br />
Speaker-Embedding<br />
Decoder<br />
Converter<br />
Attention Block<br />
Converter<br />
query<br />
Bild 4. Architektur von Baidus Deep Speech 3,<br />
Quelle: http://research.baidu.com/Blog/index-view?id=90<br />
Done<br />
Mel Input<br />
Wave<br />
WaveNet<br />
Natürlich wird in diesem Artikel nicht die<br />
Adresse veröffentlicht, wo man diese Artikel<br />
kaufen kann.<br />
Aber es ist erschreckend, dass man so etwas<br />
so günstig kaufen kann, zumal mit derartigen<br />
Dokumenten so viele kriminellen Taten<br />
mit schwerwiegenden Folgen realisiert werden<br />
können.<br />
Dass Europol und <strong>and</strong>ere Polizeibehörden<br />
nicht hiergegen einschreiten ist ebenfalls<br />
nicht nachvollziehbar.<br />
Theoretisch könnte man natürlich sagen:<br />
Woher will denn der Cyberkriminelle bzw.<br />
der Cyberterrorist wissen, dass XYZ für die<br />
Cybersecurity beim Betreiber der Kritischen<br />
Infrastruktur ABC zuständig ist.<br />
FC<br />
Mel Output<br />
x N<br />
Convolution Block (Causal)<br />
σ<br />
+<br />
Decoder PreNet<br />
FC<br />
Das Internet vergisst nie<br />
etwas<br />
Bereits vor 21 Jahren, d.h. im November<br />
2001 wurde das NATO Open Source Intelligence<br />
H<strong>and</strong>book veröffentlicht und bis heute<br />
kann es als Grundlagenwerk angesehen<br />
werden [18]. Schauen wir uns an, wie Cyberkriminelle,<br />
aber auch Geheimdienste auf<br />
legale In<strong>for</strong>mationen an alle In<strong>for</strong>mationen<br />
über uns kommen.<br />
Alles beginnt damit, dass man sich eine Person<br />
aussucht, die in der Hierarchie im Unternehmen<br />
oben steht, aber von den meisten<br />
nicht persönlich gekannt wird, zugleich<br />
aber eine entsprechende Macht im Unternehmen<br />
hat, so dass man ihr in der Regel<br />
nicht widersprechen sollte (z.B. Leiter IT,<br />
Geschäftsführung, Leiter Personalabteilung).<br />
Über google kann hier problemlos<br />
über die Schlagwörter Unternehmen, Organigramm<br />
der Aufbau des Unternehmens gefunden<br />
werden. Wenn man Glück hat, findet<br />
man dann auch gleich Name, Foto und Lebenslauf<br />
dieses Entscheiders.<br />
Die Suche nach privaten und dienstlichen E-<br />
Mail-Adressen sowie privaten und dienstlichen<br />
Festnetz- und Mobilfunknummern der<br />
entsprechenden Personen erhält man dann<br />
über entsprechende Suchdienste (i.d.R. in<br />
den USA angesiedelt):<br />
Rocket Research [19]<br />
Lusha [20]<br />
Hunter [21]<br />
In der Regel finden sich hierüber wichtige<br />
Kommunikationsdaten über die entsprechenden<br />
Personen. Die Mobilfunknummer<br />
des britischen Premierministers Boris Johnson<br />
war zum Beispiel über Jahre hinweg<br />
leicht zu finden.<br />
Oftmals finden sich in Sozialen Netzen<br />
ebenfalls In<strong>for</strong>mationen über:<br />
––<br />
Geburtsdatum<br />
––<br />
Persönliche Interessen<br />
––<br />
Freunde, Bekannte<br />
––<br />
Netzwerke<br />
––<br />
Politische Einstellung<br />
etc.<br />
Relevante Netzwerke sind hierbei:<br />
––<br />
Facebook<br />
––<br />
LinkedIn<br />
––<br />
Twitter<br />
––<br />
Instagram<br />
––<br />
Telegram<br />
Will man dann wissen, wo sich jem<strong>and</strong> aufhält<br />
(natürlich nur beim Mobilfunk relevant),<br />
so gibt es Tools (im normalen Internet),<br />
mit den man Cell-Tracking auf einfachste<br />
Art und Weise betreiben kann [22].<br />
Auch bei ausgeschalteten H<strong>and</strong>ys erfährt<br />
man problemlos:<br />
Ist die Telefonnummer noch gültig?<br />
Ist die Telefonnummer an das Netz angeschlossen,<br />
z.B. Vodafone UK<br />
60 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Künstliche Intelligenz, Darknet und OSINT im Social Engineering<br />
Ist der Benutzer im Roaming-Modus<br />
Wird die Nummer portiert<br />
Will man dann noch die Adresse erfahren,<br />
so bedarf es weiterer Tools im Darknet. Da<br />
dies nicht legal ist, werden hierzu keinerlei<br />
Angaben gemacht.<br />
Nun wissen CISOs und CIOs natürlich, dass<br />
Kriminelle – die keine E-Mail-Adresse von<br />
einer entsprechenden Führungskraft gefunden<br />
haben – hier den allgemeinen Algorithmus<br />
nutzen, wie E-Mail-Adressen aufgebaut<br />
sind, zum Beispiel: aaa.bbb@gold-<strong>energy</strong>.<br />
com. Sendet der Angreifer dann eine E-Mail<br />
an diese Adresse täuschen gute CISOs die<br />
Nicht-Erreichbarkeit zum Beispiel durch die<br />
folgende Meldung vor: „Ihre Nachricht an<br />
aaa.bbb@gold-<strong>energy</strong>.com wurde blockiert“<br />
Es wird dann noch ausgegeben: 550.5.4.1<br />
Recipient address rejected: Access denied.<br />
Trotzdem wurde die Adresse zugestellt. Nun<br />
gibt es Programme, die umgehend ein Feedback<br />
geben, wann diese Nachricht jeweils<br />
gelesen wurde. Selbst in IT-technisch sehr<br />
versierten Ländern wie China hat man derzeit<br />
kaum eine Chance, dies zu blocken. Diese<br />
Programme sind im Internet frei verfügbar.<br />
Trotzdem werden diese hier nicht genannt.<br />
Bevor wir nachfolgend zu dem wichtigen<br />
Tool maltego kommen, sei an dieser Stelle<br />
noch kurz auf die Bild-Tools verwiesen, welche<br />
Cyberkriminelle nutzen.<br />
Das in B i l d 5 gezeigte Bild wurde übers<strong>and</strong>t,<br />
um einem Leiter IT zu belegen, dass<br />
gerade XYZ verunglückt sei und man deshalb<br />
Zugang zu 123 benötigt. Eine gute Masche<br />
von Kriminellen, wobei dies jedoch<br />
deshalb in diesem Falle innerhalb von 4<br />
Stunden auffiel, weil dieses Bild bereits<br />
durch einfache google-Bildrecherche als<br />
zwei Jahre altes Unfall-Bild erkannt wurde,<br />
welches hundertfach im Netz finden ist. Zur<br />
St<strong>and</strong>ardabwehr der Gefahrenabwehr sollte<br />
stets jedes Bild, welches von Dritten übers<strong>and</strong>t<br />
wird, auf Echtheit verifiziert werden<br />
[23]<br />
Bild 5. Autounfall in London Quelle: youtube,<br />
tiktok u.a.<br />
Im besagten Falle wurde dann auch noch<br />
kommuniziert, dass man die nächsten Tage<br />
auch nicht dem verunglückten XYZ kommunizieren<br />
könne, da er im Koma sei und in die<br />
USA verbracht worden sei. In diesem Falle<br />
konnte aber einfachst verifiziert werden,<br />
dass das Mobilfunktelefon sich hiernach nie<br />
im Roaming Modus bef<strong>and</strong>.<br />
Dies mag belegen, dass manche Cyberkriminelle<br />
ihr H<strong>and</strong>werk nicht immer hinreichend<br />
beherrschen.<br />
OSINT Recherche über<br />
Kali-Linux<br />
Wir haben bereits auf OSINT verwiesen.<br />
Aber was ist OSINT? Open Source Intelligent<br />
Tools ist gemäß der [übersetzten]<br />
Definition des US-amerikanischen Department<br />
<strong>of</strong> Defense (DoD) wie folgt definiert:<br />
„erstellt aus öffentlich verfügbaren In<strong>for</strong>mationen,<br />
die gesammelt, ausgewertet und<br />
kurzfristig unter geeigneten Adressaten<br />
verbreitet werden, um besondere nachrichtendienstliche<br />
An<strong>for</strong>derungen zu erfüllen“.<br />
Die Vorgehensweise bei OSINT ist dabei relativ<br />
einfach:<br />
––<br />
Öffentliche Assets aufspüren<br />
––<br />
Relevante In<strong>for</strong>mationen außerhalb der<br />
Organisation finden<br />
––<br />
Ermittelte In<strong>for</strong>mationen verwertbar zusammenstellen.<br />
Eine sowohl für Hacker als auch für Cybersecurity-Fachkräfte<br />
wichtige S<strong>of</strong>tware ist<br />
zweifelsfrei Kali-Linux. Es h<strong>and</strong>elt sich dabei<br />
um eine auf Debian basierende Linux-<br />
Distribution, welche vor allem Programme<br />
für Penetrationstests und digitale Forensik<br />
umfasst. Da Kali die GNU-GPL-Lizenz besitzt<br />
gilt Kali als Open Source.<br />
Wichtige Kali-Linux Werkzeuge sind:<br />
––<br />
Maltego:<br />
Programm, um Daten über Einzelpersonen<br />
oder Unternehmen im Internet zu<br />
sammeln<br />
––<br />
Kismet:<br />
Passiver Sniffer zur Untersuchung von<br />
WLANS<br />
––<br />
Social-Engineer Toolkit (SET):<br />
Programme für Penetrationstest mit dem<br />
Schwerpunkt auf Social Engineering<br />
––<br />
Nmap:<br />
Netzwerkscanner zur groben Analyse von<br />
Netzwerken mit Zenmap<br />
––<br />
Wireshark:<br />
Graphischer Netzwerksniffer<br />
––<br />
Ettercap:<br />
Netzwerkadministrationstool (zum Beispiel<br />
für Man-in-the-Middle-Angriff)<br />
––<br />
John the Ripper:<br />
Programm zum Knacken und Testen von<br />
Passwörtern<br />
––<br />
Metasploit:<br />
Framework für das Austesten und Entwickeln<br />
von Exploits<br />
––<br />
Aircrack-ng:<br />
Sammlung von Tools, die es ermöglichen,<br />
Schwachstellen in WLANs zu analysieren<br />
und auszunutzen<br />
––<br />
Nemesis:<br />
Paketfälscher für Netzwerke<br />
––<br />
RainbowCrack<br />
Cracker für LAN-Manager-Hashes<br />
––<br />
The Sleuth Kit<br />
Sammlung von Forensik-Werkzeugen<br />
An dieser Stelle sei ausdrücklich erwähnt,<br />
dass der Besitz von Kali Linux nicht strafbar<br />
ist, obgleich dies gerne so kommuniziert<br />
wird.<br />
Um alle [verfügbaren] In<strong>for</strong>mationen über<br />
Personen zu finden, ist eine Analyse – S<strong>of</strong>tware<br />
wie maltego [24] immer der richtige<br />
Anfang. Hier findet man immer etwas. Mit<br />
diesem Data-Mining-Werkzeug werden In<strong>for</strong>mationen<br />
im Internet gesucht und verknüpft<br />
und die gefundenen In<strong>for</strong>mationen<br />
werden mittels gerichteter Graphen dargestellt<br />
und lassen weitere Analysen zu. Die<br />
hierzu benutzten Quellen der In<strong>for</strong>mationssuche<br />
sind Webseiten, soziale Netzwerke,<br />
Suchmaschinen oder öffentlich verfügbare<br />
Datenbanken.<br />
Mittlerweile werden OSINT Tools theoretisch<br />
der breiten Öffentlichkeit vorgestellt<br />
[25]. Nach wie vor werden diese Fachartikel<br />
aber eher von Cyberkriminiellen denn von<br />
der Gegenseite gelesen.<br />
Mit shodan.io wird es<br />
interessiert<br />
Shodan sammelt Daten meist auf Webservern<br />
(HTTP/HTTPS über die Ports 80, 8080,<br />
443, 8443), sowie FTP (Port 21), SSH (Port<br />
22), Telnet (Port 23), SNMP (Port 161), SIP<br />
(Port 5060), und Real Time Streaming Protocol<br />
(RTSP, Port 554).<br />
Eingesetzt wird shodan.io zur Gefahrenabwehr<br />
bei Betreibern kritischer Infrastrukturen<br />
wie der Energiewirtschaft, Wasser/Abwasserwirtschaft<br />
aber auch dem Bank- und<br />
Börsenwesen. Im umgekehrten Falle wird<br />
shodan.io aber auch zum Auffinden von<br />
Schwachstellen verw<strong>and</strong>t. Hierzu gibt es<br />
auch einen sehr aktuellen Fall, der allerdings<br />
nur anonymisiert wiedergegeben werden<br />
kann:<br />
Die Organisationen A und B hatten <strong>of</strong>fiziell<br />
nichts mitein<strong>and</strong>er zu tun. Cyberkriminelle<br />
erkannten jedoch, dass die Organisationen<br />
enger verbunden sind als nach außen kommuniziert<br />
wurde.<br />
Bei A konnten über shodan.io konnten sieben<br />
verwundbare Systeme (Engl<strong>and</strong>, Indien,<br />
USA, Österreich, Spanien, Niederl<strong>and</strong>e)<br />
verifiziert werden; bei B konnten über shodan.io<br />
vier verwundbare Systeme (Indien,<br />
USA, Niederl<strong>and</strong>e). Bei den Systemen von<br />
B konnte die gleiche IP-Adresse gefunden<br />
werden wie bei A. Eine geeignete<br />
Schwachstelle f<strong>and</strong> man über die cloud Systeme<br />
und die Virtuelle Maschinen. Somit<br />
konnte man über das eine Systeme unbemerkt<br />
auf die Systeme der <strong>and</strong>eren Organisation<br />
zugreifen.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 61
Künstliche Intelligenz, Darknet und OSINT im Social Engineering<br />
Das sogenannte „Abziehen“ verwertbarer<br />
Daten dauerte dann vier Tage. Es h<strong>and</strong>elt<br />
sich hierbei um große und bedeutende Organisationen,<br />
bei denen man eigentlich größere<br />
Cybersecurity hätte erwarten können.<br />
Aber vielleicht sind Cyberkriminelle ja in<br />
einer der Organisationen von A und B fix installiert.<br />
Auch wenn hier sicherlich viele an Details<br />
interessiert sein sollten, so dürfen aus rechtlichen<br />
Gründen keinerlei weiteren Auskünfte<br />
gegeben werden können.<br />
Vorausgegangen – quasi zur Qualitätskontrolle<br />
– war eine Art Stealth Scanning. Eine<br />
Version sei hier vorgestellt:<br />
Nach wie vor achten die meisten Firewalls<br />
auf SYN Pakete, FIN Pakete können unbemerkt<br />
durchschlüpfen. Es wird also ein<br />
Port Scan mit einem Paket und dem FIN<br />
Flag übers<strong>and</strong>t. Es wird keine Antwort erwartet.<br />
Erhält man eine RST Rückmeldung,<br />
kann man davon ausgehen, dass der<br />
PORT geschlossen ist. Wenn man nichts erhält,<br />
deutet dies darauf hin, dass der Port<br />
<strong>of</strong>fen ist.<br />
Beim X-Mas Scan wird ein Paket gesetzt, bei<br />
dem die Flags FIN, URG und PUSH gesetzt<br />
sind. Dabei wird entweder eine RST-Rückmeldung<br />
oder gar keine Rückmeldung verlangt.<br />
Gerade bei Nicht-Windows-Systemen<br />
kommt man bei den Weiterentwicklungen<br />
der vorstehend beschriebenen Stealth Scannings<br />
an fast jeder Firewall vorbei.<br />
Fazit<br />
Es ist heutzutage kaum mehr möglich zu<br />
wissen, ob man wirklich in einem Online-<br />
Meeting mit der Person ist, mit der man<br />
glaubt in einem Meeting zu sein. Und es<br />
wird auch immer einfacher sich die entsprechende<br />
Hardware zu besorgen, wenn man<br />
zum Beispiel nicht die benötigte NVIDIA<br />
Karte oder nur eine langsame CPU hat. In<br />
einem solchen Fall nutzt man nämlich einfach<br />
Googles Lab.<br />
Natürlich kann man jetzt entgegnen, dass es<br />
doch Programme gibt, die aufzeigen können,<br />
ob ein digitales Erzeugnis ein Fake ist. Hier<br />
ist zum Beispiel Amped Authetic zu nennen.<br />
Hat man Zeit, so ist dies kein Problem. In Krisensituationen<br />
wird man diese Zeit jedoch in<br />
der Regel nicht haben. Dann bliebt <strong>of</strong>tmals<br />
nichts <strong>and</strong>eres übrig, als sich auf den „gesunden<br />
Menschenverst<strong>and</strong>“ zu verlassen.<br />
Celltracker, E-Mail-Tracker sind Gefahrenquellen,<br />
die immer noch nicht hinreichend<br />
bekannt und abgewehrt werden. Dies gilt<br />
auch für entsprechende OSINT Werkzeuge<br />
sei es das KALI Linux Tool maltego oder das<br />
mächtige shodan.io oder das „Stealth Scanning.“<br />
Hier besteht ein großer Trainingsbedarf<br />
bei den entsprechenden Fachkräften<br />
für Cybersicherheit. Noch ist der Krieg nicht<br />
verloren, denn <strong>of</strong>tmals machen die meisten<br />
Cyberkriminellen die gleichen Fehler wie<br />
angegriffenen Institutionen, so dass man relativ<br />
einfach verifizieren kann, wer die bösen<br />
Menschen sind.<br />
Quellen<br />
[1] https://versicherungsmonitor.<br />
de/2019/06 /21/neue-sprachmasche-beifake-president/<br />
[2] https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402<br />
[3] https://www.deutschl<strong>and</strong>funk.de/kuenst<br />
liche-intelligenz-lyrebird-ein-leierschwanz-fuer-jede-100.html<br />
[4] https://events.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/events/keli-<br />
<strong>2022</strong>/6693/JG3UR/program/talk/wiecyberkriminelle-die-identitaet-einer-fuehrungskraft-eines-unternehmens-der-kritischen-infrastruktur-annehmen-und-wasman-gegen-social-engineering-tun-kann/<br />
65967/infos<br />
[5] Christopher M. Bishop, Neural Networks<br />
<strong>and</strong> Machine Learning (NATO ASI Subseries<br />
F:, B<strong>and</strong> 168, Springer, ISBN-13: 978-<br />
3540649281.<br />
[6] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron<br />
Courville: Deep Learning (= Adaptive<br />
Computation <strong>and</strong> Machine Learning). MIT<br />
Press, 2016, ISBN 978-0-262-03561-3.<br />
[7] https://cs231n.github.io/convolutionalnetworks/<br />
[8] https://www.pressetext.com/news/2018<br />
0125022<br />
[9] https://www.youtube.com/<br />
watch?v=s1D Phc9HNQ0<br />
[10] https://proceedings.neurips.cc/paper/20<br />
14/file/5ca3e9b122f61f8f06494c97b1afc<br />
cf3-Paper.pdf<br />
[11] Zhaohe Zhang, Qingzhong Liu: Detect Video<br />
Forgery by Per<strong>for</strong>ming Transfer Learning<br />
on Deep Neural Network. In: Advances<br />
in Natural Computation, Fuzzy Systems<br />
<strong>and</strong> Knowledge Discovery (= Advances in<br />
Intelligent Systems <strong>and</strong> Computing).<br />
Springer <strong>International</strong> Publishing, Cham<br />
2020, ISBN 978-3-03032591-6, S. 415–<br />
422.<br />
[12] https://proceedings.neurips.cc/paper/20<br />
19/fle/31c0b36aef265d9221af80872ceb6<br />
2f9 -Paper.pdf<br />
[13] https://proceedings.neurips.cc/paper/<br />
2019<br />
[14] https://www.nzz.ch/digital/adobe-project-voco-photoshop-fuer-die-stimmeld.126328<br />
[15] http://research.baidu.com/Blog/indexview<br />
?id=91<br />
[16] https://arxiv.org/pdf/2112.02418v3.pdf<br />
[17] E. Cooper, C.-I. Lai, Y. Yasuda, F. Fang, X.<br />
Wang, N. Chen, <strong>and</strong> J. Yamagishi, “Zeroshot<br />
multi-speaker text-to-speech withstate<br />
<strong>of</strong> the art neural speaker embeddings,”<br />
in ICASSP 2020-2020 IEEE <strong>International</strong><br />
Conference on Acoustics, Speech,<br />
<strong>and</strong> Signal Processing (ICASSP). IEEE,<br />
2020, pp. 6184–6188.<br />
[18] https://archive.org/details/NATOOSINT<br />
H<strong>and</strong>bookV1.2<br />
[19] rocketreach.co<br />
[20] lusha.com<br />
[21] hunter.io<br />
[22] https://www.cell-track.de/<br />
[23] https://images.google.de<br />
[24] https://kali.org/tools/maltego<br />
[25] Computerwoche 15.06.<strong>2022</strong>: Die besten<br />
OSINT Tools.<br />
[26] https://ieeexplore.ieee.org/abstract/doc<br />
ument /8954668 (The Not Yet Exploited<br />
Goldmine <strong>of</strong> OSINT: Opportunities, Open<br />
Challenges <strong>and</strong> Future Trends).<br />
[27] https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4842-3838-7_10<br />
(Gathering Evidence from OSINT Sources).<br />
l<br />
62 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
<strong>vgbe</strong> Fachtagung<br />
Brennst<strong>of</strong>fe, Feuerungen und Abgasreinigung <strong>2022</strong><br />
28. und 29. September <strong>2022</strong><br />
in Hamburg | Hotel Gastwerk mit Fachausstellung<br />
Brennst<strong>of</strong>fe, Feuerungen<br />
und Abgasreinigung <strong>2022</strong><br />
Mit der Fachtagung „Brennst<strong>of</strong>fe, Feuerungen und Abgasreinigung<br />
<strong>2022</strong>“ am 28. und 29. September <strong>2022</strong><br />
im Hotel Gastwerk in Hamburg starten wir in diesem<br />
Jahr ein neues Format, das die wesentlichen Aspekte<br />
und Auswirkungen des Einsatzes unterschiedlicher<br />
Brennst<strong>of</strong>fe auf die Feuerung und Abgasreinigung berücksichtigt.<br />
Kohle war die treibende Kraft hinter der industriellen<br />
Revolution und veränderte den Kurs der ganzen Welt.<br />
Heute befinden wir uns wieder in einem dramatischen<br />
Kurswechsel und ersetzen Kohle durch alternative<br />
Brennst<strong>of</strong>fe oder alternative Stromerzeugungsverfahren.<br />
In dieser Übergangsphase ist es wichtig, sowohl<br />
der auslaufenden Kohlenutzung weiterhin eine Platt<strong>for</strong>m<br />
zu bieten, als auch die integrale Auswirkung alternativer<br />
Brennst<strong>of</strong>fe oder Verfahren zu betrachten.<br />
Die Fachtagung „Brennst<strong>of</strong>fe, Feuerungen und Abgasreinigung<br />
<strong>2022</strong>“ bietet Betreibern, Herstellern, Planern,<br />
Genehmigungsbehörden und Forschungsinstituten<br />
eine Platt<strong>for</strong>m die aktuellen Heraus<strong>for</strong>derungen<br />
der Energiepolitik zu diskutieren.<br />
Wir freuen uns auf ihre Teilnahme an der <strong>vgbe</strong>-Fachtagung<br />
im September in Hamburg.<br />
In die Veranstaltung ist eine begleitende Fachausstellung<br />
inte griert, die zusätzliche In<strong>for</strong>mationsmöglichkeiten<br />
bietet.<br />
Auf Wiedersehen in Hamburg!<br />
Ihr <strong>vgbe</strong>-Team<br />
Tagungsprogramm<br />
Änderungen vorbehalten<br />
MITTWOCH, 28. SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />
ab 18:00<br />
Get-Together im Hotel<br />
DONNERSTAG, 29. SEPTEMBER <strong>2022</strong><br />
ab 08:00<br />
08:30-<br />
08:40<br />
08:40 –<br />
09:00<br />
V1<br />
09:00 –<br />
09:30<br />
V2<br />
09:30 –<br />
10:00<br />
V3<br />
10:00 –<br />
10:30<br />
V4<br />
10:30 –<br />
11:00<br />
11:00 –<br />
11:30<br />
V5<br />
11:30 –<br />
12:00<br />
V6<br />
Registrierung und Welcome-Kaffee<br />
Begrüßung<br />
Zukunft der konventionellen Kraftwerke<br />
aus Sicht des <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong><br />
Dr. Thomas Eck, <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong>, Essen<br />
Lagerschäden an Schüsselmühlen – Ergebnisse<br />
der Schadensanalyse und daraus abgeleitete<br />
Condition Monitoring Maßnahmen<br />
Dr. Gereon Lüdenbach, Patrick Gehlmann,<br />
St<strong>and</strong>Zeit GmbH, Coesfeld,<br />
Martin Fricke, Trianel, Lünen<br />
Möglichkeiten der messtechnischen Bestimmung<br />
des Betriebsverhaltens von Mahlanlagen<br />
einschließlich der Brenner und Feuerung als<br />
Basis für Bewertungen und Optimierungen<br />
Dr. Steffen Griebe, Dipl.-Ing. Helge Kaß,<br />
Dipl.-Ing. Volker Biesold, Dipl.-Ing. (FH) Peter Lange,<br />
Dipl.-Ing. (FH) Rene Wascher, M. A. Adrian Weber,<br />
VPC, Vetschau/Spreewald<br />
Online-Korrosionsmonitoring in<br />
Kraftwerksfeuerungen<br />
Pr<strong>of</strong>. Dr. B. Epple, A. Marx, D. Hülsbruch,<br />
Technische Universität Darmstadt,<br />
Institute <strong>for</strong> Energy Systems & Technology (EST)<br />
Kaffeepause in der Ausstellung<br />
Einsatz von längsnahtgeschweißten Alloy-Rohren<br />
in Überhitzerbündeln und Membranwänden<br />
Dipl.-Ing. Uwe Schadow,<br />
Steinmüller Engineering GmbH, Gummersbach<br />
Ammoniak als alternativer Brennst<strong>of</strong>f<br />
Dr. Anne Giese,<br />
Gas-Wärme-Institut e.V., Essen<br />
Online-Anmeldung<br />
https://register.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/21622/<br />
Kontakt (Teilnahme)<br />
Barbara Bochynski | t +49 201 8128-205 |<br />
e <strong>vgbe</strong>-brennst<strong>of</strong>fe@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
12:00 –<br />
12:30<br />
V7<br />
12:30 –<br />
13:30<br />
13:30 –<br />
14:00<br />
V8<br />
14:00 –<br />
14:30<br />
V9<br />
14:30 –<br />
15:00<br />
V10<br />
15:00 –<br />
15:20<br />
15:20 –<br />
15:50<br />
V11<br />
15:50 –<br />
16:20<br />
V12<br />
16:20 –<br />
16:50<br />
V13<br />
16:50 –<br />
17:00<br />
GKM und die Energiewende<br />
Peter Volkmann,<br />
Leiter Betrieb GKM, Mannheim<br />
Lunch<br />
Multifuel Feuerung in<br />
der zirkulierenden Wirbelschicht<br />
Frank Leuschke,<br />
Doosan Lentjes GmbH, Ratingen<br />
Effiziente Analyse und Bewertung des<br />
Verbrennungsprozesses durch Ermittlung<br />
relevanter Prozessgrößen<br />
Ismail Korkmaz,<br />
EUtech Scientific Engineering, Aachen<br />
Innovative Vergasungstechnologien für das<br />
chemische Recycling von Restst<strong>of</strong>fen<br />
E. Langner, Pr<strong>of</strong>. Dr. B. Epple, J. Ströhle,<br />
Technische Universität Darmstadt,<br />
Institute <strong>for</strong> Energy Systems & Technology (EST)<br />
Kaffeepause in der Ausstellung<br />
REA-Ertüchtigung im Kraftwerk Lippendorf<br />
Dr. Dorian Rasche,<br />
Steinmüller Eng., Gummersbach;<br />
G. Heinze,<br />
Lausitz Energie Kraftwerke AG, Cottbus<br />
Verfahren der Hg-Minderung<br />
– Ein Überblick zu gängigen Maßnahmen<br />
Jan Schütze,<br />
IEM FörderTechnik GmbH, Kastl<br />
Investigations on the separation potential <strong>of</strong><br />
different dust removal systems <strong>for</strong><br />
automatically-fed biomass boilers<br />
M.Sc. Javier Carrillo, M.Sc. Marc Oliver Schmid,<br />
Dr.-Ing. Ulrich Vogt,<br />
IFK, Universität Stuttgart<br />
Schlusswort Ende der Fachtagung<br />
Organisatorische Hinweise<br />
VERANSTALTUNGSWEBSEITE<br />
w https://t1p.de/<strong>vgbe</strong>-bfa<strong>2022</strong> (Kurzlink)<br />
VERANSTALTUNGSORT<br />
Gastwerk Hotel Hamburg<br />
Beim Alten Gaswerk 3<br />
22761 Hamburg<br />
t +49 40 89062-498<br />
e reservation@gastwerk-hotel.de<br />
w www.gastwerk.com<br />
ONLINE-ANMELDUNG<br />
w https://register.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/21622/<br />
ANMELDUNG<br />
Die Anmeldung wird bis zum 19. September <strong>2022</strong> erbeten<br />
(Redaktionsschluss der namentlichen Nennung im<br />
Teilnahmeverzeichnis). Eine spätere Anmeldung, auch im<br />
Tagungsbüro, ist möglich, jedoch ohne Aufnahme in das<br />
Teilnahmeverzeichnis.<br />
TEILNAHMEBEDINGUNGEN<br />
<strong>vgbe</strong>-Mitglieder 620,- €<br />
Nichtmitglieder 780,- €<br />
Hochschulen, Behörden, Ruheständler 300,- €<br />
Studierende<br />
frei mit Nachweis<br />
FACHAUSSTELLUNG<br />
Um Ihre Dienstleistungen und Produkte in den Fokus<br />
zu rücken, bieten wir Ihnen auf der Fachtagung die<br />
Gelegenheit zur Firmenpräsentation:<br />
| Paket P (inkl. 1 Konferenzticket) für<br />
€ 920 + USt. (<strong>vgbe</strong>-Mitglieder*)<br />
€ 1.080 + USt. (Nicht-Mitglieder),<br />
Kontakt:<br />
Steffanie Fidorra-Fränz<br />
t +49 201 8128-299<br />
e steffanie.fidorra-fraenz@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
* Gerne In<strong>for</strong>mieren wir Sie auch über Konditionen<br />
und Leistungen einer <strong>vgbe</strong>-Mitgliedschaft.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
Deilbachtal 173<br />
45257 Essen<br />
be in<strong>for</strong>med<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
Eastern Europe – Energy security <strong>and</strong> coal<br />
Eastern Europe –<br />
Energy security <strong>and</strong> coal<br />
Stephen Mills<br />
Abstract<br />
Osteuropa –<br />
Energieversorgungssicherheit<br />
und Kohle<br />
Osteuropa hat eine komplexe und bewegte Geschichte<br />
und wird weiterhin von internen und<br />
externen Einflüssen geprägt. Viele Faktoren<br />
spielen eine Rolle, z.B. politische und wirtschaftliche<br />
Abhängigkeiten, Gebietsstreitigkeiten<br />
und geteilte Interessen bezüglich wichtiger<br />
Akteure wie der Europäischen Union (EU)<br />
und Russl<strong>and</strong>. Die Frage der Energiesicherheit<br />
in der Region hat nach dem Einmarsch Russl<strong>and</strong>s<br />
in die Ukraine zunehmend an Bedeutung<br />
gewonnen. Russl<strong>and</strong> ist der Hauptlieferant<br />
von Erdgas für weite Teile Europas und<br />
die darauf folgenden Unterbrechungen und<br />
Liefereinschränkungen haben die Risiken<br />
deutlich gemacht, die mit einer übermäßigen<br />
Abhängigkeit von einer einzigen externen<br />
Energiequelle verbunden sind. Viele Länder<br />
prüfen ihr Energieportfolio und versuchen, er-<br />
Autor<br />
Dr Stephen Mills<br />
<strong>International</strong> Centre <strong>for</strong> Sustainable<br />
Carbon (ICSC)<br />
London, United Kingdom<br />
schwingliche und nachhaltige Alternativen zu<br />
Öl, Gas und Kohle aus Russl<strong>and</strong> zu finden.<br />
Dies wird nicht einfach sein, zumindest nicht<br />
auf kurze Sicht. Länder mit einheimischen<br />
Energiereserven wie Stein- und Braunkohle<br />
werden besser in der Lage sein, diese neuen Heraus<strong>for</strong>derungen<br />
zu meistern.<br />
In vielen europäischen Ländern ist die Kohlenutzung<br />
zurückgegangen, was vor allem auf<br />
die EU-Politik und die nationalen Maßnahmen<br />
zur Förderung des verstärkten Einsatzes<br />
erneuerbarer Energien und von Erdgas sowie<br />
auf die höheren Kohlenst<strong>of</strong>fpreise im Rahmen<br />
des EU-Emissionsh<strong>and</strong>elssystems (ETS) zurückzuführen<br />
ist. l<br />
Full report available at<br />
https://www.sustainable-carbon.org/<br />
Eastern Europe has a complex history <strong>and</strong><br />
continues to be shaped by internal <strong>and</strong> external<br />
<strong>for</strong>ces. Political <strong>and</strong> economic alignments,<br />
disputes over territory <strong>and</strong> l<strong>and</strong> annexation,<br />
<strong>and</strong> split loyalties between major players such<br />
as the European Union, China <strong>and</strong> Russia are<br />
contributing factors.<br />
Some eastern European countries are small<br />
<strong>and</strong> poor compared to their western counterparts.<br />
This can limit their available <strong>energy</strong><br />
resources, although several have sizeable reserves<br />
<strong>of</strong> hard coal <strong>and</strong>/or lignite, used to generate<br />
much <strong>of</strong> their electricity. The report covers<br />
the non-European Union (EU) countries <strong>of</strong><br />
Albania, Belarus, Bosnia <strong>and</strong> Herzegovina,<br />
Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia,<br />
Serbia, Turkey <strong>and</strong> Ukraine, some <strong>of</strong><br />
which are c<strong>and</strong>idate EU member states. Others<br />
have closer alignments with Russia or are<br />
more engaged with China, via the Belt <strong>and</strong><br />
Road Initiative. To achieve EU membership<br />
countries must align with the bloc’s commitment<br />
to decarbonise, meaning the eventual<br />
phase-out <strong>of</strong> coal-fired power generation.<br />
However, some lack the resources to fully replace<br />
their coal capacity with sustainable, af<strong>for</strong>dable<br />
alternatives <strong>and</strong> so continue to rely<br />
on their coal-fired power plants <strong>for</strong> electricity.<br />
Funding is limited <strong>for</strong> upgrading or replacing<br />
old, inefficient plant, which means some major<br />
polluting units continue to operate. Thus,<br />
governments <strong>of</strong> some prospective EU member<br />
states face conflicting requirements; they wish<br />
to achieve full EU membership <strong>and</strong> to decarbonise,<br />
but must also have a reliable, af<strong>for</strong>dable<br />
supply <strong>of</strong> electricity. Numerous proposals<br />
<strong>for</strong> new generating capacity assumed they<br />
would be fuelled by Russian gas; <strong>for</strong> many, this<br />
is no longer an option.<br />
The Russian-Ukraine conflict highlights the<br />
fragility <strong>of</strong> <strong>energy</strong> sectors over-reliant on a single<br />
technology or heavily dependent on external<br />
sources <strong>of</strong> <strong>energy</strong>. Some eastern European<br />
countries, including several aspiring EU member<br />
states, are not able to eliminate coal power.<br />
Coal sourced from indigenous reserves or imported<br />
from a portfolio <strong>of</strong> reliable outside suppliers<br />
provides some control <strong>and</strong> stability over<br />
<strong>energy</strong> costs <strong>and</strong> greater security <strong>of</strong> <strong>energy</strong><br />
supply.<br />
Various coal power projects have been proposed<br />
or are under development in eastern<br />
Europe. Some involve upgrading <strong>and</strong> improving<br />
existing plants, others are <strong>for</strong> new plant.<br />
The impact <strong>of</strong> the Russian invasion <strong>of</strong> Ukraine<br />
means that many existing plants are now likely<br />
to operate <strong>for</strong> much longer than previously<br />
anticipated. Despite many earlier plans to use<br />
Russian gas as a direct replacement <strong>for</strong> coal<br />
power, supply uncertainties may incentivise<br />
the development <strong>of</strong> more coal-based power<br />
projects.<br />
Introduction<br />
Eastern Europe has a complex <strong>and</strong> <strong>of</strong>ten<br />
troubled history <strong>and</strong> continues to be shaped<br />
by both internal <strong>and</strong> external <strong>for</strong>ces. Many<br />
factors are in play such as political <strong>and</strong> economic<br />
alignments, disputes over territory<br />
<strong>and</strong> split loyalties between major players<br />
such as the European Union (EU) <strong>and</strong><br />
Russia.<br />
Some countries in the region are EU member<br />
states: Bulgaria, Czechia, Croatia, Hungary,<br />
Pol<strong>and</strong>, Romania <strong>and</strong> the Slovak Republic.<br />
Other ‘c<strong>and</strong>idate countries’ aspire to<br />
join <strong>and</strong> are in the process <strong>of</strong> integrating EU<br />
legislation into national law: Albania, Montenegro,<br />
North Macedonia, Serbia <strong>and</strong> Turkey.<br />
Several others such as Bosnia <strong>and</strong> Her-<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 65
Eastern Europe – Energy security <strong>and</strong> coal<br />
zegovina (BiH), <strong>and</strong> Kosovo are potential<br />
c<strong>and</strong>idate countries, although they do not<br />
yet fulfil the requirements <strong>for</strong> EU membership.<br />
Full EU membership requires c<strong>and</strong>idate<br />
countries to agree to the EU’s plan <strong>for</strong> carbon<br />
neutrality by 2050. The elimination <strong>of</strong><br />
coal power plus a greater reliance on renewables<br />
is seen as a major component <strong>of</strong> this<br />
process, one that wealthier western member<br />
states are increasingly adopting. However,<br />
eastern European countries are <strong>of</strong>ten poorer<br />
<strong>and</strong> continue to rely on electricity generated<br />
by hard coal <strong>and</strong> lignite-fired power plants.<br />
Many lack the resources to fully replace<br />
their coal capacity with sustainable, af<strong>for</strong>dable<br />
alternatives. Various new coal projects<br />
have been proposed, but even where<br />
modern high efficiency, low emissions<br />
(HELE) technology has been suggested,<br />
there has been opposition from the EU. Proposals<br />
to upgrade <strong>and</strong> modernise some existing<br />
plants have also met resistance. But<br />
to comply with EU emission st<strong>and</strong>ards,<br />
many coal power plants need upgrading<br />
<strong>and</strong> equipping with new emission control<br />
systems.<br />
Governments <strong>of</strong> some prospective member<br />
states face conflicting requirements; they<br />
aspire to achieve full EU membership, but<br />
must provide af<strong>for</strong>dable electricity, crucial<br />
<strong>for</strong> their populations <strong>and</strong> economies. Despite<br />
the continued operation <strong>of</strong> some outdated<br />
<strong>and</strong> polluting coal-fired capacity, it<br />
remains the only reliable cost-effective option.<br />
In the absence <strong>of</strong> what governments<br />
consider to be sustainable, af<strong>for</strong>dable alternatives,<br />
some intend to continue its use to<br />
provide at least part <strong>of</strong> their supply. On<br />
grounds <strong>of</strong> <strong>energy</strong> security <strong>and</strong> cost, some<br />
will find the complete elimination <strong>of</strong> coal<br />
power difficult <strong>and</strong> expensive. The situation<br />
has been further complicated by Russia’s invasion<br />
<strong>of</strong> Ukraine <strong>and</strong> the subsequent impact<br />
this has on European <strong>energy</strong> supplies in<br />
general.<br />
The future <strong>for</strong> coal power in<br />
the region?<br />
Tab. 1. Individual Country’s RELIANCE on Coal <strong>for</strong> Power <strong>Generation</strong> (Rogelja, 2020; Couture <strong>and</strong><br />
Kusljugic, 2020; IEA, 2020; Buchholz, 2021; Ruiz <strong>and</strong> others, 2021.<br />
Country<br />
Coal use has been declining in many European<br />
countries, driven mainly by EU <strong>and</strong><br />
national policies promoting the greater deployment<br />
<strong>of</strong> renewables <strong>and</strong> natural gas,<br />
<strong>and</strong> higher carbon prices under the EU’s<br />
Emissions Trading Scheme (ETS). Such<br />
measures have encouraged some countries<br />
to introduce plans to phase out entirely the<br />
use <strong>of</strong> coal <strong>for</strong> power generation. In 2020,<br />
coal provided only 13 % <strong>of</strong> the EU’s electricity,<br />
a level surpassed by combined generation<br />
from wind <strong>and</strong> solar. Coal’s share <strong>of</strong> EU<br />
power supply is now lower than in major<br />
economies such as Australia, China, India,<br />
Japan <strong>and</strong> the USA.<br />
Further reductions are expected over the<br />
next decade, as 14 EU member states have<br />
announced plans to phase out coal during<br />
2025-30. However, several eastern European<br />
countries intend to retain coal-fired power<br />
generation <strong>for</strong> some time. These decisions<br />
are based on issues such as ease <strong>of</strong> availability,<br />
the use <strong>of</strong> indigenous <strong>energy</strong> resources<br />
which benefits the economy <strong>and</strong> promotes<br />
<strong>energy</strong> security, <strong>and</strong> the lack <strong>of</strong> af<strong>for</strong>dable<br />
large-scale alternatives.<br />
Many eastern European countries have traditionally<br />
relied on hard coal <strong>and</strong>/or lignite<br />
<strong>for</strong> at least part <strong>of</strong> their electricity supply<br />
(Table 1) <strong>and</strong> despite aspirations in some to<br />
decarbonise their power sectors, others intend<br />
to continue its use. Countries that use<br />
coal frequently cite combinations <strong>of</strong> the following<br />
reasons:<br />
––<br />
use <strong>of</strong> indigenous <strong>energy</strong> resources;<br />
––<br />
reducing <strong>energy</strong> import dependency;<br />
––<br />
easy availability;<br />
––<br />
enhancing national <strong>energy</strong> security;<br />
––<br />
diversification <strong>of</strong> sources <strong>of</strong> <strong>energy</strong>;<br />
––<br />
cost-effectiveness;<br />
––<br />
growing electricity dem<strong>and</strong> or shortages,<br />
<strong>and</strong> the need to provide an af<strong>for</strong>dable, reliable<br />
electricity supply;<br />
––<br />
coal generates cheaper, more af<strong>for</strong>dable<br />
electricity than alternatives; <strong>and</strong><br />
––<br />
drives economic <strong>and</strong>/or social development.<br />
Countries citing one or more <strong>of</strong> the above<br />
include BiH, Kosovo, Serbia, Montenegro,<br />
Turkey, <strong>and</strong> Ukraine.<br />
Other factors can include scepticism over<br />
the reliability <strong>and</strong> cost-effectiveness <strong>of</strong> intermittent<br />
renewables, <strong>and</strong> concerns over job<br />
losses in the mining sector. In several countries,<br />
the threat <strong>of</strong> unemployment is a major<br />
factor. For example, in Ukraine, in 2021,<br />
nearly 56,000 workers were employed directly<br />
in coal mining, with a further 40,700<br />
in power plants. In BiH, more than 14,000<br />
were engaged in mining, <strong>and</strong> around 2,500<br />
in power plants. In Serbia, the figures were<br />
12,300 <strong>and</strong> 2,900 respectively. There was<br />
also significant employment in the sector in<br />
smaller coal users such as Kosovo, North<br />
Macedonia <strong>and</strong> Montenegro – these run into<br />
the thous<strong>and</strong>s.<br />
Coal generating capacity,<br />
MW<br />
<strong>Electricity</strong> from coal, % in a<br />
typical year<br />
Albania 98 0<br />
BiH 2156 65–75<br />
Kosovo 1288 95–98<br />
Montenegro 225 45–55<br />
North Macedonia 1283 50–51<br />
Serbia 4353 67–71<br />
Belarus – 0<br />
Ukraine 2184 30<br />
Moldova 2520 0<br />
Turkey 20,323 33–36<br />
* Single plant capable <strong>of</strong> firing coal, oil <strong>and</strong> gas<br />
There are around 50 coal-fired power plants<br />
operating in the Western Balkans <strong>and</strong><br />
Ukraine, with a total installed capacity <strong>of</strong><br />
around 35 GW. Roughly 70 % <strong>of</strong> these<br />
plants, amounting to 26 GW, are hard coalfired<br />
<strong>and</strong> located in Ukraine. The remaining<br />
8.7 GW fire indigenous lignite <strong>and</strong> are scattered<br />
mainly across Serbia, BiH, Kosovo,<br />
North Macedonia <strong>and</strong> Montenegro. Of the<br />
countries considered in this report, Turkey is<br />
the largest regional coal power user, with<br />
over 25 individual plants totalling around<br />
20 GW installed capacity.<br />
In more affluent EU member states, coal is<br />
being partly supplanted by increases in capacity<br />
based on intermittent renewables,<br />
mainly wind <strong>and</strong> solar. However, the impact<br />
on some eastern European countries has<br />
been more limited, with very low levels <strong>of</strong><br />
uptake. Of the 17,000 MW <strong>of</strong> renewables installed<br />
across Europe in 2019, Pol<strong>and</strong> accounted<br />
<strong>for</strong> just 39 MW, Czechia 26 MW,<br />
Romania 5 MW <strong>and</strong> Bulgaria 3 MW. Bosnia<br />
had 87 MW <strong>of</strong> wind power <strong>and</strong> 22 MW <strong>of</strong> solar,<br />
<strong>and</strong> Serbia had 360 MW <strong>of</strong> wind <strong>and</strong><br />
10 MW <strong>of</strong> solar power.<br />
There are various reasons why the uptake <strong>of</strong><br />
renewables has lagged far behind that <strong>of</strong><br />
western countries – both regions face different<br />
challenges. The EU is attempting to unify<br />
national <strong>energy</strong> policies between eastern<br />
<strong>and</strong> western Europe. However, some eastern<br />
European governments fear that as fossil fuels<br />
are phased out, their national <strong>energy</strong><br />
prices are likely to be disproportionally affected.<br />
In the west, prices are unlikely to increase<br />
significantly, whereas, in parts <strong>of</strong> eastern<br />
Europe, the concern is that the impact is<br />
likely to be much greater.<br />
The deployment <strong>of</strong> modern coal-fired power<br />
technologies can contribute towards meeting<br />
several Sustainable development goals<br />
– SDGs – the most relevant Goals are summarised<br />
in Ta b l e 2 . The potential contribution<br />
<strong>of</strong> deploying modern coal-fired power<br />
systems in parts <strong>of</strong> eastern Europe is summarised<br />
in Ta b l e 3 .<br />
66 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Eastern Europe – Energy security <strong>and</strong> coal<br />
Tab. 2. Selected United Nations Sustainable Development Goals (SDGS).<br />
Goal<br />
Aims<br />
7 – Af<strong>for</strong>dable clean <strong>energy</strong> Ensure universal access to af<strong>for</strong>dable, reliable <strong>and</strong> modern<br />
<strong>energy</strong> services by 2030. This includes enhancing international<br />
collaboration to facilitate access to clean <strong>energy</strong> research <strong>and</strong><br />
technology, including cleaner fossil fuel technology.<br />
9 – Industry, innovations <strong>and</strong><br />
infrastructure<br />
12 – Responsible consumption<br />
<strong>and</strong> production<br />
Plans <strong>for</strong> new coal power<br />
projects in Eastern Europe<br />
Eastern Europe’s coal resources are particularly<br />
important to the power sector. In 2018,<br />
there were around 65 major mines producing<br />
hard coal <strong>and</strong> lignite [Ruiz <strong>and</strong> others,<br />
2021]. For example, Turkish reserves comprise<br />
around 551 Gt <strong>of</strong> hard coal <strong>and</strong><br />
10,975 Gt <strong>of</strong> lignite <strong>and</strong> produced a total <strong>of</strong><br />
101.5 Mt in that year, <strong>of</strong> which 87 Mt was directed<br />
to the power sector.<br />
Significant amounts <strong>of</strong> coal are produced in<br />
Ukraine, Serbia, BiH, Kosovo, North Macedonia,<br />
Montenegro, <strong>and</strong> Turkey. Fossil fuels<br />
are used to generate a combined total <strong>of</strong><br />
61% <strong>of</strong> the electricity produced in Albania,<br />
Build resilient infrastructure, promote sustainable<br />
industrialisation <strong>and</strong> foster innovation. The aim is to upgrade<br />
certain aspects <strong>of</strong> industry by 2030 in order to make them more<br />
sustainable, with increased resource-use efficiency, whilst<br />
adopting clean <strong>and</strong> environmentally sound technologies.<br />
Ensure sustainable consumption <strong>and</strong> production patterns. Aims<br />
include the environmentally sound management <strong>of</strong> wastes<br />
throughout their life cycle, <strong>and</strong> significantly reducing any<br />
adverse impacts on human health <strong>and</strong> the environment.<br />
13 – Climate action Take urgent action to combat climate change <strong>and</strong> its impacts.<br />
17 – Partnership <strong>for</strong> the goals Revitalise the global partnership <strong>for</strong> sustainable development<br />
through improved international cooperation on topics that<br />
include <strong>energy</strong> technologies with a low environmental impact.<br />
Tab. 3. The Potential Contribution <strong>of</strong> Modern Coal Power in Meeting un SDGS in Eastern<br />
Europe.<br />
Goal<br />
7 – Af<strong>for</strong>dable clean <strong>energy</strong> Provision <strong>of</strong> af<strong>for</strong>dable, reliable, sustainable electricity supply.<br />
Modern coal power plants can produce very low emission levels.<br />
Their high efficiency generates less CO 2 per unit <strong>of</strong> electricity<br />
than older technologies.<br />
Coal consumption per unit <strong>of</strong> electricity is lower.<br />
9 – Industry, innovations <strong>and</strong><br />
infrastructure<br />
12 - Responsible consumption<br />
<strong>and</strong> production<br />
Many existing coal power plants in the region are outdated <strong>and</strong><br />
polluting – they need modernising or replacing with newer<br />
technologies.<br />
Several HELE technologies are now available in the 300–400 MW<br />
range, making them suitable <strong>for</strong> countries with modest <strong>energy</strong><br />
needs or as backup where capacity based on intermittent<br />
renewables is significant.<br />
A sound, reliable electricity sector is a prerequisite <strong>for</strong><br />
meaningful, sustainable economic <strong>and</strong> social development.<br />
A suite <strong>of</strong> emission control systems can be applied to modern<br />
coal power plants, greatly reducing emissions to air, l<strong>and</strong> <strong>and</strong><br />
water.<br />
Emissions from some existing plants are currently excessive –<br />
replacement with HELE technologies would minimise adverse<br />
impacts on human health <strong>and</strong> the environment.<br />
13 – Climate action Modern coal power plants use less coal <strong>and</strong> produce lower CO2<br />
levels per unit <strong>of</strong> electricity than older systems.<br />
Modern plants have potential <strong>for</strong> equipping with CCUS, reducing<br />
CO 2 levels further.<br />
C<strong>of</strong>iring coal with biomass in power plants helps mitigate CO2<br />
emissions.<br />
17 – Partnership <strong>for</strong> the goals HELE technologies have been successfully established in many<br />
countries.<br />
Projects <strong>of</strong>ten involve significant international collaboration<br />
between national <strong>and</strong> international technology developers,<br />
vendors, <strong>and</strong> utilities.<br />
BiH, Kosovo, Montenegro, North Macedonia<br />
<strong>and</strong> Serbia. Some regional governments<br />
have pledged to follow the EU on its path towards<br />
a carbon-neutral economy by 2050,<br />
although in many cases, this has yet to be<br />
reflected in concrete actions, <strong>and</strong> some<br />
countries are proceeding with plans to refurbish<br />
existing coal-fired <strong>energy</strong> capacity or<br />
commission new plants.<br />
However, EU legislation such as the Industrial<br />
Emissions Directive (IED) is having an<br />
impact on coal power in the region, <strong>and</strong><br />
some older coal plants could be closed within<br />
the next few years. Around<br />
10 units in Serbia, Montenegro <strong>and</strong> BiH,<br />
with a combined capacity <strong>of</strong> around 1 GW,<br />
are currently operating under the EU’s optout<br />
mechanism, one <strong>of</strong> the implementation<br />
alternatives under the Directive. It provides<br />
the possibility <strong>for</strong> an exemption <strong>of</strong> individual<br />
plants from the compliance regime, although<br />
it limits their operating hours to a<br />
maximum <strong>of</strong> 20,000 between 1 January<br />
2018 <strong>and</strong> 31 December 2023. However, Russia’s<br />
invasion <strong>of</strong> Ukraine <strong>and</strong> the subsequent<br />
impact on <strong>energy</strong> supplies throughout much<br />
<strong>of</strong> the region could result in some operational<br />
lifetimes being extended to maintain <strong>energy</strong><br />
security.<br />
Most <strong>of</strong> these units that could be closed are<br />
older, small-capacity subcritical units <strong>of</strong> low<br />
efficiency <strong>and</strong> with high emissions. Individual<br />
countries are at different stages in addressing<br />
air pollution in terms <strong>of</strong> national<br />
strategies, policy development, funding,<br />
monitoring <strong>and</strong> reporting. In the run-up to<br />
the United Nations Climate Change Conference<br />
(COP26) conference <strong>of</strong> November<br />
2021, several announced plans to reduce<br />
emissions <strong>and</strong> deadlines <strong>for</strong> achieving carbon<br />
neutrality.<br />
The environmental impact <strong>of</strong> coal-fired<br />
power generation in eastern Europe <strong>and</strong> beyond<br />
has frequently been highlighted as an<br />
area <strong>of</strong> concern – emissions <strong>of</strong> SO 2 , NO x <strong>and</strong><br />
particulates <strong>of</strong>ten exceed permitted limits.<br />
SO 2 <strong>and</strong>/or particulates are the most frequent<br />
<strong>and</strong> persistent pollutants to exceed<br />
legislation thresholds, particularly in BiH,<br />
Serbia, Kosovo, <strong>and</strong> North Macedonia. For<br />
example, in 2019, total SO 2 emissions from<br />
coal power plants in these countries reached<br />
nearly six times the amount allowed by the<br />
countries’ plans.<br />
There are 16 major lignite power plants in<br />
BiH, North Macedonia, Montenegro, Serbia,<br />
<strong>and</strong> Kosovo, that have been famously cited<br />
as emitting as much SO 2 <strong>and</strong> particulates in<br />
2016 as all the EU’s 250 coal plants combined.<br />
However, remedial works have<br />
since been undertaken or are progressing<br />
at a number <strong>of</strong> sites. For example, the Ugljevik<br />
power plant in BiH <strong>for</strong>merly emitted<br />
up to 50 tSO 2 /GWh, but has recently<br />
been equipped with flue gas desulphurisation<br />
(FGD), dramatically reducing emission<br />
levels.<br />
Likewise, in Serbia, remedial works undertaken<br />
at the Nikola Tesla A <strong>and</strong> B plants have<br />
included various overhauls, the upgrading<br />
<strong>of</strong> mills, <strong>and</strong> installation <strong>of</strong> FGD units <strong>and</strong><br />
low NOx burners. Such ef<strong>for</strong>ts are important<br />
as emissions to air are not restricted by national<br />
borders, <strong>and</strong> trans-boundary dispersion<br />
means that pollutants can spread into<br />
neighbouring countries or regions.<br />
Many eastern European countries are signatories<br />
to the EU’s Energy Community Treaty<br />
that came into <strong>for</strong>ce in 2006, including Albania,<br />
BiH, Kosovo, Montenegro, North Macedonia,<br />
<strong>and</strong> Serbia. The treaty aims to integrate<br />
<strong>energy</strong> markets in the region with that<br />
<strong>of</strong> the EU <strong>and</strong> apply appropriate environ-<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 67
Eastern Europe – Energy security <strong>and</strong> coal<br />
mental legislation in the <strong>energy</strong> sector, such<br />
as commitments to reduce emissions <strong>of</strong> SO 2 ,<br />
NO x <strong>and</strong> particulates from coal plants. EU<br />
membership commits countries to adopt<br />
stricter emissions st<strong>and</strong>ards, liberalise their<br />
<strong>energy</strong> sectors, <strong>and</strong> transpose relevant parts<br />
<strong>of</strong> EU law into national legislation. Despite<br />
these requirements, several EU c<strong>and</strong>idate<br />
countries intend to continue using coal <strong>for</strong><br />
at least part <strong>of</strong> their power generation mix.<br />
In some cases, this involves the development<br />
<strong>of</strong> new coal-fired projects, <strong>and</strong> in others, the<br />
updating <strong>and</strong> modernisation <strong>of</strong> existing facilities,<br />
thereby extending their lifetimes.<br />
There is a requirement <strong>for</strong> specific plants to<br />
comply with the EU IED, although in some<br />
cases, this has not been met. In 2019, all<br />
countries in the region exceeded their emission<br />
limits at some point, especially <strong>for</strong> SO 2<br />
<strong>and</strong> particulates. Emissions from some<br />
plants continue to exceed the ceiling agreed<br />
with the Energy Community, <strong>and</strong> there have<br />
been numerous cases <strong>of</strong> non-compliance<br />
that have not been rectified by successive<br />
governments.<br />
Many coal-fired units in eastern Europe are<br />
outdated <strong>and</strong> require refurbishment <strong>and</strong><br />
modernisation. As a result, some older lignite-fired<br />
capacity has been closed, although<br />
other plants have been retr<strong>of</strong>itted with emissions<br />
control systems. There are also proposals<br />
or projects in development aimed at improving<br />
the efficiency <strong>and</strong> reducing the environmental<br />
impact <strong>of</strong> other facilities.<br />
However, not all environmental upgrading<br />
projects have progressed smoothly. For example,<br />
an FGD unit was added to the Kostolac<br />
B plant in Serbia <strong>and</strong> since h<strong>and</strong>-over,<br />
there have been reports that the plant exceeded<br />
its emissions limits on a number <strong>of</strong><br />
occasions. It remains unclear why this happened<br />
<strong>and</strong> whether the situation has been<br />
fully resolved. In other cases, the Covid-19<br />
p<strong>and</strong>emic has delayed progress. Trial operations<br />
<strong>of</strong> a new FGD unit at the Ugljevik power<br />
plant in BiH were halted temporarily, only<br />
resuming when Mitsubishi Power staff were<br />
able to return.<br />
Energy security<br />
The issue <strong>of</strong> <strong>energy</strong> security in the region<br />
has become increasingly important following<br />
Russia’s invasion <strong>of</strong> Ukraine. Russia is<br />
the major provider <strong>of</strong> natural gas to much<br />
<strong>of</strong> Europe, <strong>and</strong> the subsequent interruptions<br />
<strong>and</strong> reduced supply have highlighted<br />
the risks associated with over-reliance<br />
on a single external source <strong>of</strong> <strong>energy</strong>. Many<br />
countries are re-assessing their <strong>energy</strong> portfolios<br />
<strong>and</strong> attempting to find af<strong>for</strong>dable, sustainable<br />
alternatives to Russian oil, gas <strong>and</strong><br />
coal. This will not be easy, at least in<br />
the near term. Those with indigenous <strong>energy</strong><br />
reserves such as hard coal <strong>and</strong> lignite<br />
will be better placed to meet these new challenges.<br />
There are various projects <strong>and</strong> proposals <strong>for</strong><br />
new coal power developments in Bosnia,<br />
Serbia, Turkey, <strong>and</strong> North Macedonia. Some<br />
are well advanced in their development although<br />
others are unlikely to go ahead, even<br />
though the electricity generated would be<br />
much cleaner <strong>and</strong> more af<strong>for</strong>dable than that<br />
currently being produced by outdated power<br />
plants. Thus, in some eastern European<br />
countries, coal power will not be disappearing<br />
soon, but future developments are likely<br />
to take two <strong>for</strong>ms: all-new coal units or modernisation<br />
<strong>of</strong> existing older capacity.<br />
Clearly, the immediate issue facing many<br />
European governments is the impact <strong>of</strong> the<br />
war in Ukraine <strong>and</strong> the increasing sanctions<br />
on Russian fossil fuels. Many countries rely<br />
heavily on Russian <strong>energy</strong> supplies or have<br />
planned to use Russian gas to replace coalfired<br />
capacity. However, in general, this is no<br />
longer a realistic option. Governments are<br />
increasingly examining ways to improve<br />
their <strong>energy</strong> security, <strong>and</strong> the focus on the<br />
use <strong>of</strong> indigenous <strong>energy</strong> sources has increased.<br />
In some countries, this may provide<br />
added impetus <strong>for</strong> the life-extension <strong>of</strong> existing<br />
coal power capacity development <strong>and</strong><br />
possibly new coal-based power projects.<br />
The Russian invasion <strong>of</strong> Ukraine has highlighted<br />
the fragility <strong>of</strong> <strong>energy</strong> sectors overreliant<br />
on a single technology or heavily dependent<br />
on external sources <strong>of</strong> <strong>energy</strong>. Future<br />
<strong>energy</strong> planning <strong>and</strong> strategy should<br />
re-evaluate <strong>and</strong> consider the advantages<br />
that can be provided through the deployment<br />
<strong>of</strong> modern, highly efficient coal-fired<br />
power plants, with carbon capture <strong>and</strong> storage,<br />
ideally as part <strong>of</strong> a mixed portfolio <strong>of</strong><br />
<strong>energy</strong> sources. The effective use <strong>of</strong> indigenous<br />
reserves <strong>of</strong> coal or lignite could be a<br />
major factor, providing a buffer against external<br />
events, <strong>and</strong> boosting national <strong>energy</strong><br />
security.<br />
This executive summary including the conclusions<br />
<strong>of</strong> the full study is based on a detailed<br />
study which is available separately<br />
from: www.sustainable-carbon.org.<br />
This is a summary per<strong>for</strong>med by the <strong>vgbe</strong><br />
<strong>energy</strong> <strong>journal</strong> editorial <strong>of</strong> the report: Eastern<br />
Europe–Energy security <strong>and</strong> coal by Stephen<br />
Mills, ICSC/321, ISBN 978-2-9029-<br />
644-7, 107 pp, July <strong>2022</strong>, London, United<br />
Kingdom. l<br />
VGB-St<strong>and</strong>ard<br />
Guideline <strong>for</strong> the Testing <strong>of</strong> DeNOx-catalysts<br />
VGB-S-302-00-2013-04-EN (VGB-S-302-00-2013-04-DE, German edition)<br />
DIN A4, Print/eBook, 68 Pages, Price <strong>for</strong> <strong>vgbe</strong>-Members € 120.–, Non-Members € 190.–, + Shipping & VAT<br />
The purpose <strong>of</strong> this VGB-St<strong>and</strong>ard is to manifest a testing procedure, which can be employed by<br />
catalyst manufacturers, SCR equipment suppliers, power plant operators<br />
<strong>and</strong> independent testing institutions <strong>for</strong> determining the characteristics <strong>of</strong> SCR catalysts. The most<br />
important characteristics are guaranteed in the purchase contracts, deviation from these, which are<br />
penalized, need to be manifested under the agreed upon boundary conditions (i.e. testing conditions).<br />
NOx emissions from stationary combustion sources can be reduced by a variety <strong>of</strong> primary measures<br />
in the furnace or by secondary measures downstream.<br />
The so called Selective Catalytic Reduction (SCR process) has become the world’s most widely applied<br />
technology <strong>for</strong> secondary NOx reduction from combustion processes. This is particularly true when<br />
high NOx removal efficiencies (80 to 90 %) are required.<br />
Smaller plants (i.e. waste-to-<strong>energy</strong>, biomass, etc.) also use the so called Selective Non Catalytic<br />
Reduction (SNCR-process) reducing NOx in the gas phase without employing a catalyst.<br />
VGB-St<strong>and</strong>ard<br />
Guideline <strong>for</strong> the Testing<br />
<strong>of</strong> DeNOx-catalysts<br />
VGB-S-302-00-2013-04-EN<br />
(<strong>for</strong>merly VGB-R 302e)<br />
* Access <strong>for</strong> eBooks (PDF files) is included in the membership fees <strong>for</strong> Ordinary Members (operators, plant owners) <strong>of</strong> <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
68 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
<strong>vgbe</strong> Fachtagung<br />
Stilllegung und Rückbau<br />
von Energie- und Industrieanlagen <strong>2022</strong><br />
5. und 6. Oktober <strong>2022</strong><br />
in Velbert | Best Western Plus Parkhotel | mit Fachausstellung<br />
Stilllegung und Rückbau<br />
von Energie- und<br />
Industrieanlagen <strong>2022</strong><br />
Am 5. und 6. Oktober <strong>2022</strong> findet die 3. <strong>vgbe</strong> Fachtagung zum Thema<br />
„Stilllegung und Rückbau“ in Velbert statt, die sich erneut mit der<br />
gesamten B<strong>and</strong>breite der Energieerzeugungsanlagen von konventionell<br />
bis erneuerbar beschäftigt.<br />
Die Fachtagung mit Ausstellung richtet sich an Betreiber dieser Anlagen,<br />
aber auch an Mitarbeitende von Ingenieurbüros, Unternehmen,<br />
Planern, Genehmigungsbehörden und Forschungseinrichtungen.<br />
Auf der Veranstaltung bietet sich die Gelegenheit zum<br />
Austausch mit Fachkollegen über aktuelle Themen von der Genehmigung<br />
und Planung, Außerbetriebnahme über die Trockenlegung<br />
und den Rückbau bis hin zur Nachnutzung von Anlagen und Flächen<br />
zur Energieerzeugung. Als Themen werden unter <strong>and</strong>erem beh<strong>and</strong>elt:<br />
| Beschleunigung von Genehmigungsverfahren<br />
| Nachhaltige Rückbaukonzepte und Herstellerverantwortung<br />
| Sicherheitskultur, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz<br />
| Fehlervermeidung bei der Schadst<strong>of</strong>fsanierung<br />
| Abbruchstatik<br />
| Br<strong>and</strong>schutz<br />
| Erfahrungsberichte zum Rückbau konventioneller Anlagen<br />
| Rückbau und Repowering von Windenergieanlagen<br />
| Offshore Windparks – Rückbauszenarien<br />
| Umnutzung und Nachnutzungskonzepte<br />
Ziel der Veranstaltung ist es, die in der Praxis von Betreibern von<br />
Energie- und Industrieanlagen sowie von im Energiebereich tätigen<br />
Unternehmen gesammelten Erfahrungen vorzustellen und Hilfestellungen<br />
für den Umgang mit der Stilllegung und dem Rückbau von<br />
konventionellen bis hin zu Windenergieanlagen zu geben. <strong>vgbe</strong> stellt<br />
den Teilnehmenden eine Platt<strong>for</strong>m für den Erfahrungsaustausch unter<br />
Experten bereit, um die anstehenden Heraus<strong>for</strong>derungen vom<br />
Auslaufbetrieb über den Rückbau bis hin zur Nachnutzung von<br />
Energie- und Industrieanlagen sicherer, effizienter und wirtschaftlicher<br />
bewältigen zu können.<br />
Weitere In<strong>for</strong>mationen zur Veranstaltung finden Sie unter:<br />
https://t1p.de/<strong>vgbe</strong>-SR<strong>2022</strong>/ (Kurzlink)<br />
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme bei der <strong>vgbe</strong> Fachtagung<br />
„Stilllegung und Rückbau von Energie- und Industrieanlagen <strong>2022</strong>“<br />
im Oktober dieses Jahres in Velbert.<br />
Tagungsprogramm<br />
Änderungen vorbehalten<br />
MITTWOCH, 5. OKTOBER <strong>2022</strong><br />
12:45 Registrierung, Kaffee<br />
13:30-<br />
13:40<br />
13:40-<br />
14:10<br />
S1.1<br />
14:10-<br />
14:40<br />
S1.2<br />
14:40-<br />
15:05<br />
S1.3<br />
15:05-<br />
15:30<br />
S1.4<br />
15:30-<br />
16:00<br />
16:00-<br />
16:30<br />
S2.1<br />
16:30-<br />
17:00<br />
S2.2<br />
17:00-<br />
17:30<br />
S2.3<br />
Begrüßung zur Veranstaltung<br />
Dr. Thomas Eck, Leiter Kraftwerkstechnologien<br />
und Umwelttechnik, <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V., Essen<br />
SEKTION 1 – Grundlagen<br />
(Recht, Arbeitssicherheit, Statik)<br />
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren –<br />
aber wie?<br />
Dr. Peter Kers<strong>and</strong>t, AVR – Andrea Versteyl<br />
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB,<br />
Berlin<br />
Sicherheitskultur – Human Per<strong>for</strong>mance Tools<br />
Frank Heinrich, PreussenElektra GmbH, Hannover<br />
Abbruchstatik nach VDI 6210<br />
Markus Rost, Constructure GmbH, Düsseldorf<br />
Br<strong>and</strong>schutz beim Rückbau<br />
Michael Lischewski, DMT GmbH & Co. KG, Dortmund<br />
Kaffeepause<br />
SEKTION 2 – Windenergieanlagen von A bis Z<br />
Herstellerverantwortung für Windenergieanlagen – alte<br />
Hüte oder neue Konzepte?<br />
Dr. Petra Weißhaupt, M.A.,<br />
Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau<br />
Nachhaltiger Rückbau von Windenergieanlagen<br />
Annette Nüsslein, RDRWind e.V., Hannover<br />
Darstellung von Rückbaukonzepten für<br />
Windenergieanlagen – Lessons Learnt<br />
Sebastian Wesch, Hagedorn Service GmbH, Gütersloh<br />
18:30 Get-together<br />
Ihr <strong>vgbe</strong>-Team<br />
Online-Anmeldung<br />
https://register.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/22622/<br />
Kontakt (Teilnahme)<br />
Barbara Bochynski | t +49 201 8128-205 |<br />
e <strong>vgbe</strong>-rueckbau@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
DONNERSTAG, 6. OKTOBER <strong>2022</strong><br />
09:00-<br />
09:30<br />
S3.1<br />
09:30-<br />
10:00<br />
S3.2<br />
10:00-<br />
10:30<br />
S3.3<br />
SEKTION 3 – Praxisbeispiele Rückbau<br />
konventionelle Anlagen<br />
Rückbau KW Moorburg<br />
Thomas Pietzsch<br />
Vattenfall Heizkraftwerk Moorburg GmbH, Hamburg<br />
Von der Stilllegung / Trockenlegung bis zum<br />
Rückbau von konventionellen Kraftwerken<br />
Ansgar Vierhaus,<br />
RWE Technology <strong>International</strong> GmbH, Essen<br />
Die Rückbauprojekte der<br />
VERBUND Thermal Power GmbH & Co KG<br />
DI Thomas Zagler und DI Martin Hochfellner, VERBUND<br />
Thermal Power GmbH & Co KG, Mellach, Österreich<br />
10:30 Kaffeepause<br />
SEKTION 4 – Sonderthemen<br />
11:30-<br />
12:00<br />
S4.1<br />
12:00-<br />
12:30<br />
S4.2<br />
12:30-<br />
13:00<br />
S4.3<br />
Rücknahme von Kondensatorrohren<br />
als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie<br />
Dr. Andreas Gahl,<br />
MPG Mendener Präzisionsrohr GmbH, Menden<br />
Fehlervermeidung in der Planung und Ausführung<br />
von Schadst<strong>of</strong>fsanierungen<br />
Dr. Stefan Henning,<br />
Ingenieurbüro Dr. Stefan Henning, Dortmund<br />
Offshore Windparks – Entwicklung und Bewertung<br />
von Rückbauszenarien<br />
Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. Silke Eckardt, Hochschule Bremen, Bremen<br />
13:00 Mittagspause<br />
SEKTION 5 - St<strong>and</strong>ortentwicklung,<br />
Nachnutzung und Relokation<br />
14:00-<br />
14:30<br />
S5.1<br />
14:30-<br />
15:00<br />
S5.2<br />
15:00-<br />
15:30<br />
S5.3<br />
ca. 15:30<br />
Repurposing Coal Power Plants (RECPP)<br />
als europäischer Ansatz –<br />
zukünftige Roadmap und Toolbox<br />
Dr. Thomas Eck, <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V., Essen<br />
„Flächenfraß verhindern – Ungenutzte Areale<br />
recyceln, anstatt neue Flächen zu versiegeln“<br />
Rick Mädel, GF Hagedorn Revital GmbH, Gütersloh<br />
GuD Öresundsverket – alternative Nutzungsideen<br />
und finaler Verkauf der Anlage zur Relokation<br />
Dr. Arne Krist<strong>of</strong>fer Bayer, Alex<strong>and</strong>er Micajkov,<br />
Uniper Kraftwerke GmbH, Düsseldorf<br />
Ende der Veranstaltung<br />
Organisatorische Hinweise<br />
VERANSTALTUNGSWEBSEITE<br />
w https://t1p.de/<strong>vgbe</strong>-SR<strong>2022</strong>/ (Kurzlink)<br />
VERANSTALTUNGSORT<br />
Best Western Plus Parkhotel, Velbert<br />
Günther-Weisenborn-Straße 7<br />
42549 Velbert<br />
t +49 2051 4920<br />
e info@parkhotel.nrw<br />
w www.parkhotel.nrw<br />
ONLINE-ANMELDUNG<br />
w https://register.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>/21622/<br />
ANMELDUNG<br />
Die Anmeldung wird bis zum 23. September <strong>2022</strong> erbeten<br />
(Redaktionsschluss der namentlichen Nennung im<br />
Teilnahmeverzeichnis). Eine spätere Anmeldung, auch im<br />
Tagungsbüro, ist möglich, jedoch ohne Aufnahme in das<br />
Teilnahmeverzeichnis.<br />
TEILNAHMEBEDINGUNGEN<br />
<strong>vgbe</strong>-Mitglieder 750,- €<br />
Nichtmitglieder 950,- €<br />
Hochschulen, Behörden, Ruheständler 350,- €<br />
Studierende<br />
frei mit Nachweis<br />
FACHAUSSTELLUNG<br />
Um Ihre Dienstleistungen und Produkte in den Fokus<br />
zu rücken, bieten wir Ihnen auf der Fachtagung die<br />
Gelegenheit zur Firmenpräsentation:<br />
| Paket P für<br />
400,00 € + USt. (<strong>vgbe</strong>-Mitglieder)<br />
500,00 € + USt. (Nicht-Mitglieder*)<br />
Kontakt:<br />
Steffanie Fidorra-Fränz<br />
t +49 201 8128-299<br />
e steffanie.fidorra-fraenz@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
* Gerne In<strong>for</strong>mieren wir Sie auch über Konditionen<br />
und Leistungen einer <strong>vgbe</strong>-Mitgliedschaft.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
Deilbachtal 173<br />
45257 Essen<br />
be in<strong>for</strong>med<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
IEA – Empowering people to act<br />
Empowering people to act:<br />
How awareness <strong>and</strong> behaviour<br />
campaigns can enable citizens to<br />
save <strong>energy</strong> during <strong>and</strong> beyond<br />
today’s <strong>energy</strong> crisis<br />
Brian Motherway, Kristina Klimovich, Emma Mooney <strong>and</strong> Céline Gelis<br />
Abstract<br />
Bürger beim H<strong>and</strong>eln unterstützen:<br />
Wie Sensibilisierungs- und<br />
Empfehlungskampagnen die Bürger in<br />
die Lage versetzen können, während<br />
der heutigen Energiekrise und darüber<br />
hinaus Energie zu sparen<br />
Eine globale Sicht auf die Nachfrageseite der<br />
Energieversorgung war noch nie so wichtig<br />
wie heute. Versorgungsunsicherheit, hohe<br />
Preise und dringende Klimaziele weisen auf<br />
den Wert von Energieeffizienz und Energieeinsparungen<br />
hin. Die Regierungen reagieren darauf<br />
mit verschiedenen Maßnahmen, darun-<br />
Autors<br />
<strong>International</strong> Energy Agency – IEA<br />
Brian Motherway<br />
Head <strong>of</strong> Energy Efficiency<br />
Kristina Klimovich<br />
Programme Officer - Energy Efficiency<br />
Hub<br />
Emma Mooney<br />
Energy Analyst, Energy Efficiency<br />
Céline Gelis<br />
Intern, Energy Efficiency<br />
Paris, France<br />
ter gezielten Zuschüssen und Kampagnen zur<br />
Nachfragereduzierung. Gut konzipierte Kampagnen<br />
können die Bürger dazu motivieren,<br />
ihren Energieverbrauch zu senken. Es wurde<br />
viel darüber gelernt, wie man Kampagnen zur<br />
Bewusstseinsbildung und Verhaltensänderung<br />
ausgestaltet, um eine maximale Wirkung<br />
zu erzielen. Vier Schlüsselkonzepte sind dabei<br />
entscheidend: Die richtige Botschaft vermitteln.<br />
Vermittlung der Botschaft. Die Kombination<br />
von In<strong>for</strong>mationen mit Erkenntnissen<br />
über das Verhalten. Kampagnen für einen Krisenkontext.<br />
l<br />
A global focus on the dem<strong>and</strong> side <strong>of</strong> the <strong>energy</strong><br />
equation has never been more important.<br />
Supply uncertainty, high prices <strong>and</strong><br />
urgent climate targets all point to the value<br />
<strong>of</strong> <strong>energy</strong> efficiency <strong>and</strong> <strong>energy</strong> savings.<br />
Governments are responding with various<br />
measures including targeted grants <strong>and</strong> dem<strong>and</strong>-reduction<br />
campaigns. At the IEA’s recent<br />
7th Annual Global Conference on Energy<br />
Efficiency, <strong>energy</strong> ministers from around<br />
the world agreed that “<strong>energy</strong> efficiency <strong>and</strong><br />
dem<strong>and</strong> side action have a particularly important<br />
role to play now as global <strong>energy</strong><br />
prices are high <strong>and</strong> volatile, hurting households,<br />
industries <strong>and</strong> entire economies” <strong>and</strong><br />
called on “all governments, industry, enterprises<br />
<strong>and</strong> stakeholders to strengthen their<br />
action on <strong>energy</strong> efficiency.”<br />
This commentary was originally published online<br />
on the website <strong>of</strong> the <strong>International</strong> Energy<br />
Agency, IEA, www.iea.org<br />
Well-designed campaigns can motivate people<br />
to reduce their <strong>energy</strong> use. For example,<br />
in the United States, some estimates suggest<br />
that up to 20 % <strong>of</strong> home <strong>energy</strong> dem<strong>and</strong><br />
could potentially be saved from behavioural<br />
changes in the residential sector. One estimate<br />
<strong>for</strong> India suggests the potential <strong>for</strong> <strong>energy</strong><br />
savings through behavioural adjustments<br />
to be in the range <strong>of</strong> 3.4 to 10.2 TWh<br />
per year by 2030. The IEA’s 2021 report The<br />
Potential <strong>of</strong> Behavioural Interventions <strong>for</strong><br />
Optimising Energy Use at Home shows that<br />
campaigns can achieve a wide range <strong>of</strong> impacts<br />
in terms <strong>of</strong> amounts <strong>of</strong> <strong>energy</strong> saved.<br />
Even beyond today’s <strong>energy</strong> crisis, IEA modelling<br />
highlights the importance <strong>of</strong> behavioural<br />
measures <strong>for</strong> achieving net zero targets.<br />
Many lessons have been learned on how to<br />
design awareness <strong>and</strong> behaviour change<br />
campaigns to achieve maximum effect. It is<br />
clear that good design matters – simply<br />
transmitting in<strong>for</strong>mation will not change behaviour<br />
<strong>and</strong> poorly designed campaigns <strong>of</strong>ten<br />
do not deliver their expected impact.<br />
The choice <strong>of</strong> message, the tone, how the<br />
campaign is designed <strong>and</strong> the transmission<br />
channels, can all fundamentally affect the<br />
resulting impact on behaviour. Four key concepts<br />
are crucial:<br />
––<br />
Getting the message right<br />
––<br />
Getting the message across<br />
––<br />
Combining in<strong>for</strong>mation with behavioural<br />
insights<br />
––<br />
Campaigns <strong>for</strong> a crisis context<br />
Getting the message right<br />
The correct messaging sets the foundation<br />
<strong>for</strong> an effective awareness campaign.<br />
The first choice is narrative: what themes or<br />
stories will be used to communicate the issues<br />
<strong>and</strong> prompt the desired actions. Campaigns<br />
typically focus the narrative around<br />
three approaches:<br />
1 Saving money: <strong>for</strong> example, the America<br />
Saves save <strong>energy</strong> save money campaign<br />
gives homeowners <strong>energy</strong> tips based on<br />
real cost-saving projections. (F i g u r e 1 ,<br />
example)<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 71
IEA – Empowering people to act<br />
Fig. 1. Saving money, example. America saves (2021). 12 ways to save <strong>energy</strong> <strong>and</strong> money, https://<br />
americasaves.org/resource-center/insights/12-ways-to-save-<strong>energy</strong>-<strong>and</strong>-money/.<br />
2 The environmental approach: the Become<br />
Part <strong>of</strong> the solution campaign directly<br />
links climate change to the threatened extinction<br />
<strong>of</strong> polar bears <strong>and</strong> recommends<br />
<strong>energy</strong> efficiency action as a key part <strong>of</strong><br />
the solution.<br />
3 The social approach: messages relating to<br />
being a good citizen, appealing to social<br />
norms or the general good. These messages<br />
are particularly relevant during an<br />
<strong>energy</strong> crisis, as with the 1973 Danish <strong>energy</strong><br />
crisis, more recent <strong>energy</strong> supply<br />
pressures in Japan <strong>and</strong> Korea, <strong>and</strong> the<br />
current <strong>energy</strong> crisis resulting from Russia’s<br />
invasion <strong>of</strong> Ukraine.<br />
Experience shows that a campaign is more<br />
likely to succeed when based on messages<br />
<strong>and</strong> narratives that are:<br />
––<br />
Targeted: Different messages work with<br />
different audiences, so research is important<br />
to help define the campaign audience<br />
<strong>and</strong> refine the messages that will resonate.<br />
For example, the Government <strong>of</strong> India<br />
tapped into the potential <strong>for</strong> children<br />
to positively influence adults’ behaviour<br />
in the ‘Save <strong>energy</strong>, make country’ campaign,<br />
the Egyptian <strong>Electricity</strong> Ministry<br />
chose the message ‘You are the solution.<br />
Don’t be too lazy to turn <strong>of</strong>f an appliance’<br />
<strong>and</strong> repeatedly diffused it over multiple<br />
plat<strong>for</strong>ms, while ‘Michigan Saves’ chose a<br />
campaign based on crime drama genre,<br />
‘Avoid your <strong>energy</strong> drama’.<br />
––<br />
Relatable: An effective campaign communicates<br />
with the target audience in terms<br />
that resonate with their lives – few people<br />
talk about ‘<strong>energy</strong> efficiency’ on a daily basis,<br />
but they do talk about saving <strong>energy</strong>,<br />
climate related events or how the recent<br />
<strong>energy</strong> crisis is costing them money. For<br />
example, the Dutch campaign, Zet ook de<br />
knop om (Flip the Switch) relates <strong>energy</strong><br />
action to current events. (F i g u r e 2 )<br />
Focusing on the multiple benefits <strong>of</strong> <strong>energy</strong><br />
efficiency such as health <strong>and</strong> wellbeing, or<br />
com<strong>for</strong>t, can help people relate to the topic.<br />
By talking about addressing com<strong>for</strong>t levels,<br />
the Let’s live warmer campaign in Lithuania<br />
increased the number <strong>of</strong> applications <strong>for</strong><br />
home renovations by four-fold in two years<br />
from 2009 to 2011. The Wisconsin focus on<br />
<strong>energy</strong> project highlights the concept <strong>of</strong> a<br />
person’s <strong>energy</strong> ‘footprint’ <strong>and</strong> shares local<br />
success stories to promote local relevant <strong>and</strong><br />
repeatable projects.<br />
––<br />
actionable: those receiving the messages<br />
should be able to underst<strong>and</strong> what they<br />
are being asked to do, <strong>and</strong> easily do it. For<br />
example, the German campaign Love 80<br />
Million is a cross societal call to action,<br />
with clear in<strong>for</strong>mation on the measures to<br />
be taken to save <strong>energy</strong>. Similarly, the recent<br />
Danish campaign, Én ting er sikkert.<br />
Og det er grønt (One thing is certain. And<br />
it is green) <strong>of</strong>fers simple tips on saving<br />
electricity <strong>and</strong> heat during the summer<br />
months.<br />
––<br />
hitting the correct tone: Different tones<br />
connect with different categories <strong>of</strong> people,<br />
<strong>and</strong> can help to convey the message<br />
more clearly. Successful behavioural<br />
change messages entertain, engage <strong>and</strong><br />
educate the target audience. Humour, <strong>for</strong><br />
example Smart Meters: Einstein’s Bath<br />
(UK), can successfully go viral on social<br />
media. In other contexts, more serious<br />
emotional messages may be more appropriate,<br />
<strong>for</strong> example the ``live life give life’’<br />
organ donor campaign which combined a<br />
well-known actor <strong>and</strong> a popular song with<br />
a strong message. When the situation is<br />
urgent, a crisis message can evoke an immediate<br />
response such as the stronger<br />
tone in this Japanese campaign or the use<br />
<strong>of</strong> more urgent <strong>and</strong> direct climate messaging<br />
such as the climate clock.<br />
Testing messages <strong>and</strong> narratives with relevant<br />
audiences in advance is key. A greater<br />
underst<strong>and</strong>ing <strong>of</strong> what resonates with different<br />
groups allows the campaign to be<br />
fine-tuned, making a huge difference in a<br />
campaign’s success.<br />
Getting the message across<br />
While tailoring the message <strong>for</strong> a specific audience<br />
is key, packaging the message <strong>and</strong><br />
Fig. 2. SparEnergi.dk (Danish Energy Agency’s website on electricity consumption) (<strong>2022</strong>).<br />
Én ting er sikkert. Og det er grønt: https://sparenergi.dk/<strong>for</strong>bruger/en-ting-er-sikkert-ogdet-er-gront.<br />
sharing it widely is equally important. Governments<br />
have historically used public service<br />
announcements to share in<strong>for</strong>mation<br />
on new programmes <strong>and</strong> services. Behavioural<br />
campaigns share some features with<br />
public service announcements but tend to<br />
go further by inspiring people to act. To get<br />
messages across, the following best practices<br />
have emerged from current <strong>and</strong> previous<br />
campaigns:<br />
––<br />
Using impactful visuals to attract attention<br />
<strong>and</strong> increase shareability via social<br />
media. Germany’s “80 Millionen gemeinsam<br />
für Energiewechsel” (80 million together<br />
<strong>for</strong> <strong>energy</strong> change) campaign features<br />
people <strong>and</strong> refers to the population<br />
<strong>of</strong> the country, thus creating making it<br />
more relatable <strong>and</strong> promoting a sense <strong>of</strong> a<br />
community. (F i g u r e 3 )<br />
––<br />
Engaging with key industry players early<br />
on to ensure their commitment <strong>and</strong> future<br />
support. For instance, the Netherl<strong>and</strong>s actively<br />
involved industry, prominent NGOs<br />
<strong>and</strong> foundations in its Zet ook de knop om<br />
(Flip the switch) campaign. Making industry<br />
an early ally is key to leveraging<br />
private sector resources <strong>and</strong> experience<br />
with advertising <strong>and</strong> the media. A prominent<br />
example is Velux’s The Indoor Gen-<br />
Fig. 3 German Federal Ministry <strong>for</strong> Economic Affairs <strong>and</strong> Climate Action (<strong>2022</strong>). “80 Millionen<br />
gemeinsam für Energiewechsel” (80 million together <strong>for</strong> <strong>energy</strong> change):<br />
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Home/home.html.<br />
72 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
IEA – Empowering people to act<br />
Fig. 4. Rijksoverheid (<strong>2022</strong>). Ze took de knop om, https://zetookdeknopom.nl/.<br />
eration campaign broadcast in more than<br />
40 countries. (F i g u r e 4 )<br />
––<br />
A dedicated website with a catchy name is<br />
easier <strong>for</strong> citizens to find <strong>and</strong> share, <strong>and</strong><br />
allows easier impact tracking.<br />
––<br />
Using social media to spread the message<br />
more widely. Many campaigns centre on<br />
advertisements in mainstream media<br />
such as newspaper <strong>and</strong> radio, but social<br />
media helps to remain relevant <strong>and</strong> reach<br />
more people effectively. In Japan, the internet,<br />
SMS, email <strong>and</strong> telephone were all<br />
used to reach citizens to communicate<br />
about the recent <strong>energy</strong> supply crisis.<br />
––<br />
Building on previous experience <strong>and</strong><br />
gathering data from each campaign is key<br />
to improving future per<strong>for</strong>mance. Measurement<br />
<strong>of</strong> baselines <strong>and</strong> impacts is essential.<br />
Insights can be gained by engaging<br />
with focus groups <strong>and</strong> conducting population-wide<br />
representative surveys be<strong>for</strong>e<br />
<strong>and</strong> after campaigns.<br />
An important consideration is the question<br />
<strong>of</strong> who is the messenger. Many campaigns,<br />
implicitly or explicitly, involve the government<br />
speaking to citizens. Their impact thus<br />
depends on how people perceive the government’s<br />
trustworthiness, authority <strong>and</strong> credibility<br />
on the topic. Similar questions arise<br />
when governments partner with companies<br />
such as <strong>energy</strong> utilities. Such campaigns are<br />
unsuccessful if citizens feel they are being<br />
asked to solve a problem they see as being<br />
someone else’s responsibility. Some campaigns<br />
employ celebrities or ‘influencers’,<br />
which can provide greater recognition if<br />
done well, but need to be carefully thought<br />
out in terms <strong>of</strong> likely effectiveness, credibility<br />
<strong>and</strong> reputational risk.<br />
Simple, well-structured <strong>and</strong> well-communicated<br />
<strong>energy</strong>-saving advice can motivate<br />
citizens to act. For example, clear messages<br />
such as those in IEA/European Commission’s<br />
Playing My Part have received widespread<br />
recognition, such as the significant<br />
impact <strong>of</strong> simply turning down heat thermostats<br />
at home. However, while good in<strong>for</strong>mation<br />
is essential, it is not enough. Without<br />
well-crafted messages <strong>and</strong> design, simply<br />
presenting facts such as how much <strong>energy</strong><br />
can be saved will not lead to significant behaviour<br />
change. To achieve sustained<br />
change, policymakers can learn from behavioural<br />
science <strong>and</strong> employ digital tools,<br />
nudges <strong>and</strong> incentives to continue stimulating<br />
<strong>energy</strong>-saving behaviour. The following<br />
tips have been shown to deliver better results.<br />
(F i g u r e 5 )<br />
––<br />
Real-time in<strong>for</strong>mation on <strong>energy</strong> use can<br />
influence user behaviour. South Africa<br />
provided real-time in<strong>for</strong>mation on the<br />
electricity shortfall via a “Power Alert”<br />
message, displayed at 30-minute intervals<br />
on the internet <strong>and</strong> on television between<br />
17:30 <strong>and</strong> 20:30, in<strong>for</strong>ming the public <strong>of</strong><br />
immediate measures to reduce the peakload<br />
crisis. Each message resulted in<br />
quantifiable savings. Data shows that in<br />
the US, real-time feedback to customers<br />
can result in up to 15 % <strong>energy</strong> savings. In<br />
the UK, households with smart meters<br />
<strong>and</strong> in-home displays, providing real-time<br />
consumption in<strong>for</strong>mation, ended up using<br />
1.5 % less natural gas <strong>and</strong> 2.2 % less electricity<br />
in 2011, compared with homes with<br />
conventional meters. India’s dashboard,<br />
<strong>for</strong> instance, demonstrates <strong>energy</strong> savings,<br />
costs savings <strong>and</strong> emissions savings<br />
economy-wide <strong>and</strong> by region.<br />
––<br />
Utilities can play a key role through dem<strong>and</strong><br />
response programmes. In Cali<strong>for</strong>nia,<br />
communication with citizens via<br />
apps, SMS, <strong>and</strong> email is used to lower <strong>energy</strong><br />
dem<strong>and</strong> at peak times, when the system<br />
is under most pressure . Such methods<br />
have been deployed in many countries,<br />
including in recent months in Japan,<br />
France, the US <strong>and</strong> others.<br />
––<br />
Feedback mechanisms relying on social<br />
norms <strong>and</strong> comparisons used in home <strong>energy</strong><br />
reports (HERs) have been shown to<br />
reduce residential electricity consumption<br />
by 2.2 % <strong>and</strong> natural gas consumption<br />
by up to 1.6 %. HERs translate complex,<br />
<strong>and</strong> sometimes obscure aspects <strong>of</strong><br />
<strong>energy</strong> consumption in<strong>for</strong>mation <strong>and</strong> tariffs,<br />
into user-friendly language <strong>and</strong> visuals.<br />
Japan’s Ministry <strong>of</strong> Environment<br />
worked with four major utilities across<br />
Japan to send quarterly HERs, containing<br />
personalised <strong>energy</strong> use, to 300 000<br />
households. On average the households<br />
receiving these reports used 2% less <strong>energy</strong>.<br />
––<br />
A set <strong>of</strong> coordinated ‘nudges’ can increase<br />
the impact. For instance, the so-called<br />
just-in-time <strong>and</strong> right-in-place prompts<br />
used in Switzerl<strong>and</strong> resulted in a reduction<br />
<strong>of</strong> <strong>energy</strong> <strong>and</strong> water consumption <strong>of</strong><br />
22 % among 620 households. In this case,<br />
a smart shower meter was installed between<br />
the showerhead <strong>and</strong> shower hose<br />
<strong>and</strong> displayed water temperature, <strong>energy</strong><br />
<strong>and</strong> water consumption, <strong>energy</strong> efficiency<br />
rating, <strong>and</strong> a polar bear animation. The<br />
European Commission-funded, Nudge<br />
Project, is testing various behavioural interventions<br />
in Greece, Belgium, Germany,<br />
Portugal <strong>and</strong> Croatia.<br />
––<br />
Setting <strong>energy</strong>-saving defaults is an effective<br />
way to rely on consumers taking the<br />
path <strong>of</strong> least resistance. In order to reduce<br />
<strong>energy</strong> consumption due to over-cooling,<br />
the Indian government m<strong>and</strong>ated a 24C<br />
default cooling temperature <strong>for</strong> all new<br />
air conditioners. Consumers have the option<br />
to adjust the settings, but many stay<br />
at the default, leading to significant <strong>energy</strong><br />
savings.<br />
––<br />
Appeal to people’s emotions with stories<br />
<strong>and</strong> messages focusing on multiple bene-<br />
Combining in<strong>for</strong>mation with<br />
behavioural insights<br />
Fig. 5. Opower by Oracle (<strong>2022</strong>), Dem<strong>and</strong> Side-Management https://www.oracle.com/industries/<br />
utilities/opower-<strong>energy</strong>-efficiency/what-is-opower/.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 73
IEA – Empowering people to act<br />
wave in 2011, reached 1.5 million households,<br />
reducing electricity dem<strong>and</strong> by 2 %<br />
compared to the previous year.<br />
Fig. 6. Government Of Irel<strong>and</strong> <strong>2022</strong> Reduce Your Use, https://www.gov.ie/en/campaigns/6ca43-<br />
reduce-your-use/.<br />
fits. Focusing on messages <strong>of</strong> public health<br />
related to emissions has resulted in <strong>energy</strong><br />
savings <strong>of</strong> 19 % in families with children,<br />
according to the Nudge project.<br />
However, retaining people’s attention<br />
with such nudging can be challenging after<br />
several weeks.<br />
––<br />
Using techniques such as goal setting <strong>and</strong><br />
public commitments <strong>and</strong> challenges, as in<br />
the case <strong>of</strong> the Federal <strong>energy</strong> <strong>and</strong> water<br />
management per<strong>for</strong>mance act, can be effective.<br />
––<br />
Bringing all existing <strong>energy</strong> efficiency<br />
programs <strong>and</strong> relevant subsidies under<br />
one ro<strong>of</strong>. Irel<strong>and</strong>’s Reduce Your Use campaign<br />
<strong>of</strong>fers a clear list <strong>of</strong> existing grants,<br />
incentives <strong>and</strong> tax rebates. Similarly,<br />
the UK’s Simple Energy Advice brings together<br />
all relevant assistance schemes.<br />
(Figure 6)<br />
Behavioural insights specialists have been<br />
studying the impact <strong>of</strong> social norms, price<br />
signals, social media, digital technologies<br />
<strong>and</strong> other drivers on people’s willingness to<br />
change behaviour. Using such insights can<br />
greatly enhance the success <strong>of</strong> awareness<br />
<strong>and</strong> behaviour change campaigns.<br />
Campaigns in a crisis context<br />
Crisis situations create particular challenges<br />
<strong>for</strong> <strong>energy</strong> systems, <strong>and</strong> also change the<br />
kinds <strong>of</strong> messages <strong>and</strong> campaigns that might<br />
be most effective. When <strong>energy</strong> is in the<br />
news, <strong>and</strong> when changing behaviour gives<br />
an immediate <strong>and</strong> directly visible benefit<br />
(increased com<strong>for</strong>t, lower costs, reduced<br />
risk <strong>of</strong> blackouts), campaigns can be stronger<br />
in calling <strong>for</strong> collective action <strong>and</strong> go further<br />
in what is asked <strong>of</strong> people.<br />
Many countries already have experience developing<br />
<strong>and</strong> launching citizen-oriented<br />
campaigns in response to <strong>energy</strong> supply crises.<br />
For instance, after an earthquake hit <strong>of</strong>f<br />
its north-eastern coast in March <strong>2022</strong>, Japan<br />
launched a campaign encouraging businesses,<br />
utilities <strong>and</strong> citizens to drastically<br />
cut <strong>energy</strong>. Within a day, electricity dem<strong>and</strong><br />
savings reached 6.5 % in the Kanto region.<br />
In the aftermath <strong>of</strong> the March 2011 earthquake<br />
<strong>and</strong> tsunami, a dem<strong>and</strong>-reduction<br />
campaign relied on a whole-<strong>of</strong>-society response<br />
based on an appeal <strong>for</strong> solidarity <strong>and</strong><br />
shared action. The campaign focused on<br />
“setsuden,” or electricity savings, to unite<br />
the country in its response to the crisis. The<br />
government launched “Super Cool Biz” campaign<br />
to motivate workers to dress in cooler<br />
outfits to better tolerate warmer <strong>of</strong>fices during<br />
summer. Not only were there significant<br />
immediate <strong>energy</strong> use reductions, but a<br />
large proportion <strong>of</strong> the efficiency gains were<br />
sustained <strong>for</strong> many years beyond the original<br />
crisis.<br />
In 2018, the Day Zero campaign in South Africa<br />
prepared the citizens <strong>of</strong> Cape Town <strong>for</strong><br />
an anticipated water shortage crisis, asking<br />
people to consume less water to avoid a citywide<br />
water shut <strong>of</strong>f. The city ran an effective<br />
communication campaign focused on inclusivity,<br />
relying on behavioural nudges, as opposed<br />
to solely depending on restrictions<br />
<strong>and</strong> fines. According to the research carried<br />
out during the crisis by the Environmental<br />
Economics Policy Research Unit (EPRU) <strong>of</strong><br />
the University <strong>of</strong> Cape Town, people were<br />
more likely to conserve water knowing that<br />
they were working towards a common goal.<br />
The Cape Town Water Map, an example <strong>of</strong><br />
the so-called ‘green nudging’, openly<br />
showed the range <strong>of</strong> households’ water usage<br />
<strong>and</strong> allowed <strong>for</strong> comparison with neighbours.<br />
New Zeal<strong>and</strong>, which generates much <strong>of</strong> its<br />
electricity from hydro, experienced electricity<br />
shortfall during a drought in 2008. A<br />
government-led in<strong>for</strong>mation campaign,<br />
which targeted both residential <strong>and</strong> small<br />
commercial sectors, resulted in national<br />
electricity savings ranging from 3.6 % <strong>and</strong><br />
6.9 %. In Korea, a campaign in response to<br />
the <strong>energy</strong> supply crisis caused by a heat<br />
Many crisis campaigns relate to short-term<br />
outage risks, <strong>for</strong> example when electricity<br />
systems are reaching capacity limits, as seen<br />
recently in the USA, Japan <strong>and</strong> other places.<br />
Effective communication is vital to encourage<br />
short-term behaviour change, i.e.<br />
switching things <strong>of</strong>f. In Australia, the Powershop’s<br />
Curb Your Power dem<strong>and</strong>-response<br />
programme relied on volunteers with installed<br />
smart meters to curb <strong>energy</strong> consumption<br />
ahead <strong>of</strong> an extreme weather<br />
event. Notified by SMS, households were<br />
asked to reduce their <strong>energy</strong> consumption<br />
<strong>for</strong> one to four hours <strong>and</strong> were <strong>of</strong>fered a discount<br />
on the next electricity bill. Such incentives<br />
are not uncommon, though messaging<br />
<strong>of</strong>ten tends to shift towards a more social,<br />
collective-action narrative. This is especially<br />
true in the case <strong>of</strong> campaigns seeking to<br />
change behaviour over a longer timeframe,<br />
rather than just an immediate supply shortage.<br />
Many <strong>of</strong> the recent examples mentioned in<br />
this note fit into the current context <strong>of</strong> high<br />
prices <strong>and</strong> security concerns arising from<br />
Russia’s invasion <strong>of</strong> Ukraine, such as<br />
``St<strong>and</strong> with Ukraine: Let’s stop fuelling<br />
war’’ campaign which presents home insulation<br />
as a direct protest action. Campaigns,<br />
launched by Members States <strong>and</strong> the IEA/<br />
European Commission’s Playing My Part,<br />
highlight the need to reduce reliance on<br />
Russian <strong>energy</strong> <strong>and</strong> thus support the Ukrainian<br />
people. In times <strong>of</strong> crisis, saving <strong>energy</strong><br />
is coming to be seen by many as an example<br />
<strong>of</strong> citizen activism.<br />
Additional resources<br />
(with shortlinks)<br />
A 10-Point Plan to Reduce the European Union’s<br />
Reliance on Russian Natural Gas ‘<br />
(https://t1p.de/7iesz)<br />
A 10-Point Plan to Cut Oil Use (https://t1p.<br />
de/c5ek)<br />
IEA User TCP Toolkit (https://t1p.de/<br />
lmop8)<br />
The Potential <strong>of</strong> Behavioural Interventions<br />
<strong>for</strong> Optimising Energy Use at Home<br />
(https://t1p.de/9czp5)<br />
Saving Energy in a Hurry 2011 (https://t1p.<br />
de/1vpx5)<br />
Nudge project (https://www.nudgeproject.<br />
eu/, https://t1p.de/f5ord)<br />
Effective in<strong>for</strong>mation measures to promote<br />
<strong>energy</strong> use reduction in EU Member States<br />
(https://t1p.de/8ruhf) l<br />
74 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Forum Technology: Kunstst<strong>of</strong>f ersetzt legiertes Metall<br />
Kunstst<strong>of</strong>f ersetzt legiertes Metall<br />
bei Anwendungen in aggressiver<br />
Umgebung<br />
Abstract<br />
Plastic replaces alloyed metal <strong>for</strong><br />
applications in aggressive environments<br />
High-alloy metal has long been considered the<br />
material <strong>of</strong> choice <strong>for</strong> applications in aggressive<br />
environments such as flue gas cleaning.<br />
The fact that thermoplastics such as polyphenylene<br />
sulphide (PPS) are in no way inferior<br />
to common metals in applications under high<br />
chemical, thermal <strong>and</strong> mechanical stresses<br />
<strong>and</strong> even <strong>of</strong>fer advantages through more flexible<br />
processability is <strong>of</strong>ten overlooked. In one<br />
project, corrosion-resistant metal was completely<br />
replaced by engineering plastic in the<br />
frame system <strong>of</strong> a filter <strong>for</strong> mercury. An example<br />
<strong>of</strong> the per<strong>for</strong>mance <strong>of</strong> plastic that could<br />
also be transferred to many other application<br />
areas <strong>and</strong> industries. <br />
l<br />
Hochlegiertes Metall galt lange als Werkst<strong>of</strong>f<br />
der Wahl für Anwendungen in aggressiven<br />
Umgebungen wie zum Beispiel in der Rauchgasreinigung.<br />
Dass Thermoplaste wie Polyphenylensulfid<br />
(PPS) bei Anwendungen unter<br />
hohen chemischen, thermischen und mechanischen<br />
Belastungen gängigen Metallen in nichts<br />
nachstehen und sogar Vorteile durch flexiblere<br />
Verarbeitbarkeit bieten, wird <strong>of</strong>t übersehen.<br />
Im Rahmen eines Projektes wurde korrosionsbeständiges<br />
Metall im Rahmensystem eines<br />
Filters für Quecksilber komplett durch technischen<br />
Kunstst<strong>of</strong>f ersetzt. Ein Beispiel für die<br />
Leistungsfähigkeit von Kunstst<strong>of</strong>f, das sich<br />
auch auf viele <strong>and</strong>ere Anwendungsbereichen<br />
und Branchen übertragen könnte.<br />
Quecksilber: Abscheidung als<br />
Beitrag zum Umweltschutz<br />
Quecksilber ist ein giftiges Schwermetall. In<br />
der Umwelt breitet sich Quecksilber weiträumig<br />
über Wasser und Luft aus und wird<br />
von Tieren und Pflanzen aufgenommen.<br />
Rund 20 Prozent der weltweiten Quecksilber-Emissionen<br />
entstehen bei der Verbrennung<br />
von Kohle zur Stromerzeugung.<br />
2013 unterzeichneten 128 Staaten die Minamata-Konvention,<br />
die darauf abzielt, den<br />
Ausstoß von Quecksilber weltweit einzudämmen.<br />
Neue EU-Vorschriften begrenzen<br />
Emissionen von Quecksilber. Studien zufolge<br />
können bis zu 85 Prozent der Quecksilberemissionen<br />
mit moderner Technik reduziert<br />
werden.<br />
Eine solche Technik zur Reduktion von<br />
Quecksilberemissionen aus Kraftwerken,<br />
Verbrennungsanlagen und <strong>and</strong>eren industriellen<br />
Quellen wird u.a. von W. L. Gore &<br />
Associates angeboten.<br />
Die Technologie:<br />
GORE ® Quecksilberfilter<br />
Das GORE ® Mercury Control System<br />
(GMCS) ist ein fest eingebautes Sorbens-<br />
System für die Abscheidung von elementarem<br />
und oxidiertem Quecksilber in der Gasphase<br />
aus industriellen Rauchgasen.<br />
Das System beruht auf stapelbaren Modulen,<br />
die je nach An<strong>for</strong>derung in die Rauchgasreinigung<br />
integriert werden (B i l d 1 ).<br />
Aus statischen Gründen und wegen der aggressiven<br />
Umgebungsbedingungen besteht<br />
die aus Pr<strong>of</strong>ilen und Eckverbindungen zusammengesetzte<br />
Rahmenkonstruktion der<br />
Module aus hochlegiertem Stahl.<br />
Autor<br />
Techno<strong>for</strong>m Caprano +<br />
Brunnh<strong>of</strong>er GmbH<br />
Kassel, Deutschl<strong>and</strong><br />
Bild 1. Stapelbare Module des Sorbens-Systems im Rauchgaskanal<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 75
Forum Technology: Kunstst<strong>of</strong>f ersetzt legiertes Metall<br />
Das Herz der Technologie bildet ein entwickeltes<br />
Material auf der Basis von Fluorpolymeren,<br />
ein Sorbent-Polymerkatalysator<br />
(SPC) Verbundmaterial. Das Sorbens in diesem<br />
Material scheidet nicht nur elementares<br />
und oxidiertes Quecksilber aus dem Rauchgasstrom<br />
ab und bindet es. Es entschwefelt<br />
zusätzlich den Gasstrom durch die Umw<strong>and</strong>lung<br />
von Schwefeldioxid in flüssige<br />
Schwefelsäure.<br />
Die Zielsetzung: Herstellung<br />
vereinfachen, Metallteile<br />
durch Kunstst<strong>of</strong>f ersetzen<br />
Damit die GMCS-Module über viele Jahre<br />
wartungsfrei betrieben werden können,<br />
müssen die eingesetzten Werkst<strong>of</strong>fe nicht<br />
nur hohen chemischen und thermischen,<br />
sondern auch mechanischen Belastungen<br />
st<strong>and</strong>halten. Diese können durch die Stapelung<br />
der Module oder beim Transport, der<br />
H<strong>and</strong>habung und der Installation der Module<br />
durch Montage- und Betriebspersonal<br />
entstehen.<br />
Die Konstruktion der Module ist darauf ausgelegt,<br />
maximale Stabilität und eine möglichst<br />
lange Lebensdauer zu realisieren. Bei<br />
der Herstellung der Modulrahmen soll auf<br />
schwer zu verarbeitende korrosionsbeständige<br />
Metalle verzichtet werden. Dann wäre<br />
auch eine Vor-Ort-Montage in weniger entwickelten<br />
Ländern oder weit entfernten<br />
St<strong>and</strong>orten möglich. Deshalb arbeiten die<br />
Ingenieure bei W. L. Gore & Associates <strong>for</strong>tlaufend<br />
daran, Komponenten und Werkst<strong>of</strong>fe<br />
zu optimieren.<br />
Ziel der Zusammenarbeit mit Techno<strong>for</strong>m<br />
ist es, mittelfristig Metall durch Komponenten<br />
aus widerst<strong>and</strong>sfähigem Kunstst<strong>of</strong>f zu<br />
ersetzen. Gleichzeitig soll eine alternative<br />
Lösung aus Kunstst<strong>of</strong>f helfen, Komponenten<br />
einfacher zu montieren und flexibler<br />
an neue An<strong>for</strong>derungen anpassen zu können.<br />
Die Heraus<strong>for</strong>derung: Den<br />
richtigen Kunstst<strong>of</strong>f für hohe<br />
chemische, thermische und<br />
mechanische Belastungen<br />
finden<br />
Um den An<strong>for</strong>derungen an die hohen chemischen,<br />
thermischen und mechanischen Belastungen<br />
in der Rauchgasreinigung zu genügen,<br />
best<strong>and</strong> das Rahmensystem der<br />
GMCS-Module bisher aus korrosionsbeständigem<br />
Metall. Die Beständigkeit der Metallelemente<br />
gegen Stress-Korrosionsrisse und<br />
Säuren wurde durch Nickel-Molybdän-Legierungen<br />
sichergestellt.<br />
Korrosionsbeständiges Metall<br />
zu aufwändig in der Verarbeitung<br />
Wegen des vergleichsweise hohen Aufw<strong>and</strong>s<br />
bei der Verarbeitung legierter Metalle wurde<br />
schon lange nach alternativen Lösungen gesucht.<br />
Kunstst<strong>of</strong>f wurde zwar in Betracht gezogen,<br />
jedoch ursprünglich wieder verworfen.<br />
Er schien für die hohen chemische, thermischen<br />
und mechanischen Belastungen in<br />
der Rauchgasreinigung nicht geeignet.<br />
Thermoplast als<br />
vollwertige Alternative<br />
Als Ersatz für korrosionsbeständige Metalle<br />
in aggressiven Umgebungen bietet sich Polyphenylensulfid<br />
(PPS) an. Dabei h<strong>and</strong>elt es<br />
sich um einen technischen Thermoplast, der<br />
sich durch sehr hohe Chemikalien- und<br />
Wärme<strong>for</strong>mbeständigkeit sowie Steifigkeit<br />
auszeichnet und sich daher bestens für den<br />
Einsatz im GORE ® Mercury Control System<br />
eignet. (B i l d 2 )<br />
Bild 2. PPS ersetzt korrosionsbeständiges Metall<br />
im Rahmenpr<strong>of</strong>il.<br />
Die Lösung: Kunstst<strong>of</strong>fpr<strong>of</strong>ile<br />
und -verbindungsmittel für<br />
aggressive Umgebungen von<br />
Techno<strong>for</strong>m<br />
Techno<strong>for</strong>m ist auf die Extrusion von thermoplastischen<br />
Kunstst<strong>of</strong>fpr<strong>of</strong>ilen spezialisiert.<br />
Das Unternehmen liefert nicht nur<br />
fertige Kunstst<strong>of</strong>fprodukte, sondern ist<br />
auch Entwicklungspartner für individuelle<br />
Lösungen und eine Vielzahl von Branchen<br />
und Anwendungsbereiche wie z.B.<br />
Elektrotechnik, Automotive, Maschinenbau<br />
u.v.a..<br />
Gemeinsam mit W. L. Gore & Associates<br />
wurden Kunstst<strong>of</strong>fpr<strong>of</strong>ile für das GORE®<br />
Mercury Control System entwickelt, die die<br />
gleiche chemische, thermische und mechanische<br />
Beständigkeit aufweisen, wie die ursprünglichen<br />
Bauteile aus Metall Legierungen,<br />
jedoch in der Montage einfacher zu<br />
verarbeiten und anzupassen sind. (B i l d 3 )<br />
Bild 3. Strukturelement mit Rahmenpr<strong>of</strong>ilen<br />
aus PPS.<br />
Neben tragenden Pr<strong>of</strong>ilen aus PPS GF 40,<br />
die wir individuell entwickeln und in hochpräzisen<br />
Extrusionsverfahren fertigen, kommen<br />
für Eckverbindungen in den GMCS-<br />
Modulen von W. L. Gore & Associates auch<br />
Spritzgusselemente aus Kunstst<strong>of</strong>f zum Einsatz,<br />
die die bisherigen Komponenten aus<br />
korrosionsbeständigem Metall ersetzen.<br />
Das Ergebnis: Alternative<br />
Lösung aus Kunstst<strong>of</strong>f nach<br />
nur 12 Monaten Entwicklung<br />
im Pilotbetrieb<br />
Rapid-Pr<strong>of</strong>iling-Verfahren und intensive<br />
Tests in Zusammenarbeit mit W. L. Gore &<br />
Associates ermöglichten einen extrem<br />
schnellen Innovationsprozess: Nur 12 Monate<br />
nach dem ersten Austausch über An<strong>for</strong>derungen<br />
und mögliche Lösungsansätze<br />
gelangte das GORE® Mercury Control System<br />
mit unseren neuen Kunstst<strong>of</strong>fpr<strong>of</strong>ilen<br />
und Verbindungselementen in den Pilotbetrieb<br />
in Industrieanlagen in Europa und in<br />
den USA.<br />
Die für diese Art Innovationsprojekt sehr<br />
kurze Entwicklungszeit ist unter <strong>and</strong>erem<br />
der Tatsache zu verdanken, dass hier zwei<br />
Unternehmen zusammenarbeiten, die nach<br />
agilen Prinzipien sehr ergebnisorientiert<br />
und in kleinen flexiblen Teams mit kurzen<br />
Entscheidungs- und Kommunikationswegen<br />
arbeiten. Auf diese Weise können wir schnell<br />
auf neue An<strong>for</strong>derungen im Projektverlauf<br />
reagieren und den Kurs bei Bedarf neu justieren.<br />
Fazit: Kunstst<strong>of</strong>f als<br />
leistungsstarke Alternative<br />
zu Metall<br />
Thermoplaste sind wahre Allrounder und<br />
eignen sich selbst für Anwendungen unter<br />
extremen Bedingungen wie in der Rauchgasreinigung.<br />
Das Beispiel GORE® Mercury<br />
Control Systems zeigt, dass das auch dort<br />
der Fall ist, wo auf den ersten Blick kein Weg<br />
an extrem hochwertigen Metallen als Werkst<strong>of</strong>f<br />
für Systemkomponenten vorbei zu gehen<br />
scheint.<br />
In weniger als einem Jahr haben wir gemeinsam<br />
mit W. L. Gore & Associates eine<br />
alternative Lösung für das Rahmensystem<br />
der Filtermodule entwickelt, das ganz ohne<br />
Metall auskommt und trotzdem die An<strong>for</strong>derungen<br />
an die Beständigkeit gegenüber<br />
chemischen, thermischen und mechanischen<br />
Belastungen in der Rauchgasreinigung<br />
zu 100 Prozent erfüllt.<br />
Durch den Einsatz von technischem Kunstst<strong>of</strong>f<br />
konnte die Montage der Rahmenpr<strong>of</strong>ile<br />
vereinfacht werden. Gute Lösungen liegen<br />
<strong>of</strong>t näher, als man denkt.<br />
l<br />
76 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Forum Technology: DIN 28177: Erste Norm für Strukturrohre veröffentlicht<br />
DIN 28177: Erste Norm für<br />
Strukturrohre veröffentlicht<br />
Dimple Tubes lassen Anlagen und<br />
Apparate drastisch schrumpfen<br />
Udo Hellwig<br />
Abstract<br />
DIN 28177: First st<strong>and</strong>ard <strong>for</strong> structural<br />
tubes published<br />
Dimple tubes drastically shrink plant<br />
<strong>and</strong> equipment<br />
DIN 28177, published in February by the German<br />
Institute <strong>for</strong> St<strong>and</strong>ardisation, defines a<br />
normative st<strong>and</strong>ard <strong>for</strong> dimensions <strong>and</strong> materials<br />
<strong>of</strong> so-called dimple tubes or structural<br />
tubes <strong>for</strong> heat transfer in process engineering<br />
apparatus. Such tubes made <strong>of</strong> unalloyed, alloyed<br />
or stainless steels are characterised by<br />
regular spheroidal indentations (RSE), which<br />
are created by targeted mechanical <strong>for</strong>ming.<br />
The seamless or welded tubes are particularly<br />
suitable <strong>for</strong> the production <strong>of</strong> shell-<strong>and</strong>-tube<br />
heat exchangers <strong>and</strong> <strong>for</strong> use in pressure applications.<br />
<br />
l<br />
Einen normativen St<strong>and</strong>ard für Maße und<br />
Werkst<strong>of</strong>fe sogenannter Dimple Tubes oder<br />
Strukturrohre zur Wärmeübertragung an<br />
verfahrenstechnischen Apparaten definiert<br />
die im Februar vom Deutschen Institut für<br />
Normung veröffentlichte DIN 28177. Solche<br />
Tubes aus unlegierten, legierten oder nichtrostenden<br />
Stählen sind durch regelmäßige<br />
spheroidische Einprägungen (RSE) gekennzeichnet,<br />
die durch gezielte mechanische<br />
Um<strong>for</strong>mung entstehen. Die nahtlosen oder<br />
geschweißten Rohre sind besonders für die<br />
Produktion von Rohrbündel-Wärmeübertragern<br />
und den Einsatz in Druckanwendungen<br />
geeignet.<br />
In Form, Abmessung und Tiefe nach dem<br />
jeweiligen Anwendungszeck auslegbar, bewirkten<br />
die strukturierten Rohrwände Turbulenzen<br />
im Strömungsmedium und verbesserten<br />
so gegenüber Glattrohren die Wärmeübertragungsleistung<br />
ohne Druckverlusterhöhung<br />
drastisch, sagt Pr<strong>of</strong>. Udo Hellwig,<br />
Geschäftsführer der Berliner ERK Eckrohrkessel<br />
GmbH. Als Resultat des um bis<br />
zum Faktor 3 höheren Wärmeübergangs<br />
schrumpften die Abmessungen von Anlagen<br />
und Apparaten bei gleicher Leistung um die<br />
Hälfte bis zwei Drittel, ebenso Materialbedarf<br />
und Produktionsaufw<strong>and</strong>. Diese Wirkung<br />
sei inzwischen durch mehr als 1000<br />
Referenzen bei Konvektionsheizflächen in<br />
unterschiedlichen Anwendungsbereichen<br />
nachgewiesen. Zudem seien nach seinen<br />
Worten selbst bei starker Partikelbeladung<br />
von Rauchgasen durch die geringere Verschmutzungsneigung<br />
der Rohr-Oberflächen<br />
im Vergleich bis zu sechsfach längere St<strong>and</strong>zeiten<br />
zu erreichen.<br />
Akzeptanzhemmungen<br />
hinfällig<br />
ERK war in die zweijährige Arbeit des regelmäßig<br />
tagenden DIN-Ausschusses aus Wissenschaftlern,<br />
Industrieexperten und Anlagenbauern<br />
intensiv eingebunden. Das Traditionsunternehmen<br />
sicherte umfangreiche<br />
Analysen zur Festigkeit dünnw<strong>and</strong>iger Rohre<br />
für diverse Geometrien, zur Begründung<br />
der geometrischen Präge-Formen sowie<br />
zum Funktionsnachweis der Tubes in prakti-<br />
Autor<br />
Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. Udo Hellwig<br />
ERK Eckrohrkessel GmbH<br />
Berlin, Deutschl<strong>and</strong><br />
Bild 1. Flexibel für unterschiedliche An<strong>for</strong>derungen gestaltbar: Verschiedene Querschnitte und<br />
W<strong>and</strong>stärken von ERK-Tubes.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 77
Forum Technology: DIN 28177: Erste Norm für Strukturrohre veröffentlicht<br />
Bild 2. Um den Faktor zwei erhöhter Wärmeübergang<br />
ohne Druckverlusterhöhung:<br />
Durchführung DIN-gemäß strukturierter<br />
Rohre durch den Rohrboden eines<br />
prototypischen Rohrbündel-Wärmeübertragers.<br />
schen Anwendungen und zur Wiederholbarkeit<br />
des Um<strong>for</strong>mverfahrens. „Für Prüfbehörden<br />
entfällt jetzt jegliche Akzeptanzhemmung<br />
bei Strukturrohren für Druckanwendungen,<br />
denn ihre Praxistauglichkeit<br />
ist nachgewiesen, sie sind bei Festigkeitsberechnungen<br />
mit nicht strukturierten<br />
Rohren gleichsetzbar“, konstatiert Hellwig.<br />
Anwender könnten Rohrproduzenten<br />
künftig auf die neue DIN hinweisen und ihre<br />
effizienzsteigernde Berücksichtigung verlangen.<br />
Die Berliner Verfahrenstechniker mit acht<br />
Jahrzehnten Erfahrung im Energietechnikbereich<br />
hatten die Strukturrohr-Entwicklung<br />
über Jahre vorangetrieben, wurde da-<br />
Bild 3. In der Produktion, die ERK-Tube-Um<strong>for</strong>mmaschine.<br />
für schon 2016 mit dem „Deutschen Rohst<strong>of</strong>f-Effizienz<br />
Preis“ ausgezeichnet. Ihre<br />
Tubes bewähren sich vor allem in Kraftwerken,<br />
Müllverbrennungsanlagen und im Kesselbau.<br />
Die neue Norm half dem Unternehmen<br />
auch gerade selbst bei der Entwicklung<br />
eines innovativen Re<strong>for</strong>mers zur<br />
Erzeugung von Methanol und Wasserst<strong>of</strong>f<br />
aus Erdöl sowie aus Biomasse: Der Verweis<br />
auf die DIN habe jegliche Diskussionen zu<br />
Sicherheitsaspekten mit dem bayerischen<br />
Auftraggeber so<strong>for</strong>t beendet, so Firmenchef<br />
Hellwig.<br />
Massenprodukt für mehr<br />
Effizienz<br />
Die Dimple Tubes etwa aus der Produktion<br />
des erfahrenen Partnerunternehmens La<br />
Mont (Berlin) sieht er als klassisches Massenprodukt.<br />
Allein im Energiebereich läge<br />
der Bedarf für Wärmeübertragungstechnik<br />
zur Effizienzerhöhung der Abhitzenutzung<br />
im Hoch- und Niedertemperaturbereich<br />
jährlich „beim 10fachen Erdumfang“. Zusätzliche<br />
Anwendungsmöglichkeiten böten<br />
sich für Reaktionstechnik in der chemischen<br />
Industrie, in der Metallurgie und selbst im<br />
Bauwesen, dem die extreme Biegesteifigkeit<br />
strukturierter Rohre ganz neue Anwendungsfälle<br />
und Einsparpotenziale eröffne.<br />
Damit sei das Ende wirtschaftlich wie ökologisch<br />
vorteilhafter Nutzungsmöglichkeiten<br />
aber lange nicht erreicht. Ließen sich doch<br />
neben Stahl- auch Rohre aus <strong>and</strong>eren duktilen<br />
Materialien wie Kupfer, Kunstst<strong>of</strong>f oder<br />
sogar Glas mit Nennweiten von acht bis 60<br />
Millimeter strukturieren.<br />
l<br />
VGB-St<strong>and</strong>ard<br />
Analysenverfahren im Kraftwerk<br />
(vormals VGB-B 401)<br />
Ausgabe 2020 – VGB-S-004-00-2020-10-DE<br />
DIN A4, Print/eBook, 234 S., Preis für <strong>vgbe</strong>-Mit glie der € 280.–, Nicht mit glie der € 420,–, + Ver s<strong>and</strong> und USt.<br />
Die Kraftwerkschemie spielt in vielen Kraftwerksprozessen eine gewichtige Rolle. Sie unterstützt das<br />
Kraftwerk bei dem sicheren, effizienten, umweltbewussten und auflagenkon<strong>for</strong>men Betrieb seiner Anlagen.<br />
Sie hilft bei der Bewertung von Einsatzst<strong>of</strong>fen und im Kraftwerksprozess entstehenden St<strong>of</strong>fen.<br />
Um diesen An<strong>for</strong>derungen gerecht zu werden, benötigt der St<strong>and</strong>ort eine kompetente, personell gut<br />
ausgestattete chemisch analytische Abteilung, die über die für eine qualitativ hochwertige Analytik<br />
geeignete Analysengeräte verfügt. Die Analytik im Kraftwerk besitzt auch die Kompetenz Analysenwerte,<br />
die von externen Labors erzeugt wurden, zu bewerten und die daraus notwendigen H<strong>and</strong>lungen<br />
einzuleiten. Somit stellt die Analytik einen unverzichtbaren Kernbereich im Kraftwerk dar.<br />
VGB-St<strong>and</strong>ard<br />
Analysenverfahren<br />
im Kraftwerk<br />
(vormals VGB-B 401)<br />
VGB-S-004-00-2020-10-DE<br />
Das „H<strong>and</strong>buch der analytischen Kraftwerkschemie“ (VGB-B 401) existiert seit 1973. Seine Anfänge<br />
liegen weit zurück, als der Einsatz von modernen elektronischen Medien hauptsächlich als Ersatz der<br />
Schreibmaschine gesehen wurde. Inzwischen gab es bekanntermaßen eine rasante Entwicklung. Die<br />
Allgegenwart des Internets ermöglicht eine schnelle Recherche von analytischen Sachverhalten. Diese Aktualität kann ein gedrucktes<br />
Medium nie erreichen. Die Fachgruppe (TG) „Analytik“ erhielt deshalb durch das Technical Committee (TC) „Chemistry“ den Auftrag,<br />
das H<strong>and</strong>buch inhaltlich und konzeptionell zu überarbeiten und dem Einsatz neuer Medien Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck<br />
wurde eine Projektgruppe gegründet, die das vorliegende H<strong>and</strong>buch erstellt hat.<br />
78 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Konferenzbericht: <strong>vgbe</strong> Fachtagung „Dampfturbinen und Dampfturbinenbetrieb <strong>2022</strong>“<br />
Konferenzbericht:<br />
<strong>vgbe</strong> Fachtagung „Dampfturbinen<br />
und Dampfturbinenbetrieb <strong>2022</strong>“<br />
Abstract<br />
Conference Report: <strong>vgbe</strong> Conference<br />
“Steam Turbines <strong>and</strong> Operation <strong>of</strong><br />
Steam Turbines <strong>2022</strong>”<br />
With around 260 participants from Germany<br />
<strong>and</strong> abroad <strong>and</strong> an accompanying trade exhibition<br />
with 37 exhibitors, the <strong>vgbe</strong> conference<br />
“Steam Turbines <strong>and</strong> Steam Turbine Operation<br />
<strong>2022</strong>” took place in Cologne from 14 to 15<br />
June <strong>2022</strong>. The high number <strong>of</strong> participants<br />
<strong>and</strong> the large trade exhibition underline the<br />
importance <strong>of</strong> this <strong>vgbe</strong> conference on the one<br />
h<strong>and</strong> <strong>and</strong> the great interest in an attendance<br />
event on the other. This year’s lecture programme<br />
focused on the following topics: Repair<br />
possibilities <strong>and</strong> measures, numerical<br />
analyses <strong>and</strong> reverse engineering, retr<strong>of</strong>its<br />
<strong>and</strong> possibilities <strong>for</strong> plant optimisation, steam<br />
quality <strong>and</strong> analysis, as well as government<br />
regulations on the <strong>energy</strong> market (Grid Code,<br />
Energy Tax Act, etc.).<br />
l<br />
Mit rund 260 Teilnehmenden aus dem In- und<br />
Ausl<strong>and</strong> und einer begleitenden Fachausstellung<br />
mit 37 Ausstellern hat die Veranstaltung<br />
vom 14. bis 15. Juni <strong>2022</strong> in Köln stattgefunden.<br />
Nach dem p<strong>and</strong>emiebedingten Ausfall der<br />
Dampfturbinentagung in 2020 und einer<br />
Onlineveranstaltung im vergangenen Jahr,<br />
Eröffnung der <strong>vgbe</strong> Fachtagung<br />
„Dampfturbinen und Dampfturbinenbetrieb<br />
<strong>2022</strong>“ Dipl.-Ing. Hartmut Strangfeld,<br />
RWE Power AG, Grevenbroich.<br />
wurde in diesem Jahr die Tagung erneut in<br />
Präsenz durchgeführt, damit der bislang übliche<br />
Zwei-Jahres-Rhythmus wieder eingehalten<br />
werden kann.<br />
Die hohe Teilnehmerzahl und die große<br />
Fachausstellung unterstreichen einerseits<br />
die Bedeutung dieser <strong>vgbe</strong>-Tagung und <strong>and</strong>ererseits<br />
das große Interesse an einer Präsenzveranstaltung.<br />
Neben der fachlichen<br />
Bedeutung wurde dieser Aspekt bereits<br />
in der Eröffnungsrede von Hartmut Strangfeld<br />
besonders hervorgehoben: „Eine Veranstaltung<br />
wie die Fachtagung Dampfturbine<br />
lebt nicht nur von den fachlichen Inhalten,<br />
sondern in besonderer Weise von<br />
den zwischenmenschlichen Kontakten,<br />
vom Networking und dem gemeinsamen Erleben.“<br />
Für das Networking und die persönliche<br />
Kontaktpflege wurde bei dieser Veranstaltung<br />
zusätzlicher Raum geschaffen: Ein spezieller<br />
„<strong>vgbe</strong> Meeting Point“ mit Vertretern<br />
der <strong>vgbe</strong>-Technical Group „Dampfturbinen“<br />
bot Gelegenheit zum gezielten fachlichen<br />
Austausch und zur detaillierten In<strong>for</strong>mation<br />
über die Aktivitäten und Projekte dieses <strong>vgbe</strong>-Gremiums.<br />
Im diesjährigen Vortragsprogramm wurden<br />
schwerpunktmäßig folgende Themen beh<strong>and</strong>elt:<br />
<strong>vgbe</strong> Fachtagung „Dampfturbinen und Dampfturbinenbetrieb <strong>2022</strong>“, aus den Vortragssessions.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 79
Konferenzbericht: <strong>vgbe</strong> Fachtagung „Dampfturbinen und Dampfturbinenbetrieb <strong>2022</strong>“<br />
Das Thema „Reverse Engineering“ wurde<br />
unter <strong>and</strong>erem in einem Beitrag von Dr. Stephan<br />
Schwab adressiert. Für den Bereich<br />
Dampfturbine wurde die prinzipielle Vorgehensweise<br />
des Reverse-Engineering-Prozesses<br />
beschrieben und anh<strong>and</strong> von mehreren<br />
Projekten wurden Beispiele aus der Praxis<br />
erläutert. Sollen beim Reverse Engineering<br />
Bauteile modifiziert werden, kann dies unter<br />
<strong>and</strong>erem mit Hilfe der numerischen Analyse<br />
umgesetzt werden. Dadurch wird der<br />
sichere Turbinenbetrieb mittels Festigkeitsanalysen<br />
und rotordynamischen Betrachtungen<br />
gewährleistet. Durch strömungsmechanische<br />
Analysen kann darüber hinaus<br />
auch die Energieumw<strong>and</strong>lung innerhalb der<br />
Dampfturbine optimiert werden.<br />
Anlagenoptimierung, Erhöhung der Verfügbarkeit<br />
und optimierte Zust<strong>and</strong>süberwachung<br />
sind stets Themen die weit oben auf<br />
der Agenda stehen. In einem Vortrag von<br />
Clemens Bueren et al wurden die Möglichkeiten<br />
des Betriebsauswuchtens unter der<br />
Überschrift „Kleine Masse, große Wirkung“<br />
diskutiert. Beim Auswuchten von Dampftur<strong>vgbe</strong><br />
Fachtagung „Dampfturbinen und Dampfturbinenbetrieb <strong>2022</strong>“, Impressionen aus der<br />
Ausstellung.<br />
––<br />
Inst<strong>and</strong>setzungsmöglichkeiten und -maßnahmen<br />
––<br />
Numerische Analysen und Reverse-Engineering<br />
––<br />
Retr<strong>of</strong>its und Möglichkeiten zur Anlagenoptimierung<br />
––<br />
Dampfqualität und -analytik<br />
––<br />
Staatliche Vorgaben am Energiemarkt<br />
(Grid Code, EnergieStG, etc.)<br />
Das Thema Inst<strong>and</strong>setzung wurde z.B. in einem<br />
Vortrag von Dr. Jens Göhler und Christian<br />
Frank beh<strong>and</strong>elt. Es wurden innovative<br />
Reparaturlösungen an stationären und rotierenden<br />
Bauteilen von Industriedampfturbinen<br />
mit mobiler Lasertechnologie anschaulich<br />
vorgestellt. Bei dieser Technologie<br />
kommen auf Dioden gepulste Faserlaser Yt-<br />
YAG mit einer Wellenlänge von 1070 nm<br />
zum Einsatz und ermöglichen die schweißtechnische<br />
Bearbeitung einer großen B<strong>and</strong>breite<br />
von Werkst<strong>of</strong>fen und Legierungen.<br />
Eine Besonderheit dieses Verfahrens ist der<br />
mögliche Verzicht der Wärmenachbeh<strong>and</strong>lung<br />
des Bauteils, wie sonst bei konventionellen<br />
Schweißverfahren zwingend er<strong>for</strong>derlich.<br />
<strong>vgbe</strong> Fachtagung „Dampfturbinen und Dampfturbinenbetrieb <strong>2022</strong>“, Impressionen aus der<br />
Ausstellung<br />
<strong>vgbe</strong> Fachtagung „Dampfturbinen und Dampfturbinenbetrieb <strong>2022</strong>“, Impressionen aus der<br />
Ausstellung<br />
binen h<strong>and</strong>elt es sich um eine seit langem<br />
erprobte Möglichkeit zur Verbesserung der<br />
Schwingungsamplitude, bzw. des Laufverhaltens<br />
der Turbine. Die Vortragenden haben<br />
die Bedeutung der sorgfältigen Analyse,<br />
Voraussetzung für die erfolgreiche Verbesserung<br />
des Schwingungs- und Betriebsverhaltens,<br />
vor dem eigentlichen Auswuchten<br />
hervorgehoben. Dazu sind erprobte und geeignete<br />
Messinstrumente sowie qualifiziertes<br />
Personal er<strong>for</strong>derlich, das in enger Abstimmung<br />
mit dem Betreiber und Schwingungsexperten<br />
das Auswuchten vorbereitet<br />
und durchführt, um so ein gutes Betriebsverhalten<br />
zu sichern.<br />
Das Expertenteam der <strong>vgbe</strong>-Technischen<br />
Dienste war ebenfalls auf der Tagung vertreten.<br />
Dr. Christian Ullrich, Geschäftsführer<br />
der <strong>vgbe</strong>-service GmbH und Leiter der <strong>vgbe</strong>-<br />
Technischen Dienste, hat einen Vortrag zu<br />
„Schäden durch Spannungsrisskorrosion<br />
(SpRK) an Turbinen und Kompressoren“ ge-<br />
80 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Konferenzbericht: <strong>vgbe</strong> Fachtagung „Dampfturbinen und Dampfturbinenbetrieb <strong>2022</strong>“<br />
halten. In der Vergangenheit wurde SpRK<br />
als eine Ursache von frühzeitigem Turbinenversagen<br />
identifiziert. Drei ungünstige Bedingungen,<br />
die sich wechselseitig beeinflussen<br />
– Auftreten eines kritischen flüssigen<br />
Mediums, Vorliegen eines sensiblen Werkst<strong>of</strong>fzust<strong>and</strong>s<br />
und Zugspannung in ausreichender<br />
Höhe –, können zu SpRK führen.<br />
Anh<strong>and</strong> von drei Schadensbeispielen wurde<br />
dargestellt, wie betriebliche Gründe (z.B.<br />
schlechte Dampf- und Luftqualität, unzureichend<br />
ausgeführte Inst<strong>and</strong>haltungsmaßnahmen)<br />
Bedingungen schaffen, die zu<br />
SpRK führen. Die <strong>vgbe</strong>-Technischen Dienste<br />
können hier einen wertvollen Beitrag leisten,<br />
um das entstehen derartiger ungünstiger<br />
Bedingungen zu vermieden.<br />
Während der Pausen gab es reichlich Gelegenheit,<br />
die gut aufgestellte Fachausstellung<br />
zu besuchen. Hersteller und Serviceunternehmen<br />
haben ihre Produkte und Dienstleistungen<br />
präsentiert und konnten alte und<br />
neue Kontakte pflegen und die Diskussionen<br />
aus dem Plenum <strong>for</strong>tsetzen und vertiefen.<br />
Der hohe Wert des bereits zu Beginn der Veranstaltung<br />
hervorgehobenen Networkings<br />
ist auch stets in der Fachausstellung von besonderer<br />
Bedeutung. Dabei geht es derzeit<br />
auch um den <strong>Generation</strong>enwechsel in den<br />
Unternehmen. Erfahrene Kollegen:innen<br />
scheiden altersbedingt aus und werden<br />
durch jüngere Nachfolger:innen ersetzt. Der<br />
Erfahrungsaustausch am R<strong>and</strong>e von Fachtagungen<br />
dient dementsprechend auch einer<br />
Art „Wissensmanagement“ und dem Erhalt<br />
langjähriger, gut funktionierender Business-<br />
Partnerschaften.<br />
Auch die <strong>vgbe</strong>-Community musste Abschied<br />
nehmen: Nachdem Peter Richer von 1999<br />
bis 2021 als Dampfturbinen-Referent bei<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V. tätig war, wechselt er nun<br />
in den Ruhest<strong>and</strong>. Mit Peter Richter verliert<br />
die <strong>vgbe</strong>-Community einen erfahrenen und<br />
humorvollen Dampfturbinen-Experten mit<br />
hoher fachlicher Expertise und Reputation.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V. freut sich, mit Anna-Maria<br />
Mika, die bereits seit Juli 2021 im Verb<strong>and</strong><br />
tätig ist, eine neue Dampfturbinenexpertin<br />
beim <strong>vgbe</strong> begrüßen zu können. Anna-Maria<br />
Mika tritt die Nachfolge von Peter Richter<br />
an und erweist sich durch ihr Maschinenbaustudium<br />
an der TU Braunschweig, Fachrichtung<br />
Energie- und Verfahrenstechnik,<br />
als ehemalige Projektleiterin im Bereich Revision<br />
Turbomaschinen, Konstruktionsingenieurin<br />
für Schraubenverdichter und Expertin<br />
für Ersatzteilempfehlungen bei Revisionen<br />
von Turbosträngen als ausgewiesene<br />
und erfahrene Dampfturbinenexpertin, um<br />
die erfolgreiche Arbeit von Peter Richter<br />
beim <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V. <strong>for</strong>tsetzen zu können.<br />
Verabschiedung Peter Richter<br />
Das <strong>vgbe</strong>-Tagungsteam bedankt sich herzlich<br />
bei allen Teilnehmenden, Vortragenden<br />
und Ausstellern für ihre Teilnahme und Unterstützung<br />
und freut sich auf die nächste<br />
<strong>vgbe</strong>-Dampfturbinentagung, die turnusgemäß<br />
vom 28./29. Mai 2024 in Würzburg<br />
stattfinden wird.<br />
Weitere In<strong>for</strong>mationen finden Sie auf der<br />
Webseite des <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> und zu Vorträgen<br />
in kommenden Ausgaben des <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong><br />
<strong>journal</strong>s.<br />
For more in<strong>for</strong>mation, please visit the new<br />
<strong>vgbe</strong> event plat<strong>for</strong>m <strong>and</strong> <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong>;<br />
selected papers will be published here.<br />
This report is also available in English language<br />
on <strong>vgbe</strong>´s website, www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>,<br />
topic news.<br />
l<br />
VGB-St<strong>and</strong>ard<br />
Empfehlungen zum Management der funktionalen Sicherheit in<br />
Dampfkesselanlagen und Anlagen des Wasser-Dampf-Kreislaufs<br />
2. überarbeitete Ausgabe 2020<br />
Ausgabe 2020 – VGB-S-008-00-2020-11-DE<br />
DIN A4, Print/eBook, 166 S., Preis für <strong>vgbe</strong>-Mit glie der € 260.–, Nicht mit glie der € 390,–, + Ver s<strong>and</strong> und USt.<br />
Mit den neuen Normen zur funktionalen Sicherheit auf Basis der EN 61508 wurde für die<br />
Geräte an<strong>for</strong>derungen in Schutzkreisen das Management der funktionalen Sicherheit eingeführt.<br />
Diese EN Normen bieten einen erheblichen Ermessensspielraum, der durch Hersteller und<br />
Betreiber gestaltet werden muss.<br />
Es ist er<strong>for</strong>derlich, die Anwendung dieser Normen in Kraftwerken zu konkretisieren. Es war daher<br />
ein Ziel des Arbeitskreises „Funktionale Sicherheit“ beim VGB mit diesem VGB-St<strong>and</strong>ard diese Hilfestellung<br />
zu geben. Da es sich hier um die Erläuterung zum Hintergrund und zur Anwendung von<br />
Teilbereichen des Managements der funktionalen Sicherheit h<strong>and</strong>elt, wird dieser VGB-St<strong>and</strong>ard nicht<br />
als Bestellrichtlinie veröffentlicht. Hier ist jeder Hersteller und Betreiber ge<strong>for</strong>dert, die An<strong>for</strong>derungen<br />
dieses Managements der funktionalen Sicherheit in seine Prozesse zu integrieren.<br />
VGB-St<strong>and</strong>ard<br />
Empfehlungen zum<br />
Management der funktio nalen<br />
Sicherheit in Dampfkesselanlagen<br />
und Anlagen des<br />
Wasser-Dampf-Kreislaufs<br />
2. überarbeitete Ausgabe 2020<br />
VGB-S-008-00-2020-11-DE<br />
Der Arbeitskreis (AK) hat ein Beispiel für eine Risikoanalyse einer Dampfkessel- und Druckanlage erarbeitet, da es zur eindeutigen<br />
Erläuterung der Anwendung des Verfahrens als unabdingbar angesehen wurde. Die Empfehlungen können jedoch nur nach<br />
erneuter Überprüfung im Rahmen eines Managements der funktionalen Sicherheit betrachtet werden.<br />
Der VGB-St<strong>and</strong>ard wendet sich sowohl an Betreiber von thermischen Kraftwerken wie auch an Hersteller und soll eine Hilfestellung<br />
zur Anwendung der Normen zur funktionalen Sicherheit geben.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 81
Konferenzbericht: KELI <strong>2022</strong> –<br />
Konferenz Elektro-, Leit- und<br />
In<strong>for</strong>mationstechnik in der<br />
Energieversorgung<br />
Abstract<br />
Conference report: <strong>vgbe</strong> Conference<br />
Electrical Engineering, Instrumentation<br />
& Control <strong>and</strong> In<strong>for</strong>mation Technology<br />
in the <strong>energy</strong> supply<br />
Around 230 participants from Germany <strong>and</strong><br />
abroad used the KELI <strong>2022</strong> – Conference Electrical<br />
Engineering, Instrumentation & Control<br />
<strong>and</strong> In<strong>for</strong>mation Technology in the <strong>energy</strong> supply<br />
as plat<strong>for</strong>m to find out about the latest KELI<br />
trends <strong>and</strong> discuss the technical challenges <strong>of</strong><br />
current <strong>energy</strong> policy. The conference was again<br />
rounded <strong>of</strong>f by an accompanying trade exhibition<br />
with 12 exhibitors from the fields <strong>of</strong> electrification,<br />
automation, drive technology, engineering<br />
s<strong>of</strong>tware, IT security, control systems<br />
<strong>and</strong> cyber security. On the two days <strong>of</strong> the conference,<br />
ten sections focused on the main actual<br />
topics <strong>of</strong> electrical engineering, instrumentation<br />
& control <strong>and</strong> in<strong>for</strong>mation technology. l<br />
Rund 230 Teilnehmer aus dem In- und Ausl<strong>and</strong><br />
haben die KELI als Platt<strong>for</strong>m genutzt, um<br />
sich über die neuesten Trends zu in<strong>for</strong>mieren<br />
und die technischen Heraus<strong>for</strong>derungen<br />
der aktuellen Energiepolitik zu diskutieren.<br />
Ihrem Zweijahresrhythmus folgend, f<strong>and</strong><br />
die diesjährige „KELI – Konferenz Elektro-,<br />
Leit- und In<strong>for</strong>mationstechnik in der Energieversorgung“<br />
vom 10. bis 12. Mai <strong>2022</strong> in<br />
Bremen statt. Die Konferenz wurde wieder<br />
durch eine begleitende Fachausstellung mit<br />
12 Ausstellern aus den Bereichen Elektrifizierung,<br />
Automation, Antriebstechnik, Engineering-S<strong>of</strong>tware,<br />
IT-Sicherheitslösungen,<br />
Leittechniksystemen und Cybersicherheit<br />
abgerundet. Rund 230 Teilnehmer aus<br />
dem In- und Ausl<strong>and</strong> haben die KELI als<br />
Platt<strong>for</strong>m genutzt, um sich über die neuesten<br />
Trends zu in<strong>for</strong>mieren und die technischen<br />
Heraus<strong>for</strong>derungen der aktuellen<br />
Energiepolitik zu diskutieren. Traditionell<br />
begann die Konferenz bereits am Vorabend<br />
des ersten Veranstaltungstages mit ausreichend<br />
Gelegenheit zum fachlichen und persönlichen<br />
Austausch und zum Besuch der<br />
Fachausstellung beim zwanglosen Get-together.<br />
An den folgenden beiden Tagen wurden<br />
in zehn Sektionen schwerpunktmäßig<br />
folgende Themen beh<strong>and</strong>elt:<br />
––<br />
Cybersicherheit und IT-Sicherheit aus<br />
Sicht der Betreiber, Hersteller und Dienstleister<br />
im Hinblick auf die Verknüpfung zu<br />
bestehenden Kraftwerksautomatisierungen<br />
und neuen Lösungsansätzen wie<br />
Künstlicher Intelligenz (KI), funktionale<br />
Sicherheit und SIL-An<strong>for</strong>derungen,<br />
––<br />
Systemstützendes Reglerverhalten und<br />
Robustheit gegenüber Frequenzgradienten,<br />
––<br />
Netzanschlusserfahren für Energieanlagenbetreiber<br />
komplex und schwer h<strong>and</strong>elbar:<br />
Austausch zu Sichtweisen eines<br />
Zertifizierers und Projekterfahrungen eines<br />
Betreibers, Elektrische Sicherheit,<br />
––<br />
Weitreichende Modellierungen, virtuelles<br />
Kraftwerk und Zentralwarten, Ursachen<br />
und Auswirkungen von Torsionsschwingungen<br />
auf Kraftwerksturbosätze im Umfeld<br />
geänderter Netzbedingungen,<br />
Bild 1. Eröffnung der KELI <strong>2022</strong> durch Dr. Oliver Then, <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
82 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong>
Konferenzbericht: KELI <strong>2022</strong><br />
Bild 2. KELI <strong>2022</strong>: Aktivitäten der <strong>vgbe</strong>-Gremien zur Elektro-, Leit- und In<strong>for</strong>mationstechnik,<br />
Joachim von Graeve, Uniper Technologies GmbH, Gelsenkirchen<br />
––<br />
Neuigkeiten und Innovationen in Diagnostik<br />
und Inst<strong>and</strong>haltung,<br />
––<br />
Optimierungen und Lifecycle-Betrachtungen<br />
zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit<br />
und Erhalt der Zukunftsfähigkeit<br />
Die Dekarbonisierung der Energieversorgung<br />
stellt alle bisherigen Veränderungen<br />
der industriellen Entwicklung in den Schatten.<br />
Stefan Basenach hat in seinem Plenarvortrag<br />
zum Thema „Dekarbonisierung mit<br />
Wasserst<strong>of</strong>f – Erzeugung und Einsatz von<br />
H2 im Energiesystem“, die damit verbundenen<br />
Heraus<strong>for</strong>derungen eindrucksvoll dargestellt.<br />
Zum einen gilt es die Verfügbarkeit<br />
bestehender (konventioneller) Energieversorgung<br />
bis zum letzten Tag sicher zu stellen<br />
und zum <strong>and</strong>eren müssen diese bestehenden<br />
Energiest<strong>and</strong>orte in Energiefabriken<br />
trans<strong>for</strong>miert werden. Dabei spielt die Herstellung<br />
von grünem Wasserst<strong>of</strong>f eine entscheidende<br />
Rolle.<br />
Durch die Nutzung von Best<strong>and</strong>sanlagen ergeben<br />
sich erhebliche Vorteile im Hinblick<br />
auf Genehmigungsfragen, Infrastruktur,<br />
Technik, Konw-how und vor allem Personal<br />
– eine wichtige Ressource, deren Knappheit<br />
sich bereits heute deutlich abzeichnet. Damit<br />
bieten Best<strong>and</strong>sanlagen optimale Voraussetzungen<br />
auch in Zukunft als Rückgrat<br />
einer gesicherten und CO2-neutralen Energieversorgung<br />
zu fungieren. Dazu bedarf es<br />
jedoch wesentlicher Veränderungen beim<br />
Betrieb dieser Anlagen. Die Energiest<strong>and</strong>orte<br />
von heute werden sich zu komplexen Prozessanlagen<br />
entwickeln und das gleichzeitige<br />
H<strong>and</strong>ling verschiedenster Energieträger<br />
(Strom, H2, Wärme, Bio Fuels) er<strong>for</strong>dert<br />
eine umfangreiche Digitalisierung der Prozesse.<br />
Ohne entsprechende Digitalisierung<br />
und Automatisierung werden weder Erzeugung<br />
und Verteilung, noch das Energiesystem<br />
als Ganzes funktionieren.<br />
In einem weiteren Plenarvortrag von Harald<br />
Weber zum Thema „Wege zu einer sicheren<br />
und stabilen voll-regenerativen elektrischen<br />
Energieversorgung“ wurde am Beispiel des<br />
Bild 3. KELI <strong>2022</strong>: Plenarsitzung.<br />
Bild 4. KELI <strong>2022</strong>, Einblick in eine Sektion.<br />
Wasserst<strong>of</strong>f-Speicherkraftwerksprojekts „Referenzobjekt<br />
Lausitz“ (RefLau) im Industriepark<br />
Schwarze Pumpe gezeigt, wie mit komplett<br />
neuen Ansätzen für die Netzregelung<br />
und Systemführung der Weg hin zur vollregernativen<br />
elektrischen Energieversorgung<br />
beschritten werden kann. Seit der<br />
wattschen Dampfmaschine wird die Netzstabilität<br />
über ein gestuftes System, bestehend<br />
aus Momentanreserve, Primär-, Sekundär<br />
und Tertiärregelung gewährleistet.<br />
Durch neue volatile Einspeisung insbesondere<br />
Windkraft und Photovoltaik, ergeben<br />
sich für das Netz neue Regel- und Steuermöglichkeiten.<br />
Mit vermehrter Außerbetriebsetzung<br />
konventioneller Kraftwerke<br />
müssen die Erneuerbaren die Aufgaben der<br />
Sicherung der Netzstabilität übernehmen<br />
und auch Störfälle bis hin zum Inselnetzbetrieb<br />
sicher beherrschen können. Eine Aufgabe,<br />
die von Forschungseinrichtungen,<br />
Herstellern und Verbänden gemeinsam zu<br />
lösen ist.<br />
Die Plenarvorträge wurden in einer Podiumsdiskussion<br />
vertieft. In der Diskussion<br />
zum Thema „Digitalisierung auf dem Weg<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 83
Konferenzbericht: KELI <strong>2022</strong><br />
vor allem auch autonome St<strong>and</strong>orte und<br />
Kraftwerke eine immer größer werdende<br />
Rolle.<br />
Zum Teilnehmerkreis zählten auch dieses<br />
Mal wieder Studierende, die kostenlos an<br />
<strong>vgbe</strong>-Veranstaltungen teilnehmen können.<br />
Rund 15 Studierende nutzten das Angebot<br />
und beteiligten sich aktiv am Vortragsprogramm<br />
und ergriffen die Möglichkeiten<br />
Netzwerke zu etablieren. Wie bereits dargestellt,<br />
zählt der Fachkräftemangel mit zu<br />
den gravierendsten aktuellen und zukünftigen<br />
Problemen. Aus solchen Veranstaltungen<br />
und den dort neu geknüpften Netzwerken<br />
ergeben sich sowohl für die angehende<br />
Ingenieure: Innen als auch für Betreiber und<br />
Hersteller interessante Kontakte, für die <strong>vgbe</strong>-Veranstaltungen<br />
eine ideale Platt<strong>for</strong>m<br />
bieten.<br />
Bild 5. Podiumsdiskussion – Moderation: Pr<strong>of</strong>. Dr. Jens Paetzold, Hochschule Ruhr West.<br />
zum Schlüssel des Energiesystems der Zukunft“<br />
haben Betreiber und Hersteller die<br />
Themen Dekarbonisierung, Digitalisierung<br />
und Automatisierung und deren Auswirkung<br />
auf den zukünftigen Energiemarkt erörtert.<br />
Dabei wurde noch einmal die herausragende<br />
Rolle der Vernetzung und Kooperation<br />
aller Akteure des Energiesystems<br />
herausgestellt. Darüber hinaus sind treibende<br />
und flankierende regulatorische Aspekte<br />
von großer Bedeutung, die den Bedarf und<br />
Nutzen einer sektoren-übergreifenden Zertifizierung<br />
von grüner Energie darlegen und<br />
nachweisen, um den kommenden EU-Programmen<br />
zu entsprechen und die Dekarbonisierung<br />
zu unterstützen.<br />
Wie bereits beim Get-together am Vorabend,<br />
gab es bei einer Abendveranstaltung am<br />
Ende des ersten Konferenztages reichlich<br />
Gelegenheit zum intensiven fachlichen Austausch<br />
und zum Networking.<br />
Die Sektionsbeiträge des zweiten Tages wurden<br />
jeweils durch kurze Diskussionen der<br />
Beiträge beendet. Es konnte festgestellt werden,<br />
dass insgesamt eine positive Grundstimmung<br />
herrscht und die Konferenzteilnehmer<br />
den KELI-Themen auch zukünftig<br />
eine hohe Bedeutung beimessen, um<br />
den Heraus<strong>for</strong>derungen einer gesicherten<br />
Energieversorgung angemessen zu begegnen.<br />
In diesem Zusammenhang spielen<br />
Das <strong>vgbe</strong>-Tagungsteam dankt allen Teilnehmenden,<br />
Vortragenden und Ausstellern für<br />
ihr Interesse und ihre Mitwirkung und freut<br />
sich auf ein Wiedersehen auf der nächsten<br />
KELI, die vom 14. bis 16. Mai 2024 in Essen<br />
stattfinden soll.<br />
Weitere In<strong>for</strong>mationen finden Sie auf der<br />
Webseite des <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> und zu Vorträgen<br />
in kommenden Ausgaben des <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong><br />
<strong>journal</strong>s.<br />
For more in<strong>for</strong>mation, please visit the new<br />
<strong>vgbe</strong> event plat<strong>for</strong>m <strong>and</strong> <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong>;<br />
selected papers will be published here.<br />
This report is also available in English language<br />
on <strong>vgbe</strong>´s website, www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>,<br />
topic news.<br />
l<br />
84 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Nuclear power plants: Operating results<br />
Plants in direct exchange <strong>of</strong> experience with <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> I May <strong>2022</strong><br />
Nuclear<br />
power plant<br />
Country<br />
Type<br />
Nominal<br />
capacity<br />
Gross Net<br />
MW<br />
MW<br />
Operating<br />
time<br />
generator<br />
in h<br />
Energy generated<br />
(gross generation) MWh<br />
Month Year 4 commis-<br />
Since<br />
sioning<br />
Time<br />
availability %<br />
Unit capability<br />
factor % 1<br />
Energy unavailability<br />
% 1<br />
Energy<br />
utilisation % 1<br />
Planned 2 Unplanned 3<br />
Month Year 4 Month Year 4 Postponable Not postponable Month Year 4<br />
Month Year 4<br />
Month Year 4 Month Year 4<br />
GKN-II Neckarwestheim DE PWR 1400 1310 744 969 600 5 002 200 367 505 044 100.00 100.00 100.00 99.98 0 0.02 0 0 0 0 92.98 98.83 4<br />
KKE Emsl<strong>and</strong> DE PWR 1406 1335 295 335 754 4 301 639 384 668 923 39.68 87.61 39.15 87.50 60.85 12.50 0 0 0 0 31.83 84.41 1,2,4<br />
KKI-2 Isar DE PWR 1485 1410 744 1 072 229 5 161 790 394 659 118 100.00 98.91 99.98 98.81 0.02 0.01 0 0 0 1.18 96.67 95.59 -<br />
OL1 Olkiluoto FI BWR 920 890 185 169 438 2 845 104 287 546 016 24.95 84.59 24.75 84.49 75.19 15.49 0 0 0.06 0.01 24.75 85.36 1,4<br />
OL2 Olkiluoto FI BWR 920 890 673 607 731 3 128 809 277 316 740 90.46 93.90 88.91 93.46 11.09 6.54 0 0 0 0 88.79 93.87 1<br />
KCB Borssele NL PWR 512 484 744 376 725 1 581 544 177 478 297 99.97 85.56 99.97 85.55 0.03 14.45 0 0 0 0 98.93 85.38 -<br />
KKB 1 Beznau CH PWR 380 365 0 0 1 083 590 137 494 137 0 78.44 0 78.20 100.00 21.60 0 0 0 0.20 0 78.69 1,2,7<br />
KKB 2 Beznau CH PWR 380 365 744 279 043 1 372 435 144 717 696 100.00 100.00 100.00 100.00 0 0 0 0 0 0 98.67 99.74 7<br />
KKG Gösgen CH PWR 1060 1010 485 505 423 3 574 035 342 778 861 65.12 92.84 64.87 92.76 35.13 7.24 0 0 0 0 64.09 93.06 1,2,7<br />
CNT-I Trillo ES PWR 1066 1003 325 331 040 3 366 531 275 319 472 43.71 88.44 43.66 88.42 56.34 11.58 0 0 0 0 41.33 86.68 1,2,4<br />
Dukovany B1 CZ PWR 500 473 744 364 470 1 218 715 124 671 498 100.00 70.00 100.00 68.90 0 30.82 0 0 0 0.28 97.98 67.28 -<br />
Dukovany B2 CZ PWR 500 473 744 364 424 1 329 587 119 721 430 100.00 74.88 100.00 74.03 0 25.97 0 0 0 0 97.96 73.40 -<br />
Dukovany B3 CZ PWR 500 473 744 353 206 1 766 436 118 730 359 100.00 100.00 100.00 100.00 0 0 0 0 0 0 94.95 97.51 -<br />
Dukovany B4 CZ PWR 500 473 744 357 904 1 791 147 120 033 471 100.00 100.00 100.00 100.00 0 0 0 0 0 0 96.21 98.88 -<br />
Temelin B1 CZ PWR 1086 1036 0 0 2 761 973 140 338 811 0 69.45 0 69.41 100.00 30.59 0 0 0 0 0 70.20 2<br />
Temelin B2 CZ PWR 1086 1036 744 814 235 3 985 300 137 430 868 100.00 100.00 99.99 100.00 0 0 0 0 0.01 0 100.77 101.29 -<br />
Doel 1 BE PWR 467 445 744 340 705 1 658 718 145 429 718 100.00 97.99 100.00 97.43 0 0.05 0 0 0 2.52 98.24 98.21 -<br />
Doel 2 BE PWR 467 445 744 344 597 1 396 177 143 676 802 100.00 83.00 100.00 81.83 0 17.86 0 0 0 0.31 98.95 82.38 -<br />
Doel 3 BE PWR 1056 1006 744 791 881 3 886 275 283 499 958 100.00 100.00 99.95 99.99 0 0 0 0 0.05 0.01 100.18 100.96 -<br />
Doel 4 BE PWR 1086 1038 744 809 422 3 968 477 289 766 927 100.00 100.00 99.99 99.99 0 0 0 0 0.01 0.01 99.02 99.56 -<br />
Tihange 1 BE PWR 1009 962 0 0 2 710 118 319 353 349 0 74.30 0 74.17 100.00 25.81 0 0 0 0.02 0 74.40 2<br />
Tihange 2 BE PWR 1055 1008 744 695 184 3 671 980 277 263 810 100.00 100.00 88.92 96.79 0 0.02 0 0 11.08 3.20 88.87 96.79 -<br />
Tihange 3 BE PWR 1089 1038 744 794 236 2 640 734 298 688 778 100.00 69.41 99.86 68.57 0.12 31.41 0 0 0.02 0.02 97.96 67.03 -<br />
Remarks<br />
PWR: Pressurised water reactor<br />
BWR: Boiling water reactor<br />
1<br />
Net-based values (Czech <strong>and</strong> Swiss nuclear<br />
power plants gross-based)<br />
2<br />
Planned: the beginning <strong>and</strong> duration <strong>of</strong><br />
unavailability have to be determined more<br />
than 4 weeks be<strong>for</strong>e commencement<br />
3<br />
Unplanned: the beginning <strong>of</strong> unavailability<br />
cannot be postponed or only within 4 weeks.<br />
All values were entered in the column not<br />
postponable.<br />
– Postponable: the beginning <strong>of</strong> unavailability<br />
can be postponed more than 12 hours to 4<br />
weeks.<br />
– Not postponable: the beginning <strong>of</strong> unavailability<br />
cannot be postponed or only within 12<br />
hours.<br />
4<br />
Beginning <strong>of</strong> the year<br />
5<br />
Final data were not yet available in print<br />
Remarks:<br />
1 Refuelling<br />
2 Inspection<br />
3 Repair<br />
4 Stretch-out-operation<br />
5 Stretch-in-operation<br />
6 Here<strong>of</strong> traction supply:<br />
7 Here<strong>of</strong> steam supply:<br />
KKB 1 Beznau<br />
Month: <br />
– MWh<br />
Since the beginning <strong>of</strong> the year: 11,152 MWh<br />
Since commissioning:<br />
600,670 MWh<br />
KKB 2 Beznau<br />
Month:<br />
1,036 MWh<br />
Since the beginning <strong>of</strong> the year: 1,285 MWh<br />
Since commissioning:<br />
137,797 MWh<br />
KKG Gösgen<br />
Month:<br />
4,553 MWh<br />
Since the beginning <strong>of</strong> the year: 36,883 MWh<br />
Since commissioning:<br />
2,584,157 MWh<br />
8 New nominal capacity since January <strong>2022</strong><br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 85
Fachzeitschrift: 2019<br />
· CD 2019 · · CD 2019 ·<br />
Diese CD und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.<br />
© VGB PowerTech Service GmbH<br />
Essen | Deutschl<strong>and</strong> | 2019<br />
Technical <strong>Journal</strong>: 1976 to 2000<br />
English Edition<br />
· 1976 to 2000 · · 1976 to 2000 ·<br />
All rights reserved.<br />
© VGB PowerTech Service GmbH<br />
Essen | Germany | 2019<br />
Fachzeitschrift: 1990 bis 2019<br />
· 1990 bis 2019 · · 1990 bis 2019 ·<br />
Diese DVD und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.<br />
© VGB PowerTech Service GmbH<br />
Essen | Deutschl<strong>and</strong> | 2019<br />
Stefan Loubichi<br />
VGB-B 036<br />
Media directory/Medienverzeichnis<br />
Media directory/Medienverzeichnis<br />
III · <strong>2022</strong> (Excerpt/Auszug*)<br />
New publications/Neuerscheinungen 2020-<strong>2022</strong><br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> – Technical <strong>Journal</strong>/Fachzeitschrift<br />
Ref. Ordering Number/<br />
Bestell-Kennz.<br />
K 001<br />
PT-CD2021N<br />
Title/Titel<br />
Titles with “e” or “EN“ in the ordering reference number<br />
are available in English. Titel mit dem Bestellkennzeichen<br />
„e“ oder „EN“ sind in Englisch lieferbar.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> (successor <strong>of</strong>/Nachfolger der VGB POWERTECH)<br />
– Technical <strong>Journal</strong>/Fachzeitschrift (Subscription/Abonnement)<br />
<strong>International</strong> Edition – 11 issues yearly (about 1,100 p., rund 1.100 S.)<br />
Annual subscription/Jahresabonnement plus Shipping <strong>and</strong> h<strong>and</strong>ling/Vers<strong>and</strong>kosten:<br />
Germany/Deutschl<strong>and</strong>: 34,00 Euro; Europe/Europa: 46,00 Euro;<br />
Other countries/<strong>and</strong>ere Länder: 92,00 Euro<br />
POWERTECH-CD: Technical <strong>journal</strong>/Fachzeitschrift VGB POWERTECH 2021<br />
(Single user edition)<br />
(For subscribers <strong>of</strong> the printed edition/Einzelplatzversion für Abonnenten<br />
der Printausgabe)<br />
Price <strong>for</strong> non-subscribers/Preis für Nicht-Abonnenten: 198,00 Euro<br />
Prices/Preise<br />
(net/netto) 1<br />
<strong>vgbe</strong> Non-<br />
Member/ Member/<br />
<strong>vgbe</strong>-Mitglied Nichtmitglied<br />
247,50 275,00<br />
98,00/198,00<br />
PT-DVD (1976-2000EN)<br />
PT-DVD (2021)<br />
POWERTECH-DVD: Technical <strong>journal</strong> | Volume 1976 to 2000 English Edition/<br />
Fachzeitschrift VGB POWERTECH/VGB Kraftwerkstechnik<br />
Jahrgänge 1976 bis 2000 Englischsprachige Ausgabe<br />
(Single user edition/ Einzelplatzversion)<br />
950,00 Euro (Subscriber/Abonnent <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong>; <strong>vgbe</strong> member/<strong>vgbe</strong>-Mitglied)<br />
1.950,00 Euro (Non-subscriber/Nicht-Abonnent <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong>)<br />
Multi-User-/Netzwerklizenz (Corporate License): <strong>vgbe</strong>-Mitgliederversion sowie<br />
Lizenz Forschung und Lehre auf Anfrage (E-Mail: sales-media@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>).<br />
POWERTECH-DVD: Technical <strong>journal</strong> | Volume 1990 to 2021/<br />
Fachzeitschrift VGB POWERTECH/VGB Kraftwerkstechnik Jahrgänge<br />
1990 bis 2021 (Single user edition/ Einzelplatzversion)<br />
950,00 Euro (Subscriber/Abonnent <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong>; <strong>vgbe</strong> member/<strong>vgbe</strong>-Mitglied)<br />
1.950,00 Euro (Non-subscriber/Nicht-Abonnent <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong>)<br />
Multi-User-/Netzwerklizenz (Corporate License): <strong>vgbe</strong>-Mitgliederversion sowie<br />
Lizenz Forschung und Lehre auf Anfrage (E-Mail: sales-media@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>).<br />
950,00 1.950,00<br />
950,00 1.950,00<br />
<strong>vgbe</strong>/VGB St<strong>and</strong>ards, Books <strong>and</strong> S<strong>of</strong>tware<br />
Ref. Ordering Number/<br />
Bestell-Kennz.<br />
Titel/Title<br />
Titles with “e” or “EN“ in the ordering reference number<br />
are available in English. Titel mit dem Bestellkennzeichen<br />
„e“ oder „EN“ sind in Englisch lieferbar.<br />
ISBN Print<br />
ISBN eBook 1<br />
Prices/Preise<br />
(net/netto) 1<br />
<strong>vgbe</strong> Non-<br />
Member/ Member/<br />
<strong>vgbe</strong>-Mitglied Nichtmitglied<br />
VGB-B 036<br />
Cybersecurity<br />
in der Energieerzeugung<br />
Cybersecurity in der Energieerzeugung<br />
Stefan Loubichi, S<strong>of</strong>tcover, 176 S., 2020<br />
978-3-96284-201-7<br />
978-3-96284-202-4<br />
47,00<br />
47,00<br />
47,00<br />
47,00<br />
* The full <strong>vgbe</strong> Media directory is available online, www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> ... [Services] ... [Publications] ... [Media catalogue]<br />
Das komplette Medienverzeichnis steht online zum Download zur Verfügung, www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> ... [Dienstleistungen] ... [Publikationen] ... [Medienverzeichnis]<br />
86 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
<strong>vgbe</strong>-St<strong>and</strong>ard<br />
Thermal<br />
Nuclear<br />
Renewables<br />
<strong>Storage</strong><br />
P2X<br />
VGBE-S-811-91-2021-12-EN<br />
VGB-Be-105-007.4 (2021)<br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong>-St<strong>and</strong>ard<br />
Energieanlagen, Allgemein<br />
Thermische Kraftwerke<br />
Gaskraftwerke<br />
Kombikraftwerke (GuD)<br />
Kernkraftwerke<br />
Kohlekraftwerke<br />
Wasserkraftwerke<br />
Windenergieanlagen<br />
Biomassekraftwerke<br />
Photovoltaikanlagen<br />
Solarthermische Kraftwerke<br />
Geothermiekraftwerke<br />
Power-to-X-Anlagen<br />
Anlagen für Luftzerlegung und Gasabscheidung<br />
VGBE-S-821-91-2021-12-DE<br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Media directory/Medienverzeichnis<br />
Ref. Ordering Number/<br />
Bestell-Kennz.<br />
Titel/Title<br />
Titles with “e” or “EN“ in the ordering reference number<br />
are available in English. Titel mit dem Bestellkennzeichen<br />
„e“ oder „EN“ sind in Englisch lieferbar.<br />
ISBN Print<br />
ISBN eBook 1<br />
Prices/Preise<br />
(net/netto) 1<br />
<strong>vgbe</strong> Non-<br />
Member/ Member/<br />
<strong>vgbe</strong>-Mitglied Nichtmitglied<br />
KKS Kraftwerk-Kennzeichensystem | KKS Identification System <strong>for</strong> Power Stations<br />
VGB-Be 105-007.4<br />
VGB-S-811-91-2021-012-EN<br />
Pocketbook<br />
KKS Pocketbook (English Edition),<br />
84 p., 2021 (Fourth edition)<br />
Einzelexemplare kostenlos/Single copies free <strong>of</strong> charge<br />
Kostenloser Download/Free download: www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Sammelbestellung/Bulk orders: 10 Exemplare/copies: 19,90 Euro |<br />
25 Exemplare/copies: 39,90 Euro | 50 Exemplare/copies: 59,90 Euro<br />
978-3-96284-270-3<br />
(4 th edition)<br />
978-3-96284-271-0<br />
(4 th edition)<br />
―<br />
VGB-B 105-007.4<br />
VGB-S-811-91-2021-012-DE<br />
iOS <strong>and</strong><br />
Android App<br />
<strong>for</strong> KKS<br />
KKS Pocketbook (Deutsche Ausgabe),<br />
84 p./ 84 S., 2021 (Vierte Auflage)<br />
Einzelexemplare kostenlos/Single copies free <strong>of</strong> charge<br />
Kostenloser Download/Free download: www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Sammelbestellung/Bulk orders: 10 Exemplare/copies: 19,90 Euro |<br />
25 Exemplare/copies: 39,90 Euro | 50 Exemplare/copies: 59,90 Euro<br />
Kostenlose App für Smartphones und Tablets (iOS und Android)<br />
zur Dekodierung von KKS-Anlagenkennzeichen. Weitere S<strong>of</strong>twareoptionen<br />
auf Anfrage.<br />
Free smartphone <strong>and</strong> tablet app (iOS <strong>and</strong> Android) <strong>for</strong> decoding <strong>of</strong><br />
KKS-designations. Further services on request.<br />
https://www.tipware.de/kks/index.html<br />
978-3-96284-268-0<br />
(4. Auflage)<br />
978-3-96284-269-7<br />
(4. Auflage)<br />
―<br />
Kostenlos/<br />
Free <strong>of</strong> charge<br />
RDS-PP ® | Reference Designation System <strong>for</strong> Power Plants<br />
VGB-S-821-91-2021-12-EN<br />
Pocketbook<br />
RDS-PP ® Pocketbook (English edition),<br />
76 p., 2021 (Second edition)<br />
Einzelexemplare kostenlos/Single copies free <strong>of</strong> charge<br />
Kostenloser Download/Free download: www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Sammelbestellung/Bulk orders: 10 Exemplare/copies: 19,90 Euro |<br />
25 Exemplare/copies: 39,90 Euro | 50 Exemplare/copies: 59,90 Euro<br />
978-3-96284-272-7<br />
978-3-96284-273-4<br />
(2 nd Edition)<br />
―<br />
VGB-S-821-91-2021-12-DE<br />
iOS <strong>and</strong><br />
Android App<br />
<strong>for</strong> RDS-PP ®<br />
RDS-PP ® Pocketbook (Deutsche Ausgabe),<br />
76 S., 2021 (Zweite Auflage)<br />
Einzelexemplare kostenlos/Single copies free <strong>of</strong> charge<br />
Kostenloser Download/Free download: www.vgb.org<br />
Sammelbestellung/Bulk orders: 10 Exemplare/copies: 19,90 Euro |<br />
25 Exemplare/copies: 39,90 Euro | 50 Exemplare/copies: 59,90 Euro<br />
Kostenlose App für Smartphones und Tablets (iOS und Android) zur<br />
Dekodierung von RDS-PP ® -Anlagenkennzeichen. Weitere S<strong>of</strong>twareoptionen<br />
auf Anfrage.<br />
Free smartphone <strong>and</strong> tablet app (iOS <strong>and</strong> Android) <strong>for</strong> decoding <strong>of</strong><br />
RDS-PP ® -designations. Further services on request.<br />
https://tipware.de/rdspp/index.html<br />
978-3-96284-274-1<br />
978-3-96284-275-8<br />
(2. Auflage)<br />
―<br />
Kostenlos/<br />
Free <strong>of</strong> charge<br />
VGB-S-823-32-2021-12-EN-DE<br />
VGB-S-823-34-2020-12-EN-DE<br />
VGB-S-002-01-2019-05-DE<br />
VGB-S-002-01-2019-05-EN<br />
RDS-PP ® – Application Guideline; Part 32: Wind Power Plants;<br />
Anwendungsrichtlinie, Teil 32: Windkraftwerke,<br />
2 nd edition/2. Ausgabe, 414 p./S., 2021<br />
(replaces/ersetzt VGB-S-823-32-2014-03-EN-DE, 2014)<br />
RDS-PP ® – Application Guideline; Part 34: Plants <strong>for</strong> Energy Supply<br />
with Combustion Engines; Anwendungsrichtlinie, Teil 34: Anlagen<br />
der Energieversorgung mit Verbrennungsmotoren, 260 p./S., 2021<br />
Elektrizitätswirtschaftliche Grundbegriffe,<br />
11. Auflage, 183 S., 2020<br />
Basic Terms <strong>of</strong> the Electric Utility Industry,<br />
11 th edition, 184 p., 2020<br />
978-3-96284-258-1<br />
978-3-96284-259-8<br />
978-3-96284-237-6<br />
978-3-96284-238-3<br />
430,00<br />
430,00<br />
320,00<br />
320,00<br />
978-3-96284-167-6 Kostenlos/<br />
Free <strong>of</strong> charge<br />
978-3-96284-168-3 Kostenlos/<br />
Free <strong>of</strong> charge<br />
645,00<br />
645,00<br />
480,00<br />
480,00<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 87
Media directory/Medienverzeichnis<br />
Ref. Ordering Number/<br />
Bestell-Kennz.<br />
Titel/Title<br />
Titles with “e” or “EN“ in the ordering reference number<br />
are available in English. Titel mit dem Bestellkennzeichen<br />
„e“ oder „EN“ sind in Englisch lieferbar.<br />
ISBN Print<br />
ISBN eBook 1<br />
Prices/Preise<br />
(net/netto) 1<br />
<strong>vgbe</strong> Non-<br />
Member/ Member/<br />
<strong>vgbe</strong>-Mitglied Nichtmitglied<br />
VGB-S-002-01-2019-05-DE<br />
VGB-S-002-01-2019-05-EN<br />
VGB-S-002-03-2019-10-DE<br />
VGB-S-002-03-2019-10-EN<br />
VGB-S-002-03-2019-10-PT<br />
Elektrizitätswirtschaftliche Grundbegriffe,<br />
11. Auflage, 183 S., 2020<br />
Basic Terms <strong>of</strong> the Electric Utility Industry,<br />
11 th edition, 184 p., 2020<br />
Technische und kommerzielle Kennzahlen für Kraftwerksanlagen,<br />
9. Auflage, 155 S., 2020<br />
Basic Terms <strong>of</strong> the Electric Utility Industry,<br />
9 th edition, 152 p., 2020<br />
Indicadores de desempenho técnicos e comerciais para<br />
Centrais de Produção de Energia, 9ª Edição, 151 p., <strong>2022</strong><br />
VGB-S-004-00-2020-10-DE Analysenverfahren im Kraftwerk (vormals VGB-B 401),<br />
232 S., 2021<br />
VGB-S-008-00-2020-11-DE<br />
VGB-S-008-00-2020-11-EN<br />
VGB-S-014-2011-EN<br />
VGB-S-017-00-2018-09-EN<br />
VGB-S-020-00-2017-12-EN<br />
VGB-S-033-00-2017-07-LV<br />
VGB-S-052-00-2020-06-DE<br />
VGB-S-103-00-2020-02-DE<br />
VGB-S-103-00-2020-02-EN<br />
VGB-S-107-00-2018-03-DE<br />
VGB-S-150-20-2020-08-DE<br />
VGB-S-150-22-2020-10-DE<br />
VGB-S-150-24-2020-08-DE<br />
VGBE-S-150-26-<strong>2022</strong>-03-DE<br />
VGBE-S-150-27-<strong>2022</strong>-03-DE<br />
VGB-S-162-00-2020-02-DE<br />
VGB-S-164-13-2021-03-DE<br />
Empfehlungen zum Management der funktionalen Sicherheit<br />
in Dampfkesselanlagen und Anlagen des Wasser-Dampf-Kreislaufs,<br />
2. Auflage, 164 S., 2021<br />
Recommendations <strong>for</strong> managing functional safety in<br />
steam boiler plants <strong>and</strong> systems <strong>of</strong> the water/steam cycle,<br />
2nd revised edition, 164 p., 2021<br />
Construction, Operation <strong>and</strong> Maintenance<br />
<strong>of</strong> Flue Gas Denitrification Systems (DeNOx),<br />
186 p., 2021<br />
Fire Protection in Onshore Wind Turbines,<br />
1 st edition, 44 p., 2019<br />
Determination <strong>of</strong> Measurement Uncertainty upon Acceptance <strong>and</strong><br />
Control Measurements, 1 st edition, 99 p., 2020<br />
Atbilstības novērtējuma un darba aizsardzības prasību savstarpējā<br />
iedarbība hidroelektrostacijās (Latvian edition)<br />
(Interaction <strong>of</strong> Con<strong>for</strong>mity Assessment <strong>and</strong> Industrial Safety<br />
in Hydropower Plants, 2 nd edition) 104 p., 2021<br />
Leitfaden für die Qualitätssicherung bei der Montage<br />
von Flansch verbindungen, 18 S., 2020<br />
Überwachungs-, Begrenzungs- und Schutzeinrichtungen<br />
an Dampfturbinenanlagen, 86 S., 2020 (vormals VGB-R 103)<br />
Monitoring, limiting <strong>and</strong> protection devices on steam turbine plants,<br />
82 S., 2020 (<strong>for</strong>merly VGB-R 103e)<br />
Bestellung und Ausführung von Armaturen in Wärmekraftwerken,<br />
324 S., 2019 (vormals VGB-R 107)<br />
Einführung und Überblick der VGB-St<strong>and</strong>ards für Abnahmetests<br />
und Kontrolluntersuchungen, 12 S., 2021<br />
(Weiterentwicklung der VGB-R 123 B<strong>and</strong> I.2)<br />
Messstellenliste für Abnahmeuntersuchungen mit Datenerfassungsanlagen,<br />
12 S., 2021 (vormals VGB-R-123 C.2.2,<br />
Übersicht s. VGB-S-150-20-2020-08-DE)<br />
Auslegung, Prüfung und Montage von Durchflussmessstrecken<br />
mit Drosselgeräten, 30 S., 2021 (vormals VGB-R-123 C.2.4,<br />
Übersicht s. VGB-S-150-20-2020-08-DE)<br />
Abnahme- und Kontrolluntersuchungen an Rauchgasreinigungsanlagen,<br />
Teil 1: Rauchgasentschwefelung, 36 S., <strong>2022</strong><br />
(vormals VGB-R-123 C.2.6, Übersicht s. VGB-S-150-20-2020-08-DE)<br />
Abnahme- und Kontrolluntersuchungen an Rauchgasreinigungsanlagen,Teil<br />
2: Anlagen zur Stickoxidminderung, 36 S., <strong>2022</strong><br />
(vormals VGB-R-123 C.2.7, Übersicht s. VGB-S-150-20-2020-08-DE)<br />
Elektrischer Blockschutz<br />
80 S., 2020 (vormals VGB-S-025-00-2012-11-DE)<br />
Einphasig gekapselte Generatorableitung<br />
120 S., 2021<br />
978-3-96284-167-6 Kostenlos/<br />
Free <strong>of</strong> charge<br />
978-3-96284-168-3 Kostenlos/<br />
Free <strong>of</strong> charge<br />
978-3-96284-173-7 Kostenlos/<br />
Free <strong>of</strong> charge<br />
978-3-96284-174-4 Kostenlos/<br />
Free <strong>of</strong> charge<br />
978-3-96284-280-2 Gratuito/Kostenlos/<br />
Free <strong>of</strong> charge<br />
978-3-96284-211-6<br />
978-3-96284-212-3<br />
240,00<br />
240,00<br />
420,00<br />
420,00<br />
978-3-96284-230-7 260,00 390,00<br />
978-3-96284-232-1 260,00 390,00<br />
978-3-96284-253-6<br />
978-3-96284-254-3<br />
978-3-96284-075-4<br />
978-3-96284-076-1<br />
978-3-96284-025-9<br />
978-3-96284-094-5<br />
978-3-96284-225-3<br />
978-3-96284-226-0<br />
978-3-96284-159-1<br />
978-3-96284-160-7<br />
978-3-96284-195-9<br />
978-3-96284-196-6<br />
978-3-96284-197-3<br />
978-3-96284-198-0<br />
978-3-96284-048-8<br />
978-3-96284-049-5<br />
978-3-96284-205-5<br />
978-3-96284-206-2<br />
978-3-96284-227-7<br />
978-3-96284-228-8<br />
978-3-96284-203-1<br />
978-3-96284-204-6<br />
978-3-96284-286-4<br />
978-3-96284-287-1<br />
978-3-96284-290-1<br />
978-3-96284-291-8<br />
978-3-96284-100-3<br />
978-3-96284-101-0<br />
978-3-96284-249-9<br />
978-3-96284-250-5<br />
160,00<br />
160,00<br />
120,00<br />
120,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
80,00<br />
80,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
320,00<br />
320,00<br />
Kostenlos/<br />
Free <strong>of</strong> charge<br />
60,00<br />
60,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
240,00<br />
240,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
120,00<br />
120,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
480,00<br />
480,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
135,00<br />
135,00<br />
135,00<br />
135,00<br />
135,00<br />
135,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
88 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Media directory/Medienverzeichnis<br />
Ref. Ordering Number/<br />
Bestell-Kennz.<br />
Titel/Title<br />
Titles with “e” or “EN“ in the ordering reference number<br />
are available in English. Titel mit dem Bestellkennzeichen<br />
„e“ oder „EN“ sind in Englisch lieferbar.<br />
ISBN Print<br />
ISBN eBook 1<br />
Prices/Preise<br />
(net/netto) 1<br />
<strong>vgbe</strong> Non-<br />
Member/ Member/<br />
<strong>vgbe</strong>-Mitglied Nichtmitglied<br />
VGB-S-162-00-2020-02-EN<br />
Electrical Generating Unit Protection<br />
78 p., <strong>2022</strong> (<strong>for</strong>merly VGB-S-025-00-2012-11-EN)<br />
978-3-96284-187-4<br />
978-3-96284-188-1<br />
180,00<br />
180,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
VGB-S-167-00-2021-03-DE<br />
Revisionsempfehlungen für Turbogeneratoren<br />
70 S., 2021<br />
978-3-96284-241-3<br />
978-3-96284-242-0<br />
130,00<br />
130,00<br />
195,00<br />
195,00<br />
VGB-S-169-12-2021-01-DE<br />
Inst<strong>and</strong>haltungsempfehlungen für Trans<strong>for</strong>matoren und<br />
Drosselspulen<br />
52 S., 2021<br />
978-3-96284-245-1<br />
978-3-96284-246-8<br />
130,00<br />
130,00<br />
195,00<br />
195,00<br />
VGB-S-302-00-2013-04-EN<br />
Guideline <strong>for</strong> the Testing <strong>of</strong> DeNOx-catalysts,<br />
66 p., 2021 (<strong>for</strong>merly VGB-R 302e)<br />
978-3-96284-221-5<br />
978-3-96284-222-2<br />
120,00<br />
120,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
VGB-S-401-00-2020-02-DE<br />
VGB-St<strong>and</strong>ard für das Wasser in Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren.<br />
Teil 1: DWR-Anlagen. Teil 2: SWR-Anlagen<br />
94 S., 2020 (vormals VGB-R 401)<br />
978-3-96284-209-3<br />
978-3-96284-210-9<br />
180,00<br />
180,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
VGB-S-401-00-2020-02-EN<br />
VGB St<strong>and</strong>ard <strong>for</strong> the Water in Nuclear Power Plants with Light-Water<br />
Reactors. Part 1: Pressurised-Water Reactors. Part 2: Boiling-Water<br />
Reactors. 92 p., 2020 (<strong>for</strong>merly VGB-R 401 (German edition only))<br />
978-3-96284-233-8<br />
978-3-96284-234-5<br />
180,00<br />
180,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
VGB-S-415-00-2020-12-DE<br />
Aufbereitung von REA-Abwasser,<br />
60 S., 2021 (vormals VGB-M 415)<br />
978-3-96284-119-5<br />
978-3-96284-120-1<br />
260,00<br />
260,00<br />
390,00<br />
390,00<br />
VGB-S-506-00-2019-02-DE<br />
Zust<strong>and</strong>süberwachung und Prüfung der Komponenten von Dampfkesselanlagen,<br />
Druckbehälteranlagen und Wasser oder Dampf führende<br />
Rohrleitungen für Wärmekraftwerke, 126 S., 3. Ausgabe, 2019<br />
978-3-96284-239-0<br />
978-3-96284-240-6<br />
130,00<br />
130,00<br />
195,00<br />
195,00<br />
VGB-S-509-00-2019-11-DE<br />
Inhalte wiederkehrender Prüfungen an Rohrleitungen und deren<br />
Komponenten in Wärmekraftwerken, 48 S., 2020<br />
(vormals VGB-R 509)<br />
978-3-96284-189-8<br />
978-3-96284-190-4<br />
180,00<br />
180,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
VGB-S-540-00-2020-07-DE<br />
Dampfkühlung in Wärmekraftanlagen (Korrigendum der Ausgabe<br />
2019-07, vormals VGB-R 540) 225 S., 2021<br />
978-3-86875-235-2<br />
978-3-86875-236-9<br />
260,00<br />
260,00<br />
390,00<br />
390,00<br />
VGB-S-610-00-2019-10-DE<br />
BTR. Bautechnik bei Kühltürmen. VGB-St<strong>and</strong>ard für den bautechnischen<br />
Entwurf, die Berechnung, die Konstruktion und die Ausführung<br />
von Kühltürmen, 84 S., 2019, (vormals VGB-R 610)<br />
978-3-86875-143-0<br />
978-3-86875-144-7<br />
180,00<br />
180,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
VGB-S-610-00-2019-10-EN<br />
Structural Design <strong>of</strong> Cooling Towers. VGB-St<strong>and</strong>ard on the Structural<br />
Design, Calculation, Engineering <strong>and</strong> Construction <strong>of</strong> Cooling<br />
Towers, 82 p., 2019, (<strong>for</strong>merly VGB-R 610e)<br />
978-3-96284-145-4<br />
978-3-96284-146-1<br />
180,00<br />
180,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
VGB-S-104-O<br />
Online-Leitfaden zur Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung<br />
in Kraftwerken – 2007, laufend aktualisiert<br />
Einzelplatzlizenz und Update. Netzwerklizenz für Mitglieder<br />
(Fördernde, Außerordentliche) (Ordentliche Mitglieder, siehe<br />
Hinweise unter www.vgb.org/vgbvs4om)<br />
Preise für die Netzwerklizenz für Nichtmitglieder auf Anfrage.<br />
290,00<br />
950,00<br />
390,00<br />
VGB-TW | VGB Technical Scientific Reports/VGB Technisch-wissenschaftliche Berichte<br />
VGB-TW 103Ve (2021) VGB – Availability <strong>of</strong> Power Plants 2010–2019,<br />
Edition 2021, 254 p.<br />
VGB-TW 103V (2021) VGB – Verfügbarkeit von Kraftwerken 2010–2019,<br />
Ausgabe 2021, 254 S.<br />
VGB-TW 103Ae (2021) VGB – Analysis <strong>of</strong> Unavailability <strong>of</strong> Power Plants 2010–2019,<br />
Edition 2021, 138 p.<br />
VGB-TW 103A (2021) VGB – Analyse der Nichtverfügbarkeit von Kraftwerken 2010–2019,<br />
Ausgabe 2021, 138 S.<br />
VGB-TW 103Ve (2020) VGB – Availability <strong>of</strong> Power Plants 2010–2019,<br />
Edition 2020, 246 p.<br />
VGB-TW 103V (2020) VGB – Verfügbarkeit von Kraftwerken 2010–2019,<br />
Ausgabe 2020, 246 S.<br />
VGB-TW 103Ae (2020) VGB – Analysis <strong>of</strong> Unavailability <strong>of</strong> Power Plants 2010–2019,<br />
Edition 2020, 138 p.<br />
VGB-TW 103A (2020) VGB – Analyse der Nichtverfügbarkeit von Kraftwerken 2010–2019,<br />
Ausgabe 2020, 138 S.<br />
978-3-96284-263-5 145,00 290,00<br />
978-3-96284-261-1 145,00 290,00<br />
978-3-96284-267-3 145,00 290,00<br />
978-3-96284-265-9 145,00 290,00<br />
978-3-96284-216-1 145,00 290,00<br />
978-3-96284-213-0 145,00 290,00<br />
978-3-96284-219-2 145,00 290,00<br />
978-3-96284-217-8 145,00 290,00<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 89
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> news<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> news<br />
Online-Simulator-Training für<br />
indisches Kraftwerkspersonal<br />
• In dem Training ging es darum, die<br />
Teilnehmenden mit dem flexiblen<br />
Betrieb von Kohlekraftwerken<br />
vertraut(er) zu machen.<br />
Das Deutsch-Indische Energie<strong>for</strong>um<br />
(DIEF) hat in Kooperation mit der KWS<br />
Energy Knowledge eG, Steag Energy Services<br />
India und <strong>vgbe</strong> vom 4. bis 8. Juli <strong>2022</strong><br />
ein Online-Training für indisches Kraftwerkspersonal<br />
durchgeführt. In dem Training<br />
ging es darum, die Teilnehmenden<br />
mit dem flexiblen Betrieb von Kohlekraftwerken<br />
vertraut(er) zu machen. Dazu gab<br />
es zunächst theoretische Impulse von indischen<br />
und deutschen Expertinnen und Experten<br />
– der Fokus lag jedoch auf den praktischen<br />
Übungen am Simulator. Dazu kam<br />
der KWS-Simulator zum Einsatz, auf den<br />
durch eine Internetverbindung zugegriffen<br />
werden konnte. Die insgesamt zehn Teilnehmenden<br />
konnten den Simulator von<br />
Steag-Office in Noida aus bedienen.<br />
Der KWS-Simulator bildet ein 800-MW-<br />
Kraftwerk mit einem Benson-Durchlaufkessel<br />
ab. Obwohl dieses Design nicht den<br />
indischen Gegebenheiten entspricht, konnten<br />
die Teilnehmenden aus dem Training<br />
einige Erkenntnisse für ihre eigene Tätigkeit<br />
mitnehmen – z.B. in Bezug auf schnelle<br />
Start-ups durch effektive Nutzung der<br />
Vorwärmung sowie den Kondensatstau als<br />
Option zur Frequenzstützung. Alle Beteiligten<br />
waren sich darin einig, dass das<br />
Üben mit dem Simulator eine sehr gute<br />
Vorbereitung auf den flexiblen Kraftwerksbetrieb<br />
ist. Darüber hinaus stellt der Simulator<br />
ein effizientes Tool dar, um Flexibilisierungsoptionen<br />
auszuprobieren und das<br />
Betriebsregime zu optimieren.<br />
Die Entwicklung eines auf den indischen<br />
Markt zugeschnitten Simulators steht im<br />
Fokus eines weiteren IGEF-Projekts, das<br />
von der Deutsche Gesellschaft für <strong>International</strong>e<br />
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und<br />
Steag Energy Services vorangetrieben<br />
wird. Für diesen Simulator ist ein breit angelegtes<br />
Simulator-Trainingsprogramm in<br />
Planung, das auch Blended-Learning-Komponenten<br />
beinhalten wird. Das gerade<br />
durchgeführte Training stellte eine ersten-<br />
Versuchslauf dar, um Ideen für die zukünftigen<br />
Trainingskonzepte zu generieren.<br />
Online Simulator Training <strong>for</strong><br />
Indian Power Plant Personnel<br />
• The aim <strong>of</strong> the training was to<br />
familiarize the participants with the<br />
flexible operation <strong>of</strong> coal-fired power<br />
plants.<br />
The Indo-German Energy Forum (IGEF)<br />
in collaboration with KWS Energy Knowledge<br />
eG, Steag Energy Services India <strong>and</strong><br />
<strong>vgbe</strong> conducted an online training <strong>for</strong> Indian<br />
power plant operators from 4 to 8 July<br />
<strong>2022</strong>. The aim <strong>of</strong> the training was to familiarize<br />
the participants with the flexible operation<br />
<strong>of</strong> coal-fired power plants. Initially<br />
theoretical impulses from Indian <strong>and</strong> German<br />
experts were given – the focus, however,<br />
was on the practical exercises on the<br />
simulator. The KWS simulator in Germany,<br />
which could be accessed via an internet<br />
connection, was used <strong>for</strong> this purpose. A<br />
total <strong>of</strong> ten participants were able to operate<br />
the simulator from the Steag Office in<br />
Noida.<br />
The KWS simulator refers to an 800 MW<br />
power plant with a Benson once-through<br />
boiler. Although this design does not correspond<br />
to the Indian conditions, the participants<br />
were able to take some insights from<br />
the training <strong>for</strong> their own work – e.g. in<br />
relation to fast start-ups through effective<br />
use <strong>of</strong> preheating <strong>and</strong> condensate throttling<br />
as an option <strong>for</strong> frequency support.<br />
Everyone involved agreed that practicing<br />
with the simulator is very good preparation<br />
<strong>for</strong> flexible power plant operation. In addition,<br />
the simulator is an efficient tool <strong>for</strong><br />
testing flexibility options <strong>and</strong> optimizing<br />
the operating regime.<br />
The development <strong>of</strong> a simulator tailored<br />
to the Indian market is the focus <strong>of</strong> another<br />
IGEF project, which is being driven by the<br />
Deutsche Gesellschaft für <strong>International</strong>e<br />
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH <strong>and</strong> Steag<br />
Energy Services India. A broad-based simulator<br />
training program is being planned<br />
<strong>for</strong> this simulator, which will also include<br />
blended learning components. The training<br />
just carried out represented a first test<br />
run to generate ideas <strong>for</strong> future training<br />
concepts.<br />
LL<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
www.kws-eg.com<br />
www.giz.de<br />
90 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> news | People<br />
Personalien<br />
DF‘s Board <strong>of</strong> Directors has<br />
taken note <strong>of</strong> the joint decision<br />
by the French State <strong>and</strong> Jean-<br />
Bernard Lévy to launch the<br />
process <strong>for</strong> the succession <strong>of</strong><br />
EDF’s Chairman <strong>and</strong> Chief<br />
Executive.<br />
(edf) Jean-Bernard Lévy‘s term <strong>of</strong> <strong>of</strong>fice as<br />
Chairman <strong>and</strong> Chief Executive Officer <strong>of</strong><br />
EDF will end no later than 18 March, 2023,<br />
given the age limit set by the company‘s bylaws.<br />
In agreement with Jean-Bernard Lévy,<br />
the new Chairman <strong>and</strong> CEO <strong>of</strong> EDF, when<br />
appointed, will be able to take up his duties<br />
be<strong>for</strong>e this deadline. In accordance with<br />
the applicable provisions, this appointment<br />
will be subject to a proposal by the<br />
Board <strong>of</strong> Directors to the State.<br />
The Board <strong>of</strong> Directors has renewed its<br />
confidence in Jean-Bernard Lévy, who has<br />
confirmed that he will per<strong>for</strong>m his duties<br />
until the appointment <strong>of</strong> his successor.<br />
Furthermore, the Board <strong>of</strong> Directors has<br />
taken note <strong>of</strong> the State‘s intention to hold<br />
100% <strong>of</strong> EDF‘s capital <strong>and</strong> will provide all<br />
its support to achieve this, according to the<br />
terms adopted by the State <strong>and</strong> in the interest<br />
<strong>of</strong> all the parties concerned.<br />
LL<br />
www.edf.com (222351215)<br />
Energie AG Oberösterreich:<br />
Aufsichtsrat bestellt neuen<br />
Vorst<strong>and</strong> ab 1.1.2023<br />
• Dr. Leonhard Schitter (Vorsitzender des<br />
Vorst<strong>and</strong>s, CEO), Dr. Andreas Kolar<br />
(Finanzvorst<strong>and</strong>), DI Stefan Stallinger<br />
(Technikvorst<strong>and</strong>) führen künftig den<br />
oö Energie- und Dienstleistungskonzern<br />
• Aufsichtsratsvorsitzender Markus<br />
Achleitner mit Generaldirektor<br />
Leonhard Schitter<br />
(e-ag) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats<br />
der Energie AG, Wirtschaftsl<strong>and</strong>esrat Markus<br />
Achleitner, gab nach Sitzung des Aufsichtsrats,<br />
dass dieser die Weichen für die<br />
Zukunft des Konzerns gestellt hat und der<br />
neue Vorst<strong>and</strong> bestellt wurde. Ab 1. Jänner<br />
2023 führen Dr. Leonhard Schitter, Dr.<br />
Andreas Kolar und DI Stefan Stallinger den<br />
oberösterreichischen Energie- und Dienstleistungskonzern.<br />
Dr. Schitter wird auch<br />
die Funktion des Vorsitzenden des Vorst<strong>and</strong>es<br />
übernehmen.<br />
„Es freut mich, dass wir mit Dr. Leonhard<br />
Schitter einen hochkarätigen Branchenpr<strong>of</strong>i<br />
für die Nachfolge des mit Jahresende<br />
ausscheidenden Generaldirektors DDr.<br />
Werner Steinecker als Kapitän an Bord der<br />
Energie AG Oberösterreich holen konnten.<br />
Die Position wurde breit ausgeschrieben,<br />
und das Auswahlverfahren von einem international<br />
tätigen Personalberatungsunternehmen<br />
begleitet. Dr. Schitter konnte<br />
sich aus einem internationalen Bewerberkreis<br />
im Hearing durchsetzen und hat mit<br />
seinen innovativen Ideen und Konzepten<br />
überzeugt. Mit Dr. Schitter gewinnen wir<br />
einen sehr erfahrenen Manager, der ein<br />
ausgewiesener Experte der Energiewirtschaft<br />
ist. Neben seiner langjährigen Erfahrung<br />
als CEO der Salzburg AG und Branchensprecher<br />
(Präsident Österreichs Energie<br />
von 2017-2020; derzeit Vizepräsident)<br />
hat er auch in Industriebetrieben umfassende<br />
Managementerfahrung gesammelt“,<br />
betont LR Achleitner.<br />
„Ich freue mich auf diese Aufgabe und<br />
will die Energie AG Oberösterreich gemeinsam<br />
mit meinen Vorst<strong>and</strong>skollegen,<br />
Führungskräften und Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern weiterentwickeln. Die<br />
Energie AG Oberösterreich soll neben ihrer<br />
hervorragenden Positionierung als regionaler<br />
Energie- und Infrastrukturversorger<br />
auch neue, insbesondere digitale Produkte<br />
und innovative Lösungen entwickeln. Sie<br />
muss bei der Energiewende die Richtung<br />
vorgeben und wird ein starker Begleiter<br />
und Problemlöser für unsere Kunden und<br />
Partner sein“, so Schitter in einer ersten<br />
Stellungnahme. Schitter bedankt sich für<br />
das in ihn gesetzte Vertrauen.<br />
Die beiden Vorstände Dr. Kolar und DI<br />
Stallinger wurden vom Aufsichtsrat in ihren<br />
Positionen bestätigt. Damit wird das<br />
Vorst<strong>and</strong>steam mit bewährten Vorständen<br />
komplettiert, die Kontinuität gewährleisten.<br />
„Die Energie AG Oberösterreich ist ein<br />
Leitbetrieb in Oberösterreich und steht vor<br />
großen Heraus<strong>for</strong>derungen. Ich bin überzeugt,<br />
dass der neu bestellte Vorst<strong>and</strong> diese<br />
Heraus<strong>for</strong>derungen gemeinsam mit den<br />
Kolleginnen und Kollegen in der Energie<br />
AG Oberösterreich hervorragend bewältigen<br />
wird“, betont der Vorsitzende des Aufsichtsrates,<br />
Wirtschaftsl<strong>and</strong>esrat Markus<br />
Achleitner. „Gleichzeitig möchte ich mich<br />
beim bestehenden Vorst<strong>and</strong> für die geleistete<br />
Arbeit in den vergangenen Jahren bedanken.<br />
Es wurden wichtige Weichen gestellt<br />
und ein Fundament gelegt, worauf<br />
aufgebaut werden kann. Bis Jahresende<br />
wird der bestehende Vorst<strong>and</strong> die Geschäfte<br />
führen und für eine pr<strong>of</strong>essionelle Übergabe<br />
sorgen“, schließt LR Markus Achleitner.<br />
LL<br />
www.energie-ag.at (222351217)<br />
Christoph Ringwald wird neuer<br />
Leiter Kommunikation und<br />
Politik bei EnBW<br />
• Bisheriger Leiter Jens Schreiber geht<br />
mit Erreichen der Altersgrenze in den<br />
Ruhest<strong>and</strong><br />
(enbw) Christoph Ringwald (48), derzeit<br />
Vice President Br<strong>and</strong>, Marketing & Communications<br />
bei der Rolls-Royce Power<br />
Systems AG, Friedrichshafen, wird neuer<br />
Leiter des Bereichs Kommunikation und<br />
Politik bei der EnBW. Der Wechsel soll spätestens<br />
zum 1. Januar 2023 stattfinden,<br />
nach Möglichkeit früher. Ringwald folgt<br />
damit auf Jens Schreiber (66), der nach Erreichen<br />
der Altersgrenze Ende September<br />
<strong>2022</strong> in den Ruhest<strong>and</strong> geht.<br />
Schreiber war im Juli 2013 als Leiter Unternehmenskommunikation<br />
zur EnBW gewechselt.<br />
EnBW-Chef Frank Mastiaux: „Im<br />
Zuge der Neuausrichtung hat das Thema<br />
Kommunikation und Positionierung der<br />
EnBW eine entscheidende Rolle gespielt.<br />
Die heute gute Unternehmensreputation<br />
ist ganz maßgeblich der kommunikativen<br />
Führung von Jens Schreiber zu verdanken.<br />
Er hat inhaltlich und im Stil entscheidende<br />
Akzente gesetzt, die heute unsere interne<br />
und externe Kommunikation ausmachen.<br />
Dafür möchte ich ihm im Namen des Unternehmens,<br />
aber auch ganz persönlich<br />
herzlich danken und ihm für die nächste<br />
Lebensphase alles erdenklich Gute wünschen.“<br />
Der international erfahrene Kommunikationsmanager<br />
Christoph Ringwald ist seit<br />
2018 für Rolls-Royce Power Systems tätig.<br />
Er führte dort erfolgreich die kommunikative<br />
Neupositionierung und Umsetzung<br />
der Trans<strong>for</strong>mationsagenda des Motorenhersteller<br />
zum Anbieter nachhaltiger Lösungen<br />
für Antrieb und Energie durch.<br />
Dazu gehörte auch die Neuordnung der<br />
Unternehmensmarke Rolls-Royce sowie<br />
der Produkt- und Lösungsmarke mtu im<br />
Rahmen eines umfassenden Rebr<strong>and</strong>ings.<br />
Zuvor arbeitete er sieben Jahre beim<br />
Technologiekonzern Heraeus Holding<br />
GmbH, Hanau, in verschiedenen Positionen,<br />
zuletzt als Leiter Communications.<br />
Weitere berufliche Stationen waren u.a.<br />
bei der depak - Deutsche Presseakademie<br />
Berlin sowie der Pixelpark AG in Berlin.<br />
Der gebürtige Ratzeburger verfügt über<br />
eine mehr als 20jährige Berufserfahrung in<br />
der Kommunikation aus Industrie- und<br />
Dienstleistungsperspektive mit dem Fokus<br />
der Veränderungskommunikation. Christoph<br />
Ringwald studierte Germanistik, Politikwissenschaften<br />
sowie Linguistik an der<br />
Universität zu Köln und absolvierte darüber<br />
hinaus berufsbegleitend ein Studium<br />
zum PR-Manager.<br />
LL<br />
www.enbw.com (222351218)<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 91
Books<br />
Veränderungen im LEAG-<br />
Vorst<strong>and</strong><br />
• Trans<strong>for</strong>mationsprozess zum grünen<br />
Energieunternehmen soll beschleunigt<br />
werden<br />
(leag) Mit einer Neuaufteilung von Zuständigkeiten<br />
im Unternehmensvorst<strong>and</strong> will<br />
LEAG seine Trans<strong>for</strong>mation von der auf<br />
Braunkohle basierten Stromerzeugung zu<br />
einem breit aufgestellten grünen Energieunternehmen<br />
beschleunigen. Dazu wird<br />
der Vorst<strong>and</strong>svorsitzende Thorsten Kramer<br />
die Führung bei der Entwicklung neuer Geschäftsfelder,<br />
einschließlich des Ausbaus<br />
der erneuerbaren Energien mit Wind und<br />
PV im Gigawatt-Bereich, sowie deren Vermarktung<br />
übernehmen.<br />
LEAGs Projekt-Pipeline für den Ausbau<br />
der erneuerbaren Energien umfasst über 4<br />
GW auf gesicherten Flächen der Bergbaufolgel<strong>and</strong>schaft<br />
in Br<strong>and</strong>enburg und<br />
Sachsen. Bei entsprechenden rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen könnte bis 2030 ein<br />
Ausbaupotential von bis zu 7 Gigawatt realisiert<br />
werden. Bis 2040 wäre der weitere<br />
Ausbau auf 12 Gigawatt erneuerbarer Energieerzeugung<br />
möglich. Ein Großteil dieser<br />
LEAG-Gigawatt-Factory soll ihren Platz in<br />
der Lausitz haben und dabei helfen, die<br />
Strukturentwicklung voranzutreiben.<br />
In diesem Zusammenhang wird Andreas<br />
Huck, Vorst<strong>and</strong> Neue Geschäftsfelder, im<br />
besten gegenseitigen Einvernehmen aus<br />
dem Vorst<strong>and</strong> der LEAG zum 30.06.22 ausscheiden.<br />
Herr Huck wird der Gesellschaft<br />
weiterhin beratend zur Verfügung stehen.<br />
Der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas<br />
Lusch dankt Herrn Huck: „Mit seinem hohen<br />
Engagement hat Herr Huck wichtige<br />
Impulse gesetzt und in kurzer Zeit Erfolge<br />
bei der Trans<strong>for</strong>mation zu neuen Geschäftsaktivitäten<br />
erreicht. Durch die beratende<br />
Tätigkeit von Herrn Huck stellen wir<br />
gemeinsam die Fortsetzung wichtiger Projekte<br />
sicher.“<br />
LL<br />
www.leag.de (222351219)<br />
Abwärmeunternehmen Orcan<br />
Energy wächst weiter:<br />
Marcus Jentsch neuer<br />
Finanzvorst<strong>and</strong><br />
(orcan) Auf dem Weg zur globalen Expansion<br />
verstärkt das Münchner Abwärmeunternehmen<br />
Orcan Energy sein Management-Team:<br />
Marcus Jentsch (54) wird neuer<br />
Chief Financial Officer (CFO) von Orcan<br />
Energy. Mit ihm gewinnt der Technologieführer<br />
im Bereich Abwärmelösungen einen<br />
erfahrenen Finanzexperten, der die Bereiche<br />
Finance, Controlling, Steuern und<br />
Recht verantworten wird. Mit seinem<br />
Know-how im Bereich Cleantech und Erneuerbare<br />
Energien soll er vor allem Orcan<br />
Energy`s Wachstum und weltweite Expansion<br />
begleiten.<br />
Marcus Jentsch kann auf vielfältige Management-<br />
und Kapitalmarkterfahrungen<br />
- darunter Börsengänge, Kapitalerhöhungen,<br />
Aktienplatzierungen und Mergers und<br />
Acquisitions - zurückgreifen. Seine berufliche<br />
Laufbahn begann der Diplom-Wirtschaftswissenschaftler<br />
im Investmentbanking<br />
bei UBS und Lazard. Anschließend<br />
wechselte er in die Energiewirtschaft, wo<br />
er eine Reihe von CFO-Positionen bekleidete,<br />
u.a. beim börsennotierten Energieversorger<br />
MVV Energie AG in Mannheim und<br />
beim internationalen Wind-und Solar-Park-Anbieter<br />
juwi AG in Wörrstadt, wo<br />
er als Finanzvorst<strong>and</strong> erfolgreich die Sanierung<br />
und den Turnaround des Konzerns<br />
leitete. Zuletzt war Marcus Jentsch als CFO<br />
beim Münchner Start-up Jolt Energy als<br />
CFO tätig.<br />
„Mit Marcus Jentsch gewinnen wir einen<br />
international erfahrenen Finanzvorst<strong>and</strong><br />
für die erfolgreiche Weiterentwicklung von<br />
Orcan Energy. Als CFO kommt Marcus genau<br />
zum richtigen Zeitpunkt, um in der<br />
aktuellen Wachstumsphase die richtigen<br />
Weichen für die Zukunft zu stellen“, sagt<br />
Andreas Sichert, CEO und Mitgründer von<br />
Orcan Energy.<br />
Orcan Energy<br />
Orcan Energy AG ist Europas führendes<br />
CleanTech Unternehmen, das effiziente<br />
Energielösungen auf Basis der Organic-Rankine-Cycle-Technologie<br />
zur Verstromung<br />
von Abwärme entwickelt, herstellt<br />
und vertreibt. Orcan Energy AG wurde<br />
2008 von Dr. Andreas Sichert, Dr.<br />
Andreas Schuster und Richard Aumann<br />
mit dem Ziel gegründet, Unternehmen aus<br />
unterschiedlichen Industriesparten eine<br />
einfache, wirtschaftliche und effiziente<br />
Energielösung anzubieten, die das enorme<br />
Energiepotenzial ungenutzter industrieller<br />
Abwärmequellen erschließt. Kunden von<br />
Orcan Energy pr<strong>of</strong>itieren von sauberem<br />
Strom zu den günstigsten Stromgestehungskosten<br />
weltweit. Angesichts des<br />
enormen globalen Abwärmepotenzials<br />
versteht sich das Unternehmen als wichtigen<br />
Spieler in der Energiewelt von morgen.<br />
Orcan Energy AG hat bisher über 500 Anlagen<br />
in die ganze Welt verkauft. Damit<br />
sind die efficiency PACKs von Orcan Energy<br />
die meistgenutzte Anlage im Nieder-Temperatur-Sektor<br />
weltweit. Für die Erschließung<br />
neuer Absatzmärkte in Asien hat Orcan<br />
Energy ein Joint Venture mit der VPower<br />
Group <strong>International</strong> Holdings LTD,<br />
Chinas führendem Unternehmen für integrierte<br />
Stromerzeugungsanlagen und der<br />
finanzstarken CITIC Pacific Ltd gegründet.<br />
Orcan Energy AG beschäftigt 60 Mitarbeiter<br />
und hat seinen Sitz in München.<br />
LL<br />
www.orcan-<strong>energy</strong>.com<br />
(222351221)<br />
Books<br />
Karte der<br />
Stromnetzbetreiber <strong>2022</strong><br />
(vde) Die Karte zeigt die Versorgungsgebiete<br />
der ca. 870 Stromnetzbetreiber in<br />
Deutschl<strong>and</strong>. Sie basiert auf den von den<br />
Netzbetreibern veröffentlichten Angaben<br />
zu ihren Versorgungsgebieten. Die Gebietsgrenzen<br />
wurden aus den Grenzen von Gemeinden,<br />
Postleitgebieten, Ortsteilen und<br />
Gemarkungen abgeleitet.<br />
Sie dokumentiert die Auswirkungen der<br />
Rekommunalisierung ebenso wie Veränderungen<br />
der Netzgebiete aufgrund von<br />
Netzverkäufen, Netzverpachtungen, Unternehmensfusionen,<br />
Unternehmensaufsplittungen<br />
und Umfirmierungen.<br />
Die <strong>of</strong>fizielle, vom BDEW herausgegebene<br />
Karte gilt als St<strong>and</strong>ardwerk für alle am<br />
deutschen Strommarkt agierenden Unternehmen.<br />
Für Energievertrieb und H<strong>and</strong>el<br />
ist die Karte unverzichtbar.<br />
BDEW-/DVGW-Mitglieder erhalten die<br />
Karte zum Sonderpreis von 198,00 €.<br />
Bestellung: sommer@vde-verlag.de.<br />
• St<strong>and</strong>: Januar <strong>2022</strong><br />
• <strong>2022</strong>, 1 Seiten, 840 x 1185 mm,<br />
Gerollt, Karte<br />
• ISBN 978-3-8007-5794-7,<br />
E-Book: ISBN 978-3-8007-5795-4<br />
LL<br />
www.vde-verlag.de (222341604)<br />
92 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
Books<br />
<strong>vgbe</strong> Seminar<br />
Chemie im<br />
Wasser-Dampf-Kreislauf<br />
15. und 16. November <strong>2022</strong><br />
Atlantic Congress Hotel<br />
Essen, Deutschl<strong>and</strong><br />
Der Betrieb moderner Kraftwerksanlagen wird häufig<br />
durch chemisch bedingte Probleme im Bereich des<br />
Wasser-Dampf-Kreislaufs negativ beeinflusst.<br />
Aus diesem Grund ist es wichtig, die grundlegenden<br />
Zusammenhänge zu kennen und die chemische Fahrweise<br />
entsprechend der betrieblichen Belange einzustellen.<br />
Hierzu sollen die Teilnehmenden in die Lage<br />
versetzt werden, die chemischen Vorgänge in ihren<br />
Anlagen besser zu verstehen, sie zielgerichtet prüfen<br />
und gegebenenfalls optimieren zu können<br />
Den Teilnehmenden wird darüber hinaus die Möglichkeit<br />
geboten, spezifische Probleme ihrer Anlagen zu<br />
diskutieren und Erfahrungen auszutauschen.<br />
Pr<strong>of</strong>itieren Sie durch Ihre Teilnahme an diesem praxisorientierten<br />
Seminar „Chemie im Wasser-Dampf-<br />
Kreislauf“ von den langjährigen Erfahrungen der Mitarbeitenden<br />
des Bereiches „Wasserchemie“ der Technischen<br />
Dienste des <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong>.<br />
INFORMATIONEN | PROGRAMM | ANMELDUNG<br />
https://t1p.de/6w9qj (Shortlink)<br />
KONTAKT<br />
Konstantin Blank<br />
e <strong>vgbe</strong>-wasserdampf@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
t +49 201 8128-214<br />
Foto: © Shotshop.com<br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> service GmbH<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
Deilbachtal 173 |<br />
45257 Essen |<br />
Deutschl<strong>and</strong><br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 93
Inserentenverzeichnis<br />
Media<br />
News<br />
<strong>vgbe</strong> service: Wir für Sie in <strong>2022</strong><br />
Die Mediadaten des ab <strong>2022</strong> erscheinenden<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> – bislang VGB<br />
POWERTECH – sind jetzt erschienen und<br />
stehen als Download unter <strong>and</strong>erem mit<br />
der Themenplanung auf unseren Webseiten<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> und www.<strong>vgbe</strong>.<br />
services zur Verfügung.<br />
Martin Huhn unterstützt Sie gerne als Ansprechpartner<br />
für Ihre Insertionen in unserer<br />
internationalen Fachzeitschrift sowie<br />
unseren weiteren Publikationen zu Veranstaltungen.<br />
Kontakt: Martin Huhn ist über die bekannte<br />
Durchwahl 0201 8128-212 und unter<br />
der E-Mail ads@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> zu erreichen.<br />
LL<br />
<strong>vgbe</strong>.services<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong><br />
MEDIADATEN <strong>2022</strong><br />
<strong>International</strong>e Fachzeitschrift für die Erzeugung<br />
und Speicherung von Strom und Wärme<br />
Sonderpublikationen zu <strong>vgbe</strong>-Veranstaltungen<br />
Mediapartner Ihrer Veranstaltung<br />
Online-Werbung und Jobörse<br />
KURZCHARAKTERISTIK | THEMEN | ANZEIGENPREISLISTE | KONTAKTE<br />
Media-In<strong>for</strong>mationen <strong>2022</strong><br />
l Kurzcharakteristik<br />
l Leseranalyse<br />
l Redaktionsplan<br />
l Anzeigenin<strong>for</strong>mation<br />
l Kontakte<br />
Beratung: Martin Huhn<br />
e ads@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
t +49 201 8128-212<br />
f +49 201 8128-302<br />
w www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> | Publikationen<br />
Inserentenverzeichnis 7 l <strong>2022</strong><br />
<strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong> <br />
Antwerp, Belgium<br />
Titelseite/U I<br />
RWE Group 17<br />
www.hok.de<br />
<strong>vgbe</strong> Onlineseminar<br />
Basics Wasserchemie im Kraftwerk 3<br />
Enlit Europe<br />
Wörterbuch Gas- und <br />
Dampfturbinen<br />
U IV<br />
U II<br />
BRAUER Maschinentechnik AG 9<br />
KVZ Südbaden 11<br />
Stellenanzeige<br />
Borsig Service GmbH 13<br />
KWS Energy Knowledge eG 15<br />
MEORGA Messen 19<br />
<strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong> 44<br />
Chemiekonferenz <strong>2022</strong><br />
Conference Chemistry <strong>2022</strong> 54<br />
<strong>vgbe</strong> Fachtagung Brennst<strong>of</strong>fe,<br />
Feuerungen und Abgasreinigung 63<br />
<strong>vgbe</strong> Fachtagung Stilllegung und<br />
Rückbau von Energie- und<br />
Industrieanlagen <strong>2022</strong> 69<br />
<strong>vgbe</strong> Seminar Chemie im<br />
Wasser-Dampf-Kreislauf 93<br />
<strong>vgbe</strong>/VERBUND Expert Event<br />
Digitalisation in Hydropower <strong>2022</strong> 21<br />
<strong>vgbe</strong> Fachtagung IT-Sicherheit in<br />
Energieanlagen <strong>2022</strong> 25<br />
<strong>vgbe</strong> Workshop<br />
2 nd KISSY Provider Day <strong>2022</strong> 29<br />
<strong>vgbe</strong> Workshop<br />
Öl im Kraftwerk <strong>2022</strong> 31<br />
94 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
<strong>vgbe</strong> Events | Events<br />
<strong>vgbe</strong> Events <strong>2022</strong> | Please visit our website <strong>for</strong> updates!<br />
– Sub ject to chan ge –<br />
Congress/Kongress<br />
<strong>vgbe</strong> Kongress <strong>2022</strong><br />
<strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong><br />
14 & 15 September <strong>2022</strong><br />
Antwerp, Belgium<br />
Contact<br />
Ines Moors<br />
t +49 201 8128-222<br />
e <strong>vgbe</strong>-congress@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Angela Langen<br />
t +49 201 8128-310<br />
e angela.langen@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Konferenzen | Fachtagungen<br />
Brennst<strong>of</strong>fe, Feuerungen <br />
und Abgasreinigung <strong>2022</strong><br />
Fachtagung mit Fachausstellung<br />
28. und 29. September <strong>2022</strong><br />
Hamburg, Deutschl<strong>and</strong><br />
Kontakt<br />
Barbara Bochynski<br />
t +49 201 8128-205<br />
e <strong>vgbe</strong>-brennst<strong>of</strong>fe@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Stilllegung und Rückbau von<br />
Energie- und Industrieanlagen<strong>2022</strong><br />
Fachtagung mit Fachausstellung<br />
5. und 6. Oktober <strong>2022</strong><br />
Velbert, Deutschl<strong>and</strong><br />
Kontakt<br />
Barbara Bochynski<br />
t +49 201 8128-205<br />
e <strong>vgbe</strong>-rueckbau@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong>-Chemiekonferenz <strong>2022</strong><br />
<strong>vgbe</strong> Conference Chemistry <strong>2022</strong><br />
mit Fachausstellung/<br />
with Technical Exhibition<br />
25 to 27 October <strong>2022</strong><br />
Dresden, Germany<br />
Contact<br />
Ines Moors<br />
t +49 201 8128-222<br />
e <strong>vgbe</strong>-chemie@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
IT-Sicherheit in Energieanlagen<br />
Fachtagung mit Fachausstellung<br />
8. und 9. November <strong>2022</strong><br />
Moers, Deutschl<strong>and</strong><br />
Kontakt<br />
Barbara Bochynski<br />
t +49 201 8128-205<br />
e <strong>vgbe</strong>-it-sicherheit@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Seminare | Workshops<br />
12. Emder Workshop „Offshore<br />
Windenergie – Arbeitsmedizin“<br />
Workshop<br />
16. & 17. September <strong>2022</strong><br />
Emden, Deutschl<strong>and</strong><br />
Kontakt<br />
e <strong>vgbe</strong>-arbeitsmed@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
KISSY Provider Day <strong>2022</strong><br />
Workshop | English (free)<br />
27 September <strong>2022</strong><br />
OnLine<br />
Contact<br />
Stephanie Wilmsen<br />
t +49 201 8128-244<br />
e kissy@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
In<strong>for</strong>mation on all events<br />
with exhibition/Aus kunft<br />
zu allen Veranstaltungen<br />
mit Fachausstellung<br />
t +49 201 8128-310/-299,<br />
e events@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Updates www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Basics Wasserchemie <br />
im Kraftwerk<br />
Seminar<br />
5. und 6. Oktober <strong>2022</strong><br />
Essen, Deutschl<strong>and</strong><br />
Kontakt<br />
Konstantin Blank<br />
t +49 201 8128-214<br />
e <strong>vgbe</strong>-wasserdampf@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Öl im Kraftwerk<br />
<strong>vgbe</strong>-Seminar<br />
10. und 11. November <strong>2022</strong><br />
Bedburg, Deutschl<strong>and</strong><br />
Kontakt<br />
Diana Ringh<strong>of</strong>f<br />
t +49 201 8128-232<br />
e <strong>vgbe</strong>-oil-pp@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Chemie im<br />
Wasser-Dampf-Kreislauf<br />
Seminar<br />
15. und 16. Novmeber <strong>2022</strong><br />
Essen, Deutschl<strong>and</strong><br />
Kontakt<br />
Konstantin Blank<br />
t +49 201 8128-214<br />
e <strong>vgbe</strong>-wasserdampf@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Digitalization in<br />
Hydropower <strong>2022</strong><br />
<strong>vgbe</strong>/VERBUND Expert Event<br />
17 & 18 November <strong>2022</strong><br />
Vienna/Austria & OnLine<br />
Contact<br />
e <strong>vgbe</strong>-digi-hpp@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Immissionsschutz-<br />
und Störfallbeauftragte <strong>2022</strong><br />
Fortbildungsveranstaltung<br />
22. bis 24. November <strong>2022</strong><br />
Höhr-Grenzhausen, Deutschl<strong>and</strong><br />
Kontakt<br />
e <strong>vgbe</strong>-immission@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Produkte aus der<br />
thermischen Abfallverwertung<br />
Workshop<br />
6. und 7. Dezember <strong>2022</strong><br />
Kassel, Deutschl<strong>and</strong><br />
Kontakt<br />
e <strong>vgbe</strong>-therm-abf@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Exhibitions <strong>and</strong> Conferences<br />
54. Kraftwerkstechnisches<br />
Kolloquium<br />
18. & 19. Oktober <strong>2022</strong><br />
Dresden, Deutschl<strong>and</strong><br />
Short Link: https://t1p.de/kwt54<br />
Enlit <strong>2022</strong><br />
29 November to 1 December <strong>2022</strong><br />
Frankfurt a.M., Germany<br />
www.enlit-europe.com<br />
2. Branchentag Wasserst<strong>of</strong>f –<br />
Lessons Learned?!<br />
8. und 9. Dezember <strong>2022</strong><br />
Rostock, Deutschl<strong>and</strong><br />
www.branchentag-wasserst<strong>of</strong>f.de/<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong> | 95
22/007 gkl Page2<br />
Preview | Imprint<br />
Preview 8 l <strong>2022</strong><br />
Focus: <strong>vgbe</strong> Congresss <strong>2022</strong><br />
Energy supply strategies <strong>and</strong><br />
Security <strong>of</strong> supply<br />
Fokus: <strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong><br />
Energieversorgung<br />
und Sicherheit<br />
der Energieversorgung<br />
Requirements <strong>for</strong> capacity expansion<br />
<strong>and</strong> fuel supply <strong>for</strong> a future-pro<strong>of</strong>,<br />
secure <strong>and</strong> climate-friendly electricity<br />
supply in Germany<br />
An<strong>for</strong>derungen an Kapazitätsausbau<br />
und Brennst<strong>of</strong>fversorgung für eine<br />
zukunftsfeste, sichere und klimagerechte<br />
Stromversorgung in Deutschl<strong>and</strong><br />
Hans-Wilhelm Schiffer, Stefan Ulreich <strong>and</strong><br />
Tobias Zimmermann<br />
Innovative technology <strong>for</strong> a proven gas<br />
turbine - 3D-printed V64.3 turbine inlet<br />
guide vane with in-wall cooling<br />
Innovative Technologie für eine bewährte<br />
Gasturbine – 3D-gedruckte V64.3 Turbineneintrittsleitschaufel<br />
mit In-W<strong>and</strong>kühlung<br />
Axel Pechstein <strong>and</strong> Jan Münzer<br />
Methanol production <strong>and</strong> markets<br />
Methanolproduktion und Märkte<br />
Malgorzata Wiatros-Motyka<br />
Fig. 2: Illustration <strong>of</strong> a merit order <strong>for</strong> Germany in 2020<br />
SRMC (€/MWh)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Oil Oil & <strong>and</strong> Other Fossil other fossil ET<br />
Gas Gas<br />
Hard Hard Coal coal<br />
Lignite Lignite<br />
Nuclear <strong>energy</strong><br />
RES‐E Renewable energies<br />
0 5,2 10,3 15,4 20,6 25,7 30,9 36 41,1 46,3 51,4 56,6 61,7 66,8 72 77,1 82,2 87,4 92,5 97,7<br />
Installed capacity (GW)<br />
SRMC = Short run marginal costs<br />
Average available capacity <strong>for</strong> renewable energies applied<br />
Source <strong>for</strong> price data: BAFA, EEX <strong>and</strong> NEP <strong>Electricity</strong> 2017<br />
Illustration <strong>of</strong> a merit order <strong>for</strong><br />
Germany in 2020. To be published<br />
in the article “Requirements <strong>for</strong><br />
capacity expansion <strong>and</strong> fuel supply<br />
<strong>for</strong> a future-pro<strong>of</strong>, secure <strong>and</strong><br />
climate-friendly electricity supply in<br />
Germany” by Hans-Wilhelm<br />
Schiffer, Stefan Ulreich <strong>and</strong><br />
Tobias Zimmermann<br />
Imprint<br />
Publisher<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
Chair:<br />
Dr. Georg Stamatelopoulos<br />
Executive Managing Director:<br />
Dr.-Ing. Oliver Then<br />
Address<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> e.V.<br />
Deilbachtal 173<br />
45257 Essen<br />
Germany<br />
Tel.: +49 201 8128-0 (switchboard)<br />
The <strong>journal</strong> <strong>and</strong> all papers <strong>and</strong> photos<br />
contained in it are protected by copyright.<br />
Any use made there<strong>of</strong> outside the Copyright<br />
Act without the consent <strong>of</strong> the publishers is<br />
prohibited. This applies to reproductions,<br />
translations, micr<strong>of</strong>ilming <strong>and</strong> the input<br />
<strong>and</strong> incorporation into electronic systems.<br />
The individual author is held responsible <strong>for</strong><br />
the contents <strong>of</strong> the respective paper. Please<br />
address letters <strong>and</strong> manuscripts only to the<br />
Editorial Staff <strong>and</strong> not to individual persons <strong>of</strong><br />
the association´s staff. We do not assume any<br />
responsibility <strong>for</strong> unrequested contributions.<br />
Diese Fachzeitschrift und alle in ihr enthaltenen<br />
Beiträge und Fotos sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Jede Verwertung außerhalb<br />
der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist<br />
ohne Zustimmung der Herausgeber unzulässig.<br />
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen,<br />
Übersetzungen, Mikroverfilmungen<br />
und die Einspeisung und Verarbeitung in<br />
elektronischen Systemen. Für den Inhalt<br />
des jeweiligen Beitrages ist der einzelne<br />
Autor verantwortlich. Bitte richten Sie<br />
Briefe und Manuskripte nur an die Redaktion<br />
und nicht an einzelne Personen.<br />
Für unaufge<strong>for</strong>dert einges<strong>and</strong>te Beiträge<br />
übernehmen wir keine Verantwortung.<br />
Editorial Office<br />
Editor in Chief:<br />
Dipl.-Ing. Christopher Weßelmann<br />
Tel.: +49 201 8128-300<br />
Fax: +49 201 8128-302<br />
E-mail: pt-presse@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Web: www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Editorial Staff<br />
Dr. Mario Bachhiesl<br />
Dr.-Ing. Thomas Eck<br />
Dr.-Ing. Christian Mönning<br />
Dr.-Ing. Oliver Then<br />
Dipl.-Ing. Ernst Michael Züfle<br />
Scientific Editorial Advisory Board<br />
Pr<strong>of</strong>. Dr. Frantisek Hrdlicka,<br />
Praha, Czech Republic<br />
Pr<strong>of</strong>. Dr. Antonio Hurtado, Dresden, Germany<br />
Pr<strong>of</strong>. Dr. Emmanouil Kakaras, Athens, Greece<br />
Pr<strong>of</strong>. Dr. Alfons Kather, Hamburg, Germany<br />
Pr<strong>of</strong>. Dr. Harald Weber, Rostock, Germany<br />
Editing <strong>and</strong> Translation<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong><br />
Distribution<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> service GmbH<br />
Gregor Scharpey<br />
Deilbachtal 173<br />
45257 Essen<br />
Germany<br />
Subscriptions:<br />
Tel.: +49 201 8128-271<br />
Fax: +49 201 8128-302<br />
Advertisements<br />
Martin Huhn<br />
Tel.: +49 201 8128-212<br />
Fax: +49 201 8128-302<br />
E-mail: ads@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Advertisement Rate Card<br />
No. 53 <strong>of</strong> 1 January <strong>2022</strong><br />
Advertising Representation<br />
<strong>for</strong> USA <strong>and</strong> North America<br />
Trade Media <strong>International</strong> Corp.<br />
421 Seventh Avenue, Suite 607,<br />
New York, N.Y. 10001–2002<br />
USA<br />
Tel.: +1 212 564-3380,<br />
Fax: +1 212 594-3841<br />
E-mail: rdtmicor@cs.com<br />
Publishing Intervals<br />
Monthly (11 copies/year)<br />
<strong>2022</strong> – Volume 102<br />
Subscription Conditions<br />
Annual subscription price <strong>for</strong><br />
11 copies (<strong>2022</strong>): 330.63 €<br />
Price per copy: 39.50 €<br />
Germany: VAT (USt.) <strong>and</strong> postage<br />
are included.<br />
Foreign countries: VAT <strong>and</strong> postage are<br />
not included.<br />
Postage: Europe 46.- €, other countries 92.- €.<br />
Bookseller’s discount 10 %.<br />
The subscription extends to another<br />
year if no written cancellation is made<br />
1 month be<strong>for</strong>e expiry.<br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> members receive one copy<br />
free <strong>of</strong> charge regularly;<br />
further copies at a special price.<br />
Contact: sales-media@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Printing <strong>and</strong> Processing<br />
inpuncto:asmuthdruck + medien gmbh<br />
Richard-Byrd-Straße 39<br />
Medienzentrum Ossendorf<br />
50829 Köln, Germany<br />
In<strong>for</strong>mation <strong>for</strong> authors <strong>and</strong> abstracts<br />
are available <strong>for</strong> download at<br />
www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> | Publications<br />
96 | <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong> 7 · <strong>2022</strong>
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong><br />
EDITORIAL SCHEDULE <strong>2022</strong><br />
Please check our website <strong>for</strong> updates<br />
<strong>and</strong> <strong>vgbe</strong> events:<br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> *<br />
Issue Focal points Additionally in each issue: Energy News, Calendar, People Advertisement <strong>and</strong> printing deadline<br />
January/ Trends <strong>and</strong> Innovation in Power <strong>Generation</strong> – VGB Congress 2021 | Energy system <strong>of</strong> the future | 3 Febuary <strong>2022</strong><br />
Februar Hydrogen <strong>and</strong> further options <strong>for</strong> <strong>energy</strong> carriers<br />
March Chemistry in power generation <strong>and</strong> storage | Cogeneration | Industrial <strong>and</strong> cogeneration plants 2 March <strong>2022</strong><br />
Thermal Waste Utilisation <strong>and</strong> Fluidised Bed Combustion, 23 <strong>and</strong> 24 March <strong>2022</strong>, Hamburg/Germany<br />
April Hydropower | Digitisation | Control room technology | Big data in power generation | Fuel technology <strong>and</strong> furnaces 4 April <strong>2022</strong><br />
Materials <strong>and</strong> Quality Assurance <strong>2022</strong>, 4 <strong>and</strong> 5 May <strong>2022</strong>, Schloss Paffendorf<br />
May Environmental technologies | Decommissioning <strong>and</strong> dismantling in conventional power generation <strong>and</strong> <strong>for</strong> renewables | 2 May <strong>2022</strong><br />
Nuclear power, nuclear power plants: operation <strong>and</strong> operating experience, decommissioning, waste disposal<br />
KELI – Conference <strong>for</strong> Electrical Engineering, I&C <strong>and</strong> IT <strong>2022</strong>, 10 to 12 June <strong>2022</strong>, Bremen/Germany<br />
June Gas turbines <strong>and</strong> gas turbine operation | Combined cycle power plants (CCPP) | 30 May <strong>2022</strong><br />
Sector coupling <strong>and</strong> power generation | Redispatch<br />
Steam Turbines <strong>2022</strong>, 14 <strong>and</strong> 15 June <strong>2022</strong>, Cologne/Germany<br />
July Thermal waste <strong>and</strong> sewage sludge treatment, fluidised-bed combustion | Gas <strong>and</strong> diesel engines | 24 June <strong>2022</strong><br />
Cyber-security in the <strong>energy</strong> sector | Knowledge management, documentation, databases<br />
August Power-2-X | Flexibility in power <strong>and</strong> heat generation | Emission control <strong>and</strong> reduction technologies | 28 July <strong>2022</strong><br />
Occupational safety <strong>and</strong> health protection | Environmental technology, emissions reduction | Conservation <strong>of</strong> know-how<br />
September Special issue <strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong>, 14 <strong>and</strong> 15 September <strong>2022</strong>, Antwerp/Belgium 19 August <strong>2022</strong><br />
Renewables <strong>and</strong> distributed generation: Hydro power, on- <strong>and</strong> <strong>of</strong>fshore wind power, solar-thermal power plants,<br />
photovoltaics, biomass, geothermal generation<br />
October Electrical engineering, instrumentation <strong>and</strong> control | Quality assurance | 30 September <strong>2022</strong><br />
Materials: Latest developments <strong>and</strong> experience in power plant engineering<br />
<strong>vgbe</strong> Conference Chemistry <strong>2022</strong>, 25 to 27 October <strong>2022</strong>, Dresden<br />
November Steam turbines <strong>and</strong> steam turbine operation | Steam generators | Civil engineering <strong>for</strong> conventional power plants, 27 October <strong>2022</strong><br />
wind <strong>and</strong> hydro power plants<br />
Digitisation in Hydropower <strong>2022</strong>, 8 <strong>and</strong> 9 November <strong>2022</strong>, Vienna<br />
December <strong>vgbe</strong> Congress <strong>2022</strong>, Antwerp/Belgium: Reports, impressions | Research in power generation & storage | Power plant by-products 28 November <strong>2022</strong><br />
Editorial deadline technical papers: 2 months prior to publication <strong>of</strong> respective issue (please also refer to the “Guidelines <strong>for</strong> Authors”, www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> ... Publications)<br />
Deadline <strong>for</strong> submission <strong>of</strong> technical papers: 1 month prior to publication<br />
Editorial deadline news: 4 weeks prior to publication <strong>of</strong> respective issue (please also refer to the “Guidelines <strong>for</strong> News”, www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> ... Publications)<br />
* <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> has been the new name <strong>of</strong> VGB PowerTech since April <strong>2022</strong>.<br />
Contact:<br />
VGB PowerTech Service GmbH,<br />
Deilbachtal 173, 45257 Essen, Germany |<br />
Editor in Chief: Dipl.-Ing. Christopher Weßelmann<br />
Editorial p +49 201 8128-300<br />
department: f +49 201 8128-302<br />
e pt-presse@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Advertisements Martin Huhn,<br />
<strong>and</strong> sales: Sabine Kuhlmann,<br />
Gregor Scharpey<br />
p +49 201 8128-212<br />
f +49 201 8128-302<br />
e ads@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
<strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong><br />
REDAKTIONSPLAN <strong>2022</strong><br />
Aktualisierungen und Veranstaltungstermine<br />
finden Sie hier:<br />
be in<strong>for</strong>med www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> *<br />
Ausgabe Themenschwerpunkte In jeder Ausgabe: Nachrichten aus Energiewirtschaft und -technik Anzeigen- und Druckunterlagenschluss<br />
Januar/ Trends und Innovationen in der Stromerzeugung – VGB-Kongress 2021 | Energiesystem der Zukunft | 3. Februar <strong>2022</strong><br />
Februar Wasserst<strong>of</strong>f und alternative Energieträger<br />
März Chemie in der Energieerzeugung und -speicherung | Kraft-Wärme-Kopplung | Industriekraftwerke | Blockheizkraftwerke 2. März <strong>2022</strong><br />
Thermische Abfallverwertung und Wirbelschichtfeuerungen, 23. und 24. März <strong>2022</strong>, Hamburg<br />
April Wasserkraft | Digitalisierung | Warten- und Leitst<strong>and</strong>technik | Big Data in der Stromerzeugung | 4. April <strong>2022</strong><br />
Brennst<strong>of</strong>ftechnik und Feuerungen<br />
Materials <strong>and</strong> Quality Assurance <strong>2022</strong>, 4 <strong>and</strong> 5 May <strong>2022</strong>, Schloss Paffendorf<br />
Mai Umwelttechnik | Stilllegung und Rückbau konventioneller Anlagen und im Bereich Erneuerbarer Energien | 2. Mai <strong>2022</strong><br />
Kernenergie, Kernkraftwerke: Betrieb und Betriebserfahrungen, Rückbau und Entsorgung<br />
KELI – Konferenz für Elektro-, Leit- und In<strong>for</strong>mationstechnik <strong>2022</strong>, 10. bis 12. Juni <strong>2022</strong>, Bremen<br />
Juni Gasturbinen und Gasturbinenbetrieb | Kombikraftwerke (GuD) | Sektorkopplung und Stromerzeugung | Redispatch 30. Mai <strong>2022</strong><br />
Dampfturbinen <strong>2022</strong>, 14. und 15. Juni <strong>2022</strong>, Köln<br />
Juli Thermische Abfall-, Klärschlammbeh<strong>and</strong>lung und Wirbelschichtfeuerungen | Gas- und Dieselmotoren | 24. Juni <strong>2022</strong><br />
Cyber-Security in der Energiewirtschaft | Wissensmanagement, Dokumentation, Datenbanken<br />
August Power-2-X | Flexibilität in der Strom- und Wärmeerzeugung | Emissionsminderungstechnologien | Arbeitssicherheit und 28. Juli <strong>2022</strong><br />
Gesundheitsschutz | Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Energieerzeugung | Know-how- und Kompetenzsicherung<br />
September Spezialausgabe <strong>vgbe</strong>-Kongress <strong>2022</strong>, 14. und 15. September <strong>2022</strong>, Antwerpen/Belgien 19. August <strong>2022</strong><br />
Erneuerbare Energien und Dezentrale Erzeugung: Wasserkraft, On- und Offshore-Windkraft, Solarthermische Kraftwerke,<br />
Photovoltaik, Biomasse und Biogas, Geothermie<br />
Oktober Elektro-, Leit- und In<strong>for</strong>mationstechnik | Qualitätssicherung | Werkst<strong>of</strong>fe: Neue Entwicklungen und Erfahrungen in der Stromerzeugung 30. September <strong>2022</strong><br />
<strong>vgbe</strong>-Chemiekonferenz <strong>2022</strong>, 25. bis 27. Oktober <strong>2022</strong>, Dresden<br />
November Dampfturbinen und Dampfturbinenbetrieb | Dampferzeuger | Bautechnik für Kraftwerke, Windenergieanlagen und Wasserkraftwerke 27. Oktober <strong>2022</strong><br />
Digitisation in Hydropower <strong>2022</strong>, 8 <strong>and</strong> 9 November <strong>2022</strong>, Vienna<br />
Dezember <strong>vgbe</strong>-Kongress <strong>2022</strong>, Antwerpen/Belgien: Berichte, Impressionen | Forschung für Stromerzeugung & Energiespeicherung | 28. November <strong>2022</strong><br />
Nebenprodukte in der Strom- und Wärmeerzeugung<br />
Redaktionsschluss für Fachbeiträge: 2 Monate vor Erscheinen der jeweiligen Ausgabe (s. a. „Autorenhinweise“, www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> ... Publikationen ... <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> <strong>journal</strong>)<br />
Unterlagenabgabe: bis 1 Monat vor Erscheinen der jeweiligen Ausgabe<br />
Redaktionsschluss für Pressemitteilungen/Nachrichten: 4 Wochen vor Erscheinen der jeweiligen Ausgabe (s. a. „Hinweise zu Pressemitteilungen“, www.<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong> ... Publikationen)<br />
* <strong>vgbe</strong> <strong>energy</strong> ist seit April <strong>2022</strong> der neue Name des bisherigen VGB PowerTech.<br />
Kontakt:<br />
VGB PowerTech Service GmbH,<br />
Deilbachtal 173, 45257 Essen |<br />
Chefredakteur: Dipl.-Ing. Christopher Weßelmann<br />
Redaktion: t +49 201 8128-300<br />
f +49 201 8128-302<br />
e pt-presse@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong><br />
Anzeigen<br />
und Vertrieb:<br />
Martin Huhn,<br />
Sabine Kuhlmann,<br />
Gregor Scharpey<br />
t +49 201 8128-212<br />
f +49 201 8128-302<br />
e ads@<strong>vgbe</strong>.<strong>energy</strong>
29 Nov - 1 Dec <strong>2022</strong><br />
Frankfurt, Germany<br />
Let’s build the <strong>energy</strong><br />
future together – leaving<br />
no one behind<br />
From source to generation, from<br />
grid to consumer, the boundaries<br />
<strong>of</strong> the sector are blurring <strong>and</strong><br />
this evolution is being shaped<br />
by established players, external<br />
disruptors, innovative start-ups<br />
<strong>and</strong> the increasingly engaged<br />
end-user.<br />
Enlit brings all <strong>of</strong> these people<br />
together to seize current<br />
opportunities, spotlight future<br />
ones, <strong>and</strong> inspire the next<br />
generation to be part <strong>of</strong> moving<br />
the <strong>energy</strong> transition <strong>for</strong>ward.<br />
Join us<br />
18.000 attendees<br />
1000 exhibitors<br />
500 speakers<br />
www.enlit-europe.com