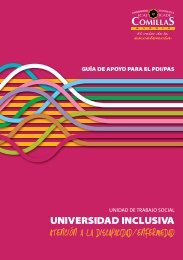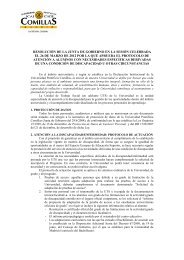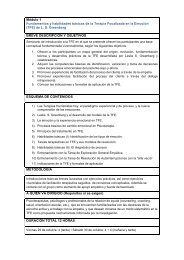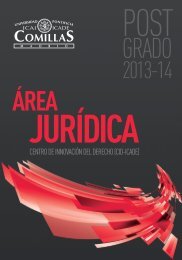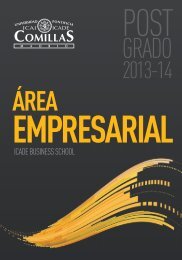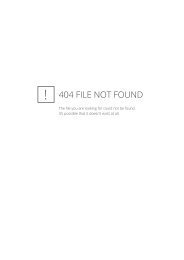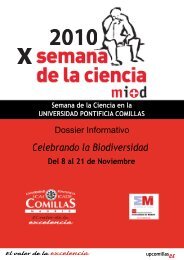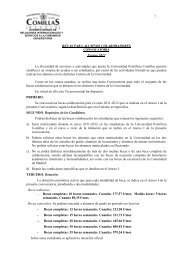1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
39 2002 Jahrgang 98 THEOLOGISCHE REVUE Nr. 1 40<br />
Sakrament bezogen wird (85±88): Es ist letztlich der Kirchenbegriff<br />
aus CA VII, mit dem K. argumentiert.<br />
Hier wäre ± gerade auch anhand von K.s diesbezüglichen Ausführungen<br />
zur Bestattung eines mutmaûlich reformierten Verstorbenen<br />
(93±95), die seine These stützen sollen ± zu fragen, ob diese Betonung<br />
des ¹die konfessionskirchliche Partikularität transzendierende(n)<br />
und (...) relativierende(n)ª Charakters des lutherischen Kirchenverständnisses<br />
(88), wie sie heute gerne in der ökumenischen<br />
Diskussion von lutherischer Seite ins Spiel gebracht wird, wirklich<br />
eine so weitreichende historische Bedeutung haben kann, wie K. unterstellt.<br />
Jedenfalls bedürfte die These eines Herauswachsens des Begriffs<br />
vom neuzeitlichen Christentum aus der lutherischen Konfessionskultur<br />
wohl einer kräftigeren Stützung durch umfassende vergleichende<br />
Studien. Dabei wäre neben den vielen binnentheologischen Problemen,<br />
die K.s Konzept an dieser Stelle aufwirft, v.a. auch zu fragen, ob<br />
nicht angesichts der geographischen Streuung der Konfessionen eine<br />
solche These die deutsche Nationalgeschichte in eine Mittelpunktstellung<br />
für die Entwicklung der Moderne rückte, die, will man ein<br />
Gesamtbild der Frühen Neuzeit entwerfen, kaum vertretbar ist.<br />
Unzweifelhaft ist mit einer solchen These also eine Lebensaufgabe<br />
angekündigt, deren anspruchsvolle Stoûrichtung schon jetzt deutlich<br />
ist. In einer Zeit, in der das Beharren der meisten evangelischen Kirchenhistoriker<br />
auf dem Umbruchcharakter der Reformation durch<br />
die allgemeinhistorische Diskussionslage in die Defensive gebracht<br />
worden ist, würde es wohl naheliegen, sich neu auf das von Ernst<br />
Troeltsch gezeichnete Bild von Christentumsgeschichte zu besinnen.<br />
K. aber geht gerade den anderen Weg: Noch einmal wird hier ein Gegenentwurf<br />
zu den ¹Soziallehrenª vorgelegt: Nicht die Reformierten,<br />
Täufer oder Spiritualisten, sondern die Lutheraner seien die Vorreiter<br />
der Moderne gewesen.<br />
Man kann ± und wird ± also über diese These streiten, aber eben<br />
das macht den Reiz des Buches aus: Hier wird einmal nicht nur gesammelt<br />
und gesichtet, sondern es wird theologisch und historisch<br />
etwas gewagt. Und eben darum wird die künftige Kirchengeschichtsforschung<br />
zur Frühen Neuzeit an diesem Buch nicht vorbei können.<br />
Jena Volker Leppin<br />
Kirche und Katholizismus seit 1945. Bd 1: Mittel-, West- und Nordeuropa, hg.<br />
v. Erwin G a t z . ± Paderborn: F. Schöningh 1998. 368 S., Ln DM 78,00 /<br />
e 39,88 ISBN: 3±506±74460±7<br />
In dem vom Kirchenhistoriker und Leiter des Römischen Instituts<br />
der Görres-Gesellschaft Erwin Gatz herausgegebenen ersten von vier<br />
Bden zur Kirche und dem Katholizismus der Nachkriegszeit in<br />
Europa und Nordamerika werden in einzelnen Länderbeiträgen die<br />
katholische Kirche als Institution und der Katholizismus als gesellschaftliche<br />
Kraft zwischen 1945 und den 1990er Jahren analysiert.<br />
Die Datendichte und der Faktenreichtum der Beiträge machen das<br />
Buch in erster Linie zu einem präzisen Nachschlagewerk, das Katholizismusforschern<br />
hauptsächlich zu komparativen Zwecken dienlich<br />
sein wird, wobei allerdings vergleichende Erkenntnisse noch aus den<br />
einzelnen Beiträgen zu extrahieren sind. Eine nach einer Typologie<br />
organisierte Gesamtstruktur ± etwa entsprechend der Mehrheitsbzw.<br />
Minderheitensituation des Katholizismus oder nach Ländern<br />
mit und solchen ohne einer katholischen Sondergesellschaft ± hätte<br />
diesen Zugriff eventuell erleichtern können.<br />
Den Wiederaufbau der unmittelbaren Nachkriegszeit thematisieren v.a. die<br />
längeren Beiträge zu jenen Ländern, in welchen der Zweite Weltkrieg für das<br />
gesellschaftliche Leben und die organisatorischen Strukturen des Katholizismus<br />
eine einschneidende Zäsur darstellte. G., der den mehr als hundertseitigen<br />
Beitrag zu Deutschland verfaûte (Josef Pilvouseks Ausführungen zur DDR integrierend),<br />
sieht in Deutschland am Ende des Zweiten Weltkrieges v.a. in den<br />
Pfarreien und Bistümern die ¹Träger der Kontinuitätª, von wo aus die Aktionen<br />
zur geistigen und organisatorischen Erneuerung des Katholizismus ausgingen.<br />
Gut zum Ausdruck kommt in G.s Beitrag die Bedeutung und Eingebundenheit<br />
der Kirche in den Prozeû der öffentlichen Meinungsbildung. In bezug auf den<br />
Schweizer Katholizismus analysiert der Luzerner Kirchenhistoriker Markus<br />
Ries die erste Nachkriegszeit gut als Ausdruck des gesteigerten Selbstbewuûtseins<br />
im Katholizismus. Er zeigt auf, wie in der Schweiz die Kontinuitäten zur<br />
Vorkriegszeit, welche die eigentliche Milieublüte gebracht hatte, im Unterschied<br />
zu den direkt vom Krieg betroffenen Ländern groû waren und die Struktur<br />
der katholischen Sondergesellschaft keinen Bruch erlebte, wenngleich sich<br />
dieselbe schon bald dem Ende zuneigte. ¾uûerst anregend ist Marcel Alberts<br />
Beitrag zu Frankreich, da er Institutionen- auf der einen, Kultur- und Intellektuellengeschichte<br />
auf der anderen Seite integriert und auch die Bedeutung<br />
katholischer Intellektueller wie Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier oder<br />
Jacques Maritain hervorhebt und kurz auf die katholische Wissenschaft, insbesondere<br />
die Religionssoziologie, eingeht. Georges Hellinghausen bringt die<br />
lange Verbundenheit von Religion und Nationalbewuûtsein in Luxemburg, die<br />
¹identitätsstiftende und kulturelle Bedeutungª des Katholizismus gut zum<br />
Ausdruck, ein Thema, das in der heutigen Nationalismusforschung auf erhöhtes<br />
Interesse stöût. Mit Ausnahme des Artikels zu Frankreich in den Beiträgen<br />
kaum angesprochen wird die m. E. wichtige Frage der Thematisierung bzw.<br />
Nicht-Thematisierung der eigenen Vergangenheit seitens der Katholiken, d. h.<br />
des Verhaltens von Kirche und Katholizismus gegenüber Antisemitismus und<br />
Nationalsozialismus.<br />
Auf den von G. herausgegebenen Bd zum internationalen Katholizismus<br />
bzw. der Kirche der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wird die<br />
internationale Forschung zu Katholizismus und Kirche der zweiten<br />
Hälfte des 20. Jh.s aufbauen können, wenn komparatistisch anhand<br />
einzelner Themenkomplexe vertieft weitergearbeitet wird. Dabei stellen<br />
etwa Säkularisierung und Pluralisierung, der Fundamentalismus,<br />
die nachkonziliäre Krisensituation, die Milieuerosion, neue religiöse<br />
Bewegungen oder ideengeschichtliche Fragestellungen (etwa bzgl.<br />
des katholischen Antikommunismus nach dem Krieg) auch theoretisch<br />
interessante Fragenkomplexe für eine international vergleichende<br />
Diskussion dar.<br />
Freiburg/Schweiz Franziska Metzger<br />
Theologiegeschichte / Neuzeit<br />
Eckerstorfer, Andreas: Kirche in der postmodernen Welt. Der Beitrag George<br />
Lindbecks zu einer neuen Verhältnisbestimmung. ± Innsbruck: Tyrolia<br />
2001. 403 S. (Salzburger Theologische Studien, 16), brosch. DM 61,50 /<br />
e 32,50 ISBN: 3±7022±2347±9<br />
Diese auf mehrjährigen Studien in den USA beruhende, unter der<br />
Betreuung von Johann Werner Mödlhammer in Salzburg entstandene<br />
Diss. bietet die erste umfassende Darstellung des Werks des evangelischen<br />
Yale-Theologen George Lindbeck, der als maûgeblicher Architekt<br />
der nicht nur in den USA vieldiskutierten, sog. postliberalen<br />
Theologie anzusehen ist. Eckerstorfer präsentiert Lindbecks postliberalen<br />
Ansatz als auch für die katholische Theologie attraktiven dritten<br />
Weg zwischen progressiv-liberaler Anpassung an den jeweiligen<br />
Zeitgeist und konservativ-prämoderner Ghettoisierung der Kirche. Im<br />
Mittelpunkt seiner Untersuchung steht L.s Versuch einer Neubestimmung<br />
des Verhältnisses von Kirche und Welt, der die Kirche sowohl<br />
vor ¹fundamentalistischen, weltverneinenden Verengungstendenzenª<br />
evangelikaler bzw. reaktionärer Theologie als auch vor ¹der Gefahr<br />
glaubensauflösender Weltlichkeitª liberaler Theologie bewahren<br />
soll (349).<br />
Eckerstorfers Studie geht von der Frage aus, ¹wie sich die Kirchen in der<br />
gegenwärtigen Umbruchszeit selbst bestimmen und angesichts unserer sich<br />
wandelnden Welt organisieren und darstellen sollenª (21) und möchte in diesem<br />
Zusammenhang L.s Beitrag für ein neues ¹Selbstverständnis der Kirche im<br />
21. Jh.ª skizzieren (15). Im ersten Teil gibt der Vf. einige sehr grobe und<br />
dadurch notwendig oberflächliche Kategorisierungen möglicher derartiger Verhältnisbestimmungen<br />
aus dem Umfeld L.s wieder und nimmt mit ihnen eine<br />
sehr schematisierende Ordnung der neueren protestantischen Theologieentwicklung<br />
vor (26±69). Dabei wird deutlich, daû sich L. und seine postliberalen<br />
Mitstreiter in der Tradition Karl Barths verorten lassen, insofern sie ± gewissermaûen<br />
als ¹rechte Barthianerª (62) bzw. als Vertreter einer ¹postmodernen Neoorthodoxieª<br />
(350) ± gegen die in ihren Augen wieder festzustellende Hegemonie<br />
liberal-revisionistischer Theologie und der mit ihr verbundenen Gefahr<br />
einer Auflösung des genuin christlichen Anliegens ins Feld ziehen.<br />
Den gründlichsten und besten Teil von Eckerstorfers Studie stellt die im<br />
zweiten Teil vorgenommene Darstellung von L.s eigener Verhältnisbestimmung<br />
von Kirche und Welt dar (70±236). Unter akribischer Berücksichtigung<br />
sämtlicher, z. T. nur schwer zugänglicher Veröffentlichungen L.s und aller<br />
wichtigen jeweils in diesem Zusammenhang weiterführenden Beiträge von<br />
Schülern und Mitstreitern L.s gliedert der Vf. die Untersuchung in drei Schaffensperioden.<br />
Der frühe, z.T. noch vom Liberalismus geprägte L. nahm das<br />
bereits in den 60er Jahren zu diagnostizierende Ende der konstantinischen<br />
¾ra der Kirche und ihre damit verbundene neue Diaspora-Situation zum Anlaû,<br />
ein neues Selbstverständnis der Kirchen einzufordern (77±113). Nur wenn<br />
die Kirche bereit sei, sich als ¹sectarian churchª (80) zu konstituieren, ¹in der<br />
gemeinschaftliche Glaubensinhalte, Wertvorstellungen und Praktiken ihre<br />
Identität bestimmenª (113), könne Kirche den gegenwärtigen Paradigmenund<br />
Epochenwechsel überstehen. Statt den Zeiten der Volkskirche nachzutrauern,<br />
sollten Christen sich angesichts einer nur noch sporadisch christlich geprägten<br />
Kultur wieder zu wirklich gläubigen Gruppen mit einer unverwechselbaren<br />
Identität zusammentun. In diesem Zusammmenhang seien in den Augen<br />
des frühen L. ¹Modernisierung und Anpassung an die modernen Bedingungen<br />
höchst notwendig und würden die Zeugniskraft der Kirche in der Welt signifikant<br />
stärkenª (99). Die ¾nderung dieser Haltung im Laufe der 70er Jahre stelle<br />
den entscheidenden Wendepunkt L.s auf seinem Weg von einer liberalen zu