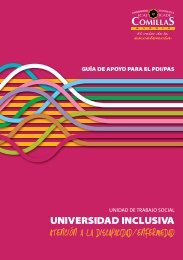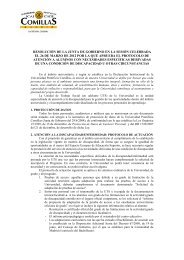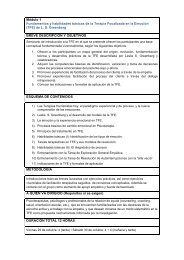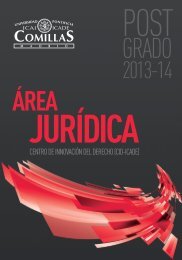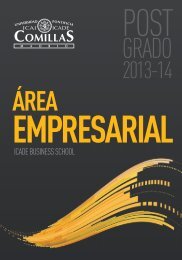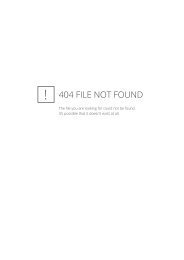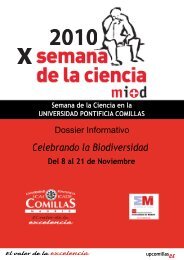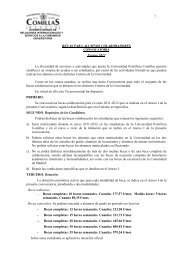1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
47 2002 Jahrgang 98 THEOLOGISCHE REVUE Nr. 1 48<br />
und die Begegnung der göttlichen Freiheit mit der menschlichen Freiheit im<br />
sakramentalen Akt treten in den Vordergrund. Immer wieder wird die Eucharistie<br />
zur Erläuterung herangezogen. Nach der Theodramatik wendet sich der Vf.<br />
der ¾sthetik zu. In der ¾sthetik von ¹Herrlichkeitª erscheint das Sakrament als<br />
geschichtliche Form der vergegenwärtigenden Gestalt des Christusereignisses.<br />
Aus dem dritten Bd von ¹Herrlichkeit III/l: Im Raum der Metaphysikª werden<br />
Balthasars Reflexionen über den Mythos und die griechische Tragödie für die<br />
Sakramentenlehre fruchtbar gemacht. Der letzte Teil gilt dem Sakrament in der<br />
¹Theologikª. Der Vf. verknüpft Balthasars Transzendentalienlehre in ¹Wahrheit<br />
der Weltª (= Theologik I) mit dem Abriû der Sakramentenlehre in ¹Der<br />
Geist der Wahrheitª (= Theologik III). Das Ergebnis der Untersuchung wird<br />
mit einer paradox formulierten Umschreibung festgehalten: ¹Das Sakrament<br />
ist eine praktische Form der Objektivierung des nicht-objektivierbaren Mysteriums<br />
der göttlichen Freiheit, die in ihrem [trinitarischen] Innern die Partizipation<br />
der [menschlichen] Freiheit einschlieût, die vom Wesen des Sakramentes<br />
als Akt gefordert istª (285).<br />
Methodisch gesehen ist die Arbeit eine werkimmanente Interpretation<br />
der Theologie Balthasars unter dem Blickwinkel der Kategorie<br />
des Sakramentes, dessen Stellenwert klar erfaût wird. Der Tendenz<br />
des Vf.s, die inzwischen auch bei anderen Interpreten zu beobachten<br />
ist, innerhalb der Trilogie der ¹Theodramatikª den Primat zuzuerkennen,<br />
stehe ich reserviert gegenüber. Nach meinem Urteil ist für die<br />
Trilogie das Axiom der ¹circumincessioª der Transzendentalien<br />
grundlegend und deshalb entspricht die Gleichursprünglichkeit des<br />
Sich-Zeigens (¾sthetik), des Sich-Gebens (Dramatik) und des Sich-<br />
Sagens (Logik) am ehesten der Intention Balthasars. Die öfters verteilten<br />
Seitenhiebe auf die alte ¹manualisticaª halte ich für überflüssig.<br />
Was an solchen Handbüchern verstaubt oder abgestorbenes Holz ist,<br />
bedarf m. E. keiner Seitenhiebe mehr. Dem Fortschritt der theologischen<br />
Wissenschaft dienen sie nur, wenn Roû und Reiter direkt genannt<br />
werden. Schlieûlich gestehe ich, daû ich der auf den allerletzten<br />
S. (288±293) geäuûerten Kritik einer christologischen Absorption<br />
der endlichen Freiheit bei Balthasar nicht folgen konnte. M. E. spielt<br />
in diese Thematik das Problem des Verhältnisses von transzendentalem,<br />
d. h. subjekt-betontem Ansatz (Karl Rahner) und objektgerichtetem<br />
Ansatz (Balthasar) der Theologie hinein, zweifellos ein schwieriges<br />
Problem, das am Schluû einer Untersuchung zwar gestreift, aber<br />
keiner Lösung mehr zugeführt werden kann.<br />
Der Priester Nicola Reali hat mit seiner Lizentiatsarbeit eine souveräne<br />
Kenntnis des theologischen êuvres Balthasars bewiesen. Das<br />
hohe Reflexionsniveau der Arbeit läût für das Doktorat, das er, wie<br />
auf dem Buchumschlag vermerkt wird, an der Lateranuniversität in<br />
Rom anstrebt oder inzwischen schon erlangt hat, die schönsten<br />
Früchte erwarten. Im übrigen ist das Werk ein Zeichen dafür, wie intensiv<br />
in Italien gerade von jungen Theologen die Theologie Balthasars<br />
studiert wird. An der eingangs genannten Fak. in Mailand sind<br />
bereits mehrere Diss.en über den Basler Theologen geschrieben worden.<br />
Bonstetten Manfred Lochbrunner<br />
Liturgiewissenschaft<br />
Beten: Sprache des Glaubens ± Seele des Gottesdienstes. Fundamentaltheologische<br />
und liturgiewissenschaftliche Aspekte, hg. v. Ulrich Wi l l e r s . ±<br />
Tübingen: A. Francke 2000. 507 S., 7 Abb. (Pietas liturgica, 15), geb. DM<br />
120,00 / e 61,34 ISBN: 3±7720±3031±9<br />
¹Wenn wir nicht aufhören dürfen zu beten, so darf man vielleicht<br />
auch nicht aufhören, vom Gebet zu sprechen. So gut und schlecht<br />
davon zu sprechen, wie es einem gegeben ist.ª Mit diesem Wort K.<br />
Rahners beginnt der Eichstätter Fundamentaltheologe U. Willers das<br />
Vorwort des von ihm hg. Sbdes. Das Buch geht auf eine gleichnamige<br />
interdisziplinäre Studientagung vom 28.±31. Mai 1996 in Nothgottes<br />
bei Rüdesheim zurück. Diese Tagung wurde vom Mainzer Liturgiewissenschaftler<br />
H. Becker und dem Hg. des Bdes in Verbindung mit<br />
der Interdisziplinären Vereinigung zur wissenschaftlichen Erforschung<br />
und Erschlieûung des christlichen Gottesdienstes ¹Kultur ±<br />
Liturgie ± Spiritualität e. V.ª durchgeführt. Die Herausforderung,<br />
vom Gebet zu sprechen, sei auf der Tagung in ¹einer heute selten<br />
gewordenen Einheit von theoretisch-theologischer Reflexion und<br />
konkret-praktischer Erfahrung, von intellektueller Anstrengung und<br />
konkreter liturgischer Praxis wie lebendiger Einübung des Glaubensª<br />
aufgenommen worden. Der Bd enthält die Vorträge, die auf der<br />
Tagung gehalten wurden, sowie weitere Beiträge, und versteht sich<br />
deshalb als Dokumentation und Fortsetzung des in Nothgottes begonnenen<br />
Gespräches (vgl. Vorwort).<br />
Bevor er einen knappen Überblick über die einzelnen Beiträge<br />
gibt, präzisiert der Hg. in seiner Einleitung, um welchen Begriff des<br />
Betens es in allen nachfolgenden Überlegungen gehen soll: um ¹den<br />
Kern des Betens jenseits aller spezifischen Formen und Inhalteª, um<br />
¹das, was Beten zum Beten machtª (2). Diesen Kern lokalisiert W. im<br />
sog. inneren Beten, das Teresa von Avila (1515±1582) wieder stark<br />
gemacht habe, und in ¹Titel, Intention und Inhalten des vorliegenden<br />
Bdes atmet dieser Geist der heiligen Teresaª (ebd.). Das ¹Tiefenereignis<br />
des Betensª wird von Teresa wie etwa auch neuzeitlich von<br />
S. Kierkegaard ¹als Freundschaftsbegegnung mit Gottª verstanden,<br />
¹die von Gottes Seite her natürlicherweise viel intensiver als von seiten<br />
des Menschen ist, so daû wir Menschen immer weit hinter dem<br />
Angebot Gottes zurückbleiben. Solches Beten erweist sich als Begegnung,<br />
in der wir uns einlassen auf die Liebe, in der wir geborgen<br />
sindª (ebd.). Primär sieht W. Gebet in diesem Sinne davon geprägt,<br />
daû sich der Betende der Dynamik der Liebe Gottes überläût, wobei<br />
¸Gott die transzendente Wirklichkeit bezeichnet, die das Christentum<br />
verkündet, und auf deren Gegenwart der Betende sein Sehnen<br />
richtet: Ohne ¹viele Worte und Gesten (Riten) zu machen und ohne<br />
dabei viel zu denken, werden wir uns selbst dabei neu geschenkt: Der<br />
Glanz unseres Daseins, oftmals verdeckt und unserer Selbsterfahrung<br />
entzogen, erscheint gleichsam wieder in den Augen des Freundes,<br />
der uns liebend anblickt und nichts anderes von uns erwartet, als<br />
daû wir einfach ¸da sind.ª (3) Mit dem berühmten Wort Kierkegaards<br />
formuliert: ¹¸Er (der Betende) hatte gemeint, beten sei reden; er lernte,<br />
beten ist nicht bloû schweigen, sondern ist hören. Und so ist es<br />
denn auch; beten heiût nicht, sich selber reden hören, sondern heiût<br />
dahin kommen, daû man schweigt, und im Schweigen verharren, und<br />
harren, bis der Betende Gott hört. ª (hier: 3; aus: Die Lilie auf dem<br />
Felde und der Vogel unter dem Himmel. Drei fromme Reden, Kopenhagen<br />
1849 = Kleine Schriften 1848/49 (GW; 21.±23. Abteilung), Köln<br />
1960, 37±38). Solches Hören ist zu bestimmen als ¹Wahr-Nehmen<br />
dessen, was empirisch nicht gehört werden kann und dem wahrhaft<br />
betend-hörenden Menschen doch wirklicher wird als jeder Laut<br />
sonstª. Die ¹Gebetsrealitätª, so W., ¹das, was im Beten jenseits und<br />
innerhalb der rein psychischen Realität sich ereignet, ist nicht demonstrierbar,<br />
sondern eine Zeugnisrealität ganz eigener Qualitätª<br />
(ebd.).<br />
Die einzelnen Beiträge sind Beispiele einer theologischen Reflexion<br />
auf solches Beten im Rahmen der genuin christlichen Tradition<br />
und vier Abteilungen bzw. Gängen zugeordnet. Der Hg. beschreibt<br />
eine Abteilung als ¹je in sich relative Einheitª, wobei alle Abteilungen<br />
¹durchaus auf die Beiträge der jeweils anderen verwiesen sindª<br />
(11). Der erste Gang ist überschrieben mit ¹Dimensionen einer Gebetstheologieª,<br />
der zweite mit ¹Systematisch-praktische Spannungsfelder:<br />
Probleme und Zugängeª; in einer dritten Abteilung werden<br />
¹Alte Traditionen ± Neue Dimensionen ± Offene Erfahrungsräumeª<br />
durchschritten, in einer vierten unter der Überschrift ¹Betend auf<br />
dem Weg? Situationen und Stationenª diverse Beispiele des Betens<br />
bzw. des Nachdenkens über das Gebet z. B. in bildender Kunst und<br />
(philosophischer) Literatur beleuchtet und konkrete Modelle liturgischen<br />
Gebets vorgestellt.<br />
Der zitierten Charakterisierung des Hg.s, gemäû der die einzelnen<br />
Gänge lediglich eine ¹relative Einheitª (Herv. Rez.) bilden, kann der<br />
Rez. nur lebhaft zustimmen. Hierin liegt auch ± darauf muû schon an<br />
dieser Stelle hingewiesen werden ± die zentrale konzeptionelle<br />
Schwachstelle des Bdes: Das leitende Motiv bei der Zusammenstellung<br />
der Texte ist, wie der Hg. in einer Fuûnote betont, keineswegs<br />
gewesen, ¹die Fluchtlinien der Wissenschaftenª (sprich: Liturgiewissenschaft<br />
und Fundamentaltheologie) nachzuzeichnen; vielmehr<br />
geht es um ¹das aus der Mitte der Fundamentaltheologie und der Liturgiewissenschaft<br />
wie aus der Begegnung hervorgehende spirituell<br />
stimulierte Fragen nach Wahrheit und Wirklichkeit des Betens, (postmoderner<br />
formuliert:) nach Optionen und Realitäten betender Menschen,<br />
speziell der Christen in der Gegenwartª (10, mit Fn. 22). Gewiû<br />
kann die nachträgliche Zusammenstellung in schriftlicher Form per<br />
se nicht einholen, was vielleicht in der akademieartigen Atmosphäre<br />
einer gemeinsamen Tagung gelungen sein mag: die Liturgiefähigkeit<br />
des modernen Menschen und speziell die Gebetsfähigkeit dadurch<br />
zu steigern, daû man (sich) in das Mysterium des Betens wieder neu<br />
einführt (/einführen läût) ± im gemeinsamen praktischen Vollzug wie<br />
im diskursiven Austausch. Aber gerade aufgrund dieser prinzipiellen<br />
Schwierigkeit wäre eine strengere thematische Zuordnung der einzelnen<br />
Beiträge wichtig gewesen. Jetzt liegt letzten Endes ein Buch vor,<br />
das sich als eine Pluralität von Beiträgen präsentiert, die isoliert rezipiert<br />
werden können, und damit tatsächlich ein Beispiel für eine