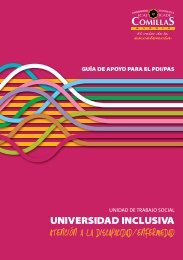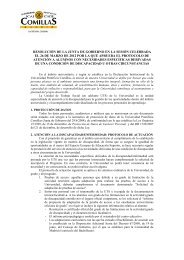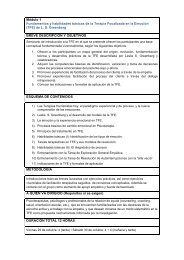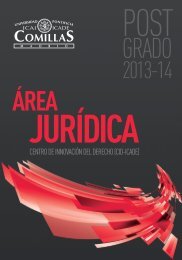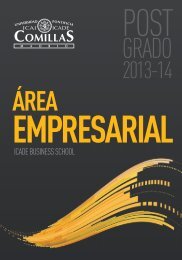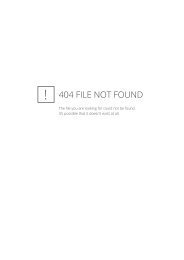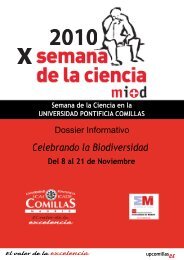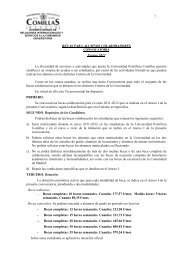1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
15 2002 Jahrgang 98 THEOLOGISCHE REVUE Nr. 1 16<br />
In der Tradition christlichen Betens, insbesondere bei der Feier<br />
der Eucharistie, gilt die Hinwendung von Priester und Gemeinde<br />
nach Osten als wesentlicher Ausdruck der eschatologischen Grundorientierung,<br />
wie sie in der Alten Kirche maûgeblich war. Kirchengebäude<br />
und Position der Altäre waren dementsprechend organisiert.<br />
1 Zwar ist die Ausrichtung der Kirchen besonders in Rom aufgrund<br />
topographischer und städtebaulicher Gegebenheiten höchst<br />
unterschiedlich. 2 Dennoch war auch hier die Orientierung beim Gebet<br />
lange Zeit obligatorisch. 3 Die in Rom und anderswo verbreitete<br />
Eingangsostung mit der daraus resultierenden Blickrichtung des Priesters<br />
zum Kirchenschiff hin hat als rubrizistische Beschreibung<br />
schon im Missale Romanum von 1570 und programmatisch innerhalb<br />
der Liturgischen Bewegung des 20. Jh.s zu der Redewendung<br />
von der Zelebration versus populum geführt, die im Zuge der Liturgiereform<br />
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zur Regel wurde,<br />
wenngleich sie stets umstritten blieb. Die jeweilige Wertung erklärt<br />
sich aus der unterschiedlichen Interpretation der Quellen aufgrund<br />
gegensätzlicher Interessen. So sichtete Otto Nuûbaum in seiner Monographie<br />
¹Der Standort des Liturgen am christlichen Altar vor dem<br />
Jahre 1000ª aus dem Jahr 1965 das schriftliche und archäologische<br />
Quellenmaterial vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden liturgischen<br />
Erneuerung der katholischen Liturgie. 4 Nuûbaum sah in der<br />
Geschichte des Kirchenbaus und der Feierpraxis einen hinreichenden<br />
Grund für die Einführung der Zelebration versus populum.<br />
Auch nach der in den folgenden Jahren ausgetragenen Kontroverse<br />
über seine These resümiert er im Jahr 1971: ¹In Übereinstimmung<br />
mit den nachkonziliaren Dokumenten der Liturgiereform müssen daher<br />
die Gleichrichtung von Liturge und Gemeinde am Altar und die<br />
Zelebration versus populum als die beiden legitimen Formen der Eucharistiefeier<br />
gelten.ª 5 Dabei ging es ihm primär darum, die Angemessenheit<br />
der ¹römischenª Zelebrationsrichtung für das pastorale<br />
Anliegen der ¹tätigen Teilnahmeª zu konstatieren. 6 Tatsächlich ist<br />
festzuhalten, ¹daû auch die einheitliche Ausrichtung aller Gottesdienstteilnehmer<br />
in der Alten Kirche weder Gesetz noch Selbstzweck<br />
bildete. Wo ein Kirchengebäude so angelegt war, daû bei der Eucharistiefeier<br />
entweder allein die Priester oder allein die Gläubigen den<br />
Osten und den Altar gleichzeitig im Blick haben konnten, traten Himmelsrichtung<br />
und gleichförmige Ausrichtung zurück hinter dem gemeinsamen<br />
Blick auf den Altar.ª 7<br />
Für einige Zeit trat die Frage nach der angemessenen Zelebrationsrichtung<br />
in der katholisch-theologischen Diskussion in den Hintergrund.<br />
8 Die Zelebration versus populum galt weithin als eine Gegebenheit<br />
und brachte auch evangelische Theologen in Zugzwang,<br />
zumal das Anliegen des stärkeren Gemeinschaftscharakters, mit dem<br />
die Veränderung begründet wurde, dem evangelischen Gottesdienst-<br />
1<br />
Vgl. die ausführlichere Darlegung: Gerhards, A.: ¹¸Blickt nach Osten! Die<br />
Ausrichtung von Priester und Gemeinde bei der Eucharistie ± eine kritische<br />
Reflexion nachkonziliarer Liturgiereform vor dem Hintergrund der<br />
Geschichte des Kirchenbausª, in: Liturgia et Unitas. Melanges Bruno Bürki,<br />
hg. v. M. K l ö c k e n e r / A. Jo i n - L a m b e r t , Fribourg 2001, 197±217.<br />
2<br />
Vgl. de Blaauw, S.: Met het oog op het licht. Een vergeten principe in de<br />
orientatie van het vroegchristelijk kerkgebouw, Nijmegen 2000.<br />
3<br />
Vgl. Lang, U. M.: ¹Conversi ad Dominum. Zu Gebetsostung, Stellung des<br />
Liturgen am Altar und Kirchenbauª, in: FKTh 16, 2000, 81±123, hier 107.<br />
4<br />
Nuûbaum, O.:Der Standort des Liturgen am christlichen Altar vor dem<br />
Jahre 1000. Eine archäologische und liturgiegeschichtliche Untersuchung,<br />
2 Bde = Theophaneia 18, Bonn 1965. Vgl. die Rezension von J. A. Jungmann,<br />
in: ZKTh 88, 1966, 445±450; auûerdem Metzger, M. : La place des liturges à<br />
l'autel, in: RevSR 45, 1971, 113±145.<br />
5<br />
Nuûbaum, O.: ¹Die Zelebration versus populum und der Opfercharakter der<br />
Messeª, in: ZKTh 93, 1971, 148±167; wieder abgedruckt in: ders.,<br />
Geschichte und Reform des Gottesdienstes. Liturgiewissenschaftliche<br />
Untersuchungen, hg. v. A. G e r h a r d s / H. B r a k m a n n , Paderborn 1996,<br />
50±70, hier 70.<br />
6<br />
Louis Bouyer hatte diesen Zusammenhang drastisch zurückgewiesen:<br />
Mensch und Ritus, Mainz 1964, 213.<br />
7<br />
Brakmann, H.: ¹Muster bewegter Liturgie in kirchlicher Traditionª, in: Volk<br />
Gottes auf dem Weg, hg. v. W. M e u r e r, Mainz 1989, 25±51, hier 39, unter<br />
Bezug auf Nuûbaum, ¹Die Zelebration versus populumª (Anm. 5).<br />
8<br />
Sie wurde von der Theologie eher als ein Sonderproblem traditionalistischer<br />
Kreise betrachtet. Allerdings wurde auch aus der Sicht der Denkmalpflege<br />
auf unangemessene Raumkonzepte hingewiesen. Vgl. dazu: Odenthal,<br />
A.: ¹Denkmalpflege als Postulat der Liturgiereformª, in: LJ 42, 1992,<br />
249±259.<br />
Versus orientem ± versus populum<br />
Zum gegenwärtigen Diskussionsstand einer alten Streitfrage<br />
von Albert G e r h a r d s<br />
verständnis entgegenkam. 9 Nicht zuletzt muûte das von den Gegnern<br />
des versus populum vorgebrachte Junktim von Opfercharakter und<br />
Orientierung und seine oft polemische Entgegensetzung zum Mahlcharakter<br />
und zur Hinwendung des Priesters zur Gemeinde aus evangelischer<br />
Sicht nachdenklich stimmen. Dennoch wurde in den meisten<br />
evangelischen Kirchen die gewohnte Ausrichtung beibehalten.<br />
Ende der siebziger Jahre meldete Kardinal Ratzinger sich in der<br />
Frage der Zelebrationsrichtung zu Wort. 10 Er wies darauf hin, daû<br />
die Hinwendung zum Altar (also das Stehen des Priesters mit dem<br />
Rücken zum Volk) ¹Ausdruck einer kosmisch-parusialen Sicht der<br />
eucharistischen Feierª 11 gewesen sei und plädierte für eine ausdrückliche<br />
Hinwendung zum Kreuz auf dem Altar: ¹Das Altarkreuz<br />
ist als der bis in unsere Tage verbliebene Rest der Ostung zu bezeichnen.ª<br />
12<br />
Die in Freiburg/Schweiz erstellte und 1989 erschienene Diss. von<br />
Erwin Keller ¹Eucharistie und Parusieª ordnet ± wie zuvor schon J.<br />
Ratzinger ± die Frage der Ausrichtung in die kosmisch-eschatologische<br />
Dimension der Eucharistie ein. Für Keller ist die Gebetsostung<br />
¹sichtbare äuûere Gebärde zum Ausdruck der inneren Ausrichtung<br />
von Gebet und Gottesdienst auf den kommenden Herrn hinª. Diese<br />
hat sich auch ausgewirkt auf den Kirchenbau, ¹angefangen bei der<br />
Ausrichtung nach Osten bis hin zur Ausstattung und Deutung der<br />
Kirche als Bild des himmlischen Jerusalem, an welchem die Kirche<br />
in ihrer Liturgie in Zeichen und Riten und im Sakrament schon Anteil<br />
bekommt und welches sie selber ist, bis Christus kommt und die<br />
Seinen in vollendeter Weise ins himmlische Jerusalem aufnimmtª. 13<br />
In den neunziger Jahren wurde die Frage der Zelebrationsrichtung<br />
von verschiedenen Seiten wieder aufgegriffen. Zum einen fanden interdisziplinäre<br />
Kongresse über Gestalt und Funktion altkirchlicher<br />
und mittelalterlicher Kirchenräume statt, deren Ergebnisse in mehreren<br />
Sammelbänden vorliegen. 14 Darin kommt eine differenzierte Betrachtungsweise<br />
zur Wirkung, die die apriorischen Positionen für<br />
oder wider versus populum relativiert. Dies gilt auch für das Axiom,<br />
die Zelebration sei immer in Richtung Osten erfolgt. Überraschenderweise<br />
ist dies für den vermeintlichen Prototyp der Zelebration versus<br />
populum, für Sankt Peter in Rom, nachweisbar. In dem Band ¹Kölnische<br />
Liturgie und ihre Geschichteª befaût sich der Kunsthistoriker<br />
Werner Jacobsen mit ¹Organisationsformen des Sanctuariums im spätantiken<br />
und mittelalterlichen Kirchenbauª, u. a. mit der Peterskirche.<br />
Die jetzige Anordnung des Hauptaltars über der Confessio in St.<br />
Peter greift die Anlage Gregors des Groûen (um 600) auf, welcher die<br />
Situation durch die Schaffung der Ringkrypta und der Confessio<br />
grundlegend verändert hatte. Der Vorgängeraltar des konstantinischen<br />
Baus stand am vorkonstantinischen Tropaion, so daû der<br />
Priester nur von vorne am Altar, also gegen Westen gerichtet und mit<br />
dem Rücken zum Volk, zelebriert haben konnte. 15 Erst Gregor d. Gr.<br />
¹korrigiertª die Altarsituation nach dem Vorbild der Lateranbasilika.<br />
Insgesamt stellt Jacobsen eine ¹erstaunlich groûe Vielfalt baulicher<br />
Formenª fest. Fazit: ¹Unsere Suche nach der alten, wahren, richtigen<br />
9<br />
Vgl. Walther, V.: ¹Celebratio versus populum.ª Evangelisches Echo und Fragen<br />
an den evangelischen Gottesdienst, in: HlD 53, 1999, 137±142.<br />
10<br />
Ratzinger, J. Kardinal: ¹Kleine Korrekturª, in: IKaZ 8, 1979, 381f; überarbeitete<br />
Fassung unter dem Titel: ¹Anmerkung zur Frage der Zelebrationsrichtungª,<br />
in: ders., Das Fest des Glaubens. Versuche zur Theologie des Gottesdienstes,<br />
Einsiedeln 1981, 121±126.<br />
11<br />
Ratzinger, Zelebrationsrichtung (vorige Anm.) 122.<br />
12<br />
Ebd. 123.<br />
13<br />
Keller, E.: Eucharistie und Parusie. Liturgie- und theologiegeschichtliche<br />
Untersuchungen zur eschatologischen Dimension der Eucharistie anhand<br />
ausgewählter Zeugnisse aus frühchristlicher und patristischer Zeit, Freiburg/Schweiz<br />
1989, 147.<br />
14<br />
Vgl. Heiliger Raum. Architektur, Kunst, und Liturgie in mittelalterlichen<br />
Kathedralen und Stiftskirchen = LQF 82, hg. v. F. K o h l s c h e i n / P. W ü n -<br />
s c h e , Münster 1998; Kölnische Liturgie und ihre Geschichte. Studien zur<br />
interdisziplinären Erforschung des Gottesdienstes im Erzbistum Köln =<br />
LQF 87, hg. v. A. G e r h a r d s / A. O d e n t h a l , Münster 2000; Bock, N./de<br />
Blaauw, S. / Frommel,C.L./Kessler,H.:Kunst und Liturgie im Mittelalter.<br />
Akten des internationalen Kongresses der Bibliotheca Hertziana und des<br />
Nederlands Instituut te Rome. Rom, 28.±30. September 1997 = RJ33, Beiheft,<br />
München 1999/2000.<br />
15<br />
Jacobsen, W.: ¹Organisationsformen des Sanctuariums im spätantiken und<br />
mittelalterlichen Kirchenbauª, in: Gerhards/Odenthal, Kölnische Liturgie<br />
(vorige Anm.) 67±97, hier 70f.