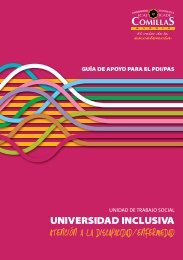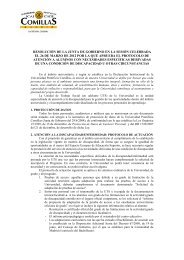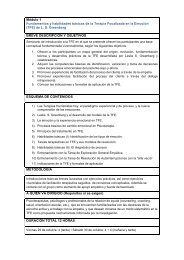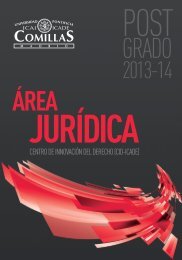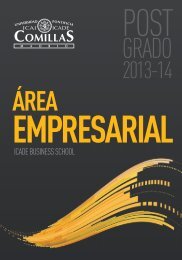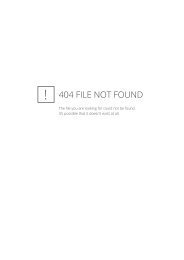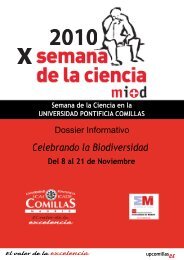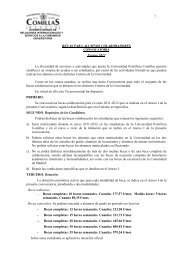1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
43 2002 Jahrgang 98 THEOLOGISCHE REVUE Nr. 1 44<br />
Kritische Hinweise:<br />
1. H. hätte sich Probleme in der Darstellung spannungsreicher<br />
Begriffe und ihnen entsprechender, einen Vollzug symbolisierender<br />
¸Oberbegriffe wie ¹Gnadeª, ¹Theonomieª oder ¹Offenbarungª erspart,<br />
wenn diese, einer intensionalen philosophischen Begriffslogik<br />
entsprechend, durch Unterscheidung von (extensional und intensional<br />
klar beschreibbaren und unterscheidbaren) ¸Begriffen und<br />
¸Grenzbegriffen zur Sprache gebracht worden wären. So finden sich<br />
eher bildhafte Formulierungen wie ¹konstruktives Zielª (106) oder<br />
¹flieûende Prädizierungenª (129f).<br />
2. Es fehlt vielleicht im Blick auf das durch H. selbst dargelegte<br />
Defizit ein Versuch, Tillichs Denken im Hinblick auf seine heutige<br />
¸Anwendbarkeit als triftig zu erweisen.<br />
Emsdetten Linus Hauser<br />
Overbeck, Franz-Josef: Der gottbezogene Mensch. Eine systematische Untersuchung<br />
zur Bestimmung des Menschen und zur ¹Selbstverwirklichungª<br />
Gottes in der Anthropologie und Trinitätstheologie Wolfhart Pannenbergs.<br />
± Münster: Aschendorff 2000. 457 S. (Münsterische Beiträge zur Theologie,<br />
59) kt DM 112,00 ISBN: 3±402±03964±8<br />
Die als systematische Theologie zu konzipierende Dogmatik hat<br />
ihren Stoff nach W. Pannenberg in allen Teilen als Entfaltung des<br />
christlichen Gottesgedankens vorzutragen. Gleichwohl könne sie<br />
nicht unmittelbar bei der Wirklichkeit Gottes einsetzen, weil diese<br />
zunächst nur in menschlicher Weise gegeben sei, nämlich in menschlichen<br />
Vorstellungen, menschlichen Worten und menschlichen<br />
Gedanken. Erst im Fortgang der Dogmatik lasse sich der durch das<br />
religiöse Verhältnis vermittelte anthropologische Zugang in die Gotteslehre<br />
aufheben und als Implikat der trinitarischen Selbstverwirklichung<br />
Gottes in seiner Offenbarung erweisen. Der theanthropologischen<br />
Lehre von Jesus Christus und der Lehre von der Dreieinigkeit<br />
Gottes kommt dabei die entscheidende Begründungsfunktion zu; für<br />
beide ist nach Pannenberg der Gedanke eines eschatologischen<br />
Selbsterweises Gottes am Ende der Geschichte bestimmend.<br />
Mit der gegebenen Problemskizze ist nicht nur die strukturelle Verfassung<br />
der in drei Bden erschienenen ¹Systematischen Theologieª als der Summe des<br />
Pannenbergschen Werkes umschrieben, sondern zugleich der Rahmen abgesteckt<br />
für die umfangreiche Untersuchung von Overbeck, die im Wintersemester<br />
1999/2000 von der Kath.-Theol. Fak. der Westfälischen Wilhelms-Univ.<br />
Münster als Diss. angenommen wurde. Systematische Hauptabsicht der Studie<br />
ist es, anhand der Explikation der Gottbezogenheit des Menschen das Verhältnis<br />
von Gotteswirklichkeit und geschichtlicher Menschenwelt einer Klärung<br />
zuzuführen. In einem ersten Kap. (19±102) wird eine an wesentlichen Themen<br />
und Leitfragen Pannenbergs orientierte Darstellung der Koordinaten seiner<br />
Denkform gegeben, wie sie sich in der Promotionsarbeit über die Prädestinationslehre<br />
des Duns Scotus bereits abzeichnet, um über das Konzept von Offenbarung<br />
als Geschichte, die hermeneutischen und wissenschaftstheoretischen,<br />
anthropologischen und christologischen Studien bis hin zur ¹Systematischen<br />
Theologieª immer detailliertere und elaboriertere Gestalt anzunehmen. Sodann<br />
analysiert der Vf. materialreich und in epischer Breite die (religions)philosophische<br />
(103±240) und trinitätstheologische (241±322) Explikation der<br />
Gottbezogenheit des Menschen in Pannenbergs Werk. ¹Beide Angängeª, so<br />
wird gesagt, ¹haben dasselbe Ziel: den gottbezogenen Menschen in seiner Identität<br />
zu bestimmen.ª (240)<br />
Kontrovers wird es im vierten und letzten Kap., welches unter der Überschrift<br />
¹Die Verwirklichung der Bestimmung des Menschen als ¸Selbstverwirklichung<br />
Gottes ª die Geschichte der Realisierung der Gottbezogenheit des Menschen<br />
bedenkt (323±439). Die Zielperspektive der Erörterungen besteht nach<br />
Maûgabe des Vf.s ¹in einer abstandnehmenden Problematisierung und diagnostischen<br />
Bewährung der im Vorherigen erarbeiteten Strukturelemente der<br />
Denkform Pannenbergs angesichts der kritikwürdigen Aporien und ihrer möglichen<br />
Alternativen. Geschehen soll dies auf dem Hintergrund einer transzendentalphilosophischen<br />
Freiheitsanalyse, die geeignet erscheint, das Menschsein<br />
des Menschen in seiner Gottbezogenheit so zu erschlieûen, daû in diesem<br />
Geschehen sowohl der durch Freiheit bestimmte Mensch, als auch der freie,<br />
sich dem Menschen selbst offenbarende Gott ansichtig wird.ª (323) Das<br />
Schluûkapitel übernimmt, mit anderen Worten gesagt, ¹die Aufgabe einer kritischen<br />
Inspektion des Ansatzes Pannenbergs im Gegenlicht der transzendentalphilosophisch<br />
vermittelten Offenbarungstheologie Th. Pröppersª (17), dessen<br />
Anregungen und aufmerksam-kritischem Interesse sich Konzeption und<br />
Durchführung der Studie nach Ausweis ihres Vorwortes (vgl. 8) wesentlich verdanken.<br />
Das Ergebnis des abschlieûenden kritisch-konstruktiven Vergleichs<br />
zwischen Pannenberg und Pröpper ist damit gewissermaûen<br />
schon antizipiert. Eine transzendentale Theorie des Selbstbewuûtseins<br />
und der Freiheit, wie der Vf. sie bei seinem Lehrer findet, sei<br />
einerseits in der Lage, den Ansatz Pannenbergs zu integrieren, andererseits<br />
die Aporien von dessen Systemkonzept zu vermeiden. Argumentationsaporien<br />
von Pannenberg zeigen sich nach dem Urteil des<br />
Vf.s sowohl unter anthropologischen als auch unter offenbarungsund<br />
trinitätstheologischen Aspekten. In erster Hinsicht werden v.a.<br />
hamartiologische Gründe geltend gemacht. Im Gegensatz zur Hamartiologie<br />
Pannenbergs, die zwischen Disposition zur Sünde und dem<br />
Faktum der Sünde nur unzureichend zu unterscheiden und infolgedessen<br />
die Frage nicht befriedigend zu beantworten vermöge, wo Gott<br />
im Menschen ansetzt, wenn er dessen freie Zustimmung zur Partnerschaft<br />
will, achtet transzendentales Freiheitsdenken den bezeichneten<br />
Unterschied und stimmt damit ¹einer Erkenntnisgrenze zu, die<br />
sich mit der Faktizität der Sünde bescheidet, den Menschen aber in<br />
seiner grundsätzlichen Fähigkeit zur Freiheit so bestimmt, daû Gott<br />
diesen Menschen zum freien, ihn anerkennenden Partner erwählen<br />
kann, und nicht ± wegen der Naturalität der Sünde ± im Menschen<br />
keinen Anknüpfungspunkt zu finden vermag, an dem dieser, die freie<br />
Zustimmung des Menschen voraussetzend, ansetzen könnteª (405f).<br />
Während eine transzendentalphilosophisch vermittelte Offenbarungstheologie<br />
das Verhältnis von Gott und Mensch im Sinne der<br />
biblischen Überlieferung als Bundesverhältnis zu bestimmen vermöge,<br />
sei Pannenbergs Denken dazu allenfalls bedingt in der Lage.<br />
In der Sache handelt es sich also um eine Neuauflage der Debatte,<br />
wie sie 1990 zwischen Thomas Pröpper und Wolfhart Pannenberg in<br />
der Theologischen Quartalschrift geführt wurde (vgl. Th. Pröpper,<br />
¹Das Faktum der Sünde und die Konstitution menschlicher Identität.<br />
Ein Beitrag zur kritischen Aneignung der Anthropologie Wolfhart<br />
Pannenbergsª, in: ThQ 170 [1990], 267±289; W. Pannenberg, ¹Sünde,<br />
Freiheit, Identität. Eine Antwort an Thomas Pröpperª, in: a.a.O.,<br />
289±298). Wie bei Diss.en die Regel, sekundiert O. seinem Doktorvater.<br />
Entscheidend neue Gesichtspunkte werden nicht erkennbar.<br />
Dem Interessierten sei daher empfohlen, sich an die Originale zu halten<br />
und dabei v.a. zwei Problemaspekte zu reflektieren, nämlich den<br />
speziellen Aspekt von Sünde und Wahlfreiheit und denjenigen des<br />
anthropologischen Verhältnisses von Freiheit und Identität im allgemeinen.<br />
Der sachliche Zusammenhang beider Aspekte ist durch<br />
die These Pröppers vorgegeben, ¹daû das in Pannenbergs Sündenlehre<br />
vermiûte unbedingte Moment menschlicher Freiheit auch sonst<br />
nicht in Anschlag gebracht wirdª (a.a.O., 280).<br />
Pannenbergs Auseinandersetzung mit Pröppers Option für eine<br />
transzendentale Freiheitslehre entfaltet sich ihrerseits unter dem<br />
benannten Doppelaspekt. Dabei ist in beiden Hinsichten der für das<br />
Gesamtsystem zentrale Gesichtspunkt entscheidend, daû ¹der Spielraum<br />
der Wahlfreiheit immer schon eingebettet ist in ein ihn übersteigendes<br />
Lebensganzesª (a.a.O., 295). Hamartiologisch bringt Pannenberg<br />
diesen Gesichtspunkt u. a. dadurch zur Geltung, daû er das peccatum<br />
originale im Kontext der Naturbedingungen des menschlichen<br />
Daseins deutet und zwar nicht lediglich als Disposition zur Sünde,<br />
sondern als sündiges Faktum v.a. individuellen Handelns. Zwar<br />
habe die Sünde ihre Macht nicht ohne den Menschen und seine tätige<br />
Zustimmung, aber sie habe sie ebensowenig erst von ihm und in der<br />
Folge eines arbiträren Freiheitsentschlusses. Dem entspricht in universalanthropologischer<br />
Hinsicht die Annahme, daû die Ichinstanz<br />
das Ergebnis eines Prozesses der Ichwerdung und nicht eine unableitbare<br />
Vorgegebenheit sei. ¹Der ganze Prozeû der Identitätsbildung, in<br />
welchem die Ichinstanz sich herausbildet und festigt, istª, wie Pannenberg<br />
ausführt, ¹ein Prozeû der Klärung und Artikulation der ursprünglich<br />
im Gefühl begründeten Selbstvertrautheit. Es handelt<br />
sich daher nicht um Akte der Wahl einer Identität durch ein schon<br />
zugrundeliegendes Ich, sondern um einen Prozeû der Selbsterfahrung.<br />
Dabei kommt im Maûe der Ausbildung der Ichinstanz<br />
sicherlich auch ein Moment wählender Stellungnahme mit hinzu.<br />
Diese ist aber gerade nicht, etwa im Sinne einer Selbstwahl,<br />
ursprünglich konstitutiv für die Identität des Individuums.ª (a.a.O.,<br />
296) Mit diesen und analogen Erwägungen soll nach Pannenbergs Urteil<br />
nicht der transzendentale Ansatz als solcher, wohl aber die nicht<br />
selten mit ihm assoziierte Prämisse verabschiedet werden, das transzendentale<br />
Ich sei ein wie auch immer geartetes identisches Realsubjekt.<br />
Das Zentrum der Kontroverse zwischen Pröpper und Pannenberg<br />
ist sonach durch das Problem markiert, ob bzw. in welcher Weise Reflexionen<br />
über die Bedingung der Möglichkeit menschlicher Freiheit<br />
mit der Gröûe eines Transzendental-Ich berechtigtermaûen rechnen<br />
dürfen. An der Antwort auf diese Frage wird sich nachgerade auch<br />
das Urteil über den Sachgehalt der kritischen Teile von O.s. Untersuchung<br />
zur Gottbezogenheit des Menschen in Pannenbergs Theologie<br />
zu entscheiden haben.<br />
München Gunther Wenz