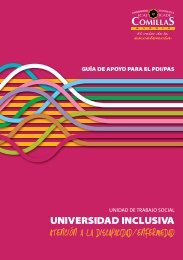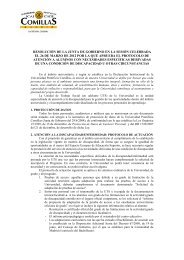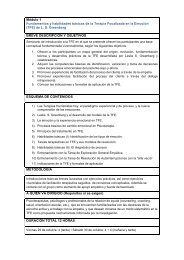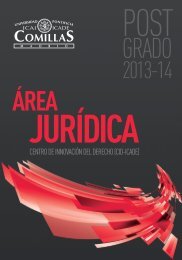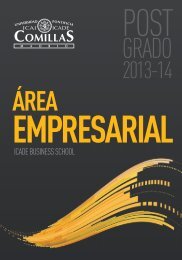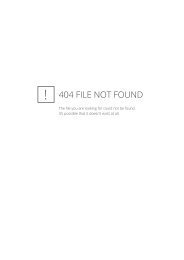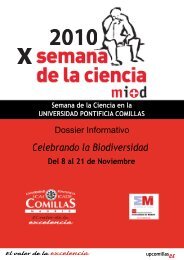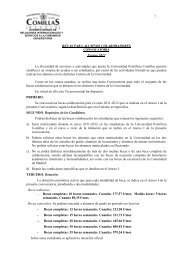1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
63 2002 Jahrgang 98 THEOLOGISCHE REVUE Nr. 1 64<br />
des Empirismus ist. Wenn man es als Jh. der Methode bezeichnet, dann überdeckt<br />
eine solche Auskunft die tiefen Meinungsverschiedenheiten, die es in<br />
puncto Methode in diesem Jh. gab. Schlieûlich ist es auch problematisch, das<br />
17. Jh. ausschlieûlich unter dem Titel ¸Aufstieg der Wissenschaft oder ¸Kritik<br />
der überlieferten Religion abzuhandeln. Statt solcher Absolutsetzungen eines<br />
Grundzugs hält K. es für sinnvoller, von dominierenden Strömungen und charakteristischen<br />
Zügen der Philosophie des 17. Jh.s zu sprechen. Zu diesen rechnet<br />
er auch ¹die Diskreditierung der Autoritätª (12) sowie ¹ein starkes Interesse<br />
an Problemen der Metaphysik bzw. an solchen der heute so genannten theoretischen<br />
Philosophieª (13), das Fragen der praktischen Philosophie in den Hintergrund<br />
treten läût. K. äuûert sich in seiner Einleitung auch zum Problem der<br />
zeitlichen Abgrenzung. Selbst wenn er zugibt, daû die runden Jahreszahlen<br />
nicht einfach mit inhaltlichen Zäsuren der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte<br />
koinzidieren, so sieht er doch die Möglichkeit einer solchen<br />
Abgrenzung, denn es sei durchaus ¹sinnvoll, das 17. Jh. sowohl von der Renaissance<br />
als auch von dem nachfolgenden Jh. der Aufklärung abzugrenzen und als<br />
Epoche der frühneuzeitlichen Philosophie zu fassenª, in der sich nachdrücklich<br />
¹das moderne (Selbst-) Bewuûtsein (...) artikuliertª (14f) und auf<br />
den verschiedensten Betätigungsfeldern der Vernunft schlieûlich auch durchsetzt.<br />
Die einzelnen Beiträge des vorliegenden Sbdes sind so konzipiert, daû sie<br />
anhand von repräsentativen Philosophengestalten des 17. Jh.s zu verdeutlichen<br />
suchen, ¹auf welchen Gebieten, mit welchen argumentativen Mitteln<br />
und mit welcher Zielsetzungª (15) eine solche Artikulation geschieht. Eine eingehende<br />
Würdigung der einzelnen Beiträge ist in dem vorliegenden Rahmen<br />
nicht möglich. Der Rez. muû sich auf Schlaglichter beschränken.<br />
W. Krohn zufolge kann man Bacon nicht lesen, ohne an drängende Probleme<br />
der gegenwärtigen Gesellschaft zu denken. Denn bereits bei Bacon gehe<br />
es ¹um Fortschrittsorientierung und Traditionsverlust (...) um die Verzahnung<br />
von Wissenschaft und Industrie (. ..) um die fragwürdige Hoffnung, die materielle<br />
Not des Menschen durch Einsatz immer neuer Techniken zu bewältigenª<br />
sowie ¹um die Frage, wieweit der Mensch berechtigt ist, Herrschaft über die<br />
Natur auszuübenª (23). W. Kersting sieht die Bedeutung von Hobbes darin,<br />
daû er der politischen Philosophie der Neuzeit die Sprache gegeben hat. Hobbes'<br />
bleibende Modernität liegt für ihn ¹in der rechtfertigungstheoretischen Erfindung<br />
des Gesellschaftsvertragsª, denn in diesem ¹individualistische(n), egalitaristische(n)<br />
und prozeduralistische(n) Begründungsmodellª (66) komme bis<br />
heute das Selbstverständnis der politischen Moderne genuin zum Ausdruck. D.<br />
Perler rückt Descartes erkenntnistheoretische Leistung in den Mittelpunkt.<br />
Descartes, so schreibt er, ¹leitete die Überwindung des aristotelisch-scholastischen<br />
Erkenntnismodells zugunsten eines repräsentationalistischen Modells<br />
ein. Erkenntnis wurde nicht mehr als das Angleichen des Erkennenden an<br />
den Erkenntnisgegenstand aufgefaût, sondern als das Bilden und Erfassen von<br />
repräsentierenden Ideen.ª (88) R. Puster geht in seinem Beitrag von einer Dialektik<br />
in Lockes Denken aus, die darin bestand, daû er den Empirismus, um ihn<br />
auf einer tieferen Ebene seiner metaphysischen Fundierung vor dem Abgleiten<br />
in einen Idealismus zu retten, auf der Oberflächenebene seiner Durchführung<br />
mitunter verletzenª (111) muûte, und glaubt, daû sich nicht wenige der oft kritisierten<br />
Inkonsistenzen des ¸Essay auf diese Weise erklären lassen. Für W.<br />
Schmidt-Biggemann ist Pufendorf ¹ein wesentlicher Vertreter der politischen<br />
Philosophie an der Schwelle von Barock und Aufklärungª, dessen Verdienste<br />
¹in der Theorie und Theoriegeschichte des Staatsrechts, in naturrechtlich<br />
grundgelegter Ethik und Politik sowie in der Lehre von der religiösen Toleranz<br />
im Staateª (115) liegen. Im übrigen ist er der Meinung, es gebe ¹vor Kant keinen<br />
deutschen Politik- und Rechtstheoretiker, der einen vergleichbaren Einfluû auf<br />
die Entwicklung der Staatsphilosophie in Europa gehabt hätte wie Pufendorfª<br />
(ebd.). R. Schnepf sieht die Bedeutung Spinozas darin, daû dieser ¹gegen eine<br />
Theorie, die, vom menschlichen Selbstbewuûtsein ausgehend, den Menschen<br />
als Substanz deutet und ihm Willensfreiheit zusprichtª, eine Metaphysik stellt,<br />
¹die den endlichen Menschen konsequent aus dem ihm vorgegebenen Unbedingten<br />
deutetª (154). Dieser Ausgang von einer Theorie des Unbedingten ermögliche<br />
es ihm, perspektivische Verzerrungen zu vermeiden, zu denen der<br />
cartesische Ausgang vom endlichen Ich verführe. Für das Freiheitsproblem ergibt<br />
sich im Kontext des spinozistischen Ethikkonzepts: ¹Willensfreiheit<br />
kommt weder Gott noch dem einzelnen Menschen zuª (154). Allerdings steht<br />
und fällt Spinozas Ethik damit, daû sich der formale ontologische Rahmen, der<br />
mit den ersten Lehrsätzen der Ethik entworfen wird und Grund aller weiteren<br />
Argumentationen Spinozas bildet, als ¹der einzig vernünftige erweistª (155). R.<br />
Specht möchte dem Leser den Zauber der heute weithin vergessenen Philosophie<br />
Malebranches nahebringen, den noch der späte Kant für ¹eine der exemplarischen<br />
Gestalten der Philosophiegeschichteª (174) gehalten hatte, und<br />
skizziert anhand von Malebranches Werk ¹Recherche de la VØritت die ¹Umwandlung<br />
der Philosophie des Cartesianismus in eine Philosophie der Alleintätigkeit<br />
Gottesª (157). M. Carrier sieht die folgende Gemeinsamkeit ¹zwischen<br />
dem Newton der mathematischen Deduktion der Planetenbewegungen und der<br />
experimentellen Aufdeckung der Erscheinungen des Lichts einerseits und dem<br />
Newton der hermetischen, alchemistischen und bibelchronologischen Studien<br />
andererseitsª (196): Es ging Newton stets ¹um klare Erkenntnis, nicht um<br />
Schwärmerei und Obskurantismusª (ebd.). Auf sämtlichen Gebieten zeigte er<br />
¹die gleiche nüchterne, auf Vernunft und Erfahrung setzende Haltung, die das<br />
Bestreben erkennen läût, zunächst verwirrende und dunkle Befunde mit Sorgfalt<br />
und Sachverstand in eine durchsichtige Sprache zu übertragen und einsichtig<br />
werden zu lassenª (ebd.). Im Hintergrund steht dabei die Vorstellung,<br />
¹daû sich Gott sowohl in seinem (...) Wort als auch in seinem Werk äuûert<br />
und daû eine Erkenntnis des göttlichen Bauplans nur durch Verfolgen einer<br />
doppelsträhnigen, auf Textauslegung und Erfahrung setzenden Strategie gelin-<br />
gen kannª (ebd.). Für Th. Leinkauf hatte Leibniz schon früh drei zentrale metaphysische<br />
Intuitionen, die er in seinem Werk systematisch entfaltete. Als erstes<br />
nennt er hier die Individuations-Intuition, die besagt, daû alles Wirkliche ausschlieûlich<br />
als ein individuiertes, durchgängig bestimmtes und unverwechselbares<br />
Sein zu denken ist. Da aber alles, was ist, ¹nicht nur individuelle Substanzª<br />
ist, ¹sondern zugleich Teil eines Ganzenª und ¹die Welt als Inbegriff<br />
alles Seienden die Totalität solcher vollständig bestimmter (...) individueller<br />
Existenzen istª (ebd.), kann man zweitens von einer enzyklopädisch-kombinatorischen<br />
Einheitsintuition sprechen, die Leibniz der Individualitätsintuition<br />
zur Seite stellt. Schlieûlich ist ¹dieses aus individuellen Substanzen bestehende<br />
Ganze (. ..) ein in mikro- und makroskopischer Hinsicht unendliches<br />
und zugleich ins Unendliche bestimmtes Seinskontinuumª (199). Diese ebenfalls<br />
frühe Einsicht des Leibniz bezeichnet Leinkauf als Unendlichkeitsintuition.<br />
Im Fortgang der philosophischen Reflexion erschloû sich Leibniz Leinkauf<br />
zufolge ¹die tiefere Dimension und der unaufhebbare Zusammenhang der Intuitionen<br />
durch eine beharrliche Korrektur des gängigen Verständnisses von<br />
Substanzª (200). S. Neumeister betont, daû Bayle in seinem Kampf für die religiöse<br />
und politische Toleranz von einer Glaubenszuversicht getragen blieb und<br />
nicht etwa dem Skeptizismus oder dem Pessimismus anheimfiel. M. Albrecht<br />
schlieûlich verbindet die Würdigung von Thomasius als Begründer der deutschen<br />
Aufklärung mit einer kurzen Darstellung seines philosophischen Systems.<br />
Im ganzen vermittelt der Sbd durchaus einen Eindruck von der<br />
Bandbreite der Philosophie des 17. Jh.s, die sich eben nicht allein<br />
auf Vf. wie Hobbes und Locke oder Descartes, Spinoza und Leibniz<br />
beschränkt, die in diesem Zusammenhang meist genannt werden.<br />
Die einzelnen Beiträge erfüllen durchweg ihren Zweck und bieten<br />
auf engem Raum eine solide Einführung in das Denken zentraler Gestalten<br />
der Philosophie des 17. Jh.s, wenngleich in dem einen oder<br />
anderen Fall sicher auch andere Akzentuierungen denkbar gewesen<br />
wären. So betont etwa Perler in seinem Beitrag v.a. die Bedeutung der<br />
cartesischen Philosophie für die Entwicklung der neuzeitlichen Erkenntnistheorie,<br />
man hätte aber genausogut, wie K. es in seiner Einleitung<br />
auch tut, darauf abheben können, daû Descartes ¹v.a. einer<br />
der groûen Metaphysikerª (17) ist. Der Vermutung Krohns, daû die<br />
moderne Gesellschaft vielleicht tiefer in den Baconismus verstrickt<br />
sei als in jede andere Philosophie, kann man mit Henrich entgegenhalten,<br />
daû die moderne Grunderfahrung vielschichtig ist und unter<br />
vielerlei Aspekten betrachtet werden kann. Henrich wendet sich daher<br />
gegen eine Überbewertung des Baconismus, ohne dessen Bedeutung<br />
freilich leugnen zu wollen. Der Feststellung des Hg.s, daû man<br />
Schwierigkeiten habe, das Proprium der neuzeitlichen Philosophie<br />
exakt zu bestimmen, wird man gewiû zustimmen können. Auch sein<br />
eigener Versuch, das Proprium speziell der Philosophie des 17. Jh.s<br />
zu bestimmen, zeugt von dieser Schwierigkeit. Denn der Hinweis<br />
auf verschiedene dominierende Strömungen und charakteristische<br />
Züge der Philosophie des 17. Jh.s versucht, gewissermaûen aus der<br />
Not, daû sich für diesen Zeitraum eine griffige Formel nicht finden<br />
läût, eine Tugend zu machen. Selbst wenn man für die Herausbildung<br />
des modernen Bewuûtseins noch andere Theorietraditionen bemüht<br />
als die Philosophie des 17. Jh.s, wird man K. doch zweifellos darin<br />
zustimmen können, daû die eigentlich neuzeitliche Philosophie im<br />
17. Jh. beginnt.<br />
Frankfurt/Main Hans-Ludwig Ollig<br />
Philosophische Disziplinen. Ein Handbuch, hg. v. Annemarie P i e p e r. Leipzig:<br />
Reclam 1998. 479 S. (Reclam-Bibliothek, 1643), kt DM 25,00 / e 12,78<br />
ISBN: 3±379±01643±8<br />
Dieses Handbuch behandelt 20 philosophische Disziplinen und<br />
beinhaltet neben einem Vorwort ein Personen- und Sachregister sowie<br />
Angaben zu den Vf.n. Da die Beiträge zu den einzelnen Disziplinen<br />
¹einfach nurª alphabetisch angeordnet sind, folgt die Grundkonzeption<br />
dieses Werkes offensichtlich dem Programm ¹Philosophie als<br />
Enzyklopädieª: Enzyklopädie verstanden als ein Projekt, in dem ¹unter<br />
den Bedingungen des Pluralismus mögliche Welten koexistieren<br />
und scheinbar chaotische Vielheit in eine Einheit gebracht wird, die<br />
nicht von dem Einen beherrscht istª (Sandkühler). Diese Schluûfolgerung<br />
hinsichtlich des Ansatzes dieses Werkes drängt sich bei aller<br />
Vorsicht (ex nihilo nihil sequitur) auf, auch wenn oder gerade weil<br />
keine tiefergehenderen Reflexionen geboten werden über das jeweils<br />
Philosophische all dieser Fächer gegenüber der einzelwissenschaftlichen<br />
Forschung oder über ein derzeit nicht mehr zu etablierendes<br />
Philosophie-System im alten Sinne, wie es der ¹Neu-Thomismusª<br />
vielleicht als letztes im 20. Jh. war.<br />
Die einzig erkennbare Zuordnung der einzelnen Disziplinen, von der die<br />
Hg.in im Vorwort spricht, ist eine eher äuûerliche Dreiteilung: Erstens gibt es<br />
alte Disziplinen wie die Ethik (Pieper, Basel), die Logik (Stuhlmann-Laeisz,