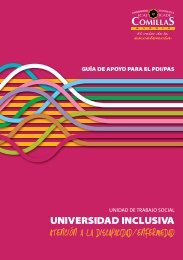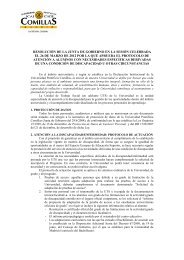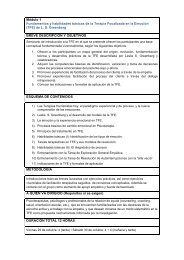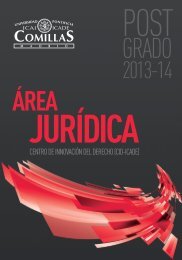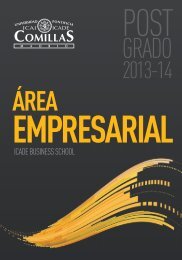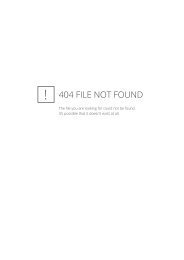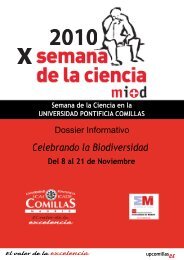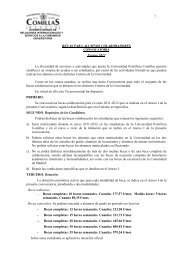1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
67 2002 Jahrgang 98 THEOLOGISCHE REVUE Nr. 1 68<br />
chen (21±25). Diese Perspektive wird aber zunächst nicht weiterverfolgt, sondern<br />
einer Reflexion zum Metaphysikbegriff nachgeordnet, die auf die kontrastive<br />
Darstellung der Metaphysikkritik Derridas zielt. Präzise wird hier die<br />
Kritik am binär-hierarchischen Denken der traditionellen griechischen<br />
Metaphysik sowie die damit verbundene Unterordnung der Absenz unter die<br />
Präsenz, der Materialität der Sprache unter den Logos und folglich der Schrift<br />
unter das gesprochene Wort vorgestellt (30ff). Anschlieûend wird intensiv auf<br />
die Spezifika der Dekonstruktion eingegangen: die Spur (43ff), die diffØrance<br />
(50ff), die Auseinandersetzung Derridas mit Husserls Phänomenologie des<br />
inneren Zeitbewuûtseins (55ff) sowie das umstrittene Verhältnis der Dekonstruktion<br />
zur Hermeneutik (59ff). Diese Ausführungen geben Einblick in die<br />
zentralen Motivationen und Motive der Dekonstruktion, wie Derrida sie u. a.<br />
in Anlehnung an Heidegger und Husserl entwickelt hat.<br />
Im zweiten Hauptteil der Arbeit erörtert V. das Verhältnis Derridas zum Judentum.<br />
Hierbei geht er im besonderen auf Selbstaussagen Derridas (75±86),<br />
auf die Auseinandersetzung Derridas mit den ebenfalls jüdischen Vf.n E. LØvinas,<br />
P. Celan und E. Jab›s (87±118) sowie auf das Schriftverständnis der Rabbiner<br />
und des Talmud (119±148) ein. Im Mittelpunkt dieses Groûkapitels steht<br />
zum einen die Erfahrung von Alterität, Ausgrenzung und Beschneidung als<br />
Kontrapunkt zum griechischen Einheits-, Ursprungs- und Präsenzdenken und<br />
dem damit verbundenen Subjektbegriff, wobei insbesondere die ethischen<br />
Implikationen der Differenz, Alterität und Spur hervorgehoben werden. Zum<br />
anderen werden der spezifisch jüdische Schriftbegriff und die daraus resultierende<br />
Interpretationsweise erläutert, um deren deutliche Nähe zum Konzept<br />
der diffØrance aufzuzeigen.<br />
Schlieûlich korreliert V. im dritten und zentralen Hauptteil die Dekonstruktion<br />
mit der griechisch-christlichen Tradition Negativer Theologie. Nach einer<br />
Abgrenzung der Negativen Theologie von Formen der Mystik (152ff) und im<br />
Anschluû an einen Exkurs zum Bilderverbot im Ersten Testament (155ff) sowie<br />
bei Kant (159ff) und Adorno (161ff) wird die Negative Theologie Dionysios<br />
Areopagitas und Meister Eckharts in ihren Grundzügen vorgestellt (166±176).<br />
Vor dem Hintergrund dieser Form Negativer Theologie und in bezug auf zwei<br />
ausführliche Stellungnahmen Derridas zur Negativen Theologie, nämlich Wie<br />
nicht sprechen. Verneinungen (117±191) und Auûer dem Namen (Post-Scriptum)<br />
(191±209), versucht V. die Dekonstruktion als Form negativer Theologie<br />
zu präsentieren (177ff) bzw. die Negative Theologie als Dekonstruktion affirmativer<br />
Theologie auszuweisen (183). Er betont, daû es nur eine bestimmte Tradition<br />
der Negativen Theologie sei, welche dem Derridaschen Denken nahestehe<br />
und einen neuen Modus des Sprechens (über Gott) etabliere (178f/213), nämlich<br />
die jenseits einer binären Logik und letzten Affirmation befindliche Negative<br />
Theologie Dionysios Areopagitas und Meister Eckhards.<br />
Hinsichtlich der Frage nach Übereinstimmungen zwischen Dekonstruktion<br />
und Negativer Theologie ergeben sich v.a. bei der Lektüre von Wie nicht sprechen<br />
allerdings diverse Verkürzungen, die nicht unproblematisch sind. Daû in<br />
der Tat die Dynamik der Negation und endlosen Verschiebung in ihrem gleichzeitigen<br />
Mangel und Überschuû eine Transzendenzerfahrung markiert, welche<br />
theologische Implikationen zuläût, gesteht Derrida durchaus zu. Diese Tatsache<br />
wird aber weniger zum Anlaû genommen, die möglichen Affinitäten zu<br />
bestätigen und so einer Parallelisierung von Negativer Theologie und Dekonstruktion<br />
Vorschub zu leisten. Im Gegenteil wird eben diese Möglichkeit als<br />
das eigentliche Problem aufgefaût, das es zu unterminieren gilt, um eindeutige<br />
Kategorisierungen zu verunmöglichen. Verfehlt V. nicht die eigentliche Intention<br />
Derridas, indem er die luzide Textstrategie von Wie nicht sprechen auûer<br />
acht läût? Derridas Aufsatz handelt nämlich nicht (nur) vom Problem des ¹Wie<br />
nicht sprechenª (von Gott) der Negativen Theologie und Dekonstruktion, sondern<br />
auch davon, wie er (Derrida) es vermeiden könne, von jenen unterstellten<br />
Parallelen zwischen der griechisch-christlichen Tradition der via negativa und<br />
seinem eigenen Denken, also der Dekonstruktion und einer jüdisch-arabischen<br />
Tradition, zu sprechen, um so vielmehr eine subversive ¹Leereª oder ¹Wüsteª<br />
in den griechisch-christlichen Diskurs einzuführen. Derrida nimmt mit Wie<br />
nicht sprechen keineswegs (explizit) Stellung, sondern er dekonstruiert und<br />
verschiebt diese Stellungnahme permanent, um nicht zu sprechen. Sein Aufsatz<br />
generiert sich nicht primär als Kommentar zur Negativen Theologie, sondern<br />
± wie in anderen Texten Derridas auch ± als Dekonstruktion in praxi, welche<br />
die dekonstruktiven Strategien thematisiert und zugleich durchführt.<br />
Aus dieser Auslassung resultiert ein Defizit: V. geht nicht auf das<br />
zentrale Motiv der Khora ein. So kommt er zu dem problematischen<br />
Schluû, Derrida habe einen ¹radikalisierten Begriff Negativer Theologieª<br />
entwickelt (213), während die eigentlichen Differenzierungen<br />
und Entwürfe Derridas hinsichtlich eines Denkens der diffØrance,<br />
Spur und Khora unberücksichtigt bleiben.<br />
Insgesamt kann V.s Buch aufgrund der breiten Einführung in die<br />
Biographie und das Werk Derridas jedoch als eine erhellende und<br />
viele Perspektiven aufzeigende Arbeit gewertet werden, die v.a. einen<br />
wichtigen theologischen Annäherungsversuch darstellt, um die<br />
noch immer bestehenden Vorbehalte der Theologie gegenüber Derrida<br />
und dem Poststrukturalismus insgesamt abzubauen und die Basis<br />
für eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung zu schaffen.<br />
Gleichwohl scheint sich V. nicht radikal auf Derridas Denken eingelassen<br />
zu haben, da er dessen Intention einem ± bei aller Vorläufigkeit<br />
± Streben nach Identität und Kontinuität zuordnet (50) und Derrridas<br />
Thesen dahingehend würdigt, den ¹Wert von Nichtverstehen positiv<br />
zu denken, nämlich als Wahrung des Geheimnissesª (63), statt die<br />
zuvor geschilderten Aspekte und Konsequenzen der Dekonstruktion<br />
in ihrer Radikalität wahrzunehmen. So erscheint die Dekonstruktion<br />
ausschlieûlich als Kritik an einem totalisierenden und vereinnahmenden<br />
Denken, ohne die am Motiv der diffØrance illustrierte konstitutive<br />
Unmöglichkeit eindeutigen und endgültigen Verstehens (theologisch)<br />
zu bedenken, welche die gesamte Theoriebildung und philosophische<br />
Rede affiziert.<br />
Vor dem Hintergrund einer ¹radikalisierten Grundsituationª für<br />
eine Theologie der späten Moderne (15), die insbesondere durch<br />
Auschwitz markiert ist, bleibt zudem das theologische Grundkonzept<br />
V.s schwierig, da er verkennt, daû die Negativität der Gottesrede und<br />
die Gotteskrise unserer Zeit nicht (nur) in einem unzulänglichen oder<br />
aber totalisierenden Zugriff auf Gott begründet sind (20/244), sondern<br />
in der Erfahrung einer radikalen Gottverlassenheit, die vielleicht<br />
nur noch ein ¹Gott vermissenª zu artikulieren vermag. Daû<br />
angesichts dieser Gotteskrise und mit Derrida gefragt werden soll,<br />
wie man die Abwesenheit Gottes positiv(!) denken könne, ist nicht<br />
einsichtig; noch weniger aber jene angebliche, die christologische<br />
Perspektive abschlieûend erneut verstärkende ¹Notwendigkeit, Gott,<br />
wenn personal, dann trinitarisch zu denkenª (255).<br />
Die im einzelnen sehr interessante Untersuchung zu Derrida zielt<br />
letztlich immer wieder darauf ab, das logozentrismuskritische Denken<br />
Derridas wie auch die mit ihm in Verbindung zu bringende jüdische<br />
Tradition (Erfahrung des Bruchs und der Andersheit, spezifische Gottesrede,<br />
Thora- und Textverständnis, Zimzum) in einen spezifisch<br />
christlichen Rahmen einzubinden, statt sich gerade der Differenzen<br />
bewuût zu werden und diese als Anfragen an die Theologie zu formulieren.<br />
Auch ist an dieser Stelle zu bedenken, daû V. nicht explizit<br />
unterscheidet zwischen Bilderverbot und Negativer Theologie. Vom<br />
biblischen Bilderverbot ausgehend wäre ihm die dezidiert geschichtliche<br />
Dimension erkenntnistheoretischen Fragens sicher deutlicher<br />
geworden. Der christozentrische Einschlag und die Suche nach Gemeinsamkeiten<br />
drohen somit das wichtige Anliegen der Vermittlung<br />
zwischen Theologie und Dekonstruktion sowie christlichem und jüdischem<br />
Denken zu relativieren. Die Arbeit oszilliert letztlich unentschieden<br />
zwischen dekonstruktiver Nichtidentität und christlichtheologischem<br />
Sicherungsbedürfnis, statt sich der Negativität ± auch<br />
jenseits sprachlicher und totalitätskritischer Aspekte ± theologisch zu<br />
stellen. Gleichwohl schmälert die hier geäuûerte Kritik nicht die Leistung<br />
V.s, sondern sie will im Gegenteil und im besten Sinne des Wortes<br />
auf die Kritikwürdigkeit dieser Diss. aufmerksam machen.<br />
Münster Michaela Willeke / Jürgen Manemann<br />
Sozialwissenschaften<br />
Zukunftsfähigkeit der Theologie. Anstöûe aus der Soziologie Franz-Xaver<br />
Kaufmanns, hg. v. Karl G a b r i e l / Johannes H o r s t m a n n / Norbert M e t t e .<br />
± Paderborn: Bonifatius 1999. 170 S. (Einblicke, 2) kt DM 29,80 / e 15,23<br />
ISBN: 3±89710±056±8<br />
Dieser Bd (Nr. 2 einer neuen Reihe der Katholischen Akademie<br />
Schwerte, ¹Einblickeª) dokumentiert ein Symposion, das die Akademie<br />
Schwerte anläûlich des 65. Geburtstags von Franz-Xaver Kaufmann<br />
veranstaltet hat. Eingeleitet wird das Buch von dem profiliertesten<br />
Schüler Kaufmanns, dem Münsteraner Sozialethiker und Religionssoziologen<br />
Karl Gabriel, der das Thema des Bdes angeht, indem er<br />
¹Anstöûe aus der Soziologie Franz-Xaver Kaufmannsª ins Spiel<br />
bringt, jenes Religionssoziologen, der (da die katholische Kirche<br />
kein eigenes pastoralsoziologisches Institut besitzt) für Deutschland<br />
gewissermaûen zur Institution geworden ist. Besonders interessant<br />
ist in diesem Beitrag auch eine Auflistung der Themenbereiche, die<br />
nach Hermann J. Pottmeyer die theologische Dimension der Arbeit<br />
Kaufmanns charakterisieren, eine Auflistung, der Gabriel zustimmend<br />
folgt. Am Ende dieses Abschnitts bietet der Vf. eine Übersicht<br />
über die Beiträge des Buches und charakterisiert diese kurz: Karl Lehmann,<br />
¹Religion als Privatsache und als öffentliche Angelegenheit.<br />
Die Kirche in pluralistischer Gesellschaftª, Trutz Rendtorff, ¹Theologie<br />
als Kulturwissenschaftª, Peter Hünermann, ¹Theologie als<br />
Kulturwissenschaft. Inkulturation im Horizont der Christentumsgeschichte<br />
zwischen Anerkennung und Transformationª, Johannes<br />
A. von der Ven, ¹Theorie der Kirche. Zwischen sozialwissenschaftlicher<br />
Empirie und theologischer Ekklesiologieª, Hermann J. Pottmeyer,<br />
¹Theorie der Kirche zwischen sozialwissenschaftlicher Empirie<br />
und theologischer Ekklesiologie. Fundamentaltheologische Überlegungen<br />
und Anfragenª, Hermann Steinkamp, ¹Belastbare Solidari-