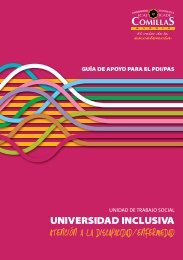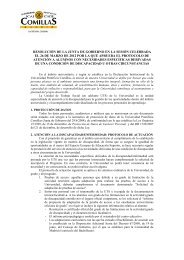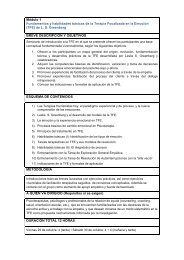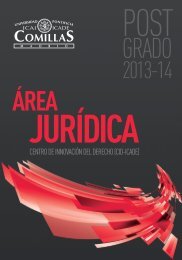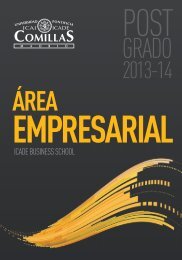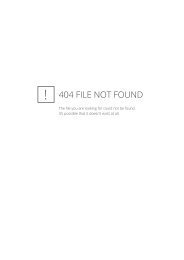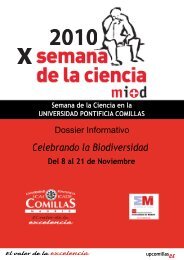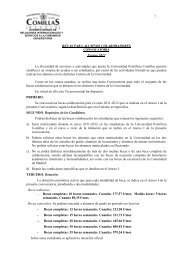1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
59 2002 Jahrgang 98 THEOLOGISCHE REVUE Nr. 1 60<br />
beschreibt die Mitgliederstruktur und wertet Umfrageergebnisse aus,<br />
in denen positive und negative Sichtweisen gegenüber den unabhängigen<br />
Kirchen greifbar werden. Daran schlieût sich eine Auflistung<br />
der Kritikpunkte unabhängiger Kirchen an der katholischen Kirche<br />
an, die detailliert wiedergegeben werden und denen jeweils eine<br />
kurze Replik aus katholischer Sicht angefügt ist. Damit erfüllt das<br />
Buch eine katechetische Funktion in der konkreten Herausforderung<br />
durch die neuen Kirchen. Dieses Vorgehen wird zu den Themen Bibelverständnis,<br />
Gemeinschaftserfahrung und geistliche Wiedergeburt<br />
fortgesetzt. In einem Auswertungskapitel setzt sich E. als katholischer<br />
Theologe bemerkenswert selbstkritisch mit der eigenen<br />
Kirche auseinander. Er anerkennt die pastoralen Leistungen der unabhängigen<br />
Kirchen und macht z. B. in den groûen unpersönlichen<br />
katholischen Pfarreien eine wesentliche Schwäche aus, welche die<br />
Auswanderung in die neuen afrikanischen Kirchen fördert.<br />
Angesichts der dramatisch zu nennenden Umbruchsituation innerhalb<br />
des afrikanischen Christentums stellt die Arbeit E.s eine<br />
wohltuend sachliche, gut lesbare und für sein erwünschtes Lesepublikum<br />
hilfreiche und nicht zusätzlich Aggressionen schürende<br />
Lektüre dar. Für die europäischen Leserinnen und Leser ist das<br />
Buch eine Einladung, sowohl das globale Phänomen der Explosion<br />
unabhängiger, charismatischer und inkulturierter Kirchen wahrzunehmen<br />
als auch die notwendige Selbstkritik am eigenen Stil des<br />
Kirche-Seins einzuüben.<br />
Münster Arnd Bünker<br />
Kubera, Ursula: Frauen in der Missionierung Sambias. ¹Ich will ein Beweis für<br />
meine Religion sein.ª ± Nettetal: Steyler Verlag 1998. 537 S. (Studia Instituti<br />
Missiologici Societatis Verbi Divini, 67), kt DM 78,00 ISSN: 0562±2816<br />
ISBN: 3±8050±0410±9<br />
Ursula Kubera untersucht in ihrer umfangreichen Diss. den Beitrag<br />
von Frauen in der Missionierung Sambias. Ihre Arbeit ist motiviert<br />
durch die Begegnung mit Frauen aus der Kirche Sambias und<br />
der Rezeption feministischer Theologie. Die Vf.in legt eine wichtige<br />
Untersuchung über die oft gerade in der katholischen Theologie unterschlagene<br />
Rolle von Frauen in der Mission vor.<br />
Im ersten Abschnitt bietet die Arbeit eine detaillierte soziokulturelle,<br />
historische und religiöse Verortung im Kontext Sambias und<br />
seiner Geschichte. Insbesondere die Rolle der Frau in der dortigen<br />
stammesgesellschaftlichen Kultur erfährt wie die Darstellung der Kolonialpolitik<br />
und ihrer bis in die Gegenwart reichenden Folgen groûe<br />
Beachtung.<br />
Der zweite Teil widmet sich der Missionsgeschichte Sambias. Einer<br />
Einführung über die Aktivitäten der katholischen Männerorden<br />
folgt ein Überblick über die Schwesterngemeinschaften in Sambia,<br />
ihre Anliegen und Ziele sowie ihre Beiträge zur Missionierung.<br />
Nach diesen historischen Abrissen geht die Vf.in ihrer maûgeblichen<br />
Fragestellung nach und skizziert die Rolle der Frauen bei der<br />
Glaubensweitergabe in der Kirche Sambias. Nach einer Darstellung<br />
der spezifischen Situation und Motivation europäischer Frauen wendet<br />
sich K. den einheimischen Frauen als Trägerinnen der Glaubensweitergabe<br />
zu. Hier verdeutlicht sich auch eine Perspektive, die<br />
christliche Frauen auûerhalb verfaûter Ordensgemeinschaften in den<br />
Blick nimmt. Laienbewegungen und Familie werden zu charakteristischen<br />
Orten der Glaubensweitergabe. Darüber hinaus wird die Beteiligung<br />
der Frauen an der Feier der Sakramente in der Gemeinde erläutert<br />
und insbesondere die Inkulturationsleistung bei Initiationsriten<br />
und Ehe vor dem Hintergrund des afrikanischen Kontextes erklärt.<br />
Schlieûlich werden die Arbeitsbereiche Erziehung, Bildung<br />
und Gesundheit hinsichtlich des Wirkens der Frauen darin vorgestellt<br />
bevor als Auswirkung aller dieser Tätigkeiten der Wandel im<br />
Gottes- und Menschenbild im Kontext traditioneller Vorstellungen in<br />
Sambia beschrieben wird.<br />
Im letzten Kap. unternimmt K. eine kritische Retrospektive der<br />
Frauenmission in Sambia. Sie problematisiert das Verhältnis von<br />
Kolonisation und Mission und die Rolle der europäischen und afrikanischen<br />
Frauen in diesem Spannungsfeld. Zum Abschluû wird der<br />
maûgebliche Beitrag von Frauen zur Entwicklung der Missionsbewegung<br />
in Deutschland insgesamt hervorgehoben und schlieûlich ± vor<br />
dem Hintergrund aktueller christlicher Aufbrüche und Umbrüche in<br />
Afrika ± die Frage nach der neuen Identität afrikanischer christlicher<br />
Frauen im ekklesiologischen Modell der ¸Kirche als Familie Gottes<br />
gestellt.<br />
Münster Arnd Bünker<br />
Philosophie<br />
Duns Scotus, Johannes: Über die Erkennbarkeit Gottes. Texte zur Philosophie<br />
und Theologie. Lateinisch-deutsch, hg. und übersetzt v. Hans K r a m l / Gerhard<br />
L e i b o l d / Vladimir R i c h t e r. ± Hamburg: Felix Meiner 2000. XXXII,<br />
232 S. (Philosophische Bibliothek, 529), geb. DM 68,00 / e 34,77 ISBN:<br />
3±7873±1544±6<br />
In Meiners bekannter und vielgelesener Reihe ¹Philosophische<br />
Bibliothekª, die seit 1868 (Leipzig) als ¹grüne Reiheª wesentliche<br />
und wichtige Texte der Geistesgeschichte veröffentlicht, sind als<br />
529. Bd ± wahrlich eine Bibliothek! ± Texte des Johannes Duns Scotus<br />
(² 1308) ¹Über die Erkennbarkeit Gottesª in der Bearbeitung der bekannten<br />
Innsbrucker Gelehrten erschienen. In der für Haus- und<br />
Schularbeit bewährten Anlage werden in der Einleitung (IX±XXXII)<br />
die Textgrundlage und der Vf. vorgestellt; im Hauptteil (1±199) folgt<br />
der Text in der kritischen lateinischen Überlieferung und in der deutschen<br />
Übersetzung. Text und Übersetzung sind durch Zwischenüberschriften<br />
vortrefflich gegliedert, die deutsche Version ist die untadelige<br />
Leistung von Prof. H. Kraml. Zum Text bieten die Anmerkungen<br />
der Hg. (201±213) text- und literarkritische und begriffsgeschichtliche<br />
Lese- und Interpretationshilfen. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis,<br />
ein Verzeichnis der latein. Stichworte (Fachtermini von<br />
acceptatio bis visio) mit Übersetzung (221±223), ein Index verborum<br />
(225±229) und ein Namenverzeichnis (231±232) runden das Opusculum<br />
ab.<br />
Zum Thema der philosophisch-theologischen Gotteslehre des Franziskanertheologen<br />
wählten die Hg. folgende Texte aus der Erklärung der Sentenzenbücher<br />
des Petrus Lombardus (des Schulbuches des Mittelalters) aus: Prol. q.<br />
1±3 (2±43): die Notwendigkeit der Offenbarung und die (wissenschaftliche)<br />
Theologie, Lib. I, dist. 1, q. 1±2 (44±63): das augustinische Thema ¹frui und<br />
utiª oder der Primat des Wollens im Verbund des (theol.) Erkennens, dist. 2, q.<br />
1±2 (64±93): das Problem des (philos.) Gottesbegriffes: Gott, der Unendliche,<br />
dist. 3, q. 1±5 (94±145): die Methode und Vermittlung der philosophischen Gotteserkenntnis:<br />
aufgrund der Aussagen über Gott, der Gottebenbildlichkeit des<br />
Menschen und der Kraft unseres geschöpflichen Intellekts, dist. 8 (146±159)<br />
mit der einzigen Frage nach der Einfachheit Gottes und der Bedeutung der vielfältigen<br />
Gottesprädikate (Attribute), dist. 26 (160±181) mit der einzigen Frage<br />
nach dem Constitutivum der göttlichen Personen. Aus dem Kommentar des 2.<br />
Buches wurde die (einzige) Frage der dist. 25 (182±199) genommen: über die<br />
Willensfreiheit. Diese Quaestio sprengt nicht den Rahmen, weil Duns Scotus<br />
(im Anschluû an Heinrich von Gent) in der Lehre von der Freiheit des menschlichen<br />
Wollens den theologischen Vorbehalt (der Bibel) geltend machte.<br />
Johannes Duns Scotus begann 1300 bzw. kurz zuvor als Dozent im Oxforder<br />
Franziskanerstudium seine Sentenzenlesung, die ¹Lectura Oxoniensisª, die<br />
von den Studenten mitgeschrieben, in Mit- und Nachschriften (Reportationes)<br />
verbreitet wurden und von der Schule als Lehrbuch ihres begabten und gefragten<br />
Dozenten redigiert wurde. Diese Redaktion der ¹Lectura Oxoniensisª, die<br />
in wenigen Hss. auf uns gekommen ist, verdient das besondere Augenmerk. Mit<br />
dem Scriptum seines Handapparates, dem ¹liber Dunsª, ging der junge Dozent<br />
Johannes im Auftrag des Ordens 1300 bzw. 1301 an die Universität Paris und<br />
las im Rahmen seines Graduiertenstudiums ein zweites Mal die Sentenzenerklärung,<br />
die als ¹Lectura Parisiensisª überliefert ist. Diese von Oxford über<br />
Paris fluktuierende Schulüberlieferung der Sentenzenvorlesungen suchte später<br />
die sog. ¹Ordinatioª in den Griff zu bekommen; sie ist nicht am Schreibtisch<br />
des Gelehrten entstanden, sondern hat ihren Sitz in der Oxforder Überlieferung.<br />
Seit mehr als 20 Jahren ist Prof. Dr. Vladimir Richter bemüht, die<br />
Textgeschichte des Sentenzenkommentars des Duns Scotus transparent<br />
zu machen. Er sistiert (mit der Geduld des Forschers) auf die<br />
der Ordinatio vorgängige Textüberlieferung, um die von ihm sog.<br />
¹Grundschriftª zu eruieren, die dem ¹Liber Dunsª nahesteht und die<br />
ursprüngliche Oxforder Textüberlieferung aufdeckt. Dabei geht es<br />
ihm nicht nur (wenngleich auch) darum, den Text der Ordinatio zu<br />
hinterfragen, sondern eine textgeschichtliche und quellenanalytische<br />
Lektüre und Interpretation der Ordinatio zu ermöglichen. Die<br />
vorliegende Ausgabe versteht sich darum als Begleitbuch der vorliegenden<br />
(kritischen und unkritischen) Editionen, die auf jeder S. der<br />
¹grünen Ausgabeª angegeben sind. Das Lehrbuch der Schule war im<br />
Mittelalter ein offenes Buch; am Anfang stand nicht das Buch sondern<br />
das Lehrwort.<br />
Ein bemerkenswertes Beispiel dieser Geschichte der Schulüberlieferung,<br />
um nur eines aus der Textsammlung aufzugreifen, ist die<br />
¹quaestio unicaª zur 26. Distinktion des 1. Sentenzenbuches, die<br />
Frage nach dem Constitutivum (Seinsgrund) der drei Personen in<br />
Gott. Die aus dem 13. Jh. überkommene Lehrmeinung, welche auch<br />
der hl. Bonaventura vertrat, besagt, daû die relativen Eigentümlichkeiten<br />
von Vater, Sohn und Heilig-Geist die Personunterschiede in<br />
Gott begründen, ohne die Einheit und Einfachheit des Wesens aufzuheben.<br />
Thomas von Aquin vertrat (im Anschluû an seinen Lehrer