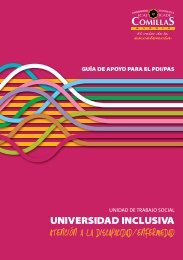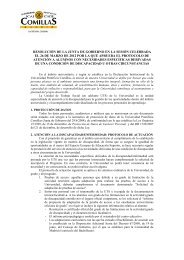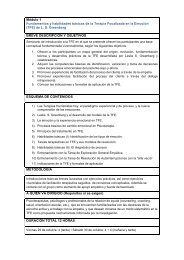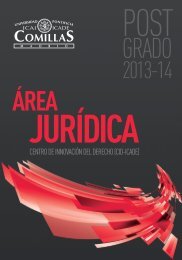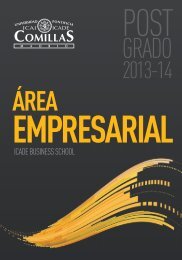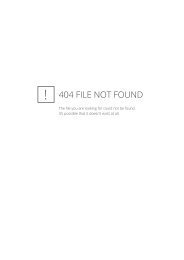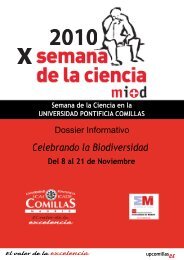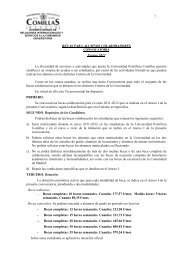1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
1902±2002 - Universidad Pontificia Comillas
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
55 2002 Jahrgang 98 THEOLOGISCHE REVUE Nr. 1 56<br />
nun vorliegt. Angekündigt sind Bde über Altertum und Frühmittelalter<br />
(Bd l, ebenfalls vom Hg.), das Reformationszeitalter (Bd 3: A.<br />
Burkardt), das Zeitalter des Konfessionalismus (Bd 4: K. v. Greyerz),<br />
die Periode von 1750±1900 (Bd 5: M. Pammer). Bd 6 über das 20. Jh.<br />
ist offenbar noch nicht vergeben.<br />
Der stattliche, auf schweres Papier gedruckte Bd 2 enthält neben dem Text<br />
53 Schwarzweiû-Abb. sowie auf 20 S. in der Mitte hervorragend reproduzierte<br />
Farbtafeln. Ein umfangreicher Anmerkungsteil (396±488), der Bildnachweis,<br />
30 S. Bibliographie sowie ein nach Personen, Orten, Titeln und Sachen unterteiltes<br />
Register bilden den wissenschaftlichen Apparat. Der Inhalt gliedert sich<br />
in einen historischen und einen ¹phänomenologischenª Teil; ersterer ist nochmals<br />
unterteilt in ¹Hochmittelalterª (Investiturstreit bis Auftreten der Bettelorden)<br />
und ¹Spätmittelalterª. Daniel Krochmalnik hat einen (vergleichsweise)<br />
kurzen Aufsatz über die ¹askenasische Spiritualitätª am Ende des Textteils beigesteuert<br />
(376±396).<br />
Im ersten Teil skizziert der Vf., der sich der Schule Friedrich Heilers<br />
verpflichtet weiû, die politischen, religiösen und theologischen<br />
Komponenten der frömmigkeitsgeschichtlich auûerordentlich und<br />
auûergewöhnlich reichen Epoche, die den Nachfahren oft nostalgisch<br />
als die goldene Zeit des Christentums erscheint. In der Tat werden<br />
damals alle Existenzfragen unter geistlichem Gesichtspunkt wie gestellt<br />
so beantwortet. Die Menschen leiten dabei kaum die von der<br />
sich gerade ausbildenden wissenschaftlichen Theologie erstellten<br />
Kriterien, Normen und Vorgaben als vielmehr die vornehmlich emotional<br />
aufgefüllte Erfahrung des Numinosum, des Heiligen und Göttlichen<br />
also. Von Anfang an macht D. freilich unmiûverständlich klar:<br />
Nicht alles ist das Gold lauterer christlicher Spiritualität, was uns in<br />
der Gegenwart aus der damaligen Epoche so glanzvoll erscheint.<br />
Werke der Frömmigkeit waren nicht selten erzwungen, ihre Ableistung<br />
wurde kontrolliert (die Inquisition kommt auf, die Hexen werden<br />
verbrannt, die Ketzer um ihres ewigen Heiles willen zeitlichen<br />
Feuerqualen unterworfen); gewöhnlich war (nicht nur seinerzeit)<br />
geldlicher Profit damit herauszuschlagen durch die Verwalter des<br />
geistlichen Lebens. Hinter allem stand eine existentielle Angst, die<br />
zwar von den Organisatoren der Spiritualität ausgenutzt wurde, der<br />
sie aber selber nicht minder unterworfen waren. Der zweite Teil füllt<br />
mit staunenswerter Abundanz den historischen Rahmen aus. Nahezu<br />
alle denkbaren Bereiche des geistlichen Lebens werden anhand der<br />
literarischen und künstlerischen Quellen wenigstens paradigmatisch<br />
so ausgeleuchtet, daû nahezu kein Phänomen unerwähnt bleibt, welches<br />
sachdienlich wird. Unter dem Titel ¹Vorstellungsweltª etwa<br />
werden die wesentlichen Impulse aus Gotteslehre, Eschatologie,<br />
Geschichtstheologie, Sakramententheologie, Psychologie, Realienkunde<br />
(Waffen, Kleidung, Pflanzen, Tiere usw.) erörtert. Ein eigenes<br />
Kap. ist der Anthropologie reserviert mit den Stichworten Charismatik,<br />
Amtsheiligkeit, heilige Gemeinschaften, Zauberer etc. Die dank<br />
des flüssigen Stils und der hervorragenden didaktischen Vermittlung<br />
des immensen Materials an jeder Stelle anregende (nicht selten auch<br />
aufregende) Lektüre gibt Einblick in mittelalterliche Passageriten,<br />
Mariodulie, Tabuzeiten, apotropäische Riten, die do-ut-des-Mentalität,<br />
die Sakrallandschaften ± es können nur einige ganz wenige jener<br />
Themen herausgegriffen werden, über die man kundig informiert<br />
wird. Das ¹Handbuchª beschränkt sich bei den Recherchen nicht<br />
nur auf die orthodoxe Religiosität, sondern wirft an den entscheidenden<br />
Stellen wenigstens einen kurzen Blick auf die devianten Formen<br />
des Christentums. Besonderen Dank verdient der Exkurs über die<br />
Spiritualität der deutschen Juden in der behandelten Epoche (D.<br />
Krochmalnik), von der auch der theologisch instruierte Normalleser<br />
höchst wenig Ahnung hat, die aber im untersuchten Raum sehr wohl<br />
nachhaltig gewirkt hat.<br />
D.s Blick auf die mittelalterliche Frömmigkeitslandschaft ist durchgehend<br />
sehr kritisch. Immer wieder deckt er aus der Sicht des postmodernen Religionswissenschaftlers<br />
Bedenklichkeiten, Abnormitäten und Abstrusitäten auf,<br />
nennt die Machtmiûbräuche bei Namen, demaskiert hohles Pathos. Was entzaubert<br />
werden kann, wird entzaubert. Das kann alles prinzipiell nicht nochmals<br />
der Kritik unterworfen werden. Wenn beispielsweise kolportiert wird,<br />
daû Maria ihren Sohn von der Gicht geheilt hat (!), weil sie allein über die dessen<br />
mächtigen Engel gebietet ± übrigens nicht ohne sich vorher den halben<br />
Himmel und die halbe Erde als Einfluûsphäre zu sichern ±, dann ist das auch<br />
von innertheologischen Kriterien der damaligen Zeit her abzulehnen (vgl. 145<br />
f). Gleichwohl überkommt einem beim Studium des Werkes ein ungutes Gefühl:<br />
Kann man wirklich und (v. a.) wahrhaftig die mittelalterliche Religiosität<br />
mehr oder weniger total unter dem Lemma Kuriositäten abheften ± dieser Eindruck<br />
drängt sich immer wieder auf? Steht nicht hinter den Unbeholfenheiten<br />
und Mangelhaftigkeiten der Gottesverehrung auch und nicht an letzter Stelle<br />
ein Wissen um die konstitutive Relation des Menschen zum erschaffenden<br />
und erlösenden Gott? Und vermittelte sie bei aller Bedenklichkeit in den Formen<br />
und Gestalten, die wir heute unterdrücken nicht können und nicht wollen<br />
müssen, nicht vielleicht doch ein später kaum mehr erfahrbares Sensorium für<br />
die Geborgenheit des homo religiosus in und bei seinem Gott? Es soll nicht behauptet<br />
werden, daû sich das ¹Handbuchª dessen gar nicht bewuût ist; man<br />
wünschte sich trotzdem eine deutlichere Akzentuierung des Faktenbestandes<br />
auch in diese Richtung. Daû ein so tatsachenreiches und materialgefülltes Buch<br />
den einen oder anderen sachlichen und dokumentarischen Fehler nicht vermieden<br />
hat, kann ernstlich nicht angekreidet werden. Am störendsten erweisen<br />
sich die gelegentlichen Lakunen in der bibliographischen Dokumentation<br />
(Wie heiût das Werk von Maschek wirklich?: 424, Anm. 406). Ein Manko, das<br />
nicht verhehlt werden darf, ist der Mangel eines Glossars in der Weise, wie es<br />
der Beitrag von D. Krochmalnik musterhaft anbietet. D. gebraucht eine Reihe<br />
von (meist volkskundlichen) Termini, die nicht ausreichend eingeführt werden.<br />
Was, exempli gratia, ist ein ¹Atzmannª (317) oder ein ¹Bilwisª (146, 165)?<br />
Mit solchen Ausstellungen kann und soll die eminente Leistung<br />
nicht geschmälert werden, die der Vf. erbracht hat. Nicht nur die<br />
Frömmigkeitsgeschichte und die Volkskunde, auch die Dogmengeschichte,<br />
die Geschichte von Pastoral und Katechese profitieren<br />
von diesem Buch, das alle Anzeichen vermittelt, daû mit dem ¹Handbuch<br />
der Religionsgeschichte im deutschsprachigen Raumª ein Standardwerk<br />
im Werden ist, auf das man zukünftig nicht verzichten können<br />
wird. Wir wünschen uns ein unverzügliches Erscheinen der anderen<br />
fünf Bde!<br />
Pentling Wolfgang Beinert<br />
Huxel, Kirsten: Die empirische Psychologie des Glaubens. Historische und<br />
systematische Studien zu den Pionieren der Religionspsychologie. ± Stuttgart:<br />
W. Kohlhammer 2000. 448 S., kt DM 79,80 / e 40,80 ISBN:<br />
3±17±016301±9<br />
Versammeln sich im disparaten Feld ¹Religionspsychologieª zwei<br />
Disziplinen, Psychologie und Theologie, oder nicht eher Vertreter aus<br />
(mindestens) zwei Fächerspektren, aus vielerlei Psychologien im akademischen<br />
und klinisch-therapeutischen Feld einerseits und aus<br />
dem Spektrum konfessioneller Theologien sowie vergleichender Religionswissenschaften<br />
andererseits? In welchem Frage- und Deutehorizont<br />
bestimmen sie den Gegenstand von ¹Religionspsychologieª,<br />
das subjektive religiöse (Er-)Leben, und ihre Forschungsmethoden?<br />
Wissenschafts- und erkenntnistheoretische Fragen sind aufs engste<br />
verknüpft; ihre Behandlung hängt ab von den Optionen der Forschenden<br />
und, im Falle interdisziplinären Dialogs, der Dialogpartner.<br />
An sie richten sich für verantwortete Forschung und Rezeption notwendig<br />
epistemologische und hermeneutische Ansprüche, die sich<br />
in diesem interdisziplinären Feld idealiter aus philosophischer, theologischer<br />
und psychologischer Sachkenntnis speisen. Von der Theologie<br />
ist ein selbstbewuût stimulierender, kritisierender und integrierender<br />
philosophisch-theologischer Beitrag gefordert samt Fragen<br />
nach dem epistemischen Status vorgetragener Ergebnisse, leitenden<br />
Vorverständnissen wie anthropologischen Prämissen und deren Ausgewiesenheit<br />
wie Legitimität (vgl. z. B. K. Demmer, Fundamentale<br />
Theologie des Ethischen, Freiburg 1999, 109±116).<br />
Kirsten Huxel legt in ihrer Diss. im Fach Systematische Theologie<br />
an der Ev.-Theol. Fak. in Tübingen einen theol. Beitrag von exemplarischer<br />
Qualität zu den Arbeiten amerikanischer Pioniere der Religionspsychologie<br />
vor. Ihr Doktorvater E. Herms hatte über William<br />
James habilitiert (Radical Empiricism. Studien zur Psychologie, Metaphysik<br />
und Religionstheorie William James', Gütersloh 1977). An<br />
dessen empiristischem Werk stellte er die ¹Unverzichtbarkeit der Metaphysik<br />
für die szientifische Arbeit in einem mehrfachen Sinneª<br />
(ebd. 290) heraus und betonte: ¹Ohne einen reinen ¸Normbegriff<br />
von Religion bekommt keine empirische Untersuchung Religiosität<br />
auch nur in den Blickª (ebd. 292).<br />
So geschult kritisiert H., ¹daû die Religionspsychologie (. . .) bis heute weder<br />
eine gründliche Bestandsaufnahme ihrer eigenen historischen Ursprünge<br />
vorgelegt hat noch zu einer überzeugenden Klärung ihrer wissenschaftstheoretischen<br />
Grundlagen, und damit auch ihrer Verhältnisbestimmung zur Theologie,<br />
vorgestoûen istª (27). Als Beitrag gegen diese historischen und systematischen<br />
Mängel bearbeitet H. die Lebenswerke von James' Zeitgenossen, die<br />
¹empirischenª Religionspsychologien Granville Stanley Halls (1844/46±1924;<br />
S. 33±174), James Henry Leubas (1868±1946; S. 175±295) und Edwin Diller<br />
Starbucks (1866±1947; S. 296±413). Hall ist bis heute durch seine Einladung<br />
an S. Freud und C. G. Jung zu ihrem für die Psychoanalyse historischen Besuch<br />
von 1909 in die USA an die von ihm mitaufgebaute Clark-Univ. bekannt. Hier<br />
arbeiteten in den 1890er Jahren sowohl Leuba als auch Starbuck zeitweise bei<br />
ihm. Sie übernahmen auf je eigene Weise sein von der amerikanischen Erwekkungsbewegung<br />
stimuliertes Interesse an Bekehrungserfahrungen und die Hervorhebung<br />
der Adoleszenz für die religiöse Entwicklung der Persönlichkeit<br />
(Halls ¹Adoleszenztheseª). Ehrgeizig reklamierten alle drei gegeneinander<br />
und gegen W. James für sich, die empirische Religionspsychologie begründet