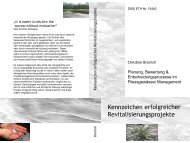Geochemische und wasserisotopische Untersuchungen im ...
Geochemische und wasserisotopische Untersuchungen im ...
Geochemische und wasserisotopische Untersuchungen im ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diplomarbeit Resultate<br />
Aus der Abbildung 14 geht hervor, dass bei allen Zuströmen die Calciumkonzentrationen<br />
deutlich höher sind als die Magnesium- <strong>und</strong> Silikakonzentrationen. Die SiO2/Ca 2+ -<br />
Verhältnisse liegen zwischen 0.01-0.1, die Mg 2+ /Ca 2+ -Verhältnisse zwischen 0.15-0.4.<br />
Auffällig ist, dass die SiO2/Ca 2+ -Verhältnisse der <strong>im</strong> Einzugsgebiet des Rhoneabschnittes<br />
südseitig (bzw. linksufrig) gelegenen Kraftwerke <strong>und</strong> Seitengewässer (KW Nendaz, KW<br />
Mauvoisin <strong>und</strong> Printse, eine Ausnahme bildet die Fare) deutlich höhere<br />
Kieselsäurekonzentrationen <strong>im</strong> Vergleich zu den Calziumkonzentrationen zeigen, als<br />
diejenigen der nordseitig (bzw. rechtsufrig) gelegenen Seitengewässer <strong>und</strong> Kraftwerke.<br />
In Abbildung 15 sind die Sulfatkonzentrationen <strong>im</strong> Verhältnis zu den Calzium- <strong>und</strong><br />
Magnesiumkonzentrationen aufgetragen. Bei praktisch allen Zuströmen variieren die<br />
Ca 2+ /SO4- <strong>und</strong> die Mg 2+ /SO4 2- -Verhältnisse um ungefähr einen Faktor zwei. Die<br />
Calziumkonzentrationen dominieren die Sulfatkonzentrationen <strong>und</strong> liegen ein- bis<br />
sechsmal höher. Generell sind die Sulfatkonzentrationen etwa doppelt so hoch wie die<br />
Magnesiumkonzentrationen. Die Printse zeigt höhere Magnesiumkonzentrationen als die<br />
anderen Zuströme. Man beachte, dass die geochemischen Konzentrationen der Morge <strong>im</strong><br />
Tagesverlauf stark schwanken (siehe S. 41).<br />
5.2.2 Schneeschmelze<br />
Zur Zeit der <strong>Untersuchungen</strong> (5.-6. Juli 2001) lag die Schneegrenze bei 2600-2700 m; an<br />
Nordhängen <strong>und</strong> in Muldenlagen 200-300 m tiefer (Mündliche Mitteilung Charlie Viu,<br />
Schnee- <strong>und</strong> Lawinenforschung Davos 2001). In der Periode des 29. Juni bis zum 5. Juli<br />
regnete es bei den nahegelegenen Meteostationen Sion-Aéroport <strong>und</strong> Fey nicht<br />
(Schweizerische Meteorologische Anstalt 2001). Gezeigt werden soll der Einfluss der<br />
Schneeschmelze auf die beiden hydrologisch unbeeinträchtigten Seitengewässer Losentse<br />
<strong>und</strong> Salentse. Ihre Einzugsgebiete grenzen aneinander <strong>und</strong> liegen nordseitig der Rhone<br />
(siehe Abb. 3). Die rechte Abbildung der Abbildungspaare 16 <strong>und</strong> 17 zeigt die<br />
Veränderung der Leitfähigkeit <strong>und</strong> der δ 18 O-Werte während des 24-St<strong>und</strong>enzyklus. Die<br />
zweite Abbildung zeigt die tageszeitliche Veränderung der Globalstrahlung der<br />
Meteostation Fey (Schweizerische Meteorologische Anstalt 2001), sowie die relative<br />
Konzentrationsveränderung 8 der Leitfähigkeit, der Kationen (Ca 2+ <strong>und</strong> Mg 2+ ), der Anionen<br />
(Cl - <strong>und</strong> SO 4 2- ) <strong>und</strong> des Silika. Die Kurve der Globalstrahlung in Fey soll qualitativ die<br />
Sonnenintensität <strong>im</strong> Untersuchungsgebiet repräsentieren.<br />
8 Die relative Konzentrationsangabe wurde zur besseren Vergleichbarkeit <strong>und</strong> Darstellung der Parameter<br />
verwendet. Es wurde jeweils die höchste Konzentration eines einzelnen Parameters auf 100% gesetzt <strong>und</strong> die<br />
anderen Konzentrationen des selben Parameters relativ zum höchsten Wert ausgedrückt.<br />
27