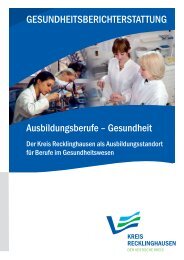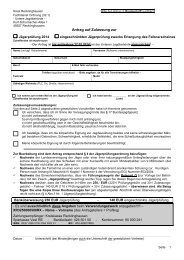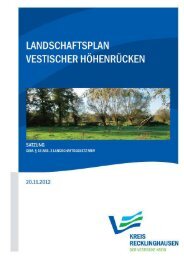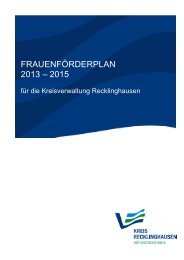Wienbach KNEF Endfassung - Kreis Recklinghausen
Wienbach KNEF Endfassung - Kreis Recklinghausen
Wienbach KNEF Endfassung - Kreis Recklinghausen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Konzept zur naturnahen Entwicklung<br />
von Fließgewässern (<strong>KNEF</strong>)<br />
<strong>Wienbach</strong><br />
Dorsten, Heiden, Raesfeld, Reken<br />
3 Wasserbauliche Maßnahmen der<br />
Vergangenheit<br />
3.1 Historische wasserbauliche Maßnahmen<br />
Hinsichtlich der historischen Gewässerverläufe und etwaiger historischer<br />
wasserbaulicher Maßnahmen wurde vornehmlich die Preußische Landesaufnahme<br />
von 1892/95 ausgewertet und in Teilen mit der sog. Preußischen<br />
Uraufnahme (ca. 1843) abgeglichen. Dabei ist zu beachten, dass sich die<br />
Angaben in den historischen Karten nur in begrenztem Umfang hinsichtlich<br />
einer Konkretisierung des Leitbildes und der Ableitung von Entwicklungszielen<br />
verwenden lassen. Insbesondere darf der in den Karten dargestellte Zustand<br />
nicht mit dem Zustand verwechselt werden, der ohne menschlichen<br />
Einfluss bestanden hat, da anzunehmen ist, dass Überformungen bereits im<br />
Mittelalter einsetzten. Zudem nimmt bei kleinen Gewässern die Darstellungsschärfe<br />
in den Karten erheblich ab, da deren genaue Wiedergabe nicht<br />
das primäre Ziel der Kartenerstellung war.<br />
Auch schon Ende des 19. Jh. war das Einzugsgebiet des Hammbachsystems<br />
überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Allerdings überwog zumindest<br />
in unmittelbarer Nähe zu den Fließgewässern die Grünlandnutzung gegenüber<br />
dem Ackerbau. Zum Teil verzeichnet die Karte auch ausdrücklich<br />
Feuchtgrünland. Größere Siedlungsflächen gab es nur wenige und nur selten<br />
unmittelbar an die Gewässer angrenzend. In unmittelbarer Gewässernähe<br />
bestanden solche Siedlungsflächen v.a. im Norden der Dorstener Altstadt,<br />
wo bereits größere Fabrikanlagen (z.B. Eisengießerei) und die<br />
Schachtanlage Baldur verzeichnet sind.<br />
Die Mühlenbauwerke Tüshausmühle, Rhader Mühle, Wienbecker Mühle und<br />
Midlicher Mühle mit ihren Stauanlagen stellten bereits historisch die wesentlichen<br />
Unterbrechungen in Hinblick auf die Längsdurchgängigkeit dar.<br />
Die nachfolgende Beschreibung der historischen Situation beschränkt sich<br />
auf die größeren Fließgewässer, in denen die Maßnahmen aufgrund von Kartenunterlagen<br />
vergleichsweise gut nachvollziehbar sind. Die Abbildungen<br />
verdeutlichen zudem exemplarisch einige der zahlreichen anthropogen bedingen<br />
Laufverlagerungen.<br />
Hammbach<br />
Das Umfeld des Hammbaches war weit überwiegend landwirtschaftlich genutzt,<br />
allerdings lagen Ackerflächen meist in einem größeren Abstand zum<br />
Fließgewässer. Wald war kaum vorhanden. Lediglich im Oberlauf gab es der<br />
Karte zufolge Nadelwald auf Flächen, auf denen heute überwiegend Ackerbau<br />
betrieben wird. Siedlungsflächen grenzten lediglich nördlich der Dorstener<br />
Altstadt an. Es handelte sich vorrangig um Fabrikanlagen (z.B. Bleicherei)<br />
und die Schachtanlage Baldur. Eine weitere bauliche Nutzung mit Auswirkungen<br />
auf das Fließgewässer war die Tüshausmühle mit ihrem Mühlenteich.<br />
Erste historische Belege für die Mühle gibt es aus dem 17. Jahrhundert.<br />
Eine Bleicherei in Dorsten leitete verschmutztes Wasser in den Hammbach.<br />
Veränderungen am Gewässer und in der Aue des Hammbaches sind an vielen<br />
Stellen zu erkennen. Die Mündung des Hammbaches lag 300 m westlich<br />
der heutigen Mündung und das Gewässer verlief in einem großen Bogen in-<br />
umweltbüro essen - Stand: 02.10.2012<br />
20