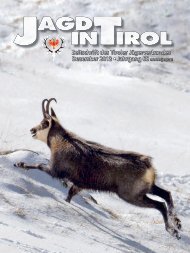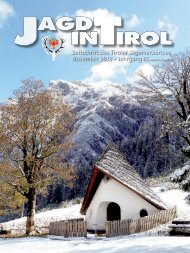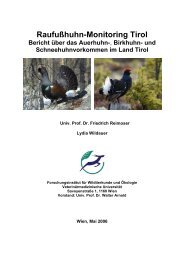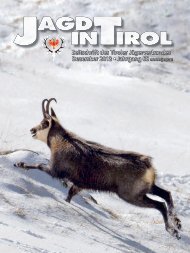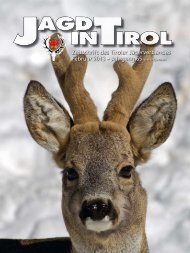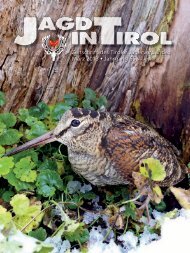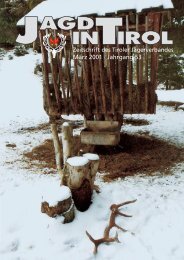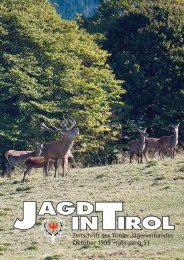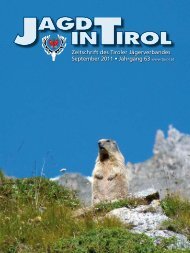November 1999 · Jahrgang 51 - Tiroler Jägerverband
November 1999 · Jahrgang 51 - Tiroler Jägerverband
November 1999 · Jahrgang 51 - Tiroler Jägerverband
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
20 Jahre Vogelrichtlinie<br />
Schützen wir sie alle - und wir helfen nur ein paar wenigen wirklich . . .<br />
So wie jede Sache<br />
zwei Seiten hat, so<br />
wie ein zur Hälfte<br />
mit Wasser gefülltes<br />
Glas „halbvoll”<br />
oder „halbleer” sein<br />
kann, läßt sich grundsätzlich ein Problem<br />
von zwei verschiedenen Seiten<br />
her bearbeiten.<br />
Im Jahr 1979 entschied sich die Europäische<br />
Gemeinschaft bei der<br />
Schaffung der Vogelrichtlinie<br />
79/409/EWG für eine der möglichen<br />
Varianten von Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen<br />
zugunsten der Vogelwelt<br />
in Europa, die vielleicht schon<br />
10 oder 15 Jahre später, jedenfalls<br />
aber heute grundsätzlich in Frage gestellt<br />
würde.<br />
„Macht es denn Sinn, jedem in Europa<br />
vorkommenden Vogel, welcher<br />
Art auch immer, von vorneherein und<br />
generell den Schutzstatus der »Unantastbarkeit«<br />
aufzuerlegen?” Der bittere<br />
Nachgeschmack, bedingt durch die<br />
große Menge nicht zu bewältigender<br />
Aufgaben der Kommission, mit der<br />
die Mitgliedstaaten konfrontiert werden,<br />
wirft die Frage auf, „Wo beginnen?”,<br />
wenn ein Ende der Pflichten<br />
und Zusagen nicht in Sicht ist.<br />
Die Methodik aller Mitgliedstaaten<br />
erinnert an das Bestreuen von Tortenstücken<br />
mit einem Zuckerstreuer.<br />
Würden wir denn heute nicht unsere<br />
Kräfte vielmehr auf jene Tierarten focussieren,<br />
die unserer Aufmerksamkeit,<br />
des Bemühens und der menschlichen<br />
Hilfe, einer geregelten Bewirtschaftung<br />
und einer vollziehbaren<br />
Kontrolle bedürfen?<br />
Die Richtlinien der EU Anfang der<br />
Neunziger (etwa die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie<br />
92/43 / EWG) zeigen<br />
diesen zweiten Weg der Artenlisten<br />
auf, welchen Priorität hinsichtlich der<br />
zu setzenden Maßnahmen und der<br />
einzusetzenden Mitteln zu gelten hat.<br />
Die Motivation ist in diesem zweiten<br />
Fall eine ungleich andere: Aufgaben<br />
und Ziele sind sichtbar, scheinen<br />
nicht unerreichbar und lassen sich<br />
überblicken. Entscheiden Sie selbst:<br />
Halbvoll oder halbleer!<br />
Die Schwerfälligkeit läßt sich leicht<br />
anhand von Beispielen illustrieren:<br />
Wenn unter Beachtung der Vogelrichtlinie<br />
in ganz Europa eine Vogelart<br />
die autochtonen und in den einzelnen<br />
Regionen heimischen Fischarten<br />
gefährdet, wird der an der Fisch-<br />
Fauna verursachte Schaden von einer<br />
geschützten Art (sagen wir vom Kormoran)<br />
herbeigeführt.<br />
Nur Arten des Anhanges II lassen sich<br />
generell - über jagdliche Maßnahmen<br />
- reduzieren, vertreiben oder bewirtschaften.<br />
Jede andere europäische Vogelart,<br />
und wir finden den Kormoran<br />
nicht in Anhang II der Vogelrichtlinie,<br />
läßt sich nur über Artikel 9 und<br />
dessen streng normierte Ausnahmeregelungen<br />
beeinflussen.<br />
Auch die bloße Vertreibung, das<br />
Stören an Schlafbäumen oder Nestern<br />
(Horsten) oder die Unterbindung<br />
der Reproduktion oder die Beeinflussung<br />
der Jungenaufzucht würden<br />
schon Eingriffe gegen den<br />
Schutzstatus der Vogelrichtlinie bedeuten.<br />
Ein über Jahre hinweg Periode für Periode<br />
etabliertes Vertreibungs- und<br />
Abschußsystem gestützt auf den<br />
Schadenstatbestand des Artikel 9 -<br />
entspräche jedenfalls nicht der „Ausnahme<br />
von der Regel”, weil es nach<br />
Jahren selbst „Regel” wäre. Artikel 9<br />
kann aber nicht Anhänge - etwa Anhang<br />
II/2. Teil ersetzen. Um die Realität,<br />
nämlich die Zunahme der Kormoranbestände<br />
in Europa, einzuholen,<br />
ist eine Gesamtänderung der Vogelrichtlinie<br />
notwendig. Bis die<br />
Richtlinie adaptiert wird, kann es für<br />
die Ökosysteme in manchen Regionen<br />
zu spät sein.<br />
Ein anderes Beispiel sind die Rabenvögel<br />
(Corvidae), die 1979 offenbar<br />
bei der Endredaktion der Vogelrichtlinie<br />
„vergessen worden waren”.<br />
15 Jahre dauerte es, bis die Rabenvögel<br />
in Anhang II/2. Teil aufgenommen<br />
wurden. Österreich hat im Zuge<br />
seiner Beitrittsverhandlungen diese<br />
Richtlinienänderung (Erweiterung<br />
des Anhanges II/2. Teil um die Rabenvögel)<br />
offenkundig „verschlafen”und<br />
alle vier Arten der Corvidae<br />
„nicht als bejagbar” reklamiert und<br />
sohin nicht „genannt”.<br />
Trotz einer innerstaatlich akkordierten<br />
Fachmeinung aller neun Regionen<br />
in Österreich hatten es die Vertreter<br />
beim Verhandeln verabsäumt,<br />
das „Kreuzchen” bei den vier Vogelarten<br />
zu machen. Die Auswirkungen<br />
dieses formaljuristischen Versäumnisses<br />
sind für unsere heimische Tierwelt<br />
(vor allem für die Singvögel und das<br />
Jungwild) fatal: Seit 1995 (dem Beitrittsjahr<br />
Österreichs) verstößt die Bejagung<br />
der Rabenvögel in Österreich<br />
gegen Gemeinschaftsrecht, weil das<br />
„Kreuzchen” an der richtigen Stelle<br />
fehlt.<br />
Was bis Dezember 1994 richtig war<br />
und in 13 Mitgliedstaaten zulässig ist,<br />
ist seit 1995 in Österreich nicht mehr<br />
gesetzeskonform. Um diesen Umstand<br />
zu sanieren, ist eine Gesamtänderung<br />
der Vogelrichtlinie notwendig.<br />
Bis die Richtlinie in der Spalte<br />
Österreichs in Anhang II/2. Teil „repariert”<br />
ist, wird es für viele Beutetiere<br />
der Rabenvögel - darunter sind vor<br />
allem auch andere Vogelarten - zu<br />
spät sein.<br />
Es zeigt sich, daß ein lückenlos erscheinendes<br />
oder wenig flexibles „Tabu-System”<br />
dazu führt, bestimmte<br />
Vogelarten in Europa zu begünstigen:<br />
Dann nämlich, wenn auf tatsächliche<br />
Populationstrends nicht flexibel genug<br />
reagiert werden kann und eine<br />
schwerfällige Gesamtänderung der<br />
Richtlinie als Lösung für ein Problem<br />
um Jahre zu spät eintritt.<br />
Wir Europäer könnten viel mehr für<br />
den Vogelschutz in Europa tun, wenn<br />
dort Maßnahmen und Regulierungen<br />
möglich wären, wo sie nötig sind.<br />
Zum Wohle betroffener Tierarten -<br />
und nicht, um eine starre und unflexible<br />
Rechtsnorm zu vollziehen.<br />
Dr. Peter Lebersorger<br />
Zentralstelle Österreichischer<br />
Landesjagdverbände<br />
15 JAGD IN TIROL ➜ 11/99