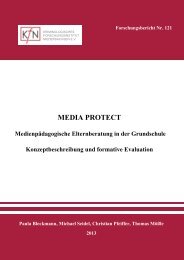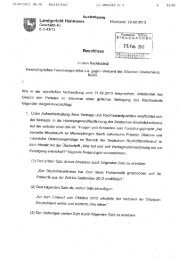download - Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.
download - Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.
download - Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10 Theoretischer Rahmen<br />
3 Theoretischer Rahmen<br />
Um den empirischen Teil der Untersuchung auf ein solides theoretisches Fundament zu stellen, fin-<br />
den in der Folge einige Überlegungen statt, welche in zweierlei Hinsicht von maßgeblicher Relevanz<br />
für das Projekt „Lust auf Leben wecken“ sind. So liefern die theorieseitigen Implikationen zum einen<br />
Hinweise darauf, ob und in welcher Weise überhaupt Handlungsbedarf be- und/oder entsteht. Zum<br />
anderen liefern die in der Theoretisierung als relevant herausgearbeiteten Dimensionen im Begrün-<br />
dungszusammenhang wertvolle Hinweise zur Konstruktion der zur Datenerhebung durchgeführten<br />
Befragungen.<br />
Bevor anschließend Ausführungen zu kindlicher Mediennutzung und deren potentielles Wirkungs-<br />
portfolio sowie die Datenlage zu Medienausstattung und -nutzungszeiten den größten Raum inner-<br />
halb dieses Abschnittes einnehmen werden, finden zunächst einige Vorüberlegungen zu Besonder-<br />
heiten kindlicher Mediennutzung statt. Die innerhalb dieses Kapitels zugrunde gelegte theoretische<br />
und – in Form von Sekundäranalysen – empirische Fundierung geht auf eine ausführliche und pro-<br />
funde Analyse des derzeitigen Forschungsstandes zurück, welche Kleimann (2011) in seiner Disserta-<br />
tionsschrift vorgelegt hat. Die im Folgenden zitierten Autoren, Studien und deren Ergebnisse sind<br />
Inhalt dieses Werkes. Aus pragmatischen Gründen werden jedoch lediglich die jeweils relevanten<br />
Ursprungswerke zitiert.<br />
3.1 Vorüberlegungen zu Kindern und Mediennutzung<br />
Eine elementare Besonderheit kindlicher und jugendlicher Mediennutzung ist, dass die Entwicklungs-<br />
voraussetzungen – oder ‚Medienliteralität’ im weiteren Sinne – im Regelfall nur sehr bedingt mit den<br />
Voraussetzungen von Erwachsenen zu vergleichen sind. Ein in diesem Zusammenhang immer wieder<br />
hervorgebrachtes Konstrukt ist das der Medienkompetenz (vgl. Kleimann, 2011, S. 45).<br />
3.1.1 ‚Literale’ Besonderheiten kindlicher Mediennutzung<br />
Wenngleich der Begriff der ‚Medienkompetenz’ in der Alltagssprache sicherlich oft als selbsterklä-<br />
rend vorausgesetzt und in unterschiedlichen Kontexten unscharf verwendet wird, so wird diesem<br />
Ausdruck zu Recht der Status eines ‚Komplexbegriffes’ attestiert, welcher Phänomene und Merkmale<br />
verschiedenster Art im Sinne eines ‚größten gemeinsamen Nenners’ zusammenfasst (vgl. Gapski,<br />
2001, S. 24). 8 Es bietet sich daher an, Medienkompetenz differenzierter zu fassen. Charlton bietet an,<br />
auf Seiten der Entwicklungsvoraussetzungen für die kindliche Mediennutzung zwischen der Entwick-<br />
lung Kommunikativer Kompetenz 9 , Kognitiver Kompetenz 10 und Emotionaler Kompetenz 11 zu unter-<br />
8 Für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Begriff der Medienkompetenz vgl. Kleimann, 2011, S. 45ff.<br />
9 Die Kommunikative Kompetenz zielt nach Charlton im Bezug auf Medien der Massenkommunikation darauf ab, dass ein<br />
Kind zunächst in der Lage sein muss, allgemeinverständliche, konventionelle Symbole zu nutzen und zu verstehen. Vgl.<br />
Charlton, 2007 sowie Kleimann, 2011, S. 45.<br />
10 Medienbezogene Kognitive Kompetenzen setzen sich nach Charlton vor allem zusammen aus der Fähigkeit zur Perspektivübernahme,<br />
dem Verstehen von Narrationen sowie dem Erkennen spezifischer Kommunikationsabsichten. Vgl. Charlton,<br />
2007 sowie Kleimann, 2011, S. 47ff.