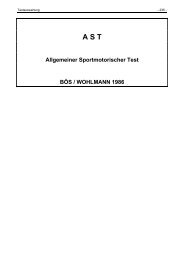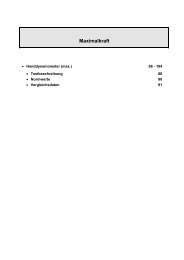II. Theoretische Grundlagen - Dr. Jochen Beck
II. Theoretische Grundlagen - Dr. Jochen Beck
II. Theoretische Grundlagen - Dr. Jochen Beck
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>II</strong>. <strong>Theoretische</strong> <strong>Grundlagen</strong> - 21 -<br />
Selektionsentscheidungen in Form von „geeignet/nicht geeignet“ erscheinen außerordentlich<br />
problematisch, wenn die Eignungskriterien an sich ebenso wie ihre Schwellenwerte<br />
nicht hinreichend theoretisch und empirisch begründet werden können.<br />
„Eignungsnormen“ sind jedoch nur dann sinnvoll, wenn ein enger Zusammenhang<br />
zwischen den aktuellen Leistungsdaten und der Leistungsfähigkeit im Hochleistungsalter<br />
besteht.<br />
Hauptproblem im Zusammenhang mit der Bestimmung von Schwellenwerten ist die<br />
Ausleseschärfe. Bei hochgesetzten Normen werden nur wenige Sportler als talentiert<br />
eingestuft, die meisten fallen durch ein grobmaschiges Diagnosenetz hindurch, darunter<br />
auch potentielle Talente. Im Gegensatz dazu selektiert ein engmaschiges Diagnosenetz<br />
mehr Talente, ist aber auch weniger sensibel gegenüber Untalentierten, was rasch zu<br />
einer Überlastung der personalen und materiellen Möglichkeiten führt, wenn versucht<br />
wird, alle ausgewählten Individuen optimal zu fördern.<br />
Den vorhandenen Defiziten stehen inhaltliche (personenspezifische Eignung), organisatorische<br />
(Effektivität) und ökonomische (Finanzierung, Resourcen) Gründe gegenüber,<br />
die die Beibehaltung von Selektionsmaßnahmen unabdingbar machen.<br />
Da Kontrollnormen der Talentauswahl nicht die geforderten Kriterien einer exakten<br />
Prognose berücksichtigen, scheint es nicht sinnvoll, Talentauswahl nur auf der Grundlage<br />
einmalig erhobener Leistungskennziffern vorzunehmen. Ansätze, die versuchen,<br />
der Vielschichtigkeit der Problematik eher gerecht zu werden, liegen in der Anwendung<br />
von sequentiellen Diagnosestrategien.<br />
Solche ausdifferenzierten und vielstufigen Selektionsentscheidungen können eine<br />
erhebliche Verbesserung der Trefferquote erzielen und die pädagogische Verantwortbarkeit<br />
erhöhen. Innerhalb solch verzweigter Diagnosestrategien spielen Leistungskennziffern<br />
keine dominante Rolle. Sie haben die Aufgabe, dem für die Talentauswahl<br />
Verantwortlichen neben seinem subjektiven Eindruck vom physischen und psychischen<br />
Leistungsvermögen des Nachwuchssportlers auch objektive Daten als Entscheidungshilfen<br />
zur Verfügung zu stellen.<br />
Im Bereich „Talentsuche/-förderung“ sollten sportmotorische Test 4 zur Evaluation von<br />
Trainingsmaßnahmen sowie als Entscheidungshilfe bei sequentiellen Selektionsentscheidungen<br />
eingesetzt werden.<br />
4 Entsprechendes gilt für analoge Verfahren aus Psychologie, ...