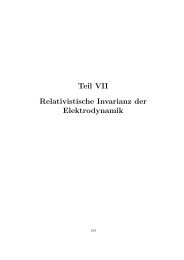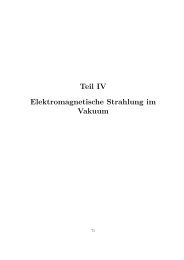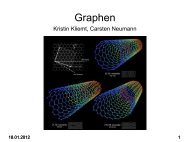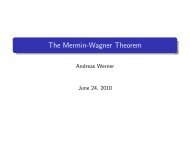Technisierung oder technische Verbesserung des Menschen?
Technisierung oder technische Verbesserung des Menschen?
Technisierung oder technische Verbesserung des Menschen?
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schnittstellen liegen und sich bei der weiteren gesellschaftlichen Aneignung der dadurch<br />
möglichen Verfahren und Produkte rasch verflüchtigen.<br />
Aufgabe der Ethik ist jedoch zweifellos, dem genannten faktischen Unbehagen nachzuspüren.<br />
In dem intuitiven Unbehagen müssen sich zwar keine normativen Unsicherheiten<br />
verbergen, könnten es aber. Durch Analyse der normativen Hintergründe<br />
können eventuell auftretende normative Unsicherheiten aufgedeckt werden, mittels<br />
derer dann ein Bedarf an ethischer Reflexion konkret und problemorientiert geäußert<br />
werden könnte statt bloß plakativ angesichts eines durch Verunsicherung entstanden<br />
Unbehagens nach Ethik zu rufen. Es geht in diesem Sinne also zunächst darum zu<br />
klären, welcher normative Rahmen für Entwicklung und Anwendung neuroelektrischer<br />
Schnittstellen besteht, wo der bestehende Rahmen durch neue wissenschaftlich-<strong>technische</strong><br />
Entwicklungen in dem Sinne herausgefordert werden, dass die in<br />
Kap. 3.3 genannten Kriterien für das Bestehen eine Standardsituation in moralischer<br />
Hinsicht nicht mehr erfüllt wäre, z.B. weil es zu Kontroversen über moralische Beurteilungen<br />
und erforderliche Konsequenzen für das weitere Vorgehen kommt (analog<br />
zum Fall der Nanopartikel, vgl. Kap. 7).<br />
In diesem Kapitel wird primär die Nutzung neuroelektrischer Schnittstellen in einem<br />
medizinischen Sinn diskutiert (zu ethischen Aspekten <strong>des</strong> 'Verbesserns' vgl. Kap.<br />
9.5). Es geht um das Heilen von Krankheiten, das Wiederherstellen von dysfunktionalen<br />
<strong>oder</strong> zerstörten Organeigenschaften. Der normative Rahmen dieser Handlungstypen<br />
ist damit durch die etablierten normativen Bestandteile <strong>des</strong> Heilens und<br />
<strong>des</strong> dafür erforderlichen Umfel<strong>des</strong> gegeben (Müller 2006): das ärztliche Ethos, das<br />
Arzt/Patient-Verhältnis, die Patientenautonomie in Form der informationellen Selbstbestimmung,<br />
ethische Standards der Forschung und klinischer Testverfahren, Ermöglichung<br />
<strong>des</strong> gerechten Zugangs zu medizinischen Leistungen etc. Dieser normative<br />
Rahmen wird in der Medizinethik reflektiert, weiterentwickelt und auf neu auftretende<br />
Situationen, Therapieverfahren und Technologien bezogen. Im Hintergrund<br />
stehen Fragen, welche Rechte von Betroffenen beeinträchtigt werden könnten bzw.<br />
ob und wie in Ziel- <strong>oder</strong> Mittelkonflikten eine Abwägung vorgenommen werden kann<br />
und darf.<br />
Betroffene sind in direkter Weise zunächst diejenigen Personen, die neuroelektrische<br />
Schnittstellen nutzen, also im Verständnis dieses Kapitels vornehmlich Patienten, die<br />
eine Erhöhung ihrer Lebensqualität erhoffen. Hier ist zu fragen, ob die möglicherweise<br />
auftretenden Einschränkungen, Risiken und Belastungen zu den erwarteten Vorteilen<br />
in einem angemessenen Verhältnis stehen, <strong>oder</strong> ob die Würde der Betroffenen<br />
verletzt werden könnte. Der 'informed consent' spielt hier eine entscheidende Rolle,<br />
da Entscheidungen dieser Art individuell getroffen werden müssen. Indirekt Betroffene<br />
sind auch Personen im Umkreis der Patienten und könnten auch zukünftige Personen<br />
sein, welche über Vererbung mit Folgen der Nutzung neuroelektrischer<br />
Schnittstellen konfrontiert werden könnte (wobei allerdings schwer fällt, sich derartige<br />
Szenarien auszudenken. Über die Erwägungen zu den individuell Betroffenen hinaus<br />
ist an gesellschaftliche Effekte zu denken. In diesem Sinne ist z.B. an indirekt Betroffene<br />
zu denken, die möglicherweise trotz identischer Indikation keinen Zugang zu<br />
entsprechenden (teuren) Behandlungsmöglichkeiten haben. Insgesamt wurden folgende<br />
Elemente eines normativen Rahmens vorgeschlagen (nach EGE 2005, S.<br />
97f.):<br />
• <strong>Menschen</strong>würde und das Instrumentalisierungsverbot, verankert etwa in der<br />
Charta der Grundrechte der Europäischen Union und im deutschen Grundgesetz,<br />
und philosophisch abgesichert z.B. im Rahmen der Kantischen Ethik;<br />
28