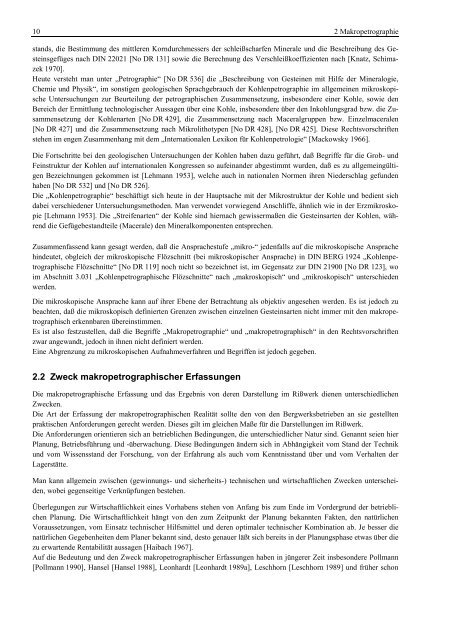1 Aufgabenstellung - Deutsche Geodätische Kommission
1 Aufgabenstellung - Deutsche Geodätische Kommission
1 Aufgabenstellung - Deutsche Geodätische Kommission
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10 2 Makropetrographie<br />
stands, die Bestimmung des mittleren Korndurchmessers der schleißscharfen Minerale und die Beschreibung des Gesteinsgefüges<br />
nach DIN 22021 [No DR 131] sowie die Berechnung des Verschleißkoeffizienten nach [Knatz, Schimazek<br />
1970].<br />
Heute versteht man unter „Petrographie“ [No DR 536] die „Beschreibung von Gesteinen mit Hilfe der Mineralogie,<br />
Chemie und Physik“, im sonstigen geologischen Sprachgebrauch der Kohlenpetrographie im allgemeinen mikroskopische<br />
Untersuchungen zur Beurteilung der petrographischen Zusammensetzung, insbesondere einer Kohle, sowie den<br />
Bereich der Ermittlung technologischer Aussagen über eine Kohle, insbesondere über den Inkohlungsgrad bzw. die Zusammensetzung<br />
der Kohlenarten [No DR 429], die Zusammensetzung nach Maceralgruppen bzw. Einzelmaceralen<br />
[No DR 427] und die Zusammensetzung nach Mikrolithotypen [No DR 428], [No DR 425]. Diese Rechtsvorschriften<br />
stehen im engen Zusammenhang mit dem „Internationalen Lexikon für Kohlenpetrologie“ [Mackowsky 1966].<br />
Die Fortschritte bei den geologischen Untersuchungen der Kohlen haben dazu geführt, daß Begriffe für die Grob- und<br />
Feinstruktur der Kohlen auf internationalen Kongressen so aufeinander abgestimmt wurden, daß es zu allgemeingültigen<br />
Bezeichnungen gekommen ist [Lehmann 1953], welche auch in nationalen Normen ihren Niederschlag gefunden<br />
haben [No DR 532] und [No DR 526].<br />
Die „Kohlenpetrographie“ beschäftigt sich heute in der Hauptsache mit der Mikrostruktur der Kohle und bedient sich<br />
dabei verschiedener Untersuchungsmethoden. Man verwendet vorwiegend Anschliffe, ähnlich wie in der Erzmikroskopie<br />
[Lehmann 1953]. Die „Streifenarten“ der Kohle sind hiernach gewissermaßen die Gesteinsarten der Kohlen, während<br />
die Gefügebestandteile (Macerale) den Mineralkomponenten entsprechen.<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Ansprachestufe „mikro-“ jedenfalls auf die mikroskopische Ansprache<br />
hindeutet, obgleich der mikroskopische Flözschnitt (bei mikroskopischer Ansprache) in DIN BERG 1924 „Kohlenpetrographische<br />
Flözschnitte“ [No DR 119] noch nicht so bezeichnet ist, im Gegensatz zur DIN 21900 [No DR 123], wo<br />
im Abschnitt 3.031 „Kohlenpetrographische Flözschnitte“ nach „makroskopisch“ und „mikroskopisch“ unterschieden<br />
werden.<br />
Die mikroskopische Ansprache kann auf ihrer Ebene der Betrachtung als objektiv angesehen werden. Es ist jedoch zu<br />
beachten, daß die mikroskopisch definierten Grenzen zwischen einzelnen Gesteinsarten nicht immer mit den makropetrographisch<br />
erkennbaren übereinstimmen.<br />
Es ist also festzustellen, daß die Begriffe „Makropetrographie“ und „makropetrographisch“ in den Rechtsvorschriften<br />
zwar angewandt, jedoch in ihnen nicht definiert werden.<br />
Eine Abgrenzung zu mikroskopischen Aufnahmeverfahren und Begriffen ist jedoch gegeben.<br />
2.2 Zweck makropetrographischer Erfassungen<br />
Die makropetrographische Erfassung und das Ergebnis von deren Darstellung im Rißwerk dienen unterschiedlichen<br />
Zwecken.<br />
Die Art der Erfassung der makropetrographischen Realität sollte den von den Bergwerksbetrieben an sie gestellten<br />
praktischen Anforderungen gerecht werden. Dieses gilt im gleichen Maße für die Darstellungen im Rißwerk.<br />
Die Anforderungen orientieren sich an betrieblichen Bedingungen, die unterschiedlicher Natur sind. Genannt seien hier<br />
Planung, Betriebsführung und -überwachung. Diese Bedingungen ändern sich in Abhängigkeit vom Stand der Technik<br />
und vom Wissensstand der Forschung, von der Erfahrung als auch vom Kenntnisstand über und vom Verhalten der<br />
Lagerstätte.<br />
Man kann allgemein zwischen (gewinnungs- und sicherheits-) technischen und wirtschaftlichen Zwecken unterscheiden,<br />
wobei gegenseitige Verknüpfungen bestehen.<br />
Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens stehen von Anfang bis zum Ende im Vordergrund der betrieblichen<br />
Planung. Die Wirtschaftlichkeit hängt von den zum Zeitpunkt der Planung bekannten Fakten, den natürlichen<br />
Voraussetzungen, vom Einsatz technischer Hilfsmittel und deren optimaler technischer Kombination ab. Je besser die<br />
natürlichen Gegebenheiten dem Planer bekannt sind, desto genauer läßt sich bereits in der Planungsphase etwas über die<br />
zu erwartende Rentabilität aussagen [Haibach 1967].<br />
Auf die Bedeutung und den Zweck makropetrographischer Erfassungen haben in jüngerer Zeit insbesondere Pollmann<br />
[Pollmann 1990], Hansel [Hansel 1988], Leonhardt [Leonhardt 1989a], Leschhorn [Leschhorn 1989] und früher schon