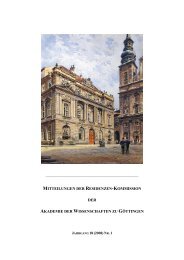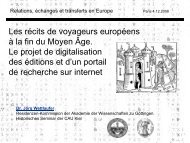MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10. SYMPOSIUM <strong>DER</strong> <strong>RESIDENZEN</strong>-<strong>KOMMISSION</strong><br />
veranstaltet in Zusammenarbeit mit den Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen Schloß<br />
Gottorf, dem Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig, dem Historischen Seminar der<br />
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und dem Deutschen Historischen Institut Paris<br />
AUFRUF ZUR ANMELDUNG UND THEMENABRISS<br />
Hofwirtschaft<br />
Ein ökonomischer Blick auf Hof und Residenz in<br />
Spätmittelalter und Früher Neuzeit<br />
Gottorf/Schleswig, 23.-26. September 2006<br />
Stets haben wir gesagt, daß der Hof und mit ihm die Residenz aufs Ganze gesehen das wichtigste<br />
Zentrum politischen Handelns in Alteuropa gewesen ist. Wir haben ihn weiterhin als<br />
soziales Zentrum beschrieben, wir könnten ihn auch als religiöses auffassen. Wie aber steht<br />
es mit seiner Qualität als Zentrum der Verteilung, des Konsums, gar der Produktion, als Anbieter<br />
und Nachfrager, kurz: mit seiner wirtschaftlichen Bedeutung? Bei aller Freude an dem<br />
schönen Schein der kulturellen Selbstdarstellung und dem Reichtum inszenierter Legitimation<br />
darf nicht aus dem Auge verloren werden, daß all dies Unsummen kostete, daß Pracht<br />
bezahlt werden mußte, Dienst belohnt werden wollte, Macht durch Interesse gelenkt wurde.<br />
Lange Zeit war der Blick vom Glanz der ökonomischen Macht der Städte geblendet, so daß<br />
fast verborgen blieb, wie die Fürsten (bzw. der Staat) sie dennoch einrahmten, von ihnen<br />
profitierten, sie schließlich zurückdrängten und überwanden.<br />
Zunächst war der Hof ein Haushalt mit stets wachsender Dienerschaft, zu Pferde und zu Fuß,<br />
zu der sich allerlei Uneingeladenes gesellte. Was kostete ein solcher Haushalt, wieviel im<br />
Verhältnis zu den Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben? Wenn der fürstliche Alltag zum<br />
alltäglichen Fest werden sollte, wie groß waren die Aufwendungen? Wenn der Krieg unzweifelhaft<br />
das meiste verschlang, wieviel erforderte die Hofhaltung? Wenn der Rang standesgemäße<br />
Ausstattung an Bauten, Mobiliar, Geschenken, Kleidung verlangte, wie hoch schlug<br />
dies zu Buche? Dem exponentiellen Wachstum an Leuten und Kosten mußte entgegengewirkt<br />
werden. Das geschah allenthalben und war selten erfolgreich. Ein beharrlicher, geradezu<br />
unüberwindlicher Druck, aus der herrscherlichen Position selbst und der sozialen Erwartung<br />
hervorgehend, stand dem entgegen: Herrschen heißt Geben. Im Kern ist der Hof der Ort<br />
des Unökonomischen (im modernen Sinne) und kann es doch nicht sein. Diese Spannung gilt<br />
es in den Blick zu nehmen.<br />
Offensichtlich war der Hof in seiner Residenz als Haushalt, Regierung, Verwaltung ein Umschlagplatz<br />
riesiger Summen. Kann man diesen Vorgang näher beschreiben, vielleicht gar<br />
beziffern? War er nicht, was dem nachrevolutionären Beobachter ein verwerfliches Spiel<br />
egoistischer, genußsüchtiger Verschwendung schien, eher ein Motor der Wirtschaft? „Liebe,<br />
Luxus und Kapitalismus“ nannte Werner Sombarth sein berühmtes Buch, und über den Zusammenhang<br />
von Luxus und (sozialer) Integration durch die Höfe fand bereits eine Tagung<br />
13