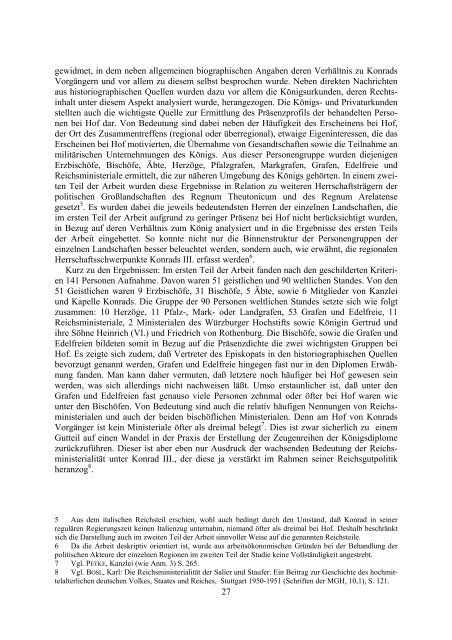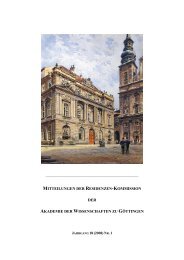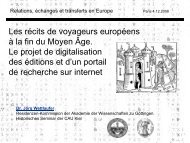MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gewidmet, in dem neben allgemeinen biographischen Angaben deren Verhältnis zu Konrads<br />
Vorgängern und vor allem zu diesem selbst besprochen wurde. Neben direkten Nachrichten<br />
aus historiographischen Quellen wurden dazu vor allem die Königsurkunden, deren Rechtsinhalt<br />
unter diesem Aspekt analysiert wurde, herangezogen. Die Königs- und Privaturkunden<br />
stellten auch die wichtigste Quelle zur Ermittlung des Präsenzprofils der behandelten Personen<br />
bei Hof dar. Von Bedeutung sind dabei neben der Häufigkeit des Erscheinens bei Hof,<br />
der Ort des Zusammentreffens (regional oder überregional), etwaige Eigeninteressen, die das<br />
Erscheinen bei Hof motivierten, die Übernahme von Gesandtschaften sowie die Teilnahme an<br />
militärischen Unternehmungen des Königs. Aus dieser Personengruppe wurden diejenigen<br />
Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte, Herzöge, Pfalzgrafen, Markgrafen, Grafen, Edelfreie und<br />
Reichsministeriale ermittelt, die zur näheren Umgebung des Königs gehörten. In einem zweiten<br />
Teil der Arbeit wurden diese Ergebnisse in Relation zu weiteren Herrschaftsträgern der<br />
politischen Großlandschaften des Regnum Theutonicum und des Regnum Arelatense<br />
gesetzt<br />
n .<br />
5 . Es wurden dabei die jeweils bedeutendsten Herren der einzelnen Landschaften, die<br />
im ersten Teil der Arbeit aufgrund zu geringer Präsenz bei Hof nicht berücksichtigt wurden,<br />
in Bezug auf deren Verhältnis zum König analysiert und in die Ergebnisse des ersten Teils<br />
der Arbeit eingebettet. So konnte nicht nur die Binnenstruktur der Personengruppen der<br />
einzelnen Landschaften besser beleuchtet werden, sondern auch, wie erwähnt, die regionalen<br />
Herrschaftsschwerpunkte Konrads III. erfasst werde 6<br />
Kurz zu den Ergebnissen: Im ersten Teil der Arbeit fanden nach den geschilderten Kriterien<br />
141 Personen Aufnahme. Davon waren 51 geistlichen und 90 weltlichen Standes. Von den<br />
51 Geistlichen waren 9 Erzbischöfe, 31 Bischöfe, 5 Äbte, sowie 6 Mitglieder von Kanzlei<br />
und Kapelle Konrads. Die Gruppe der 90 Personen weltlichen Standes setzte sich wie folgt<br />
zusammen: 10 Herzöge, 11 Pfalz-, Mark- oder Landgrafen, 53 Grafen und Edelfreie, 11<br />
Reichsministeriale, 2 Ministerialen des Würzburger Hochstifts sowie Königin Gertrud und<br />
ihre Söhne Heinrich (VI.) und Friedrich von Rothenburg. Die Bischöfe, sowie die Grafen und<br />
Edelfreien bildeten somit in Bezug auf die Präsenzdichte die zwei wichtigsten Gruppen bei<br />
Hof. Es zeigte sich zudem, daß Vertreter des Episkopats in den historiographischen Quellen<br />
bevorzugt genannt werden, Grafen und Edelfreie hingegen fast nur in den Diplomen Erwähnung<br />
fanden. Man kann daher vermuten, daß letztere noch häufiger bei Hof gewesen sein<br />
werden, was sich allerdings nicht nachweisen läßt. Umso erstaunlicher ist, daß unter den<br />
Grafen und Edelfreien fast genauso viele Personen zehnmal oder öfter bei Hof waren wie<br />
unter den Bischöfen. Von Bedeutung sind auch die relativ häufigen Nennungen von Reichsministerialen<br />
und auch der beiden bischöflichen Ministerialen. Denn am Hof von Konrads<br />
Vorgänger ist kein Ministeriale öfter als dreimal belegt 7 . Dies ist zwar sicherlich zu einem<br />
Gutteil auf einen Wandel in der Praxis der Erstellung der Zeugenreihen der Königsdiplome<br />
zurückzuführen. Dieser ist aber eben nur Ausdruck der wachsenden Bedeutung der Reichsministerialität<br />
unter Konrad III., der diese ja verstärkt im Rahmen seiner Reichsgutpolitik<br />
heranzog 8 .<br />
5 Aus dem italischen Reichsteil erschien, wohl auch bedingt durch den Umstand, daß Konrad in seiner<br />
regulären Regierungszeit keinen Italienzug unternahm, niemand öfter als dreimal bei Hof. Deshalb beschränkt<br />
sich die Darstellung auch im zweiten Teil der Arbeit sinnvoller Weise auf die genannten Reichsteile.<br />
6 Da die Arbeit deskriptiv orientiert ist, wurde aus arbeitsökonomischen Gründen bei der Behandlung der<br />
politischen Akteure der einzelnen Regionen im zweiten Teil der Studie keine Vollständigkeit angestrebt.<br />
7 Vgl. PETKE, Kanzlei (wie Anm. 3) S. 265.<br />
8 Vgl. BOSL, Karl: Die Reichsministerialität der Salier und Staufer. Ein Beitrag zur Geschichte des hochmittelalterlichen<br />
deutschen Volkes, Staates und Reiches, Stuttgart 1950-1951 (Schriften der MGH, 10,1), S. 121.<br />
27