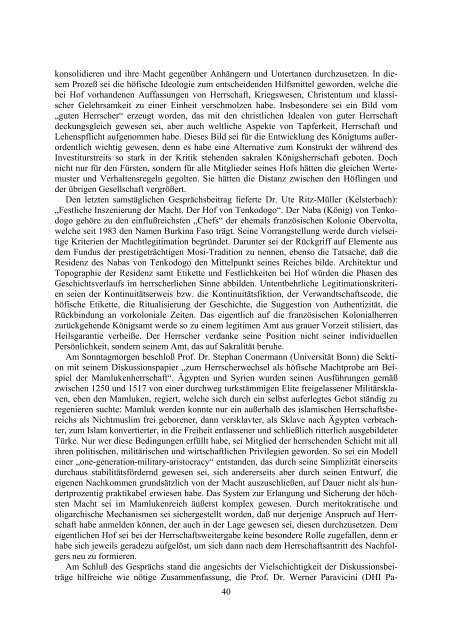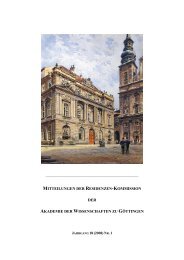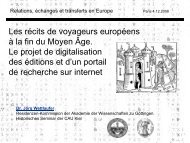MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
konsolidieren und ihre Macht gegenüber Anhängern und Untertanen durchzusetzen. In diesem<br />
Prozeß sei die höfische Ideologie zum entscheidenden Hilfsmittel geworden, welche die<br />
bei Hof vorhandenen Auffassungen von Herrschaft, Kriegswesen, Christentum und klassischer<br />
Gelehrsamkeit zu einer Einheit verschmolzen habe. Insbesondere sei ein Bild vom<br />
„guten Herrscher“ erzeugt worden, das mit den christlichen Idealen von guter Herrschaft<br />
deckungsgleich gewesen sei, aber auch weltliche Aspekte von Tapferkeit, Herrschaft und<br />
Lehenspflicht aufgenommen habe. Dieses Bild sei für die Entwicklung des Königtums außerordentlich<br />
wichtig gewesen, denn es habe eine Alternative zum Konstrukt der während des<br />
Investiturstreits so stark in der Kritik stehenden sakralen Königsherrschaft geboten. Doch<br />
nicht nur für den Fürsten, sondern für alle Mitglieder seines Hofs hätten die gleichen Wertemuster<br />
und Verhaltensregeln gegolten. Sie hätten die Distanz zwischen den Höflingen und<br />
der übrigen Gesellschaft vergrößert.<br />
Den letzten samstäglichen Gesprächsbeitrag lieferte Dr. Ute Ritz-Müller (Kelsterbach):<br />
„Festliche Inszenierung der Macht. Der Hof von Tenkodogo“. Der Naba (König) von Tenkodogo<br />
gehöre zu den einflußreichsten „Chefs“ der ehemals französischen Kolonie Obervolta,<br />
welche seit 1983 den Namen Burkina Faso trägt. Seine Vorrangstellung werde durch vielseitige<br />
Kriterien der Machtlegitimation begründet. Darunter sei der Rückgriff auf Elemente aus<br />
dem Fundus der prestigeträchtigen Mosi-Tradition zu nennen, ebenso die Tatsache, daß die<br />
Residenz des Nabas von Tenkodogo den Mittelpunkt seines Reiches bilde. Architektur und<br />
Topographie der Residenz samt Etikette und Festlichkeiten bei Hof würden die Phasen des<br />
Geschichtsverlaufs im herrscherlichen Sinne abbilden. Untentbehrliche Legitimationskriterien<br />
seien der Kontinuitätserweis bzw. die Kontinuitätsfiktion, der Verwandtschaftscode, die<br />
höfische Etikette, die Ritualisierung der Geschichte, die Suggestion von Authentizität, die<br />
Rückbindung an vorkoloniale Zeiten. Das eigentlich auf die französischen Kolonialherren<br />
zurückgehende Königsamt werde so zu einem legitimen Amt aus grauer Vorzeit stilisiert, das<br />
Heilsgarantie verheiße. Der Herrscher verdanke seine Position nicht seiner individuellen<br />
Persönlichkeit, sondern seinem Amt, das auf Sakralität beruhe.<br />
Am Sonntagmorgen beschloß Prof. Dr. Stephan Conermann (Universität Bonn) die Sektion<br />
mit seinem Diskussionspapier „zum Herrscherwechsel als höfische Machtprobe am Beispiel<br />
der Mamlukenherrschaft“. Ägypten und Syrien wurden seinen Ausführungen gemäß<br />
zwischen 1250 und 1517 von einer durchweg turkstämmigen Elite freigelassener Militärsklaven,<br />
eben den Mamluken, regiert, welche sich durch ein selbst auferlegtes Gebot ständig zu<br />
regenieren suchte: Mamluk werden konnte nur ein außerhalb des islamischen Herrschaftsbereichs<br />
als Nichtmuslim frei geborener, dann versklavter, als Sklave nach Ägypten verbrachter,<br />
zum Islam konvertierter, in die Freiheit entlassener und schließlich ritterlich ausgebildeter<br />
Türke. Nur wer diese Bedingungen erfüllt habe, sei Mitglied der herrschenden Schicht mit all<br />
ihren politischen, militärischen und wirtschaftlichen Privilegien geworden. So sei ein Modell<br />
einer „one-generation-military-aristocracy“ entstanden, das durch seine Simplizität einerseits<br />
durchaus stabilitätsfördernd gewesen sei, sich andererseits aber durch seinen Entwurf, die<br />
eigenen Nachkommen grundsätzlich von der Macht auszuschließen, auf Dauer nicht als hundertprozentig<br />
praktikabel erwiesen habe. Das System zur Erlangung und Sicherung der höchsten<br />
Macht sei im Mamlukenreich äußerst komplex gewesen. Durch meritokratische und<br />
oligarchische Mechanismen sei sichergestellt worden, daß nur derjenige Anspruch auf Herrschaft<br />
habe anmelden können, der auch in der Lage gewesen sei, diesen durchzusetzen. Dem<br />
eigentlichen Hof sei bei der Herrschaftsweitergabe keine besondere Rolle zugefallen, denn er<br />
habe sich jeweils geradezu aufgelöst, um sich dann nach dem Herrschaftsantritt des Nachfolgers<br />
neu zu formieren.<br />
Am Schluß des Gesprächs stand die angesichts der Vielschichtigkeit der Diskussionsbeiträge<br />
hilfreiche wie nötige Zusammenfassung, die Prof. Dr. Werner Paravicini (DHI Pa-<br />
40